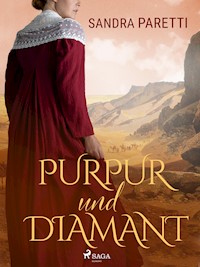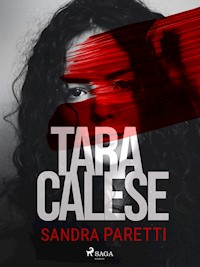Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Pavelino ist ein Frauenheld, wie er im Buche steht: reich, gutaussehend, geheimnisvoll. Seine Zeit versüßt er sich mit Frauen und Sportwagen und genießt sein Leben dabei in vollen Zügen. Doch wie kann er sich diesen Lebensstil leisten? Das weiß niemand so genau, doch alle sind sich sicher, dass dies nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Was verheimlicht Pavelino, und wer ist er wirklich?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Paretti
Paradiesmann
Saga
Paradiesmann
Copyright © 2022 by Helmut and Anka Schneeberger, represented bei AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1983 by Droemer Knaur Verlag, München
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1983, 2022 Sandra Paretti und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728469422
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Er war ein Mann,
der für die Frauen lebte,
und sie liebten ihn dafür.
Juni 1946
1
Pünktlich war er nie . . .« Flo Friedl rückte mit dem Liegestuhl etwas mehr in den Halbschatten unter dem Fliederbusch und lehnte sich wieder zurück, die Arme unter dem Kopf verschränkt. »Nein, pünktlich war er nie, nicht einmal bei unserem ersten Rendezvous . . . eine geschlagene Stunde ließ er mich warten. Ich dachte, er hat mich vergessen, aber dann, als ich die Hoffnung schon aufgegeben hatte, kam er. Und er brachte mir eine Orchidee mit, eine weiße Orchidee, nicht in einer durchsichtigen Zellophanschachtel mit Seidenschleife drumherum, wie sich das gehört. Er hatte die Orchidee einfach in der Hand, sozusagen unterwegs gepflückt . . . das war typisch für ihn, typisch Pavelino, eine Stunde zu spät, aber eine weiße Orchidee in der Hand. Nur er machte so was, nur Pavelino. Kein Wunder, daß ich mich in ihn verliebt habe. Ich dachte mir, entweder ist er ein Maharadscha oder ein Hochstapler, so oder so, er ist der erste, der mich wie eine Dame behandelt, ich muß ihn haben . . .«
Sie sprach leise vor sich hin, träumerisch, mehr zu sich selbst als zu mir. Ich konnte mir ihre Worte nicht zusammenreimen: Vor fünf Minuten, als sie in den Garten herunterkam – in ihrem weißen Leinenkostüm mit dem schmalen, engen Rock und der losen Jacke, die nur einen Knopf hatte, und der saß an der Taille –, sagte sie etwas von einem amerikanischen Offizier, der in München stationiert war, und heute eigens ihretwegen nach Regensburg kam. Und jetzt redete sie von einem anderen, von einem Mann, der Pavelino hieß.
Flo Friedl arbeitete im Nachtclub der amerikanischen Besatzungstruppen, und ihre Männerbekanntschaften wechselten rasch.
»Ich kenne mich nicht mehr aus«, sagte ich. »Ich dachte, du hast ein Rendezvous mit dem Amerikaner aus München.«
»Hab’ ich auch.«
»Und der andere?«
Sie hob den Kopf. »Welcher andere?«
»Pavelino . . .«
»Pavelino . . .« sie sagte den Namen weich und melodiös, » . . . aber Pavelino ist der Amerikaner.«
»Ein Amerikaner, der Pavelino heißt?«
»Er ist kein richtiger Amerikaner, eigentlich Deutscher, 1931 ausgewandert.« Nach kurzem Zögern fuhr sie fort: »Als ich ihn kennenlernte, konnte er nicht genug Englisch, um einen Schlagertext zu verstehn. Er mußte jedes Wort im Langenscheidt nachschlagen – und jetzt ist er amerikanischer Offizier . . . Typisch Pavelino, bei ihm ist alles möglich, auch das Unmögliche.«
Meine Neugier war geweckt. »Pavelino . . . was ist das eigentlich für ein Name?«
»Soviel ich weiß, hat er den Namen von seinem Großvater, und der war Russe.« Sie setzte sich auf, und das amerikanische Magazin, das am Ende des Liegestuhls lag, fiel ins Gras. »Eins ist sicher, wenn ich mal einen Sohn habe, nenne ich ihn Pavelino.«
Ich sah sie überrascht an, »Du willst ihn heiraten?«
»Pavelino? Du hast Ideen . . .« Sie griff hinauf, in den Fliederbusch, riß ein Blatt ab, und aus einer halbverblühten Dolde fielen kleine violette Blüten auf ihr weißes Kleid. Es war ein warmer, leicht verschleierter Junitag. Der Wind schlief, die Donau rauschte leise, und in der Luft schwebte der süße Duft der letzten Fliederdolden, die dunkelviolett und schwer wie Weintrauben allmählich dahinwelkten.
Flo Friedl sammelte die kleinen Blüten zusammen und blies sie von der flachen Hand.
»Es geht die Flo lila / Von Kopf bis Schuh lila / Auch das Dessous lila / Das muß man sehn . . . / Wenn jemand kömmt lila / Macht sie die Lampe lila / Beim lila Bett . . .« Sie sprach die Worte leise vor sich hin. Ich kannte den Schlager, denn sie ließ die Schallplatte oft laufen. Plötzlich brach sie ab. »Genug mit dem Quatsch, das ist nichts für Kinderohren.«
»Ich bin kein Kind!« protestierte ich.
»Du bist elf, und mit elf ist man noch ein Kind.«
»Ich bin neunundzwanzig.«
»Du bist elf.«
»Ich bin neunundzwanzig, denn neunundzwanzig und elf ist dasselbe. Wenn man die Zwei und die Neun von neunundzwanzig zusammenzählt, kommt elf heraus, also ist elf neunundzwanzig.«
»Neunundzwanzig! Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, einfach addieren und man ist wieder elf und fängt von vorne an . . . Aber jetzt heißt’s lernen, mein Fräulein, du hast morgen eine Ex in Geschichte, oder?«
»Ich bin fertig mit dem Lernen.«
»Du hast noch nicht mal angefangen. Du starrst die ganze Zeit hinaus auf die Badstraße. Man könnte meinen, du hast das Rendezvous mit Pavelino, aber dazu bist du noch zu jung, verstanden? So früh habe nicht einmal ich angefangen!«
»Wann hast du angefangen?«
»Schluß jetzt!« Flo Friedl griff nach dem Geschichtsheft, das im Gras lag. »Ich frage dich ab, dann werden wir gleich sehen, ob du gelernt hast.« Sie stellte die Lehne des Liegestuhls senkrecht, setzte sich zurück und schlug das Heft auf: »Alexander in Mesopotamien . . . Mensch, von dem habe ich noch nie was gehört . . . das muß ich mir merken. Alexander in Mesopotamien . . . klingt irre gut . . . Da kann man was daraus machen . . . Man, you behave like Alexander in Mesopotamia . . . irre gut . . . Mii-soo-poo-tamia, salonfähig und doch irgendwie unanständig . . . Das ist was für meine Herren Offiziere, so was mögen sie. Ein Wort, das nur unanständig ist, pah, nicht halb so gut. Das hat mir Pavelino beigebracht: Beim Reden und beim Anziehn nicht zuviel Haut zeigen! Neugierig machen, das genügt . . .« Sie blickte an sich hinunter, und ihre Hände folgten diesem Blick, glitten über die Knie und die Beine abwärts bis zu den hochhackigen Sandaletten aus hellgrauem Schlangenleder. »Pavelino hat eine Dame aus mir gemacht. Vorher war ich nur so ein Zeigste-was-biste-was-Mädchen. Ich dachte, was Josephine Baker kann, kann ich auch: oben nichts und unten einen Bananengürtel . . .« Wieder hatte sie vergessen, daß ich ein Kind war, und ich auch. Nach einer Pause fuhr sie fort. »Wenn die Amerikaner wüßten, wer da für sie steppt und tingelt – die Witwe von einem hohen SS-Tier, auweia! Jedesmal, wenn ich mir den neuen Stempel für den Passierschein hole, habe ich Bammel. Aber jetzt kann mir nichts mehr passieren. Pavelino holt mich hier raus. Ich packe noch heute meine Koffer und verschwinde mit ihm. Darauf kannst du Gift nehmen.«
Flo Friedl war eine Frau mit Vergangenheit: Sie hatte eine Karriere als Revuetänzerin hinter sich, sie hatte Filme gemacht, sie war ein paarmal verheiratet gewesen. 1945, kurz vor Ende des Kriegs, war sie mit den Resten eines Fronttheaters in Regensburg gelandet, und man hatte sie bei uns einquartiert. Sie hatte dunkles Haar, die Augen einer Sphinx, lange rote Fingernägel, lange Beine und die Figur einer hochgeschossenen Sechzehnjährigen, Kind und Frau in einem. Sie parfümierte sich mit Unmengen von Chypre und sprach Berliner Jargon. In ihrem Zimmer herrschte ein wildes Durcheinander. Tausend Fotografien aus ihrer großen Zeit lagen am Boden herum, tausend amerikanische Magazine, tausend Schallplatten, tausend Pumps, tausend einzelne Nylonstrümpfe. Und der Tisch quoll über von Schminksachen.
Sie kam aus einer anderen Welt. Ich konnte ihr stundenlang zuhören, wenn sie erzählte: die großen Revuen an der Berliner Scala, ihr Engagement am Deutschen Theater in München, die Filme, die sie bei der Ufa gedreht hatte, ihre Ehen, ihre Scheidungen und die Männer zwischendurch. Es war wie eine Droge. Ich vergaß die Schule, ich vergaß, daß ich ein Kind war. Mein Kopf summte von abenteuerlichen Bildern und Szenen, von Andeutungen, die mich verwirrten, von Rätseln, die ich nicht lösen konnte.
Flo Friedl schaute auf ihre Armbanduhr. »Halb drei!«
»Wann wollte er da sein?«
»So um zwei.«
»Vielleicht findet er nicht her.«
»Daran liegt es bestimmt nicht.«
»Hast du ihm den Weg erklärt zum Oberen Wöhrd?«
»Das war nicht nötig, er kennt Regensburg, und er kennt den Oberen Wöhrd. Er ist hier aufgewachsen.«
»Hier in Regensburg? Pavelino ist in Regensburg aufgewachsen?«
»Ja . . . ein komischer Zufall oder Fügung des Schicksals. Er wußte sofort, wo die Badstraße ist. Er kennt dieses Haus, er hat es mir genau beschrieben: ein gelbes Haus mit grünen Läden und einem kleinen Vorgarten. Er kennt auch den Tennisclub. Dort hat er sich als Schüler sein Taschengeld verdient, als Balljunge.«
*
Bis dahin war Pavelino für mich nur ein schöner Name, eine Figur aus dem abenteuerlichen Leben der Flo Friedl gewesen. Jetzt wurde er lebendig. Er war in Regensburg aufgewachsen, er war hier zur Schule gegangen, er hatte im Tennisclub, nur fünf Minuten von unserem Haus entfernt, als Balljunge sein Taschengeld verdient.
Von der Straße kam das Geräusch eines Autos, und ich wollte schon zur Einfahrt laufen, aber Flo Friedl hielt mich an der Hand fest. »Bleib da! Wir sehen ihn auch von hier.« Ich fügte mich widerwillig. Ein paar Schritte, und ich konnte von der offenen Einfahrt aus die Badstraße nach beiden Richtungen voll überblicken. Vom Garten aus reichte die Sicht nur bis zu der großen Kastanie, unter der die Telefonzelle stand.
Draußen rollte ein Jeep vorbei, vollgepackt mit jungen GIs und Mädchen, die nicht ganz so jung waren. Sie fuhren zum Schopperplatz. Dort befand sich das Sport- und Freizeit-Areal der Amerikaner mit Ruderclub, Tennisclub und einem Baseballplatz. Rund um die Sportanlagen dehnten sich die Uferwiesen der Donau, und diese Wiesen mit den Büschen und Bootshütten waren sehr beliebt bei den GIs, wenn sie mit einem Mädchen einen kleinen Ausflug machen wollten.
Das Warten machte Flo Friedl allmählich nervös. Jeden Moment wechselte sie die Stellung, schlug die Beine übereinander, verschränkte die Arme, lehnte sich im Liegestuhl zurück, setzte sich wieder auf. Sie holte die Puderdose aus der Handtasche, betrachtete sich in dem kleinen Spiegel, zog die Lippen nach.
Wieder kam auf der Badstraße ein Auto näher, wieder war es ein Jeep mit GIs und Mädchen.
Flo Friedl erhob sich aus dem Liegestuhl und begann im Garten auf und ab zu wandern. Eigentlich war der Garten zu klein zum Aufundabwandern, nur ein Stück Rasen, nur ein Sitzplatz vor dem Haus, von wo aus man beobachten konnte, was in dem langgestreckten Oval des Hofs und den anderen Häusern geschah.
Die zwei hohen gemauerten Pfosten der Einfahrt warfen kurze Schatten und erinnerten mit ihren Einschußlöchern an die letzten Kriegstage vor einem Jahr.
Ein paar versprengte Soldaten von der Waffen-SS hatten sich in unserem Hof verbarrikadiert und den amerikanischen Truppen beim Einmarsch ein Gefecht geliefert, das damit endete, daß ein amerikanischer Panzer das verrammelte Tor aufsprengte, die Flügel aus den Angeln riß und niederwalzte. Seither stand die Einfahrt immer offen und gab den Blick auf die Badstraße und die Donau frei.
Ich hatte mich ins Gras gesetzt und sammelte meine verstreuten Schulsachen zusammen. Flo Friedls Unruhe übertrug sich auf mich. Schweigend ging sie auf und ab, mit einem seltsamen Ausdruck im Gesicht, die dunklen Augen unter den langen dunklen Wimpern blickten hart, der rotgeschminkte Mund, feucht glänzend und leicht geöffnet, schien die Luft zu küssen. Summte sie ein Lied vor sich hin? War es wieder der Lila-Schlager? Es geht die Flo lila / Von Kopf bis Schuh lila / . . .
Daß ein Mann Flo Friedl warten ließ, hatte ich bisher noch nicht erlebt. Sonst waren es die Männer, die auf sie warteten. Abend für Abend stand vor unserer Haustür ein amerikanischer Straßenkreuzer, mit dem sie abgeholt wurde. Eine Viertelstunde war das mindeste, manchmal wurde es auch eine halbe Stunde, bis sie aus der Haustür trat.
Unvermittelt blieb Flo Friedl stehen. »Ich gebe ihm noch elf Minuten, wenn er dann nicht da ist, heirate ich den Colonel.«
»Und wenn er kommt? Was dann? Heiratest du dann Pavelino?«
Flo Friedl sah mich an, und ihr Gesicht hatte immer noch diesen seltsamen Ausdruck mit den harten Augen und dem weichen Mund. Ohne zu antworten, wandte sie sich ab, ging zum Liegestuhl und setzte sich wieder.
»Was hat er für einen Beruf?«
»Beruf? Mein Gott, Pavelino hat alles mögliche gemacht. Als ich ihn kennenlernte, gründete er mit einem Freund eine Fluggesellschaft. Die beiden wußten noch nicht einmal, wo sie das Geld auftreiben sollten, um das erste Flugzeug zu kaufen, aber sie gründeten die Fluggesellschaft, gaben eine Pressekonferenz im ›Regina-Palast-Hotel‹, und alle Zeitungen brachten große Berichte darüber. Es war Hochstapelei, pure Hochstapelei.«
»Und weiter?«
»Irgendwie haben sie das Geld aufgetrieben, und sie kauften drei Maschinen, alles lief bestens.«
»Und warum ist er nach Amerika ausgewandert?«
»Wegen einer Frau. Große Liebe. Sehr romantische. Eine Geschichte wie im Kino.«
»Und weiter?«
»Du, ich habe ihn vor zehn Jahren das letzte Mal gesehn, 1936 in Berlin. Ich weiß nicht, was seitdem alles passiert ist. Zehn Jahre, das ist eine Ewigkeit – und dann vor zwei Tagen plötzlich seine Stimme am Telefon. Irgendwie hat er rausgebracht, daß ich hier im amerikanischen Nachtclub arbeite. Man ruft mich ans Telefon, ich nehme den Hörer – und es ist Pavelino! Ich dachte, ich werde verrückt.« Sie schaute auf die Uhr. »Na ja, pünktlich war er nie . . .«
Durch die Stille klang der Stundenschlag der Regensburger Turmuhren; sie begannen nicht gleichzeitig, sondern nacheinander: ein Kanon heller und dunkler Glocken, der anschwoll und wieder verklang.
»Fährt er einen Jeep, oder kommt er mit Chauffeur?«
»Ich habe ihn nicht gefragt. Aber Pavelino in einem Dienstwagen mit Chauffeur, das kann ich mir nicht vorstellen. Früher fuhr er nur Sportwagen.«
Wir warteten weiter. Flo Friedl blätterte in ihrem Magazin, ohne zu lesen, und ich starrte in mein Geschichtsheft, ohne zu lernen.
Dann endlich kam er. Ich sah ihn noch nicht, ich hörte nur das leise Brummen eines Motors. Es klang anders als ein Jeep und anders als ein Straßenkreuzer. Das mußte er sein.
Der Wagen kam nicht aus der Richtung, aus der ich ihn erwartet hatte, nicht von der Steinernen Brücke, sondern vom Schopperplatz. Bei der großen Kastanie, die ihren Schatten über die Straße warf, tauchte er jetzt auf: Es war ein Sportwagen, wie Flo Friedl vermutet hatte, ein kleines, schmales Ding, rotlackiert und mit Speichenrädern. Er hatte einen silbernen Kühler und silberne Kotflügel.
Diese Kotflügel waren das Besondere an dem Wagen, sie glichen tatsächlich Flügeln: Durch chromglänzende Verstrebungen mit der Kühlerhaube verbunden, spannten sie sich in einem weiten Bogen über die Räder. Auf diesen silbernen Flügeln saßen, groß und funkelnd wie Riesenaugen, zwei verchromte Scheinwerfer.
Ich hatte nie ein ähnliches Auto gesehen. »Das muß er sein.«
Flo Friedl nickte. »Ich werd’ verrückt, Pavelino in seinem alten Amilcar! Eine geschlagene Stunde zu spät, aber in seinem alten Amilcar, typisch Pavelino. Wenn er mal in den Himmel kommt, wird ihm bestimmt auch was einfallen. Eine Stunde zu spät, aber das Tenniszeug dabei . . .«
Der Wagen fuhr nicht schnell, und je näher er kam, desto langsamer wurde er, kaum daß sich der Staub unter den Rädern kräuselte. Vom Mann in dem winzigen Cockpit hinter der Windschutzscheibe sah man vorläufig nur die Silhouette eines Kopfes mit Staubkappe und Schutzbrille. Er scherte nach rechts aus und bog, ohne zu bremsen, in die Einfahrt zu unserem Hof, fuhr bis zur Mitte und wendete dort. Dann erst, mit abgestelltem Motor, ließ er den Wagen auf unser Haus zu rollen. Vor der Treppe brachte er ihn zum Stehen.
Flo Friedl saß reglos am Fußende des Liegestuhls. Seit einer Stunde wartete sie auf ihn, und jetzt rührte sie sich nicht vom Fleck.
Ich verstand ihr Benehmen nicht und fragte: »Was hast du?«
Sie zog die Achseln hoch. »Lampenfieber hab’ ich, lila Lampenfieber, verstehst du? Mir ist lila, von Kopf bis Fuß lila . . .« Der Mann im Wagen hatte Staubkappe und Schutzbrille abgenommen und fuhr sich mit der Hand übers Haupt. Er hatte dunkles Haar, dunkles, zurückgekämmtes Haar, das glatt und glänzend den Kopf umschloß. Er richtete sich hinter dem Steuerrad auf – der Wagen hatte keine Türen – und sprang aus dem Cockpit.
Das war er also! Dieser hochgewachsene Mann in der Uniform eines amerikanischen Offiziers war Pavelino. Er sah gut aus, sehr gut sogar, aber nicht wie ein Amerikaner und schon gar nicht wie ein Soldat. Die Uniform war eine Verkleidung, ein Kostüm. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er die Uniform abgestreift hätte wie ein Flieger den Overall und wenn darunter ein weißer Anzug zum Vorschein gekommen wäre mit einer Nelke im Knopfloch.
Flo Friedl mußte denselben Gedanken gehabt haben, denn sie stand auf, pflückte eine von den kleinen Nelken, die an der Hausmauer wuchsen – sie waren rot, rot wie Pavelinos Auto –, und ging damit zu ihm.
Wenn sie etwas gesagt hat, war es so leise, daß ich es nicht hörte. Ich sah nur, wie sie ihm die kleine rote Nelke an die Uniformjacke steckte. Er ließ es geschehen, sah ihr mit einem Lächeln zu. Dann umarmten sie sich, das heißt, sie war es, die ihn umarmte. Sie hob die Arme, sie legte die Hände um seinen Hals, sie zog ihn an sich und murmelte etwas ins Ohr. Erst als sie ihn schon wieder loslassen wollte, nahm er sie in die Arme und hielt sie fest. So standen sie dort.
Bis zu diesem Moment hatte ich die beiden mit der Neugier eines Kindes beobachtet, jetzt regte sich ein Schmerz in mir, den ich bis zu diesem Tag nicht gekannt hatte und für den ich damals noch keinen Namen hatte, aber heute weiß ich: Es war Eifersucht.
*
Flo Friedl verließ noch an diesem Tag Regensburg und ging mit Pavelino nach München. Ich half beim Packen. Ich suchte mit Flo die tausend Sachen zusammen, die in ihrem Zimmer verstreut lagen: Fotografien, Schuhe, Nylons, Schallplatten, Lippenstifte, Schmuck, Handtaschen, Sonnenbrillen. Die amerikanischen Magazine nahm sie nicht mit, die erbte ich.
Pavelino kümmerte sich um die Kleider. Mit Staunen beobachtete ich, wie er die widerspenstigsten Stücke zusammenlegte; mühelos zähmte er den Abendmantel aus feuerrotem Taft, den Smoking aus weißem Satin, das schwarze Charleston-Kleid voller Pailletten und Fransen. Man sah es war nicht das erste Mal in seinem Leben, daß er für eine Frau den Koffer packte, er hatte Übung darin, und die Art, wie er es tat, verriet, daß es ihm Vergnügen machte.
Um sechs Uhr abends holte ein Jeep Flo Friedls Koffer ab, denn in Pavelinos rotem Amilcar war dafür kein Platz. Dann kam der Abschied. Flo war sehr aufgeregt. Sie umarmte mich und flüsterte: »Drück mir die Daumen!« Pavelino stand daneben, die Staubkappe und die Autobrille in der Hand. »Auf Wiedersehen«, sagte ich und streckte ihm die Hand hin. Er nahm sie und sah mich an. »Wer weiß . . . vielleicht . . . Also dann, auf Wiedersehen!«
Sie stiegen ein. Flo hatte nur eine Handtasche bei sich und den Silberfuchs. Der rote Amilcar rollte aus dem Hof, und ich winkte den beiden nach, auf Wiedersehen.
Und wie das so ist mit den Wünschen, die wir als Kinder hegen, solange wir noch ans Wünschen glauben – der Wunsch ging in Erfüllung; an einem anderen Ort, und man könnte sagen in einem anderen Leben. Als ich Pavelino wieder begegnete, zwölf Jahre später, 1958 in München, trug er nicht mehr die Uniform eines amerikanischen Offiziers, und ich war kein Kind mehr.
März 1958
2
Es war ein Märztag zwischen Nebel und Sonne, zwischen Winter und Frühling. Vor der Münchner Universität wallten die grauen Schwaden so dicht, daß man von der Tram nur die Funken der Oberleitung sah, aber hundert Meter weiter, in der Veterinärstraße, tanzten einzelne Sonnenstrahlen durch die Luft.
Auch ich fühlte mich halb neblig, halb sonnig, halb winterlich, halb frühlingshaft, während ich die Veterinärstraße in Richtung Englischer Garten hinunterging. Vor fünf Minuten hatte ich beim Studentenschnelldienst einen Job gefunden, einen guten Job für drei bis vier Wochen, und ich freute mich darüber, denn nun war ich meine Geldsorgen los. Andererseits wußte ich schon jetzt, meinem Freund Jean-Didier würde es nicht passen, daß ich den Job angenommen habe. Seit einiger Zeit paßte ihm nichts mehr, was ich machte. Der Grund war sehr einfach: Er wollte heiraten, und ich wollte nicht; jetzt nicht und auch später nicht. Zuerst gefiel ihm meine Widerspenstigkeit, doch dann wurde er nervös, und es kam zu Spannungen zwischen uns. Er machte sich über mein Studium lustig: Literatur und Musik, das sei ein netter Zeitvertreib für eine höhere Tochter, aber als Vorbereitung auf einen Beruf total wertlos, außer es genüge mir, in einem Verlag den Kaffee zu kochen. Als er merkte, daß mich sein Spott nicht traf, bildete er sich ein, hinter meiner Weigerung stecke ein anderer Mann, und er begann mich eifersüchtig zu überwachen – ein Witz, denn ich wohnte bei meinen Eltern und wurde dort schon eifersüchtig genug bewacht. Hätte ich Jean-Didier geheiratet, hätte ich nur die Adresse gewechselt. Das Leben, wie ich es mir vorstellte, hätte ich bei ihm nicht gefunden. Was stellte ich mir eigentlich vor? Freiheit, so viel Freiheit wie möglich. Ein kleines Reich für mich. Vier Wände, zwischen denen es Tag oder Nacht war, wann ich wollte. Eine Tür, zu der nur ich den Schlüssel hatte. Am besten, ich sagte Jean-Didier nichts von meinem neuen Job, sonst würde er mir nachspionieren und Vorwürfe machen, daß seine Arbeit im Architekturbüro meinetwegen liegenbleibe.
Der neue Job versprach, eine interessante Sache zu werden. In einem Privathaus sollte eine große Bibliothek geordnet und katalogisiert werden. Die Leute hießen Reich und wohnten in der Mandlstraße. Zwischen zwölf und dreizehn Uhr konnte ich mich vorstellen. Komische Zeit, aber mir kam sie gelegen. Ich hatte nichts vor, und machte mich gleich auf den Weg.
In der Königinstraße wurde der Nebel wieder dichter, weißer Qualm, der aus den Wiesen des Englischen Gartens aufstieg. Die Autos und die Radler fuhren mit Licht, und dennoch sah man sie erst im letzten Augenblick auftauchen.
Eine Bibliothek von einigen tausend Bänden in einem Haus an der Mandlstraße – das klang nach reichen Leuten, und genau das ließ mich vorsichtig werden. Die Reichen zahlen nicht gern, deshalb vergessen sie es einfach. Bevor ich bei den Reichs zu arbeiten anfing, mußte ich diesen Punkt klären. Ich würde um wöchentliche Abrechnung bitten, sonst durfte ich am Schluß meinem Geld nachlaufen.
*
Das Haus stand am Beginn der Mandlstraße, auf der rechten Seite, etwas zurückgesetzt und halb verborgen durch eine Mauer: keine Herrschaftsvilla, sondern ein Landhaus, und an dieses einstöckige Landhaus mit der klargegliederten Fensterfront und dem langen Dachfirst war ein Turm mit quadratischem Grundriß angebaut. Der graue Verputz, die schwarzgestrichenen Läden und der dichte Efeubewuchs des Turms gaben dem Haus den Ernst und die Strenge einer kleinen Festung.
Nirgends regte sich etwas, aus keinem der drei Schornsteine stieg Rauch auf. Das Haus machte einen unbewohnten und gleichzeitig doch einen gepflegten Eindruck. Der Kies der Auffahrt und des Vorplatzes war geharkt, das Glas der zwei Bronzelampen links und rechts der Haustür frisch geputzt.
Auf mein Läuten hin geschah nichts. Niemand öffnete. Typisch für die Reichen, dachte ich, lassen einen herlaufen und sind nicht zu Hause. Ich wollte schon gehen, da sah ich, wie aus dem Schornstein des Turms Rauch kam, qualmend, in unregelmäßigen Stößen, mit Funken vermischt. Jemand mußte dort gerade Feuer machen. Ich kehrte um, ging um den Turm herum und fand an der Nordseite ein großes Atelierfenster.
Ich trat langsam näher und blickte hinein. Vor einem offenen Kamin kniete eine grauhaarige, rundliche Frau in dunkelgrünem Schottenrock und schwarzer Wollbluse. Sie hatte einen Blasebalg in der Hand, um das Feuer anzufachen. Ich wartete, bis sie sich erhob und den Blasebalg weglegte, dann klopfte ich ans Fenster. Sie reagierte sofort, nickte und machte ein Zeichen, ich solle zur Haustür gehen, sie würde mir aufschließen.
Ich dachte, es sei Frau Reich. Für eine Angestellte schien sie mir zu gut gekleidet und zu gut frisiert. Es war eine altmodische Frisur: Wellen um den ganzen Kopf und im Nakken eine Rolle. Sie mußte am Morgen beim Friseur gewesen sein, so perfekt saß das Haar. Aber ich hatte mich geirrt, sie war nicht Frau Reich, sondern Frau Keller, die Haushälterin. Sie behandelte mich ziemlich abweisend und betrachtete das Formular vom Studentenschnelldienst wie ein betrügerisches Dokument.
»Herr Reich hat gesagt, ein Student kommt, um die Bibliothek zu ordnen.« Sie blickte voller Mißbilligung auf meine Hosen. »Bald gibt es keinen Unterschied mehr . . .« sie ließ den Satz unbeendet und fuhr nach einer Pause fort: »Ist das überhaupt erlaubt, Mädchen in Hosen an der Universität?«
Die Frage, ob Studentinnen an der Universität Hosen tragen dürfen oder nicht, erhitzte damals die Gemüter in München. Jeden Tag brachten die Zeitungen Leserbriefe zu diesem Thema, und in den meisten wurden die Hosen als unanständig verdammt. Uns Studentinnen ermunterte das erst recht, Hosen zu tragen, aber so wichtig war mir die Sache nicht, um es mir mit Frau Keller gleich in den ersten Minuten zu verderben. Also sagte ich: »Schön finde ich Hosen auch nicht, aber praktisch und warm. Und man zerreißt nicht jeden Tag ein Paar Strümpfe.«
Frau Keller blieb bei ihrem Urteil: »Es gehört sich nicht.«
Wir standen immer noch an der Haustür. »Kann ich jetzt Herrn Reich sprechen?«
»Herr Reich ist nicht da, vor zwölf ist er nie da. Kommen Sie etwas später wieder, sagen wir in einer halben Stunde.«
Ich hatte keine Lust, im Nebel herumzulaufen, und in ein Restaurant konnte ich nicht, dazu fehlte mir das Geld. »Ich möchte hier auf ihn warten.«
Sie ließ mich eintreten. Durch einen Windfang kamen wir in ein dämmriges Entree mit roten Lackwänden und schwarzen Lackmöbeln im Stil der zwanziger Jahre. Frau Keller bot mir Platz an, aber ich setzte mich nicht, sondern bat sie, mich in die Bibliothek zu führen.
Sie zögerte. »Herr Reich . . . ich weiß nicht . . . Also gut, kommen Sie!«
Zuerst kamen wir in ein dämmriges Musikzimmer. Über den Flügel war eine goldfarbene Seidendecke mit langen Goldfransen gebreitet; in einer Ecke standen Notenständer und aufeinandergestapelte Stühle. »Gibt es hier Hauskonzerte?« fragte ich, und Frau Keller antwortete einsilbig: »Früher mal.«
Der nächste Raum war ein Wintergarten mit halbvertrockneten Palmen, ausgedienten Übertöpfen, einem leeren Vogelbauer und zusammengerückten Korbmöbeln.
Dann kamen wir in die Bibliothek. Es war ein intimer Raum mit einem chinablauen Teppich und einem kleinen, mit grauem Marmor verkleideten Kamin. Das Fenster und die Glastür gingen auf eine Terrasse. Vor dem Fenster stand ein Tisch mit Bücherstapeln. Die Wände waren voller Bücher. Frau Keller machte sich am Tisch zu schaffen.
»Haben Sie überhaupt schon mal in einer Bibliothek gearbeitet?« In der Frage schwang ein Unterton von Eifersucht mit; offenbar fühlte sie sich zurückgesetzt, weil Herr Reich für diese Arbeit eine Studentin ins Haus holte. Ich stellte meine Umhängtasche ab und knöpfte den Mantel auf.
»Es ist besser, Sie behalten den Mantel an«, warnte mich Frau Keller. »Es ist kalt hier. Herr Reich sagt zwar immer, ich soll die Heizung anstellen, aber das wäre Verschwendung, nur wegen mir.« Nach und nach wurde sie freundlicher. »Wenn Sie sich setzen wollen . . . Es wird noch etwas dauern. Vor zwölf Uhr ist Herr Reich nicht da. Ich habe noch zu tun, bis Herr Reich kommt.«
Als ich allein war, ging ich zum Fenster und schob die Vorhänge weiter auseinander. Hinter dem Haus erstreckte sich eine große Terrasse, von der zwei flache Treppen in die Wiese hinunterführten. Am Ende der Wiese mußte der Schwabinger Bach fließen; der Nebel war so dicht, daß er die Bäume unsichtbar machte, nur der Wipfel einer hohen Pappel ragte dunkel aus dem Grau.
Ein seltsames Haus, und doch begann ich mich heimisch zu fühlen – das machten die Bücher. Neugierig studierte ich die Rücken. Den vielen juristischen Titeln nach war Herr Reich Anwalt. Neben den Gesetzbüchern reihten sich die Ergänzungsbände, jeder mit der Jahreszahl versehen, von 1887 bis 1931. Herr Reich mußte ein alter Herr sein.
Nur bei den juristischen Büchern herrschte Ordnung, die übrige Bibliothek war ein Durcheinander von Romanen, Wörterbüchern, Gedichtbänden, Kochbüchern sowie Dramen, und das in fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch und Russisch. Die russischen Bücher waren in kyrillischer Schrift gedruckt. Ich nahm eines heraus und blätterte darin. Auch der handgeschriebene Name vorne im Buch war in kyrillischen Buchstaben, daneben die Jahreszahl 1894. Stammte Herr Reich aus Rußland?
Lesen war unmöglich bei der trüben Beleuchtung. Außer der schummrigen Deckenlampe gab es nur die Lampe auf dem Tisch, und die funktionierte nicht. Doch dann fand ich bei dem kleinen Sofa vor dem Kamin eine Stehlampe, die intakt war. Ich setzte mich, um das russische Buch genauer anzusehen – und erst jetzt, im Schein des blaßroten Schirms, wurde ich aufmerksam auf das Bild über dem Kamin. Es zeigte eine blonde Frau in einem Kleid aus glänzender silbergrauer Seide, das den Körper lose umspielte. Auf dem Kopf trug sie einen roten Hut aus durchsichtigem Material, der rechts heruntergezogen war und eine Hälfte des Gesichts beschattete. Vom Hals herab bis in den Schoß fiel eine Perlenkette. Die Haltung der Frau, ihr Blick, die Geste, mit der sie die Perlenkette hielt, all das zusammen schuf eine Atmosphäre erotischer Spannung, die Suggestion, daß diese Frau einen Mann bei sich haben mußte. Der Mann war unsichtbar und doch gegenwärtig. Der Mann sprach offensichtlich, und sie hörte ihm zu.
Der breite schwarze Lackrahmen des Bildes mit den Bronzeverzierungen an den Ecken war Jugendstil, die Frau jedoch war nicht Jugendstil. Sie war auch nicht München, weder Münchner Gesellschaft noch Münchner Bohème – die Frau war Film. Eine Merle Oberon in Blond, etwas kühler, aber ebenso intensiv in der sinnlichen Ausstrahlung. Das Bild hatte etwas Beunruhigendes, immer wieder mußte ich hinschauen; es war, als hätte ich in diesem fremden Haus ein Geheimnis entdeckt.
*
Draußen kamen Schritte näher. Ich hörte die Stimme von Frau Keller: »Die Studentin wartet in der Bibliothek, Herr Reich. Wenn Sie mich brauchen, Herr Reich . . .«
Die Tür der Bibliothek ging auf, und ich erhob mich. Seit ich hier war, hatte ich mir eine bestimmte Vorstellung von Herrn Reich gemacht: klein, weißhaarig, dunkel gekleidet, eben ein alter Advokat.
Der Mann, der eintrat, war nichts von alledem, sondern groß und dunkelhaarig. Er trug einen weißen Anzug.
Der Sohn, dachte ich, das kann nur der Sohn sein.
Er kam auf mich zu, begrüßte mich, stellte sich vor. Sein Benehmen stand im. Widerspruch zu seiner blendenden Erscheinung. Er war zurückhaltend, fast scheu. Ich fand ihn sympathisch, und gleichzeitig irritierte mich etwas an ihm. Sein Gang, seine Stimme, das Gesicht – der Mann kam mir bekannt vor. Irgendwo und irgendwann hatte ich ihn schon mal gesehen.
»Hoffentlich haben Sie die vielen Bücher nicht erschreckt.«
»Je mehr Bücher, desto wohler fühle ich mich.«
»Es sind rund siebentausend ohne die Lexika und ohne die unzähligen Wörterbücher.« Er blickte mich an. »Sind Bücher Ihr Beruf . . . Ich meine, wollen Sie mal Bibliothekarin werden?«
»Nein . . .«
»Dann muß ich mich also nicht entschuldigen für das Durcheinander, das Sie hier vorfinden. Ich war immer ein wahlloser Leser, und das hier ist das Ergebnis: eine Zufallsbibliothek. Sogar die wertvollen Bücher habe ich wahllos zusammengekauft, nicht nach System.«
Er stand vor dem Kamin, unmittelbar vor dem Bild. Die blonde Frau mit dem roten Hut blickte über seine Schulter, und im Schein der Lampe wurde er für einen Moment zu einem Teil des Bildes.
So jung war er gar nicht. Ich versuchte sein Alter zu schätzen; er konnte fünfundvierzig sein oder auch fünfundfünfzig. Das Gesicht war ebenmäßig, das dunkle Haar glatt zurückgekämmt. Ein Mann wie aus einem Film, dachte ich, beide, die Frau und er, wie aus einem Film.
Er legte das Buch, in dem er kurz geblättert hatte, weg. »Ist Ihnen klar, auf was Sie sich da einlassen?«
»Nein, ich weiß ja noch nichts. Was soll mit den Büchern geschehen?«
»Wie gesagt, es sind rund siebentausend Bände. Um sie zu ordnen, habe ich ein paarmal selber Anlauf genommen, aber immer wieder aufgegeben. Nach einer Stunde hier drinnen werde ich melancholisch, ich ergreife die Flucht. Ein Haus, das nicht mehr bewohnt wird . . . Sie verstehen, man fängt an zu denken, zu grübeln, man wird deprimiert ohne Grund, man hat ein schlechtes Gewissen ohne Grund . . . Deshalb habe ich mich entschlossen, das Haus zu liquidieren. Ich verkaufe es, wie es ist, mit allem. Nur meine Bücher möchte ich behalten, das heißt einen Teil der Bücher, und das macht es kompliziert . . . Ich hoffe, Sie haben Erfahrung, wie man so was organisiert.«
»Zuerst einmal, sollen alle Bücher katalogisiert werden? Auch die Bücher, die Sie verkaufen?«
»Nein, was verkauft wird, natürlich nicht. Da genügt eine Liste, eine für mich, eine für den Antiquar. Kitzinger übernimmt die Bücher. Er bringt die leeren Kisten und holt sie voll wieder ab.«
»Dann werde ich mit den Büchern anfangen, die Sie an Kitzinger verkaufen . . .«
»Moment, ich glaube, andersherum ist es einfacher. Ich sage Ihnen, was ich behalten möchte.«
»Auch gut. Und die Bücher, die Sie behalten, wie soll ich die katalogisieren, alphabetisch oder nach Schlagworten?«
»Ich frage mich, ob das Katalogisieren überhaupt sinnvoll ist. Das war so eine Idee von mir, eine Reaktion auf das Durcheinander. Wenn ich etwas suchte, fand ich immer nur Wörterbücher. Manchmal hatte ich das Gefühl, die ganze Bibliothek besteht aus Wörterbüchern.«
»Das mit dem Katalogisieren können Sie sich noch überlegen.« Ich nahm den Block aus meiner Tasche und setzte mich damit an den Bibliothekstisch. »Wenn Sie mir jetzt angeben, welche Art von Büchern Sie behalten wollen.«
»Alles Juristische, alles über Fliegerei und über Fotografie.« Er sprach langsam, so daß ich beim Schreiben leicht mitkam. »Die bibliophilen Ausgaben, alle Bücher mit dem Exlibris ›Antoinette‹ und die Bücher, in denen mein Name steht . . . Tut mir leid, aber es wird Ihnen nicht erspart bleiben, jedes Buch aufzuklappen.« Er kam zum Tisch und legte zwei Bücher aufgeschlagen vor mich hin. »Das Exlibris für Antoinette hat Kandinsky entworfen, die Silhouette von Leningrad.«
Ich nickte. »Schön.« Aber ich hatte nur Augen für das andere Buch, für den Namen, der in klarer Schrift mit blauer Tinte auf dem Vorsatzpapier stand: Pavelino.
Ich brauchte Sekunden, bis ich zu begreifen begann. Seit er den Raum betreten hatte, rätselte ich, woher ich ihn kannte, wo ich ihn schon einmal gesehen hatte. Aber so weit war ich nicht zurückgegangen in meinem Gedächtnis. Pavelino! Längst vergessene Bilder stiegen auf, der Junitag in Regensburg, Flo Friedl, der rot-silberne Sportwagen, der amerikanische Offizier, der eigentlich kein Amerikaner war und Pavelino hieß . . . Alles war so gegenwärtig, daß ich am liebsten gesagt hätte: Ich kannte mal einen amerikanischen Offizier, der hieß auch Pavelino.
Er stand mir gegenüber, er war es, kein Zweifel.
Und doch machte ich den Mund nicht auf. Es war nicht der richtige Moment. Vielleicht würde er später kommen, vielleicht nie. Was hätte ich auch sagen sollen, im Grunde konnte ich es noch immer nicht glauben, daß der Mann hier Pavelino war.
»Wann können Sie anfangen mit der Arbeit?« fragte er.
»Jederzeit.«
»Dann sagen wir morgen.«
Ich nickte.
»Sie können es sich so einrichten, wie es Ihnen paßt, vormittags oder nachmittags. Frau Keller ist immer da. Am besten, Sie machen die Zeit jedesmal mit ihr aus.«
Ich stand auf. »Meinen Block lasse ich schon da.«
Er kam um den Tisch herum und zog die Schublade auf. »Hier sind Papier und Stifte.«
»Ich brauche eine Schreibmaschine . . . und dann, das Licht ist sehr schlecht. In dieser Lampe ist die Birne kaputt.«
»Ich sage Frau Keller, daß sie sich darum kümmert . . . Wegen der Bezahlung – Sie schreiben die Stunden auf, und Frau Keller rechnet jeweils am Wochenende mit Ihnen ab, ist Ihnen das recht?«
»Ja.«
»Haben Sie einen weiten Weg hierher?«
»Eine halbe Stunde mit der Tram.«
»Immerhin, das ist pro Tag eine Stunde, das gehört zur Arbeitszeit. Dann wäre eigentlich alles klar, oder?«
»Noch eine Frage wegen der Bücher, die Sie verkaufen. Vielleicht sollten Sie die aussortierten Kisten noch einmal durchsehen. Es könnte sein, daß ich mal einen Fehler mache . . .«
»Und wenn schon! Ich will nichts mehr damit zu tun haben, ich verlasse mich ganz auf Sie.«
Auf dem Tisch lagen die zwei Bücher, das eine mit dem Exlibris »Antoinette« und das andere mit dem Namenszug Pavelino. Mein Blick ging zu dem Bild über dem Kamin. War die blonde Frau Antoinette?
Er stand am Fenster. Der weiße Anzug paßte besser zu ihm als die Uniform eines amerikanischen Offiziers. Er trug den weißen Anzug so selbstverständlich wie ein anderer Mann den grauen Flanell. Nichts Dandyhaftes war an ihm, nichts Gesuchtes.
Ich knöpfte den Mantel zu und nahm meine Umhängtasche. Er brachte mich hinaus, durch den Wintergarten, durch das Musikzimmer. Es waren dieselben Räume, und doch erschienen sie mir verändert, nicht mehr fremd wie vorher, als ich zum erstenmal durchkam. Wenn diese Räume sprechen könnten . . . Wer weiß, vielleicht gelang es mir, sie zum Sprechen zu bringen. Morgen würde ich wieder hierherkommen, und übermorgen. Jeden Tag würde ich in diesem Haus sein.
Vor der Garage stand ein silberner Alfa Romeo Villa d’Este mit roten Lederpolstern. Ich dachte an Regensburg und an den roten Amilcar. Morgen bringe ich das Gespräch auf Regensburg, nahm ich mir vor. Ich kannte einmal einen amerikanischen Offizier, werde ich sagen, der fuhr einen roten Amilcar und hieß Pavelino.
*
Am nächsten Tag begann ich mit der Arbeit, und wie immer, wenn ich einen neuen Job antrat, hatte ich Lampenfieber. Allerdings war es diesmal stärker als sonst und vermischt mit einem Gefühl wirrer Freude und wirrer Erwartungen. In der Bibliothek fand ich alles für die Arbeit vorbereitet: Eine Schreibmaschine war da, die Lampen hatten neue, hellere Birnen, sechs leere Bücherkisten standen aufeinandergestapelt in einer Ecke – und im Kamin brannte ein Feuer. Der dämmrige, kalte Raum vom Vortag empfing mich mit Helligkeit und dem warmen Hauch eines knisternden Feuers.
Frau Keller nahm mir den Mantel ab. »Wollen Sie später vielleicht einen Tee?«
»Gerne. Ist Herr Reich da?«
»Nein, Herr Reich ist für ein paar Tage im Ausland.« Frau Keller ging zur Tür. »Wenn Sie etwas brauchen, Sie finden mich in der Küche.«
»Wissen Sie, wann Herr Reich wiederkommt?«
»Er sagte, Montag oder Dienstag. Er ruft heute zwischen fünf und sechs Uhr an. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mit ihm sprechen. Ich hole Sie dann, der Apparat steht in der Diele.«
Ich war enttäuscht, weil ich ihn nicht sehen würde, nicht nur heute, sondern die ganze Woche nicht. Ich hätte gerne gewußt, wo er jetzt, in diesem Moment, war. Ausland, das konnte alles mögliche sein: ganz in der Nähe, Schweiz oder Österreich, das konnte aber auch ein anderer Teil der Welt sein. Aber dann würde er wohl kaum hier anrufen.«
Was hatte er für einen Beruf? War er Anwalt oder Kaufmann oder beides kombiniert? Frau Keller hätte mir darauf Antwort geben können, aber ich hatte nicht die Absicht, sie auszufragen. Nach den Andeutungen, die Flo damals in Regensburg über ihn machte – kein Wort davon hatte ich vergessen –, war er ein Mann mit einem Leben ganz besonderer Art. Und genau dieses Gefühl hatte er mir auch gestern bei unserer Begegnung vermittelt: Da ist ein Mann mit einem Leben besonderer Art.
Nicht zu fassen, daß ich hier war, in seinem Haus, in seiner Bibliothek. Ein Teil seines Lebens hatte sich hier abgespielt: Jedes dieser Bücher war ein Steinchen im Mosaik seines Lebens.
Ich machte mich an die Arbeit und nahm mir das Regal in der Ecke neben dem Fenster vor. Allerlei Stadtpläne, Reiseführer und dann zwei Reihen mit Biographien: Kleopatra, Königin Christine von Schweden, Messalina, Ninon de Lenclos, Josephine Beauharnais, Eleonora Duse, Mata Hari. Alles Frauen, darunter auch Namen, die ich zum erstenmal sah: Cora Pearl, Madame Sabatier, Elisabeth Celeste Mogador, Marguerite Bellanger. Die schmalen, elegant gebundenen Bücher bestanden hauptsächlich aus Fotografien dieser Frauen, die offiziell Schauspielerinnen oder Tänzerinnen waren, aber eigentlich nichts anderes als die großen Pariser Kokotten der Jahrhundertwende.
Ich konnte der Versuchung nicht widerstehn, ich begann zu blättern und schließlich zu lesen. Die Lebensbeschreibung der schönen Marguerite Bellanger stand unter dem Motto: »Alles kommt zu dem, der warten kann.« Mein Blick ging unwillkürlich zu dem Bild über dem Kamin. Das Motto paßte auch zu dieser Frau. Die Wirkung, die von ihr ausging, kam nur zu einem Teil von ihrer Schönheit, ebenso stark war etwas anderes, das nicht sichtbar war: die innere Ruhe dieser Frau, die Fähigkeit zu warten.
Die Zeit verging schnell an diesem ersten Nachmittag in der Mandlstraße. Manchmal tauchte Frau Keller auf, legte Holz nach, brachte mir eine Tasse Tee. Jedesmal, wenn ich ihre Schritte hörte, dachte ich, sie holt mich ans Telefon, aber er rief nicht an. Um sechs Uhr räumte ich meine Sachen zusammen und löschte die Lichter. Als ich in der Diele meinen Mantel von der Garderobe nahm, kam sein Anruf.
Zuerst sprach Frau Keller mit ihm, aber die Verbindung war so schlecht, daß sie ihn kaum verstehen konnte. Sie winkte mich zum Apparat. »Ja, sie ist noch da, einen Moment, Herr Reich.«
Er fragte mich, ob ich ihn verstehen könne. »Wir stecken hier im Schnee . . . und das ist das einzige Telefon weit und breit.« Er nannte einen Ortsnamen, den ich nicht kannte. Dann wollte er wissen, wie es mir an meinem ersten Tag ergangen sei. »Gut? Keine Probleme? Die nächsten Tage werde ich nicht anrufen können, auf der Skihütte gibt es kein Telefon. Es schneit hier. Es schneit seit vierundzwanzig Stunden.«
Frau Keller machte mir Zeichen, daß sie ihn noch einmal sprechen wolle, und ich verabschiedete mich.
Die nächsten Tage glichen dem ersten. Immer wieder war ich versucht zu lesen, und immer wieder machte ich kleine Entdeckungen: Versteckt zwischen Buchseiten, fand ich ein altes Kinobillett der Fern-Andra-Lichtspiele München, Nymphenburger Straße, vom Oktober 1926, mit dem Stempel Verbilligte Studentenkarte. Oder eine Postkarte, abgeschickt und abgestempelt in Bremerhaven, adressiert an Herrn Pavelino Reich, stud. jur., München, Sophienstraße. Die Schreiberin hieß Maxi Markones. Oder eine Eintrittskarte für das Undosa-Bad in Starnberg. Und immer wieder Kinobilletts: Marmorhaus, Lichtburg, Phoebuspalast. Große Entdeckungen machte ich nicht. Das Fotoalbum, in dem man hätte blättern können wie in einer Lebensgeschichte, fand ich nicht.
Die Gespräche mit Frau Keller drehten sich um Alltägliches, und meine Konversation mit der blonden Frau auf dem Bild über dem Kamin blieb einseitig. Ich stellte Fragen, aber sie blieb stumm.
Am Freitag holte Kitzinger acht volle Bücherkisten ab und stellte acht leere in die Bibliothek. Am Samstag zahlte mir Frau Keller zum erstenmal den Lohn aus, und sie kündigte an: »Am Dienstag kommt Herr Reich nach München.«
*
Sein silbergrauer Alfa Romeo stand vor der Garage, und er wartete in der Bibliothek auf mich. Er trug einen Automantel aus einem leichten, hellen Wollstoff. Offensichtlich wollte er schon wieder aufbrechen.
Wie beim erstenmal schien er zunächst befangen. Er lobte meine Arbeit, vor allem mein Tempo. »Ich sollte mir ein Beispiel nehmen an Ihnen und endlich mein Atelier räumen. Der Papierkram, die Zeitschriften . . . mir ist richtig angst davor.« Worauf wollte er hinaus? »Ich weiß nicht, wie es mit Ihrer Zeit aussieht . . .« Er stockte. »Was meinen Sie, wäre es denkbar, daß Sie mir behilflich sein könnten, das Atelier zu räumen?«
Ich zögerte. Ich weiß nicht warum, aber ich zögerte.
»Überlegen Sie es sich, vielleicht können Sie es einrichten.«
Ich war froh, daß er nicht drängte.
An den Fenstern rüttelte der Frühlingssturm: Er wirbelte das alte Laub auf, das auf der Terrasse lag, ließ es tanzen, warf es gegen die Scheiben. Ein einzelnes Blatt blieb am Fenster haften, flatterte eine Weile lautlos und sank wieder zu Boden.
»Föhn«, sagte er. »Wenn das so weiterbläst, ist es bald aus mit dem Skifahren. Heute früh auf der Zugspitze hatten wir eine Sicht, unvorstellbar schön . . . Ja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten.«
Er sagte nichts mehr vom Atelier, schien es eilig zu haben.
»Bevor Sie gehen, noch eine Frage: Die Wörterbücher, was soll damit geschehen?«
»Die Wörterbücher? Wie viele sind es? Hundert? Oder mehr? Im Atelier liegen auch noch welche. Im ganzen Haus liegen Wörterbücher, sogar im Auto habe ich Wörterbücher.«
»Im Haus liegen keine mehr. Die sind alle hier in dieser Kiste.«
Er hatte es nicht mehr eilig, sondern ging kopfschüttelnd um die Kiste herum und setzte sich schließlich darauf.
»So ist das, wenn man auf der Schule acht Jahre lang Griechisch und Latein lernt, aber nur einen einzigen Satz Englisch. Mein Leben lang habe ich den Komplex, ein akademischer Analphabet zu sein.«
»Wissen Sie den englischen Satz noch?«
»Natürlich, wollen Sie ihn hören?«
»Unbedingt.«
»Also, passen Sie auf: An Englishman who was travelling in China entered an eating-house and called for the waiter. Altes Gymnasium Regensburg. Der Professor sprach Englisch, wie ein Berliner Hochdeutsch spricht.« Er stand auf. »Vielleicht haben Sie Verwendung für Wörterbücher, dann bitte, bedienen Sie sich! Überhaupt, wenn ein Buch Sie interessiert, nehmen Sie es! Es gehört Ihnen.«
»Sie sind ein leichtsinniger Mensch.«
Er sah mich überrascht an. »Heißt das, Sie beschlagnahmen jetzt alle Bücher für sich?«
»Und das Haus dazu.«
»Warum nicht . . .« Er zögerte, sah mich an, » . . . wenn Sie mir als Gegenleistung beim Räumen des Ateliers helfen, bin ich zu allem bereit.«
»Ich werd’s mir überlegen.«
»Und hier, wann meinen Sie, daß Sie durch sind?«
»Das hängt davon ab, ob ich die Bücher, die Sie behalten, katalogisieren soll oder nicht. Sie wollten sich das noch überlegen.«
»Richtig. Ach was, wir katalogisieren nicht. Ich würde den Katalog doch nicht benützen. In meinem Leben ging es nie nach einem Katalog.«
»Also, nicht katalogisieren. Dann bin ich in vierzehn Tagen mit der Bibliothek durch. Die Bücher, die Sie behalten, kommen auch in Kisten, nicht wahr?«
»Ja.«
»Und ich mache eine Aufstellung der Bücher nach Sachgebieten.«
Er nickte. »Sagen Sie mal, ein Album mit Aufnahmen vom Glaspalast ist Ihnen nicht in die Hände gefallen?«
»Glaspalast?«
»Der Münchner Glaspalast . . . Es sind Fotografien, die ich als Student im Glaspalast gemacht habe.«
»Wie sieht das Album denn aus?«
»Brauner Karton mit schwarzen Leinenecken und mit einem schwarzen Band verschnürt, eigentlich nicht zu übersehen.«
»Ich werde darauf achten.«
»Danke.«
Nachdem er gegangen war, machte ich mich sofort auf die Suche nach dem Album vom Glaspalast. In Arbeitsstimmung war ich ohnedies nicht, ich war wirbelig und aufgekratzt. Das kam teils vom Föhn, teils von der Aussicht, noch länger hier im Haus zu bleiben und mit Pavelino das Atelier zu räumen.
Meinem Freund Jean-Didier würde ich nichts davon sagen. Seine ewigen Sticheleien langweilten mich, und ich wünschte, ich hätte ihm nie etwas von Pavelino gesagt. Auf Herrn Reich wäre er nie eifersüchtig gewesen.
Das Album vom Glaspalast fand ich nicht an diesem Nachmittag und auch in den nächsten Tagen nicht. Erst zwei Wochen später, als ich die juristischen Werke aus dem Regal nahm, kam es zum Vorschein, eingezwängt zwischen dem »Römischen Kirchenrecht« und dem »Code Napoleon«. Eigentlich hatte ich keine Zeit, denn es war ausgemacht, daß wir am nächsten Morgen mit dem Räumen des Ateliers beginnen, und in der Bibliothek gab es noch eine Menge zu tun. Aber meine Neugier war zu groß. Nur einen Blick. Ich setzte mich mit meinem Fund auf den Teppich und öffnete das schwarze Baumwollband. Es fühlte sich staubig an, brüchig. Auf der ersten Seite stand in handgeschriebenen Druckbuchstaben Der Glaspalast. Ich zögerte weiterzublättern, fühlte mich plötzlich befangen. Was ich da machte, war nicht in Ordnung. Das war kein Buch, sondern eine Sammlung von Fotografien, also etwas sehr Persönliches, Intimes. Ach was! Nur einen Blick . . .
Das erste Foto zeigte ein Gewächshaus, Palmen, Sonne. Unter diesem Zelt aus Palmen stand eine weiße Bank, und auf der Bank lag ein Fotoapparat. Mein Fotoatelier stand handgeschrieben daneben.
Ich blätterte um: wieder Palmen, wieder Sonne, zwischen den Palmen ein schmaler Weg, und auf diesem Weg kommt eine junge Frau gegangen; hohe Pumps, lange Beine, ein helles Kleid. Der Gürtel sitzt tief, der kleine Hut ist ins Gesicht gezogen. Sie schaut nicht in die Kamera. Das nächste Bild zeigt eine andere Frau. Eine Parade von Frauen unter Palmen im Sonnenlicht. Nicht alle sind jung, aber alle sind elegant, manche sogar exzentrisch. Kleider aus geblümter Seide, Perlenketten bis zum Rocksaum. Dann plötzlich Pelzmäntel, Muffs. Ist es Winter geworden? Im Palmenhaus nicht, dort scheint immer die Sonne.
Ich verglich jede der Frauen mit der auf dem Bild über dem Kamin, aber keine ähnelte ihr, keine kam ihr gleich an Schönheit und erotischer Ausstrahlung.
»Sie sollten mal Pause machen.« Es war Herr Reich, der in der Tür stand. Ich wollte das Album zuklappen, aber zu spät. Er hatte es schon gesehen und erkannt.
»Der Glaspalast! Zeigen Sie her!«
Ich versuchte, meine Verlegenheit zu überspielen. »Ich fand es in diesem Moment zwischen dem »Römischen Kirchenrecht‹ und dem ›Code Napoleon‹.« Ich stand auf, gab ihm das Album.
»Ein gutes Versteck.« Er wog es liebevoll in den Händen. »Mein Glaspalast . . . Sie wissen nicht, was das war, der Glaspalast. Sie sind zu spät auf die Welt gekommen . . .« Sein Blick ging über die leeren Regale. »Traurig sieht es hier aus.« Er trat vor den Kamin und sagte zu der Frau auf dem Bild: »Das ist kein Ort mehr für dich.« Er gab mir das Album und nahm das Bild vom Haken. »Kommen Sie, wir geh’n in mein Atelier.«
3
Vor dem großen Fenster des Ateliers war es Frühling; die Vögel zwitscherten, und der Krokus blühte. Im Inneren des Ateliers herrschte eine andere Jahreszeit – und ich habe nur einen Namen dafür: die Jahreszeit der Verzauberung.
War es das Feuer im Kamin, das knisterte und dem Tageslicht geheimnisvolle Farben beimischte? War es der Samowar, der summte und der Stille seine Stimme lieh? Oder war es der Mann, von dem der ganze Raum und jeder Gegenstand geprägt schien?
An der Wand gegenüber dem Fenster führte eine Holztreppe zu einer Galerie; an der einen Seitenwand war der Kamin mit einem altgedienten Ledersofa und einem altgedienten Lehnstuhl davor. Den freien Raum vor dem Atelierfenster nahm ein langes Ablagemöbel ein, und dahinter, im Gegenlicht nur als dunkle Silhouette erkennbar, standen zwei Projektionsapparate. Die Mauer der Wände war weiß getüncht, die Balkendecke dunkel gebeizt.
Pavelino hatte das Bild der Frau auf den Chesterfield-Sessel gestellt. Er wischte den Staub vom Rahmen, rückte es mehr ins Licht.
»Ich habe das Haus eigentlich nur wegen des Ateliers gekauft. Hier hatte ich Platz für mein Heimkino.«
»Heimkino?«