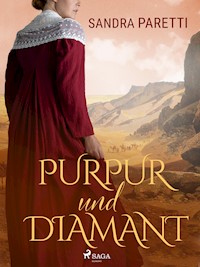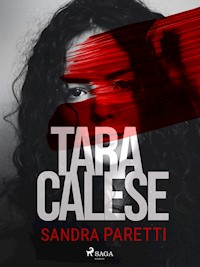
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sommer 1980 in New York: Als Tochter eines Mafia-Bosses hat Tara Calese bereits viele Tragödien durchlebt, unter anderem die Ermordung ihrer Mutter. Als sie gerade wieder glücklich zu sein scheint, folgt der nächste Schlag. Auf der Hochzeit ihres Bruders wird ein Mordversuch an einer jungen Frau der rivalisierenden Mafia-Familie verübt. Hat ihr Vater etwa was damit zu tun? Tara wird in einen Strudel aus Geheimnissen und Intrigen gezogen und weiß bald nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Spannend und mitreißend erzählt Sandra Paretti eine Geschichte von Familien, Gewalt und Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Paretti
Tara Calese
Saga
Tara Calese
Copyright © 2022 by Helmut and Anka Schneeberger, represented bei AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1988 by Droemer Knaur Verlag, München
Coverimage/Illustration: unsplash
Copyright © 1988, 2022 Sandra Paretti und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728469446
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
New York
Montag, 15. September 1986
Sie lag im Dunkeln, und das Dunkel war erfüllt von einem dumpfen Dröhnen. Ihr Herz hämmerte. Von einer Seite fiel ein schwacher Lichtschein in den Raum. Undeutlich erkannte sie die Lamellenstores eines Fensters. Eine Wolldecke war über sie gebreitet. Sie lag auf einer Couch.
War sie nicht mehr im Flugzeug?
Was hatte man mit ihr gemacht?
Warum war sie so müde?
An das Flugzeug konnte sie sich genau erinnern, ein kleiner Learjet mit sieben Sitzen. Noch vor dem Start hatte man ihr einen Becher Orangensaft in die Hand gedrückt. Durstig hatte sie den Becher ausgetrunken. Was war danach geschehen?
Hatte man ihr mit dem Saft ein Betäubungsmittel gegeben?
Warum?
Was hatte man vor mit ihr?
Wohin hatte man sie gebracht?
Man?
Wer war das? Wer steckte hinter dieser Entführung?
Zuerst hatte es ausgesehen wie eine Verhaftung, aber während der Autofahrt war ihr klargeworden, daß sie sich in der Gewalt von Kriminellen befand.
Die Stimmen. Waren es Männerstimmen? Oder lief nebenan ein Fernseher? Die Stimmen wurden lauter. Geräusche an der Tür, ein Schlüssel. Schritte kamen näher. Der Raum war plötzlich in weißes Licht getaucht. Sie schloß die Augen und stellte sich schlafend.
Was würden sie mit ihr tun?
Ihr Herz begann zu rasen. Sie hatte das Gefühl, etwas in ihr zerplatzt; etwas Heißes, Ätzendes breitete sich in ihrem Körper aus, stieg aus dem Leib aufwärts in die Brust und weiter in die Kehle. Sie konnte kaum noch atmen, sie glaubte zu ersticken.
»He, Baby, hast du gerufen?« Eine große Männerhand tätschelte ihre Wange. »Schlecht geträumt, Baby? Komm schon, mach die Augen auf. Geschlafen hast du lange genug.« Die Hand rüttelte sie an der Schulter. »He, was soll das, ich seh’ doch, daß du nicht mehr schläfst.«
Der Mann ließ sie los. »Wie du willst. Ich rate dir nur eins, mach keine Dummheiten. Versuch nicht, aus dem Fenster zu springen. Erstens kriegst du’s nicht auf, zweitens sind wir im neunten Stock, bißchen hoch zum Springen. Wäre schade um dich. Noch was, wenn du auf die Toilette mußt, die Tür in der Ecke, o.k.?« Der Mann wartete noch einen Moment, doch da sie sich weiter schlafend stellte, ließ er sie allein. Er löschte das Licht und sperrte die Tür ab.
Als er gegangen war, bereute sie, daß sie nicht mit ihm gesprochen hatte. Sie schämte sich ihrer Furcht. Warum hatte sie ihn nicht gefragt, wo sie war, und was man von ihr wollte.
Wer war dieser Mann überhaupt?
Nur eines stand fest, man hatte sie entführt.
Aber warum?
Warum sie?
Sie fand nur eine Antwort auf diese Frage – weil sie Tara Calese war, die Tochter von Massimo Calese.
Sie lag reglos. Dunkel erinnerte sie sich, daß man sie gefesselt hatte.
Im Traum?
In Wirklichkeit?
Sie versuchte, die Hände zu bewegen, erst die rechte, dann die linke. Keine Fesseln. Sie atmete auf.
Sie öffnete die Augen, hob den Kopf und blickte sich um. Aus der grauen Dämmerung lösten sich allmählich die Gegenstände, ein niedriger Tisch, zwei Polsterstühle. Sie glaubte drei Türen zu erkennen. Zwischen zweien stand ein leeres halbhohes Bücherregal. Sie setzte sich auf; sie fühlte sich benommen. Die Luft im Raum war verbraucht.
Seit wann war sie hier? Sie hob die rechte Hand an die Augen und schaute auf die Uhr. Halb acht. Aber was für eine Tageszeit? Halb acht Uhr abends? Halb acht Uhr morgens?
Als man sie zum Flugzeug gebracht hatte, war es Abend gewesen. Wieviel Zeit war seitdem vergangen? Ein Tag, oder mehr?
Auf einem der Polsterstühle erkannte sie ihre Tasche. Auf dem Boden standen ihre Turnschuhe.
Sie schob die Wolldecke zurück und blickte an sich herunter. Die Jeans, das weiße Hemd.
Sie lauschte auf ihren Körper. Schmerzen? Nein, keine Schmerzen, nur eine bleierne Schwere und das Gefühl, daß die Kleider ihr auf der Haut klebten.
Sie hatte den Wunsch, sich zu waschen. Zuerst heiß baden und dann kalt duschen. So lange kalt duschen, bis die dumpfe Benommenheit von ihr weichen würde. Sie stand auf, aber sie war so wackelig auf den Beinen, daß sie an der Wand Halt suchen mußte. Schritt für Schritt tastete sie sich zu der Tür in der Ecke.
Am Fenster hielt sie inne. Sie schob die Lamellenstores auseinander und blickte nach draußen. Eine Brandmauer, eine graue Schlucht zwischen zwei Häusern; von unten drang der diffuse Schein einer Straßenlaterne herauf. Aus der Tiefe, gedämpft durch das Fenster, klang der Lärm einer großen Stadt herauf. Ein Geräusch hob sich deutlich ab, ein Rattern und Schlagen, es schwoll an und verebbte schnell wieder.
Eine Hochbahn? Ein Fernzug, der in der Nähe vorbeifuhr?
Sie tastete sich weiter zur Toilette, öffnete die Tür und fand den Lichtschalter. An der Wand über dem Waschbecken flammte eine Neonröhre auf. Das helle Licht blendete sie. Der Raum war klein. Auf dem Waschbecken lag ein Stück Seife, an einer Stange hing ein Handtuch. Die grauweißen Kacheln und die dunklen Steinfliesen wirkten schmuddelig.
Sie trat zum Waschbecken. Das Gesicht, das ihr aus dem Spiegel entgegenblickte, war ihr Gesicht, und doch schien es ihr fremd. Es war blaß, wie versteinert. Der Tag, an dem ihre Mutter beerdigt wurde, stieg vor ihr auf: ein Sommertag mit einem warmen Südwind, der den Hudson River leicht kräuselte und über den blauen Himmel durchsichtige Tüllwolken trieb, die sich da und dort ausbreiteten wie weiße, wehende Brautschleier.
Die schwarzen Gestalten um das Grab, der Priester, der von den Geheimnissen der göttlichen Vorsehung sprach. Wußte er wirklich nicht, wie Diana Calese gestorben war? Oder hatte die Familie ihn bezahlt, damit er nichts wüßte, so wie sie die Polizei und den Arzt bezahlt hatten, damit die wahre Todesursache nicht bekannt würde.
Sie wusch sich die Hände. Als sie sich über das Waschbecken beugte, bemerkte sie, daß ihr eine Krawatte vom Hals baumelte, ein knalliges Ding in Pink und Gelb.
Woher kam diese blöde Krawatte?
Das weiße Hemd hatte ihr Norman gegeben – aber woher stammte die Krawatte?
Sie zog die Krawatte über den Kopf, suchte das eingenähte Fabrikationsschildchen. Herera Fabrics, Made in Mexico, stand da.
Der Flughafen von Mexiko. Sie hatte mit Bob Fisher auf den Abflug der Maschine nach New York gewartet. Um sich die Zeit zu vertreiben, waren sie durch die Souvernirshops geschlendert und schließlich bei einem Krawattenstand gelandet.«Wenn du schon ein Herrenhemd trägst, brauchst du auch eine Krawatte«, hatte Bob Fisher lachend gesagt, und sie aufgefordert, die knalligste herauszusuchen. Scherzend hatte Bob Fisher ihr die rosarote Krawatte mit dem Indianerhäuptling in Gelb um den Hals gebunden.
In dem Moment, als er sich abwandte und bezahlte, war über den Lautsprecher der Aufruf gekommen: Fluggast Tara Fisher nach New York bitte zur Information!
Der Aufruf hatte ihr gegolten. Ihr Ticket lautete auf diesen Namen; der Paß, den sie bei sich hatte, ebenfalls. Name und Paß waren falsch. Aus Tara Calese war Tara Fisher geworden, eine Verwandte von Bob Fisher. Sie hatte gedacht, es genügte, den Namen zu wechseln, und sie wäre gerettet. Die Ausreise aus Amerika vor drei Tagen war glattgegangen; und jetzt eben, an der Paßkontrolle, hatte der Beamte nur einen Blick auf den Einreisestempel geworfen und gemeint, das wäre aber kein langer Besuch gewesen.
Zuerst hatte man die Ansage auf spanisch durchgegeben, das zweitemal auf englisch. »Was hat das zu bedeuten?« hatte sie Bob Fisher erschrocken gefragt, doch der hatte nur gelacht: »Spiel nicht den ahnungslosen Engel, das ist hundertprozentig Luiz Martinez, den das unwiderstehliche Verlangen hergetrieben hat, dich noch mal zu sehen. Den hat es richtig erwischt. Mach dich darauf gefaßt, daß er demnächst in New York auftaucht.«
Eine innere Stimme hatte sie gewarnt, hatte ihr zugeflüstert, die Transithalle nicht zu verlassen.
Warum hatte sie nicht darauf gehört?
Jenseits der Sperre waren zwei Männer auf sie zugekommen, Männer in unauffälligen graublauen Anzügen, die sich in nichts vom Flughafenpersonal unterschieden. An der Brusttasche steckten ihre Identifikationskarten. Morris hieß der Ältere, Keller der Jüngere.
»Miss Fisher?« hatte Morris sie angeredet, und als sie nickte, hatte er gesagt: »Wir haben den Auftrag, Sie zur Flughafenpolizei zu bringen.« Er hatte amerikanisch gesprochen, auf eine schleppende Art; sein Gesicht hatte Gleichgültigkeit ausgedrückt, als handelte es sich um eine Routineprüfung.
Die beiden Männer hatten sie in die Mitte genommen und aus dem Flughafen geführt. Und dann, ehe sie begriff, was mit ihr geschah, hatte sie in einem Wagen gesessen.
Wann war das gewesen?
Tara wußte nur noch mit Sicherheit, daß sie am Samstagabend von Mexico City nach New York hatte fliegen wollen.
Wie viele Tage waren seitdem vergangen?
Zwei Tage, drei, oder mehr?
Zuerst die zwanzigstündige Autofahrt. Es war ein olivgrüner Chevrolet Station; auf der Ladefläche lagen eine Schaumgummimatratze und ein Schlafsack.
Sie waren auf Landstraßen gefahren. Immer wieder Pässe, immer wieder lange Strecken durch Steppengebiet, wo nichts wuchs als baumhohe Kakteen. Irgendwann, mitten in der Nacht, hatten sie sich in einem mexikanischen Bergdorf mit dem Fahren abgewechselt.
Sie hatte sich krampfhaft bemüht, wach zu bleiben, teils aus Furcht vor den Männern, teils in der Hoffnung, es könnte sich plötzlich eine Möglichkeit zur Flucht ergeben.
Irgendwann war sie dann doch eingeschlafen. Sie hatten ihr ein Schlafmittel in das lauwarme Wasser gemischt, das sie ihr in einem Pappbecher reichten.
Sie wußte nicht, wann und wo sie die Grenze passiert hatten. Als sie erwachte, waren sie bereits auf amerikanischem Gebiet, und das Programm im Autoradio kam von einem Sender in Houston.
Sie hatte sich wie gerädert gefühlt, als wären alle ihre Muskeln verspannt. Aber die Fahrt war immer noch nicht zu Ende gewesen. Es war weiter gegangen, immer weiter, den ganzen Tag durch. Erst bei Dunkelheit hatten sie Houston erreicht.
Mit tauben Füßen war sie aus dem Auto gestiegen. Allein die Tatsache, wieder auf den Beinen zu stehen, nicht mehr eingesperrt zu sein in dem verhaßten Auto, hatte die absurde Hoffnung in ihr geweckt, man würde sie freilassen . . .
Gefangen von ihren Gedanken hatte Tara die Schritte des Bewachers nicht gehört. Plötzlich stand er hinter ihr.
»He, Baby, ausgeschlafen?« Er legte ihr die Hand auf die Schulter und musterte sie mit einem anzüglichen Grinsen. »Du bist einsame Klasse, das muß man dir lassen. Ich habe was zu essen gebracht, einen Cheeseburger und Kaffee.«
Er war mittelgroß und schwer gebaut, zwischen dreißig und vierzig Jahre alt. Er trug ein verwaschenes hellbraunes T-Shirt mit einem U-Boot bedruckt und der Schrift We come unseen. Das Lederhalfter der Waffe war speckig und saß sehr knapp. Zu der Zeit, als es ihm angemessen worden war, mußte er schlanker gewesen sein. Er roch penetrant nach Schweiß.
Er schob sie aus dem Bad und deutete auf den Couchtisch, wo auf einer Papierserviette ein riesiger Cheeseburger lag, aus dessen Rändern Salatblätter hervorquollen. Daneben stand eine Tasse mit dampfendem Kaffee. »Den Kaffee habe ich selber gemacht. Ich hoffe, er schmeckt dir, Baby.«
Tara erwiderte nichts. Ihr Blick ging zu der Tür, die in den Außenraum führte; die Tür war offen, und Tara konnte eine primitive Einbauküche erkennen, Gasherd, Spüle und Eisschrank. Neben dem Eisschrank wieder eine Tür. Es mußte die Wohnungstür sein, die Kette war nicht eingehängt, in dem Sicherheitsschloß steckte der Schlüssel. Bis zu der Tür waren es nur wenige Meter. Sie mußte es versuchen. Wenn in der Küche nicht ein zweiter Kerl hockte, hatte sie eine gute Chance zu entkommen.
»Keinen Hunger?« fragte der Mann.
»Nein.«
»Wenigstens ein Schluck Kaffee, das wird dir guttun. Der Appetit kommt dann von selber.« Er beugte sich über den Tisch, um ihr die Tasse zu geben.
Tara handelte blitzschnell. Sie packte ihre Tasche und rannte los. Sie kam nur bis zur Mitte der Küche. Dort schnellte ein langer Kerl aus einem Sessel und trat ihr in den Weg.
»Stop, Fahrverbot«, sagte er mit gleichgültigem Gesicht. Er trug einen grünen Jogginganzug, sein strähniges Haar fiel über ein Stirnband mit der Aufschrift Olympiade Moskau.
Tara wollte an ihm vorbei. Seine Hände schnappten zu wie eiserne Zangen.
Zitternd vor Wut, sah sie zu ihm auf. »Loslassen«, schrie sie, »sofort loslassen.«
Der erste Bewacher trat dazu. »Du enttäuschst mich, Baby. Ich dachte, wir verstehen uns. Schade . . .« Der Lange ließ sie los. Tara holte aus und schlug mit der Tasche nach den Männern.
»Was hat sie?« fragte der Lange. »Was hast du mit ihr gemacht?«
»Nichts – ihr gefällt’s einfach nicht bei uns. Halt sie fest«, befahl er dem Langen, dann trat er dicht vor Tara, so dicht, daß sein Leib sie berührte. »Ich wende nicht gern Gewalt an . . . Noch eine verrückte Tour und wir stellen dich ruhig. Hast du verstanden? Und jetzt, marsch, zurück in das Zimmer.« Er wollte sie vor sich herschieben, aber sie leistete Widerstand.
Er packte ihr rechtes Handgelenk und streifte den Ärmel hoch. »Siehst du das da?«
In Taras Armbeuge klebte ein Pflaster. Der Mann riß es weg. »Das war die Spritze, mit der sie dich im Flugzeug ruhig gestellt haben. Also überleg’s dir.«
Tara starrte auf die rote Einstichstelle, die umgeben war von einem bläulichen Bluterguß. Ihre Wut fiel in sich zusammen; sie wurde schlagartig nüchtern. »Gangster«, sagte sie eisig, »ihr seid Gangster. Für wen arbeitet ihr?«
Die Männer wechselten einen Blick, und dann hielt der Lange ihr eine FBI Erkennungsmarke hin. »Sagt dir das was? Federal Bureau of Investigation. Ich bin Sergeant Finch und er ist Sergeant Heffner.«
Tara sah ihn verwirrt an. Bisher hatte alles darauf hingedeutet, daß die Entführer Kriminelle waren, vielleicht sogar Leute der Mafia, die im Dienst der Fillipis standen. Sie musterte die Männer voller Mißtrauen. »Zeigen Sie mir den Haftbefehl. Ohne Haftbefehl dürfen Sie mich nicht festhalten, das ist widerrechtlich, das ist gegen das Gesetz.«
»Hast du das gehört, Paul . . .« Sergeant Finch ließ sich in den Sessel fallen. »Eine Calese klärt uns darüber auf, was Gesetz und Recht ist. Ich lach’ mich krank.«
Sein Zynismus prallte an ihr ab. »Ohne Haftbefehl haben Sie kein Recht, mich festzuhalten. Ich will einen Anwalt und zwar sofort.« Sie wollte zu dem Telefon, das an der Wand neben der Tür hing, doch Sergeant Heffner packte sie unsanft an der Schulter. »Hände weg vom Telefon, Baby. Du brauchst keinen Anwalt – du brauchst Schutz, kapiert. Deswegen bist du hier, damit wir dich beschützen können.«
»Wovor beschützen? Was wollen Sie damit sagen?«
»Dich daran erinnern, daß du eine Calese bist, falls du das vergessen hast. Vielleicht hast du auch vergessen, daß du dir einen Paß mit falschem Namen beschafft hast und untergetaucht bist. Es war dir zu heiß geworden als eine Calese herumzulaufen, oder? Du hast verdammtes Glück gehabt, daß wir vom FBI dich aus dem Verkehr gezogen haben und nicht die Männer von Ugo Fillipi.«
Tara holte Luft. »Ugo Fillipi ist in New York?«
Die beiden Männer beobachteten mit Genugtuung, wie Tara bei der Erwähnung von Ugo Fillipi zusammenzuckte. Sergeant Heffner grinste. »Verstehst du jetzt, warum du Schutz brauchst? Es wäre schade um dich, wenn du wie deine Mutter enden würdest.«
Tara senkte den Kopf. Die Vorstellung, sie wäre Ugo Fillipi in die Hände gefallen, lähmte sie. Sergeant Finch griff nach den schwarzen Hanteln, die am Boden lagen. Er hob sie langsam über den Kopf und stieß dabei hörbar die Luft aus. Tara hatte plötzlich keine Kraft mehr, stumm wandte sie sich ab und kehrte in ihr Zimmer zurück.
Bevor Sergeant Heffner die Tür schloß, warf er Taras Tasche ins Zimmer. Beim Aufprall auf den Boden fiel ein Teil des Inhalts heraus und kollerte über den Teppich. Tara achtete nicht darauf. Sie setzte sich auf die Couch und starrte wie blind vor sich hin.
Ugo Fillipi war in New York.
Das hätte sie nie voraussehen können.
Und sie saß hier in einer FBI Wohnung.
Hatte das FBI auch ihren Vater verhaftet?
Ihre Gedanken bewegten sich im Kreis und kehrten immer wieder zu der Frage zurück: Was wußte das FBI? Hatten sie herausgefunden, daß ihr Vater verantwortlich war für die Explosion der Flamingo?Hielt man sie für mitschuldig? Ihr Verhalten sprach gegen sie. Das Verschwinden nach der Katastrophe, das Untertauchen in New York, der falsche Paß, die Reise nach Mexiko.
Warum war sie nicht in Mexiko geblieben. Dort wäre sie sicher gewesen. Oder gab es keinen Ort, wo eine Calese sicher war?
Wenn Ugo Fillipi sich in den Kopf gesetzt hatte, sie zu finden, war auch dieser FBI Unterschlupf keine Garantie für ihre Sicherheit.
Sie kniete sich auf den Boden und sammelte die Sachen ein: Kleingeld, ein paar Dollarscheine, ein Päckchen Kleenex, ein Lippenstift, die Brieftasche. Sie suchte den Paß, doch der Paß war nicht mehr da, den hatte das FBI konfisziert.
Ihr Versuch, als Tara Fisher unterzutauchen, war gescheitert.
Sie war wieder Tara Calese – und sie war eine Gefangene des FBI.
In der Brieftasche steckten ein paar Schnappschüsse, die sie im Sommer gemacht hatte: Das erste Bild zeigte Norman zu Pferd. Vor dem blaßroten Himmel waren Mann und Roß nur ein dunkler Schattenriß. Das zweite Bild hatte sie auf dem großen Gartenfest gemacht, das jedes Jahr am Geburtstag ihrer Großmutter Mariannina Calese in Sunset Hill veranstaltet wurde. Obwohl über Achtzig, tanzte die alte Dame immer noch für ihr Leben gern. Vor allem Tango, wie das Foto zeigte. Auf dem letzten Bild waren Normans Hunde zu sehen, das Ibizenco Pärchen, das in diesem Jahr Junge bekommen hatte. Die Jungen balgten tapsig miteinander, während die Eltern Fire und Flame ausgestreckt im Gras lagen. Im Hintergrund erkannte man die Terrasse von Sunset Hill; im Schatten des Säulenvorbaus stand der weißgedeckte Tisch bereit zum Abendessen; die Weinkaraffen funkelten im Licht. Jedes Bild erzählte von einem Moment des Glücks, einem Moment, den sie nie vergessen würde.
Sunset Hill. Das Haus lag auf sanften Hügeln, die sich am Ostufer des Hudson Rivers hinzogen. Der Park, der das Haus umgab, war so groß wie ein Wald und die Auffahrtsallee zum Haus eine halbe Meile lang.
Zu dem Besitz gehörten ein Jagdhaus, eine Bootshütte am Hudson River, Pferdeställe, Hundezwinger, ein Tennisplatz, ein Swimmingpool, der wie ein natürlicher See angelegt war und schließlich der Helicopter-Platz.
Das war die Welt, in der Tara geboren und aufgewachsen war. Sie hatte nie etwas anderes gekannt, und so war der Reichtum, der sie umgab, immer etwas Selbstverständliches für sie gewesen, so selbstverständlich wie die Tatsache, daß der Besitz, der an Sunset Hill angrenzte, den Vanderbilts gehörte.
Daß die Vanderbilts bereits Multimillionäre waren, als die italienische Einwandererfamilie Calese noch Mühe hatte, ihre fünf Kinder satt zu kriegen – von denen Massimo der Jüngste war –, gehörte einer grauen Vorzeit an, über die sich das Vergessen gesenkt hatte. Wenn doch die Rede darauf kam, tat man in Sunset Hill so, als könnte man sich daran nicht mehr recht erinnern. In Massimo Caleses Augen erschien dann ein ratloser Ausdruck – was diesen Mann mit dem ehrlichen Gesicht noch ehrlicher ausssehen ließ – und er murmelte: »Es ist so lange her. Die ersten zehn Jahre waren nicht einfach. Ich glaube, ich habe 21 Stunden am Tag gearbeitet. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, mit dreißig meine erste Million beisammen zu haben, und irgendwie hab’ ich’s geschafft. Danach ging alles von selber.« Die Story eines Mannes also, für den der vielgeträumte amerikanische Traum von Glück und Geld Wirklichkeit geworden war – nur leider behielt er die wahre Geschichte für sich und faßte sie mit einem ebenso vagen wie austauschbaren Satz zusammen: »Fleiß, Köpfchen und Glück, mehr braucht man nicht.«
Sonst war er alles andere als wortkarg. Eine Entenjagd konnte er so anschaulich schildern, daß man glaubte, das Knacken des Schilfs und das Hecheln der apportierenden Hunde zu hören. Und für Billardpartien reichte sein Gedächtnis viele Jahre zurück, und er hatte sogar den Punktestand gespeichert.
Massimo Calese war ein Unternehmer modernen Stils. Von seinem New Yorker Büro aus dirigierte er einen Konzern, zu dem Transportfirmen, Export-Importfirmen sowie eine Ladenkette mit mehr als tausend Niederlassungen gehörten. Bei der Führung des Unternehmens standen ihm zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe zur Seite. Angelo Calese, der älteste, führte das Büro in Los Angeles; Ed Calese, der jüngere, der in Harvard Jura studiert hatte, war in New York die rechte Hand des Vaters.
Massimo Calese aber hatte noch andere Ambitionen. Da gab es das Calese Gestüt, das er in einer »Anwandlung von katastrophalem Leichtsinn«, wie er es nannte, für seinen jüngsten Sohn, Tony Calese, finanziert hatte. Das Gestüt lag eine halbe Stunde nördlich von Sunset Hill, und Tony betrieb dort die Aufzucht von Polo Ponies und von Vollblütern. Bisher hatte das Gestüt mit den hochgesteckten Zielen nur Geld verschlungen. Massimo trug das mit Fassung. Der Gewinn lag in diesem Fall woanders. Durch das Gestüt hatten sich ihm und seiner Familie gesellschaftliche Kreise geöffnet, die ihnen vorher verschlossen gewesen waren.
Ein anderes ambitiöses Unternehmen war die Hudson River Stiftung, die er mit einem Grundkapital von dreißig Millionen ins Leben gerufen hatte. Ziel dieser Stiftung war es, den Hudson River, der die Hauptschlagader Nordamerikas war, vor den Umweltschäden, die seiner Pflanzen- und Tierwelt drohten, zu retten.
Die Reaktion der Öffentlichkeit auf diese Stiftung war überwältigend gewesen, und Massimo Calese war über Nacht so etwas wie ein Medienstar geworden. Sogar die Times hatte Massimo Calese einen Leitartikel gewidmet und ihn Retter des Hudson getauft.
Und wieder einmal hatte das ungeschriebene Gesetz der amerikanischen Gesellschaft funktioniert. Der sogenannte Geldadel, für den Massimo Calese vorher nicht existiert hatte, nahm den Mann, der die Hudson River Stiftung geschaffen hatte, mit offenen Armen auf und behandelte ihn, als hätte er schon immer dazu gehört.
Auch Tara war in den Sog dieser Entwicklung geraten. Vorher war sie für die Lehrer in der High School von Terrytown nur ein reiches Mädchen gewesen, das für Pferde mehr Interesse zeigte, als für die Schule. Durch die Stiftung des Vaters sah man ihre Tierliebe plötzlich in einem anderen Licht, nämlich als angeborene Naturverbundenheit, und man war stolz, eine Calese als Schülerin zu haben. Die Mitschüler reagierten noch direkter. Tara Calese wurde das Mädchen, dessen Freundschaft alle suchten. Dieser Umschwung hatte Tara zunächst verwirrt, doch als auf ihrer Schulbank eines Tages ein Sticker klebte, I love Calese, hatte sie einen naiven Stolz empfunden, den Namen Calese zu tragen – eine Calese zu sein.
Wie sorglos hatte sie gelebt, wie unbeschwert. War es wirklich Tara gewesen, die alle Zeitungsberichte über den Vater ausgeschnitten und gesammelt hatte? War sie es wirklich, die in stillen Stunden am Schreibtisch gesessen und ihren Namenszug geübt hatte, um dem Calese mehr Schwung zu geben?
Sie wünschte, die Zeit wäre damals stehengeblieben, und sie hätte den Tag nie erlebt, an dem sie von einer Stunde zur anderen erkennen mußte, daß sie in einer Welt voller Illusionen gelebt hatte – daß ihr Vater nicht der Mann war, für den sie ihn gehalten hatte.
Das Gestüt von Tony Calese
Donnerstag, 17. April 1980
»Zum Schluß, Ladies und Gentlemen, möchte ich Ihnen das Pferd zeigen, auf das ich persönlich die größten Hoffnungen setze, den Einjährigen Sergeant Pepper.« Tony Calese stand in der Mitte der Koppel. Etwas mehr als mittelgroß, schlank, muskulös, verkörperte er den Prototyp des Reiters. Als Züchter von Polo Ponies hatte er im Staate New York eine Monopolstellung, was Vollblüter betraf, war er ein Newcomer. Was ihm bisher fehlte, war ein Siegpferd. Würde es Sergeant Pepper sein?
Tara glaubte fest an die große Zukunft von Sergeant Pepper. Daß er etwas Besonderes war, hatte sich schon gezeigt, als er zur Welt gekommen war. Tara war dabei gewesen. Normalerweise hatten neugeborene Füllen Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Man mußte sie der Stute zum Trockenlecken hinschieben, man mußte ihnen zeigen, wo es die Milch gab. Nicht so Sergeant Pepper. Von der ersten Sekunde an war er vollkommen selbständig. Er besaß Unternehmungslust, Intelligenz, Unerschrockenheit und war für ein Pferd mit diesen Eigenschaften erstaunlich gutmütig. Nur wenn ihm etwas nicht paßte, wurde er eigensinnig. Tara konnte nur hoffen, daß ihn die Ansammlung von Menschen rund um die Koppel nicht störte, und daß der Stallbursche, der ihn vorführte, keinen Fehler machte. Sie wünschte, Tony hätte ihr diese Aufgabe übertragen. Ihr hatte Sergeant Pepper noch nie Schwierigkeiten gemacht.
Tara war mit Pferden aufgewachsen; als Fünfjährige hatte sie das erste Pony bekommen, mit zehn hatte sie bereits auf einem großen Pferd gesessen und zum Schrecken ihrer Mutter verkündet: »Ich werde Jockey.«
Rund um die Abzäunung drängten sich die geladenen Gäste. Es waren Rennstallbesitzer, Trainer, Jockeys. Männer, die auf den Rennplätzen erbittert gegeneinander kämpften, Männer, die sich bei Auktionen ohne Rücksicht auf Verluste die interessanten Pferde wegschnappten. Im Moment allerdings ruhten die Feindseligkeiten. Während sie auf Sergeant Pepper warteten, diskutierten sie das bevorstehende Old Glory Sale. Das war die große Auktion von Vollblütern, die am Wochenende im Yonkers Raceway stattfinden würde.
Einige dieser Männer kannte Tara, die anderen – und das war die Mehrzahl – sah sie zum erstenmal bei einer Pferdeschau auf Tonys Gestüt. Woher kam plötzlich dieses allgemeine Interesse? Die Antwort war einfach: Schon vor Wochen hatte Tony das Gerücht in Umlauf gesetzt, der sagenumwobene ägyptische Rennstallbesitzer Sheik Nessir – er besaß nicht weniger als 500 Rennpferde – interessiere sich für Sergeant Pepper. Gerüchte dieser Art waren im Rennsport an der Tagesordnung und meistens lösten sie sich in Luft auf. Nicht in diesem Fall. Tony hatte nicht gepokert. Gestern abend war Sheik Nessir in den Sportnachrichten des Fernsehens als Interviewgast aufgetreten, ein kompakt gebauter Mann in einem englischen Maßanzug mit fleischigem Gesicht und orientalischen Augen, der in Oxford studiert und dem die englische Königin für seine Verdienste um den englischen Rennsport den Titel Sir verliehen hatte. Ja, er würde beim Old Glory Sale mitbieten, Rennpferde wären nun einmal seine Leidenschaft. Ein Hobby neben den Pferden? Nein, das gäbe es nicht in seinem Leben. Ob er bereits Kontakte zu amerikanischen Züchtern hätte? Ja, er würde morgen das Gestüt von Tony Calese besuchen.
Das hatte eingeschlagen wie eine Bombe. Deswegen waren all die Leute hier; die Neugier hatte sie hergetrieben. Tara entging nicht, daß die Blicke der Anwesenden immer wieder in die Richtung wanderten, wo, umringt vom Calese Clan, Sheik Nessir stand. Er trug einen Kamelhaarmantel und einen weichen Hut und wirkte seltsam städtisch unter den anderen, die alle sportlich gekleidet waren.
Der Apriltag war wolkenlos, kalt und windig; jetzt, gegen Abend, frischte der Wind noch mehr auf und fegte in Böen über das flache Gelände.
Aus Gesprächsfetzen entnahm Tara, daß die anderen Rennstallbesitzer befürchteten, Nessir würde die Preise hochtreiben. Es fielen Worte wie Rennsport-Mafia, Schiebung und internationales Wettsyndikat. Galten die Vorwürfe Nessir? Galten sie ihrer Familie? Sie hatte keine Zeit, darüber zu grübeln, denn eine Hand legte sich auf ihre Schulter und eine vertraute Stimme sagte: »Tara, fast hätte ich dich nicht erkannt in deinem Jockeyblazer.«
»Dennis, was tust du hier?«
»Ich habe heute das neue Auto bekommen und wollte es dir zeigen.«
»Den Excalibur?«
»Die perfekte Kopie vom Mercedes Kabrio 1937. Die Mädchen werden Schlange stehen für eine Spazierfahrt – aber du sollst es als erste sehen. Komm . . .« Er wollte sie mit sich ziehen, aber sie schüttelte den Kopf. »Jetzt geht’s nicht.«
»Komm schon, Pferde hast du jeden Tag.«
»Sergeant Pepper ist jetzt an der Reihe.«
»Für mich ist ein Pferd wie das andere.«
»Siehst du da drüben den Mann im Kamelhaarmantel, das ist Sheik Nessir, der größte Rennstallbesitzer der Welt, er ist eigens wegen Sergeant Pepper nach Amerika geflogen. Ich muß sehen, wie er auf das Pferd reagiert. Es dauert nur ein paar Minuten.«
»Die paar Minuten kenne ich. Dann ist es dunkel. Du mußt den Wagen bei Tageslicht sehen. Rot wie die Feuerwehr.«
»Warum hast du nicht vorher angerufen?«
»Habe ich. Hat deine Mutter dir nichts ausgerichtet?«
»Nein.«
»Das ist jetzt schon das dritte Mal. Sie hat was gegen mich.«
»Sie hat es vergessen.«
»Nein, nein, sie tut es mit Absicht. Sie ist anders zu mir als früher.«
»Das bildest du dir ein.«
»Und du bist auch anders. Ich mach’ den ganzen Weg von Harvard hierher, und du . . .« Dennis verstummte. Es war zwecklos. Tara hörte ihm nicht mehr zu. Tony Calese hatte die Hand gehoben, und der Stallbursche setzte sich mit Sergeant Pepper in Bewegung. Dennis Lloyd blieb nur noch eine Geste stummen Protests. Er stellte sich mit dem Rücken zur Koppel und zündete sich eine Zigarette an. Aber auch damit beeindruckte er Tara nicht. Im Moment existierte er überhaupt nicht für sie. Gebannt blickte sie auf das Pferd.
Dennis Lloyd war der einzige Sohn des Multimillionärs Meredith Lloyd, dessen Haus am jenseitigen Ufer des Hudson, genau gegenüber von Sunset Hill, lag. Es war ein großer Besitz, jede Menge Personal. Was fehlte, war die Frau im Haus. Dennis’ Mutter war eines Tages mit einem unentdeckten Genie – einem Lyriker – verschwunden, und vagabundierte seither mit diesem Mann durch die Welt.
Die Wärme, die Dennis zu Hause entbehrte, hatte er in Sunset Hill gefunden, im Kreise der Familie Calese. Aber das Wichtigste an Sunset Hill war für ihn Tara. Sie wurde die Schwester, die er sich von klein auf gewünscht hatte, ein Mädchen, das jünger und schwächer war als er, das er beschützen, dem er imponieren konnte. In Taras Nähe hatte er schon mit vierzehn das Gefühl gehabt, ein richtiger Mann zu sein. Inzwischen war er zwanzig und aus der brüderlichen Zuneigung war Liebe geworden. Als er das bemerkte, war er zuerst erschreckt gewesen, dann hatte er sich vehement dagegen gewehrt. Tara war sechs Jahre jünger als er, sie war noch ein Kind, außerdem katholisch und streng behütet. Selbst wenn sie seine Liebe erwidern sollte, würden Taras Eltern eine Wartezeit erzwingen. Aus diesen Gründen und als eifriger Student von allen möglichen Sexualkunde-Büchern hatte er sich vorgenommen, diese aussichtslose Liebe durch ein intensives Sexleben auszutreiben. Die Voraussetzungen in Harvard schienen gut, Mädchen gab es in Hülle und Fülle, der Haken war nur: diese Zwanzigjährigen waren keine Mädchen mehr. Sie waren richtige Frauen und schüchterten den unerfahrenen Dennis so ein, daß alle seine Dates in einem Fiasko endeten. Nach einem Jahr vergeblicher Anläufe hatte er es aufgegeben. Zum Teufel mit Kinsey und den Sex-Aposteln, er wollte das Mädchen, das er liebte. Er wollte Tara. Und so kam er jeden Augenblick von Harvard herüber, um Tara zu sehen. Vor einem Monat hatte er sie ohne Erlaubnis der Eltern nach New York entführt, und sie hatten bis zwei Uhr morgens in einer Disco getanzt. Natürlich hatte es eine Szene gegeben, und natürlich hatte er sich entschuldigt. War es möglich, daß Taras Mutter ihm das noch immer nachtrug? Oder ahnte sie instinktiv, wie es um ihn stand, und sah in ihm eine Gefahr für Tara? Dennis sah sie jenseits der Koppel stehen, neben ihr Massimo. Sie trug einen grünen Lodenmantel und darüber ein rotes Cashmeretuch, das sie fröstelnd über der Brust zusammenhielt. Der Wind spielte mit ihrer blonden Mähne. Ein merkwürdiges Paar, dachte Dennis, die junge schöne Diana und der sechzigjährige Massimo. Und dann fragte er sich, ob das auch Taras Schicksal sein würde, die Frau eines alten Mannes zu werden. War es das, was die Eltern mit Tara vorhatten? Der Gedanke traf ihn wie eine Erleuchtung und gab seiner Liebe zu Tara eine neue Dimension: Er war vom Schicksal dazu ausersehen, ihr Retter zu sein, und bei Gott, nichts sollte ihn davon abhalten.
Er warf die kaum angerauchte Zigarette zu Boden und trat sie aus. Dann legte er den Arm um Taras Schultern und sagte leise und bittend: »Komm mit mir, Tara.«
Sie wandte nicht einmal den Kopf, sondern deutete zum Eingang der Koppel, wo der Stallbursche mit Sergeant Pepper stand. »Warum führt er ihn nicht herein«, murmelte sie, »worauf wartet er bloß?«
Dennis versuchte es noch einmal: »Bitte, Tara, laß uns verschwinden.« Es war, als spräche er gegen eine Wand. Tara starrte zu dem Pferd. »Da stimmt was nicht . . .«
Tony machte ein ungeduldiges Zeichen, doch die Antwort des Stallburschen war ein ratloses Schulterzucken. Sergeant Pepper verwirrt durch die Zuschauer, weigerte sich, die Koppel zu betreten. Gewalt anzuwenden war riskant. Vorläufig leistete das Pferd nur friedlich Widerstand, im nächsten Moment konnte Panik daraus werden, es konnte sich losreißen und durchgehen.
Tony versuchte die Situation mit einem Scherz zu überbrücken: »Sergeant Pepper hat Lampenfieber . . . Kein Wunder bei diesem Publikum . . .«
Sergeant Pepper rührte sich nicht vom Fleck. Seitlich von der sinkenden Sonne angestrahlt, die Glanzlichter auf sein dunkles Fell setzte, glich er einer Statue aus Bronze.
Die Zuschauer warteten halb neugierig, halb schadenfroh. Die Mitglieder der Calese Familie wechselten alarmierte Blicke. Massimo grub die Hände in die Taschen seines Dufflecoats, Ed zündete sich eine Zigarette an, Rico biß auf seinem Kaugummi herum.
Tony wußte nicht, was er tun sollte. Mußte er eingreifen und das Pferd selber vorführen? Und wenn es bei der Verweigerung blieb? Tony stand unschlüssig in der Mitte der Koppel. Wie alle Calese Männer hatte er eine energische Kinnpartie und einen kräftigen Nacken; in Momenten der Bedrängnis nahmen sie unwillkürlich die Schultern leicht nach vorne, wodurch eine Haltung entstand, die an einen gereizten Stier erinnerte.
Die Sekunden dehnten sich. Tara wußte, wenn nicht sofort etwas geschähe, wäre es zu spät. Sie begegnete Tonys hilfesuchendem Blick. Das war alles, was sie gebraucht hatte. Sie eilte zu dem Stallburschen und nahm ihm entschlossen das Halfter aus der Hand. Dann trat sie dicht an Sergeant Pepper heran und redete leise auf ihn ein. Es dauerte nicht lange, und vor aller Augen ging eine Verwandlung mit dem Pferd vor sich; die Starre fiel von ihm ab, es lockerte sich, eine Bewegung mit dem Schweif, ein leichtes Schütteln der Mähne, ein gutgelauntes Einziehen der Nüstern.
Tara tätschelte zärtlich seinen Hals. »Was ist, wollen wir?« Und Sergeant Pepper spazierte lammfromm in die Koppel.
Tony atmete sichtbar auf. Bevor er die Koppel verließ, blickte er in die Runde: »Hier also Sergeant Pepper, der dank Tara« – eine galante Verbeugung zu seiner Halbschwester – »das Lampenfieber überwunden hat.«
Ein Murmeln der Anerkennung, vom Calese Clan sogar Applaus. Tara dankte mit einem Lächeln. Die vielen Augen, die an ihr hingen, verwirrten sie nicht, im Gegenteil, sie mochte das. Sie war daran gewöhnt zu gefallen. Zu Hause, auf der High School, wo immer sie hinkam, tauchte sie in ein Bad von Blicken, die ihr sagten: »Du bist schön, Mädchen.«
Sie war groß für ihr Alter, aber alles andere als ein aufgeschossenes, halbfertiges Ding. Schmal und hochbeinig bewegte sie sich mit der grazilen Eleganz einer Gazelle. Über ihrem ebenmäßigen Gesicht lag noch der ganze Schmelz der Jugend und gleichzeitig der geheimnisvolle Zauber des Versprechens, daß sie in naher Zukunft noch schöner, noch vollkommener sein würde.
Sie trug alte Reitstiefel, verwaschene Jeans und den goldfarbenen Jockeyblazer, den sie William O’Donnel nach seinem letzten Trabrennsieg abgebettelt hatte. Die Kleidung bildete einen seltsamen Kontrast und ließ ahnen, daß in dem Mädchen mit dem Gazellenkörper das furchtlose Herz einer Amazone schlug.
Dennis verfolgte die Szene mit düsterer Miene. Tara war ihm nie schöner erschienen, nie begehrenswerter.
Tara hatte den Rundgang beendet und führte Sergeant Pepper in die Mitte der Koppel. Die sinkende Sonne hatte die Farbe von Champagner und hüllte das Pferd in eine Gloriole von Licht. Er war ein Brauner mit entschiedener schwarzer Färbung der Beine, des Schweifs, der Mähne, der Stirnhaare und der Nüstern. Er war eines jener seltenen Pferde ohne irgendein weißes Abzeichen. Die großen, klaren Augen hatten einen lebhaften Ausdruck. Der Kontrast von breiter Stirn und schmalem Gesicht war von dramatischer Schönheit.
Sie waren ein schönes Paar, das Mädchen und das Pferd. Tara trug das lange dunkle Haar offen, und der Wind vermischte es mit Sergeant Peppers dunkler Mähne.
Tara begegnete dem Blick von Dennis – und stutzte. Sie hatte wohl bemerkt, daß er in den letzten Monaten anders war als früher, aber sie hatte sich keine Gedanken darüber gemacht. Jetzt plötzlich begriff sie: Er ist verliebt in mich. Kein Zweifel. Dieser komische Blick, diese Hingerissenheit, diese Unterwürfigkeit. Dennis war ein hübscher Junge. Er hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit James Dean, und er steckte voller überraschender Ideen. Er war der erste Drachenflieger am Hudson gewesen, jetzt liebäugelte er mit einem Segelflugzeug. Und sein neues Motorboot flog wie ein Pfeil quer über den Hudson. Sie mochte ihn, er war für sie wie ein Bruder, aber sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, daß daraus Liebe werden würde. Herzklopfen bekam sie, wenn sie an einen anderen dachte. Der Mann ihrer Träume war Norman.
Als wäre sie ganz allein mit dem Pferd, küßte sie Sergeant Pepper aufs Maul. »Komm, wir gehen.«
Dennis eilte ihr nach und holte sie auf halbem Weg zu den Ställen ein. »Gib das Pferd einem Stalljungen und komm mit mir.«
Tara blieb stehen. Sein Ton hatte etwas Zwingendes, sein Gesicht war angespannt vor Entschlossenheit. Sie strich ihm das dunkelblonde Haar aus der Stirn, und diese kleine gedankenlose Geste verwirrte ihn so, daß er wie gelähmt dastand.
Tara deutete seine Reaktion falsch. »Sauer?«
»Überhaupt nicht. Komm jetzt.«
Sie lächelte. »Wenn du sauer bist, siehst du wirklich aus wie James Dean.«
Dennis biß sich auf die Lippen. Mit sechzehn war er stolz gewesen auf die Ähnlichkeit mit dem Filmstar, jetzt mit zwanzig erinnerte ihn Taras Bemerkung nur an seine Körpergröße, die der von James Dean leider nur allzusehr glich, auch er war ein bißchen zu klein. Schnell faßte er Taras Arm. »Gleich werden deine Eltern auftauchen, laß uns vorher verschwinden.« Im selben Moment hörte er hinter sich Massimos Stimme; das nächste war ein Schlag auf die Schulter. »Dennis, na so was, seit wann interessierst du dich für Pferde? Das ist ja ganz was Neues. Oder hat dich die Sehnsucht nach echten Calese Spaghetti hergetrieben? Du kommst doch mit uns.« Auch Diana trat hinzu, und Dennis reichte ihr die Hand. Sie erwiderte den Gruß kühl. Unter ihrem Blick verließ ihn seine Entschlossenheit und er murmelte: »Tut mir leid, ich muß gehen, ich habe eine Verabredung in New York.«
»Dennis . . .«, rief Tara ihm nach, aber er ging weg, ohne sich noch einmal umzudrehen. Diese Runde habe ich verloren, sagte er sich voller Ingrimm. Das nächste Mal wird es anders sein.
»Eigentlich schade, den Wagen wegzugeben«, Massimo Calese fuhr streichelnd über das graue Elefantenleder des Rolls-Royce, »jetzt wo die Polster so richtig eingesessen sind.«
Sie waren auf der Heimfahrt nach Sunset Hill. Massimo und Diana saßen im Fond, Tara vorne beim Chauffeur; sie achtete nicht auf die halblaute Unterhaltung der Eltern, sie hing den eigenen Gedanken nach.
Tara wäre gerne länger geblieben unter all den interessanten Leuten, die sie ganz wie ihresgleichen behandelt hatten.
Mit halbgeschlossenen Augen lehnte sie im Ledersitz, eingehüllt in das angenehme Gefühl, auf Männer beunruhigend zu wirken, selbst auf einen Orientalen wie diesen Nessir, mit seinen melancholischen Augen und dem übersättigten Zug um den Mund. Sie fühlte sich als Beobachterin, aufmerksam, aber ziemlich gleichgültig. Sicher würde sich das irgendwann ändern, vielleicht schon bald. Eine leise Stimme in ihr murmelte einen Namen – Norman . . .
Das Gespräch der Eltern war versickert. Massimos Arm lag um Dianas Schultern; ihre Nähe, der Duft, der aus ihrem blonden Haar aufstieg, genügte, um ihn mit einer tiefen Zufriedenheit zu erfüllen.
Mit siebzehn war Diana seine Frau geworden, mit achtzehn hatte sie Tara geboren. Für den verwitweten Massimo hatte durch Diana das Leben neu begonnen, und er war noch einmal jung geworden. Mit dem klaren Blick für die Realität, der ihn auszeichnete, wußte er, ein so großer Altersunterschied war riskant. Irgendwann würde ein jüngerer Mann versuchen, ihm Diana wegzunehmen. Wer weiß, vielleicht war er schon da.
Der Gedanke machte Massimo Calese keine Angst. In seinem Leben gab es schlummernde Gefahren, die bedrohlicher waren, die nicht nur sein privates Glück betrafen, die alles, was er aufgebaut hatte, mit einem Schlag vernichten könnten. Vorläufig schlummerten diese Gefahren, und wenn keiner sie weckte, würden sie auch weiterschlummern.
Diana hustete. Die trockene Luft im Wagen reizte ihre Kehle. Massimo tippte dem Chauffeur auf die Schulter. »Schalten Sie bitte die Ventilation aus.« Dann öffnete er die Bar, die zwischen den hinteren Sitzen eingebaut war und fragte Diana: »Einen Cognac, oder einen Gin Tonic?«
Diana lockerte das rote Cashmeretuch, das sie um den Hals gewickelt hatte. »Nur Wasser.«
Massimo füllte einen Silberbecher mit Mineralwasser und hielt ihn ihr hin. »Besser, du wärst zu Hause geblieben. Dieser eisige Wind war nichts für dich. Ich werde Dr. Bennion anrufen. Er soll vorbeischauen.«
Diana hatte im Seitenfach der offenen Bar eine grüne Aspirinschachtel erspäht und griff danach. »Ich schlucke jetzt zwei Aspirin und zu Hause nehme ich ein heißes Bad. Dr. Bennion brauche ich nicht.«
»Sei vernünftig. Dr. Bennion gibt dir eine Spritze, und die Sache hat sich. Wir haben die nächsten Tage viel vor. Eine Premiere in der Met, das Essen für die Mitarbeiter der Hudson River Foundation und die Party bei Anne Getty.« Er machte eine kleine Pause und fuhr mit plötzlich veränderter Stimme fort: »Norman Reed wäre untröstlich, wenn du auf der Party fehltest.«
Diana stellte den Silberbecher zurück und lachte leise. »Eifersüchtig?«
Massimo senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Nur wachsam, mein Engel, nur wachsam. Schließlich hat Norman Reed sich neuerdings sogar auf Tonys Gestüt einquartiert.«
»Weil er in seinem nächsten Film einen Polo Champion spielt und Tony mit ihm trainiert.«
Norman Reed. Trotz der leisen Stimmen war der Name zu Tara gedrungen. Sie hatte plötzlich Ameisen in der Magengrube und ließ sich unwillkürlich tiefer in den Sitz gleiten. Seit einer Woche, seit er mit den Polopferden trainierte, lebte er praktisch auf Tonys Gestüt, und vor zwei Tagen nun, als Tara ihr Pferd zum Ausreiten sattelte, hatte er sie gefragt, ob er sie begleiten dürfte, er würde gerne die Gegend etwas besser kennenlernen.
Tara hatte den Eltern von diesem Ausritt nichts erzählt. Die zwei Stunden zu Pferd mit Norman Reed an ihrer Seite waren ein Geheimnis.
Der Wagen hatte die Hauptstraße verlassen und fuhr durch Laubwald. Das junge Grün der Buchen und Birken fluoreszierte im violetten Blau der Dämmerung. Bald würde die Einfahrt von Sunset Hill auftauchen.
»Was meinst du«, fragte Diana ihren Mann, »hätten wir Nessir zum Abendessen einladen sollen?«
»Ich dachte auch daran, aber Angelo hatte schon ein Programm gemacht. Er ißt mit Nessir in New York zu Abend, und dann stürzen sich die beiden ins Vergnügen. Wie ich Angelo kenne, wird es eine lange Nacht werden, und ich kann mir vorstellen . . .« Er führte den Satz nicht zu Ende. Der Lebenswandel von Angelo war nicht gerade ein Thema, das ihm für Taras Ohren geeignet schien. Massimo richtete sich auf und tippte Tara leise auf die Schulter. »Kannst du mir verraten, warum Dennis so plötzlich weggerannt ist?«
»Schätze, er war sauer.«
»Habt ihr gestritten? Wie ich ihn kenne, wäre er doch sicher gerne zum Abendessen nach Sunset Hill gekommen.«
Diana unterdrückte einen Hustenreiz und stellte dann fest: »So wie ich die Sache sehe, ist er in Tara verliebt. Deswegen kommt er jeden Augenblick von Harvard herüber.«
»Er wollte mir das neue Auto zeigen, einen Excalibur.«
»Ein Vorwand . . . Ich glaube Massimo, du solltest mal ein ernstes Wort mit ihm reden. Tara ist schließlich erst vierzehn.«
Tara schnellte im Sitz hoch. »Aber ich sehe wie sechzehn aus.« Und bevor die Mutter etwas erwidern konnte, stellte sie die überraschende Frage: »Ich wüßte zu gerne, ob Nessir einen Harem hat.«
Massimo wandte sich schmunzelnd an seine Frau. »Hast du das gehört, Diana, unsere Tochter will wissen, ob Nessir einen Harem hat.«
»Es interessiert mich einfach. Er ist doch Moslem, oder?«
Massimo zuckte die Achseln und versuchte sich herauszuwinden. »Ich würde sagen, der Harem von Nessir, das sind seine Pferde.«
Das Ablenkungsmanöver klappte nicht. »Aber er ist doch Orientale, und die haben nun mal Harems.«
»Schon . . .«
Tara ließ nicht locker. »Wieso haben die Orientalen eigentlich so was?«
»Ganz einfach«, Massimo zögerte, um nichts Dummes zu sagen. »Der Orientale spielt gern den Pascha, und dazu braucht er einen Harem mit jungen hübschen Sklavinnen, die alles tun, was er will.«
Eine Stille folgte, dann kam Dianas Stimme: »Du siehst, Tara, es ist ganz ähnlich wie bei den Caleses.«
Massimo hob protestierend die Hände. »O nein, bei den Caleses ist es genau umgekehrt, die Frauen regieren und die Männer sind die Sklaven. Schaut nur euch beide an – mein Leben besteht daraus, euch zu dienen, jeden eurer Wünsche zu erfüllen.«
Diana und Tara lachten, während Massimo ernst fortfuhr: »Oder nehmt Großmutter Mariannina. Ist sie nicht die Königin der Familie und sind nicht alle Calese Männer ihr untertan? Habt ihr je erlebt, daß ich ihr widersprochen habe? Was immer sie sagt, ist Gottes Wort, ich beuge das Knie und gehorche. Und es ist gut so, denn die Frauen sind das Licht der Welt.« Mit übermütigem Zwinkern in den Augen wandte er sich an seine Frau. »Diana, mein Engel, du darfst mich an meine Worte erinnern, falls du in meinem Verhalten einen Widerspruch entdecken solltest.«
Sie küßte ihn leicht auf die Wange. »Das werde ich, verlaß dich drauf.«
Rechts tauchten die Lichter der Einfahrt auf, dann das Pförtnerhaus, weiß mit grünen Läden. Langsam fuhr der Wagen darauf zu und der Chauffeur drückte den Knopf, der den elektronischen Mechanismus in Bewegung setzte und so das Tor öffnete; gleichzeitig wurde im Haus ein Signal ausgelöst, so daß Hillary, der schwarze Butler auf Sunset Hill, sich bereitmachen konnte zum Empfang.
Der Wagen glitt durch die Allee: Die Bäume waren zu Beginn des Jahrhunderts gepflanzt worden; im Laufe der Zeit hatten die Kronen sich zu einem Gewölbe verschlungen, so daß im Sommer, wenn die Bäume dicht belaubt waren, nicht einmal Regen durchdrang. Massimo blickte auf die Uhr. In ein paar Minuten begannen die Sportnachrichten. Ein Glas Cognac, ein spannendes Baseballspiel und später ein einfaches italienisches Essen – er hatte Lust auf Penne all’ arrabbiata –, es würde ein gemütlicher Abend werden.
Am Ende der Allee wurde das erleuchtete Haus sichtbar. Auf dem Vorplatz standen mehrere Wagen; sie parkten kreuz und quer durcheinander. Ein grauer Kastenwagen verbarrikadierte die Haustür, so daß der Chauffeur entschuldigend meinte: »Tut mir leid, Sir, ich kann nicht näher ran, ich muß Sie hier rauslassen.«
Massimo blickte nach draußen. »Das sieht nach einer Party aus, Tara, hast du vielleicht deine Klasse eingeladen und vergessen, es uns zu sagen?« Es sollte scherzhaft klingen, doch während Massimo sprach, überfiel ihn eine böse Ahnung.
Früher, solange die heranwachsenden Söhne auf Sunset Hill lebten, waren improvisierte Parties keine Seltenheit gewesen; jetzt machte nur noch. Tony solche Überfälle, wenn er mit einer Gruppe ausländischer Gäste oder mit Freunden zum Abendessen hereinplatzte. Aber Tony war auf seinem Gestüt . . .
Massimo Calese gab sich einen Ruck, sprang aus dem Wagen und eilte zum Haus.
Wo war Hillary, zum Teufel. Mit unwilligem Kopfschütteln betrat Massimo Calese das Haus.
»Hillary . . .« Auch im Entrée kein Hillary.
Aus dem Innern des Hauses kamen Geräusche, Schritte, Türenschlagen, Männerstimmen. Massimo stieß die Flügeltür zur Halle auf. »Hillary . . .«
Das gedämpfte Licht, der schimmernde Marmorboden, die große Palme, die Schattenmuster auf die hellgraue Wand warf, alles war wie immer, nur die Geräusche stimmten nicht. Und noch etwas, der Geruch. War es kalter Zigarettenrauch? War es ausgelaufenes Bier?
»Hillary . . .«
Da stand er ja, neben dem Zeitungstisch, schmal, groß, mit dem wohlgeformten Kopf und dem kurzgeschnittenen Kraushaar.
»Hillary . . .«
Was war nur los mit ihm? War er taub? Warum reagierte er nicht? Warum kehrte er Massimo beharrlich den Rücken zu?
Massimo Calese durchquerte die Halle. »Was ist los mit Ihnen, Hillary?«
Der Mann drehte sich um. Es war nicht Hillary. Massimo Calese hatte den Mann nie zuvor gesehen. Er trug einen dunkelblauen Anzug und einen rosa Pullover. Er hatte eine Zigarette im Mundwinkel und hantierte mit einem Jagdgewehr.
Massimo starrte ihn an. Was geht hier vor, dachte er. Wie kommt dieser Mann hierher und wie kommt mein Jagdgewehr in seine Hände?
Ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen, sagte der Mann: »Schöne Waffe. Was schießen Sie damit, Hasen, Enten . . .«
Massimo war wie vor den Kopf geschlagen. »Wie kommen Sie dazu . . .«, stieß er hervor. Wer immer dieser Fremde war, wie ein Einbrecher benahm er sich nicht. Die Ruhe, mit der er Massimo musterte, machte eher ihn selber zu einem Eindringling.
Massimo wollte dem Mann das Jagdgewehr wegnehmen, doch der trat einen Schritt zurück und wies mit dem Kopf zur Bibliothek, deren Tür offen stand. »Wenn Sie Fragen haben, versuchen Sie es dort.«
Irgendwo im oberen Stockwerk fiel etwas polternd zu Boden. Auch aus dem Keller drang Rumoren. Das ganze Haus ist voller fremder Menschen, dachte Massimo, und etwas wie eine Lähmung erfaßte sein Denken.
Als er die Bibliothek betrat, stockte ihm der Atem. Seine geliebte Bibliothek, dieser Ort der Ruhe und des Friedens, bot ein Bild der Zerstörung. Die Schränke waren ausgeräumt, die Bücher lagen am Boden verstreut, die Zeitschriften bildeten einen wilden Haufen.
Am Schreibtisch vor dem Fenster saß ein Mann in Hemd und Weste. In aller Gemütsruhe kramte er in den offenen Schubladen und warf immer wieder ein Schriftstück in den grauen Metallcontainer, der neben ihm auf dem Boden stand.
»Was geht hier vor«, hörte Massimo sich fragen und erschrak über seine eigene Stimme.
Der Mann am Schreibtisch hob den Kopf. »Ist das nicht klar? Wir schauen uns ein bißchen um bei Ihnen, Calese.« Er hatte eine randlose Brille mit dickgeschliffenen Gläsern auf der Nase.
Massimo rang nach Luft. »Raus hier«, schrie er heiser und machte eine Bewegung, als wollte er sich auf den Mann stürzen. Im gleichen Moment zog der einen Revolver. »FBI, wir tun nur unsere Arbeit.«
»FBI . . .«, murmelte Massimo. Sekunden verstrichen, bis er begriff.
Auf dem Gesicht des Mannes erschien ein schiefes Lächeln. »Sie haben uns lange genug ausgetrickst, Calese, Sie sind so verdammt schlau gewesen, daß wir immer das Nachsehen hatten, aber wie das beim Pokern so ist, jetzt sind wir am Zug.«
Massimo schwieg; mit seiner Gestalt ging eine Veränderung vor. Er schien breiter zu werden, schwerfälliger, der Kopf verschwand zwischen den breiten Schultern, und als er sprach, klang seine Stimme dumpf und breiig. »Für das, was Sie hier tun, brauchen Sie einen Hausdurchsuchungsbefehl.«
»O. k.« Der Mann griff in die Jacke, die über der Stuhllehne hing und holte ein zusammengefaltetes Schriftstück heraus. »Bitte – und falls es Sie interessiert, ich bin Lieutenant Neimark vom Drogendezernat.«
Massimo Calese nahm das Papier und trat näher an die Schreibtischlampe. Der Hausdurchsuchungsbefehl war vom General Attorney des Staates New York ausgestellt. Unterschrieben hatte allerdings nur Untersuchungsrichter Merris; die Unterschrift von General Attorney Chris Shannendy fehlte. Massimo Calese holte Luft. Offensichtlich eine Blitzaktion, dachte er. Das war die neue Masche beim FBI. Es gab eine junge Generation von Beamten, die ein unglaubliches Tempo vorlegten, unbekümmert, ob ihre Methoden ganz legal waren oder nicht. Massimo brauchte das Papier als Beweisstück. Freiwillig würde Lieutenant Neimark es ihm nicht überlassen. Er zwang sich zur Ruhe. »Tut mir leid, Lieutenant«, begann er, »der Befehl, den Sie mir da zeigen, ist nicht rechtskräftig.«
Lieutenant Neimark stieß den Stuhl zurück und stand auf. »Geben Sie her.«
Massimo ließ das Papier auf den Schreibtisch flattern. »Die Unterschrift von General Attorney Chris Shannendy fehlt.« Er griff zum Telefon. »Ich muß mit meinem Anwalt sprechen.« Er begann zu wählen, doch Lieutenant Neimark war mit zwei Schritten neben ihm, legte schnell die Hand auf die Gabel. »Hier wird nicht telefoniert.«
Was dann geschah, war die Sache von Sekunden. Massimo Calese versetzte Lieutenant Neimark einen Stoß von solcher Wucht, daß dieser das Gleichgewicht verlor, auf dem gebohnerten Parkett ausglitt und stürzte. Der Augenblick genügte Massimo, um den Hausdurchsuchungsbefehl in der Innentasche der Jacke verschwinden zu lassen. Die Auseinandersetzung zwischen Lieutenant Neimark und Massimo hatte zwei FBI Männer alarmiert. Sie warfen sich auf Massimo Calese. Der eine schlug ihm den Telefonhörer aus der Hand, der andere drückte ihm einen Revolver in den Rücken.
»Loslassen«, schrie Massimo.
Lieutenant Neimark hatte sich aufgerappelt und rieb sich den verstauchten Unterarm. »Ab mit ihm«, befahl er seinen Männern. »Sperrt ihn zu den anderen.«
Massimo Calese protestierte. »Sie haben kein Recht«, schrie er, »lassen Sie mich los, oder . . .« Er verstummte. Aus der Halle kam die Stimme von Diana. Sie rief seinen Namen. »Massimo . . .« Es klang schrill. »Massimo . . .«
Massimo versuchte, sich loszureißen. »Lassen Sie gefälligst meine Frau in Ruhe.«
»Ab mit ihm«, wiederholte Lieutenant Neimark, und die Beamten schoben Massimo Calese energisch aus der Bibliothek in die Halle.
»Massimo . . .« Diana stand mit Tara in der Mitte der Halle, neben ihnen zwei Beamte und der Schwarze, der immer noch das Jagdgewehr in den Händen hielt. Diana rannte auf ihren Mann zu. »Was ist hier los?«
Massimo sah die Panik in ihren Augen. Irgendwie mußte es ihm gelingen, ihr das Gefühl zu geben, daß er nach wie vor Herr der Lage war. »Beruhige dich . . .«, begann er.
»Ist das eine Hausdurchsuchung?« fiel sie ihm ins Wort.
»Ja – aber ohne rechtskräftigen Befehl. Alles wird sich aufklären, glaub mir.« Er blickte zu Tara. Sie stand neben dem Schwarzen, blaß bis in die Lippen, mit angstgeweiteten Augen.
»Los, vorwärts«, befahl Lieutenant Neimark. »Bringt sie zu den anderen.«
Tara begriff nichts von dem, was um sie herum geschah. »Vorwärts«, sagte eine Männerstimme, und eine Hand umfaßte hart ihren Oberarm. Sie setzte Fuß vor Fuß. Überall standen Türen offen, überall waren fremde Männer dabei, Schränke auszuräumen und den Inhalt auf den Boden zu werfen.
Eine Hausdurchsuchung. Das FBI. Aber was suchte das FBI im Speisezimmer, im Office, in der Küche?
Einen Meter vor ihr ging ihr Vater, eingekeilt zwischen zwei FBI Beamten. Er bewegte sich seltsam steif. Einer der Beamten hielt eine Waffe gegen den Rücken des Vaters gedrückt.
Sie saßen um den rechteckigen Tisch, an dem sonst die Angestellten von Sunset Hill die Mahlzeiten einnahmen. Entlang den Wänden, die in einem sanften Pastellgrün gestrichen waren, standen dicht zusammengerückt die Stühle und Beistelltische, die man nur bei großen Einladungen brauchte. Die grelle Beleuchtung von der Decke warf ein fahles Licht auf die Gesichter. An der Tür lehnte der FBI-Posten, ein kaffeebrauner Lateinamerikaner.
Niemand sprach. Die Hausangestellten hatten erwartet, daß mit Massimos Rückkehr der Spuk so plötzlich enden würde, wie er begonnen hatte, aber sie hatten sich getäuscht. Sie waren Zeugen geworden, wie man Massimo, Diana und Tara grob durch die Tür stieß und wie der Posten sie anherrschte.
Die Erklärung von Massimo, diese Hausdurchsuchung wäre rechtswidrig, hatte flau geklungen, und so begannen sie, sich eigene Gedanken zu machen. Es war noch keine Woche her, seit der Fall Fillipi Schlagzeilen gemacht hatte. Mauro Fillipi, der Inhaber der zweitgrößten Fast-Food-Kette Amerikas, war in Verdacht geraten, der Kopf eines internationalen Drogenrings zu sein. Um an Beweise zu kommen, hatte das FBI bei allen Mitgliedern der Familie Hausdurchsuchungen vorgenommen.
Hier, an diesem Tisch bei den Mahlzeiten, hatten sie den Fall Fillipi diskutiert. Butler Hillary, der am längsten auf Sunset Hill war, konnte von den Zeiten berichten, als Ugo Fillipi – Mauro Fillipis ältester Sohn – hier ein und aus ging, früher als Tony Calese mit ihm befreundet gewesen war. Massimo Calese hatte diese Freundschaft nicht gern gesehen und Tony den Umgang mit Ugo Fillipi schließlich verboten. Er hatte triftige Gründe dafür gehabt: Die Fillipis gehörten noch immer zur New Yorker Mafia.
Mafia. Unausgesprochen stand das Wort auch jetzt im Raum. Aktionen wie diese gab es nur im Zusammenhang mit politischen Skandalen oder beim Kampf gegen die Mafia. Sicher, Massimo Calese war das Muster des ehrbaren Mannes – aber hatte es nicht immer wieder gerissene Gangster gegeben, denen es gelungen war, vor der Welt, ja vor der eigenen Familie, den Mann mit der weißen Weste zu spielen?
Massimo kannte die Menschen, die scheuen Blicke, die ihn streiften und sich dann schuldbewußt abwandten, ließen ihn erraten, was in den Köpfen seiner Leute vorging. Es ließ ihn kalt. Sollten sie denken, was sie wollten. Nur drei Menschen durften nicht an ihm zweifeln, das war seine Mutter, die achtzigjährige Mariannina Calese, das war Diana, und das war Tara. Aber nicht einmal ihrer war Massimo Calese sicher. Vergeblich suchte er in ihren Mienen nach jenem Ausdruck unbedingten Vertrauens, auf das er ein Recht zu haben glaubte, und das er jetzt in dieser Stunde so nötig gebraucht hätte.
Mariannina Calese hatte gerade ihren Mittagsschlaf beendet gehabt, als ein FBI Beamter in ihr Schlafzimmer eingedrungen war. Sie trug einen gesteppten Hausmantel aus schwarzgrundiger Seide mit einem gelben Rosenmuster. Füllig und sehr aufrecht saß sie da und strich sich manchmal glättend über das weiße Haar, das vom Schlafen noch verwirrt war.
Das Küchenpersonal in weißer Arbeitskleidung bildete eine geschlossene Gruppe und verbreitete den Geruch von Zwiebeln und Thymian. Das FBI hatte sie bei den Vorbereitungen fürs Abendessen unterbrochen und ihnen nicht einmal Zeit gelassen, sich die Hände zu waschen.
Butler Hillary war in sich zusammengesunken. Der Schädel brummte ihm von dem Faustschlag, mit dem Lieutenant Neimark ihn außer Gefecht gesetzt hatte; und die geplatzte Unterlippe schwoll immer mehr an und hörte nicht auf zu bluten. Die Galle lief ihm über, wenn er daran dachte, wie feige die zwei Bodyguards Summer und Frayn sich benommen hatten. Beide waren ehemalige Polizisten und gehörten seit März zur Hausgemeinschaft von Sunset Hill. Es wäre ihre verdammte Pflicht gewesen, dachte Butler Hillary, die Aktion des FBI zu stoppen, bis Massimo Calese selbst wieder im Hause war. Doch Summer und Frayn hatten keinen Finger gerührt. Er allein hatte versucht, den FBI-Leuten den Zutritt zum Haus zu verwehren.
Auch jetzt verhielten sich Summer und Frayn gleichgültig, als ginge sie das alles nichts an. Sie hatten am Ende des Tisches ihre Sportzeitungen ausgebreitet und blätterten raschelnd darin. Butler Hillary dachte an Cuidado, der früher Massimos Leibwächter war. Weiß der Teufel, warum Massimo ihn durch zwei Typen wie Summer und Frayn ersetzt hatte. Mit Cuidado hätte das FBI nicht so leichtes Spiel gehabt. Cuidado hätte ihnen die Absätze von den Schuhen geschossen, so wie er es mit den Wilderern gemacht hatte, wenn er einen von ihnen im Park erwischte.
Was hatte Cuidado sich für Mühe gegeben, aus Hillary einen guten Schützen zu machen, aber es war vergeblich gewesen. Wie viele Stunden hatten sie unten im Schießraum verbracht, wieviel Munition hatte Hillary in die schallschluckende Schießwand gejagt, ohne auch nur einmal zu treffen. Wenn die damals zwölfjährige Tara die Waffe genommen und Treffer auf Treffer plaziert hatte, war er sich wie ein alter Mann vorgekommen. Man hätte ihr das nicht zugetraut. Auch nicht, daß sie so gut reiten konnte. Sportliche Mädchen sahen meist anders aus, nicht so fein, nicht so anmutig. Kein Wunder, daß Massimo Calese seine Tochter abgöttisch liebte. Aber wer liebte Tara nicht. Sie hatte etwas, das einem das Herz aufgehen ließ. Und mit zärtlicher Sorge dachte Hillary weiter: »Hoffentlich liebt das Schicksal sie auch . . .«
Es war eine Stunde vergangen, seit man Massimo, Diana und Tara zu den anderen gesperrt hatte. In der brütenden Stille hörte man jedes Geräusch aus dem Haus. Die Aktion im ersten Stock schien beendet. Jetzt rumorten sie im Keller. Der Heizungsschacht in der Mauer übertrug die Geräusche so deutlich, daß Massimo ziemlich genau wußte, wo die FBI Männer sich gerade zu schaffen machten: zuerst die Waschküche, dann das Bügelzimmer, die Vorratsräume, Weinkeller, Sauna, Fitnessraum. Blieben noch der Schießraum und das Waffenlager. Ein Schießraum war nichts Unerlaubtes, der Vorrat an Waffen und Munition allerdings überstieg private Bedürfnisse.
Eine dumpfe Detonation ließ alle zusammenfahren. Eine zweite folgte, eine dritte. Die Köpfe hoben sich.
Massimo sah vor sich, was da unten geschah: Die FBI Beamten »vergnügten« sich im Schießraum, nur daß sie nicht auf die schallschluckende Zielwand schossen, sondern einfach wild herumballerten.
Er hielt es nicht länger aus, ruhig dazusitzen. »Diese Barbaren«, er stieß den Stuhl zurück und begann vor dem Fenster auf und ab zu marschieren. »Diese Barbaren«, murmelte er wieder. Die anderen blieben stumm.
Taras Blick wanderte von einem zum anderen. Die Mutter, die Großmutter, Butler Hillary, der Koch, das Zimmermädchen, die Bodyguards Summer und Frayn. Mit ihren gesenkten Blicken und den eingefrorenen Mienen, erschienen sie ihr leblos, Schaufensterpuppen. Der einzige lebendige Mensch war ihr Vater, der rastlos auf und ab ging.