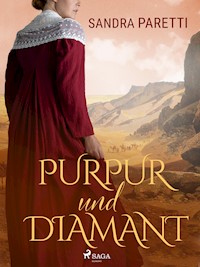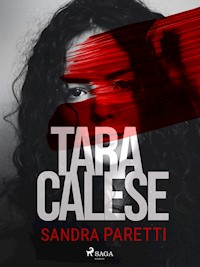Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Selten gibt es eine Beziehung, die so besonders ist, wie die zwischen Mutter und Tochter. In "Das Echo deiner Stimme" erzählt Bestsellerautorin Sandra Paretti von dem Leben ihrer Mutter – einer Frau, in der sich viele Gegensätze vereinten. Sie war emanzipiert und an einen Mann gebunden, Studentin und Hausfrau, voll von Emotionen und gleichzeitig verschlossen. Berührend und aufrichtig geschrieben, erzählt Parettis Biografie von Familie, Verlust und Zusammenhalt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Paretti
Das Echo deiner Stimme
Saga
Das Echo deiner Stimme
Copyright © 2022 by Helmut and Anka Schneeberger, represented bei AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1980 by Droemer Knaur Verlag, München
Coverimage/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1980, 2022 Sandra Paretti und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728469460
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Vergäße ich doch niemals, daß ich die Tochter einer Frau bin, die der Gedanke an den Tod weder froh noch traurig stimmte!
Als ihre Stunde gekommen war, ging sie in die andere Welt, als ginge sie in ein anderes Zimmer. Und wie im Leben achtete sie darauf, die Tür hinter sich zu schließen.
Zürich, Januar 1980
Mein Schreibtisch ist leer; nichts von all dem, was ich sonst zur Arbeit brauche. Kein Wörterbuch, kein Lexikon, kein Zettelkasten, keine Landkarte. Auch keine Schreibmaschine. Nur Papier, weiß und leer und suggestiv. Jedes Blatt ein magisches Viereck. Ich kehre zu den Wurzeln zurück: schwarze Zeichen auf weißem Grund. Zauberformeln, Geisterbeschwörung.
Es ist Nacht; die Taschenuhr, die neben der Lampe liegt, zeigt kurz nach ein Uhr. Im Haus ist es still; manchmal kommt ein Auto durch die Straße vor dem Haus; die Trambahn, die man tagsüber aus der Ferne hört, fährt um diese Zeit nicht mehr. Der grüne Glasschirm der Lampe gibt nicht mehr viel Licht, gerade genug zum Schreiben; den Raum läßt er im Halbdunkel.
Die Winternacht vor den Fenstern ist schwarz; eine schwarze kalte Winternacht.
»Du wirst dir die Augen verderben.«
Die Stimme ist leise. Die Stimme meiner Mutter war immer leise, auch als sie noch lebte. Ich habe auf sie gewartet, und nun ist sie da.
Meine Mutter war ein Mensch der Nacht. Sie schlief wenig, dann noch weniger und immer weniger. Wach zu sein war ihre Droge. Je älter sie wurde, desto mehr brauchte sie davon. Nur noch selten benützte sie das Bett im Eheschlafzimmer. Das Sofa im Wohnzimmer war ihr Biwak. Da hatte sie den Bücherschrank, die Zeitungen, die Reiseprospekte ferner Länder, die sie gerne besucht hätte; nur einer ihrer unerfüllten Wünsche. Die Uhr auf dem Buffet war nicht laut, und doch hielt meine Mutter nachts das Pendel an; die Stehlampe neben dem Sofa war nicht hell, und doch hängte meine Mutter ein Seidentuch darüber. So las sie. Kein Alkohol, keine Süßigkeiten. Nur ein Glas Wasser oder ein Apfel. Manchmal erhob sie sich, öffnete das Fenster und ließ die Nacht herein. Sie kannte die Sterne mit Namen, aber mehr faszinierte sie das Dunkel, das Universum. Ein Teil davon zu sein . . .
Meine Mutter gehörte einem Land, das sie verlassen hatte. In den durchwachten Nächten suchte sie den Weg zurück. Sie stieg die Leiter der Stunden hinab, suchte den Anfang des Anfangs. Ich kenne diese Sehnsucht: das Tor der Nacht zu finden, aus der Nacht hinauszutreten ins Universum.
Jetzt hat die Nacht sie zu mir geführt. Ich fühle ihre Gegenwart. Ich fühle ihren Blick über meine Schulter auf das beschriebene Blatt.
»Was schreibst du da? Ist das über mich?«
Ich sitze ganz still, lausche auf die Stimme, die zu mir spricht. »Ich möchte das nicht, hörst du. Ich möchte nicht, daß du über mich schreibst.«
Ja, das ist meine Mutter. Sie muß protestieren, das ist ihre Natur. Wenn sie für jedes Nein ein Goldstück bekommen hätte, sie wäre die reichste Frau der Welt geworden. Und doch wäre sie arm geblieben, denn sie hätte Stück für Stück verschenkt. Sie war nur glücklich, wenn sie sich verschwenden konnte. Und ausgerechnet sie mußte ein Leben lang sparen. Ich habe nie gehört, daß sie klagte, aber oft fühlte ich, daß sie litt.
Wie klein sie wurde, wenn sie über dem Haushaltsbuch saß! Wie peinlich sie es vermied, vor uns Kindern mit ihrem Mann Geldprobleme zu diskutieren! Wenn es nicht zu umgehen war, so sorgte sie dafür, daß es hinter geschlossenen Türen geschah. Geschlossene Türen – auch das war meine Mutter. Wenn sie eine Tür zumachte, konnte das vielerlei bedeuten. Oft war es ein Protest gegen die Formlosigkeit des Alltags. So mußten die Türen geschlossen sein, wenn sie das Tischgebet sprach; so bestand sie darauf, daß man die Badezimmertür stets zuzog, auch wenn man sich nur kurz durchs Haar fuhr.
Nichts tat sie zwischen Tür und Angel. Niemanden fertigte sie unter der Tür ab, weder den Postboten noch den Bettler. Jeden, der an ihre Tür klopfte, ließ sie eintreten.
Die Art, wie sie eine Tür schloß oder öffnete, war eine Sprache für sich: Die Türen des Alltags verwandelten sich in Türen der Verbote, in Türen der Geheimnisse oder in Türen des Zorns. Selten, daß die Türen des Zorns zufielen, aber wenn, dann war es ein Erdbeben, und wir alle, mein Vater, meine beiden Brüder und ich, wußten, die Mutter hatte uns den Krieg erklärt.
Es gab auch die Türen der Rätsel, die Türen der Strafen und die Türen der Wunder. Nicht nur vor Weihnachten, auch vor Geburtstagen wurden die Türen der Wunder mit einer dunkelblauen Decke verhängt und die Schlüssellöcher mit Papier zugestopft. Stundenlang konnte ich auf meinem Schemel davorsitzen, konnte lauern und lauschen, was dahinter geschah.
Die Türen des Streits. Wir wären nicht Mutter und Tochter gewesen, wenn wir nicht unsere Kämpfe gehabt hätten, und auch sie fanden hinter geschlossenen Türen statt. Verhöre, die sich über Stunden hinzogen. Meine Mutter war eine Meisterin der Inquisition, und ich war eine Meisterin des Widerstands. Am Schluß kam immer ihr verzweifeltes »Ich rede an eine Wand!«
Ach Mutter – keines deiner Worte war umsonst. Vieles konnte ich nicht verstehen, und vieles wollte ich nicht verstehen, aber verlorengegangen ist nichts. Deine Stimme, Mutter, deine leise Stimme, war mir schon vertraut, bevor ich auf die Welt kam, und sie wird mich begleiten bis zu meiner letzten Stunde. Wenn du auch nicht mehr bist, das Echo deiner Stimme ist nicht verstummt und wird nie verstummen.
In Nächten wie dieser werde ich warten und lauschen – wieder das Kind, das an geschlossenen Türen lauscht –, bis ich deine Stimme höre.
Die Hüterin
Der Schlüssel hängt in der Küche, an der Wand neben dem Herd, am gleichen Halter wie die Zange und der Haken, mit denen meine Mutter die Eisenringe aus der Herdplatte hebt, um die Töpfe aufs Feuer zu setzen. Zange und Haken sind schwarz und alt. Auch der Schlüssel ist alt, und er ist sehr groß, der Schlüssel für das Tor einer Festung.
Meine Mutter ist die Hüterin des Feuers, die Hüterin des Schlüssels und die Hüterin des Hauses.
Wir leben in Regensburg, nicht in der Stadt, sondern auf dem Oberen Wöhrd, einer Insel in der Donau. Mehr als die Hälfte der Insel ist Wildnis, hohes verschilftes Gras. Den Uferpfad haben die Angler ausgetreten. Niemand badet hier: Der Boden ist zu steinig, und die Stromschnellen sind zu gefährlich.
Ein Zaun aus Maschendraht markiert den Fußballplatz des Jahn Regensburg, eine Böschung dient als Tribüne, eine zertrampelte Wiese, auf der zwei Tore stehn, ist das Spielfeld. An den Wochenenden, wenn ein Spiel stattfindet, kommen viele Menschen auf unsere Insel, und man hört ihr Geschrei.
Am Schopperplatz stehen das Bootshaus und die Werft des Ruderclubs. Dahinter, etwas versteckt, hat sich der Tennisclub niedergelassen.
Dann erst beginnen die Häuser, viele davon Fischerhäuser. Am Uferquai liegen Kähne, trocknen Netze. Zwischen den niedrigen Dächern ragt ein Fabrikschlot in den Himmel. Der Schlot ist das Überbleibsel des Elektrizitätswerks, das früher einmal die Donauinsel mit Strom versorgte. Jetzt gehört der Schlot einem Storchenpaar, das jeden Sommer dort nistet.
Meine Eltern wohnen von 1932 bis 1953 in der Badstraße 18. Das Haus wurde 1746 erbaut, als Sommersitz für die Domherren, mit Refektorium und Hauskapelle. Refektorium und Hauskapelle gibt es nicht mehr, aber das Hoftor mit den vier steinernen Pfeilern existiert noch.
In kalten Wintern friert die Donau zu, und wir können über das Eis zur Stadt hinübergehen. Wenn das Eis schmilzt, haben wir Überschwemmung. Innerhalb weniger Stunden steht unser Keller unter Wasser. Wir müssen alle zusammenhelfen, um die Kohlen und das Holz in Sicherheit zu bringen. Dann werden Böcke aufgestellt und Laufbretter darübergelegt. Wenn das Wasser weiter steigt, können wir nur noch durch die Fenster der Wohnung im Hochparterre aus dem Haus.
Wir Kinder wünschen uns jedes Jahr eine Überschwemmung. Das Haus besteht zur Hälfte aus Treppe und Lichthof. Die Treppe ist breit genug für eine Pferdekutsche, und der Lichthof mit den beiden großen Rosettenfenstern erinnert an eine Kirchenkuppel.
Es ist ein Haus, wie man es kein zweites Mal findet. Für Kinder das Gelobte Land. Für meine Mutter, die in einem Haus aufwuchs, das mit allen Errungenschaften der modernen Technik ausgestattet war, ist es eine Strafversetzung ins Mittelalter.
Allein schon die Dimensionen der Türen und Fenster! Sie ist eine kleine Frau. Sie muß auf einen Schemel steigen, um die grünen Läden vorzulegen; sie muß eine Leiter holen, um die Riegel der Flügeltüren zu lösen. Die Kohleneimer, die sie schleppt, die Körbe mit nasser Wäsche!
Das Bad ist eine dunkle Zelle; die Speisekammer wird im Sommer zum Brutkasten und im Winter zum Eisloch. Wenn man die Kachelöfen nicht heizt, sind auch die Schlafzimmer im Winter Eishöhlen. Und das ganze Jahr hindurch muß der Herd in der Küche geheizt werden.
Jeden Tag sehe ich meiner Mutter zu, wie sie Feuer macht. Ich sehe ihr zu, wie sie Kienholz spaltet: Aus einem fingerdicken Stück wird in ihren Händen ein Dutzend feiner Späne. Ich sehe sie vor dem Herd knien, und aus einem Häufchen grauer Asche erheben sich Flammen.
»Siehst du, das Feuer hat nur geschlafen.«
Ich will auch in die Glut blasen.
»Ganz leicht, nur einen Hauch, ja so . . .«
Sie streift den Handschuh aus Asbest über und hält den Kienspan in die Flammen. Zwei Scheite Holz über Kreuz, ein drittes, ein viertes. Erst später, wenn sie ein Brikett auflegt, wird sie den Rost rütteln. Jetzt schnell eine Handvoll Kaffeebohnen in die schwarze Pfanne. Das ist für mich das Zeichen. Ich rücke meinen Schemel zum Ofen, und sie gibt mir den Kochlöffel.
»Langsam rühren! Geröstet sind die Bohnen schon, sie sollen nur warm werden, damit das Aroma wieder stärker wird.« Sie hängt den Schürhaken zurück; er schlägt an den großen Schlüssel, und es gibt einen hellen Klang.
Der Schlüssel. Andere gibt es nicht, nur diesen einen. Und dieser eine hängt jahrein, jahraus hier an seinem Platz. Nie sehe ich den Schlüssel in den Händen meiner Mutter. Wir haben viele Türen in der Wohnung, an keiner steckt ein Schlüssel, keine ist jemals abgesperrt, auch nicht die Speisekammer, obwohl meine Mutter weiß, daß ich oft hineinschleiche und von der Dose »Milchmädchen« nasche. Wenn sie mich dabei ertappt, droht sie, daß sie die Tür eines Tages absperren wird. Und jedesmal, wenn der elektrische Strom ausfällt – was ziemlich oft passiert – und wir im Dunkeln sitzen, spricht sie davon, daß sie ein modernes Schloß an der Haustür haben möchte. Dann erklärt ihr mein Vater, daß der Riegel absolut sicher ist. Dieser Riegel besteht aus einer flachen Eisenstange, die durch drei Halterungen geschoben wird. Ein Riegel für das Tor einer Festung. Er wird nie vorgelegt.
Ich wußte als Kind nicht, was eine verschlossene Tür ist. Wenn es mir gelang, die Klinke mit den Händen zu erreichen, tat sich jede Tür vor mir auf – auch eine verbotene Tür. Es wäre für meine Mutter einfacher gewesen, die verbotenen Türen mit einem Schlüssel abzusperren, aber sie glaubte eben nicht an Schlüssel. Sie glaubte an Verbote. »Du darfst nicht . . .« Sie sagt es nicht streng, eher bittend. Sie sieht mich eindringlich an. »Du darfst nicht ins Herrenzimmer.«
Es ist ein dämmriger Raum. Dunkelblaue Vorhänge, am Boden ein roter Teppich. Beim Fenster steht eine Staffelei. Es duftet nach Firnis und Tabak. Nicht einmal, wenn meine Mutter dort aufräumt, darf ich mit hinein. Ich muß an der Tür bleiben.
Ich würde mich so gerne auf den roten Teppich legen. Ich würde mich so gerne in den Falten des blauen Vorhangs verstecken. Ich würde so gerne das Grammophon spielen lassen. Ich würde so gerne die Türen des Bücherschrankes aufmachen.
»Nein, du bleibst draußen!«
Noch eine andere Tür ist mir verboten: die Tür zum Zimmer meines Bruders Karl. Er ist fünf Jahre älter als ich, und ich liebe ihn sehr. Unsere Schlafzimmer liegen nebeneinander. Abends, wenn die Mutter das Licht gelöscht hat und gegangen ist, klopfe ich an die Wand, und er klopft zurück. Einmal bin ich mutig, ich öffne die Tür, doch meine Mutter mit ihrem sechsten Sinn für Ungehorsam steht plötzlich da.
Sie fragt nicht; für sie steht fest, daß mein Bruder die Tür geöffnet hat.
Immer ist es mein Bruder, der schuldig ist.
Immer ist es mein Bruder, der bestraft wird.
Für mich gelten andere Gesetze. Wenn ich ungehorsam bin, spricht meine Mutter mit mir, redet mir ins Gewissen, hört sich an, was ich zu meiner Verteidigung vorzubringen habe. Und zuletzt kommt ein Freispruch, ein Freispruch allerdings, der eine Drohung enthält: »Dem Vater sage ich nichts davon.« Sie liebt suggestive Wiederholungen. »Dem Vater sage ich nichts davon.«
So lerne ich, daß es eine Welt der Männer gibt und eine Welt der Frauen.
Es wäre ein Tag zum Schlittenfahren. Nachts ist frischer Schnee gefallen, und jetzt scheint draußen die Sonne.
Mein Bruder hat Hausarrest; er muß für die Schule lernen. Meine Mutter ist in der Stadt beim Zahnarzt. Bevor sie ging, hat sie mich mit einem Malbuch an den Küchentisch gesetzt. Karl hat seinen Platz im Wohnzimmer. Solange er die Volksschule besuchte, hatte er immer Zeit, mit mir zu spielen. Seit er auf dem Gymnasium ist, muß er dauernd lernen. Meine Mutter will erzwingen, daß aus ihm ein Musterschüler wird. Alles, was ihn vom Lernen ablenkt, ist ihm verboten. Wenn sie nicht zu Hause ist, soll ich aufpassen, daß er lernt. Am Abend kontrolliert sie, ob er seine Aufgaben gemacht hat, und hört ihn ab. Dabei wird sie oft wütend. Einmal hat sie ein Buch zerrissen, als er auf eine Frage die Antwort nicht wußte. Es war die »Lateinische Grammatik«; sie hat das Buch in der Mitte auseinandergerissen und an die Wand geworfen. Sie sprach bis zum nächsten Tag nicht mehr mit Karl. Dann verlangte sie, er solle sie um Verzeihung bitten. Er weigerte sich und mußte eine Strafaufgabe schreiben: hundertmal den Satz »Ich bereue meinen Ungehorsam«. Er machte die Strafaufgabe, ohne zu murren, aber er weigerte sich erneut, um Verzeihung zu bitten. Eine neue Strafaufgabe . . . So geht das manchmal tagelang. Zu der alten Strafe kommen neue. Es herrscht immer Krieg zwischen den beiden. Karl tut so, als würde ihm das alles nichts ausmachen, aber nachts im Bett weint er. Er haßt das Gymnasium. Er will weg von zu Hause, weg von Regensburg. Er will in die Fremde.
Kaum ist meine Mutter fort, kommt er zu mir in die Küche.
»Jetzt spielen wir Grammophon.«
Das Grammophon steht im Herrenzimmer. Grammophon und Herrenzimmer fallen unter die strikten Verbote. Zweimal wurden wir schon erwischt.
»Bist du fertig mit dem Lernen?«
»Ich will nicht lernen. Ich will nicht mehr in die Schule. Komm jetzt . . .«
Das Grammophon ist ein mannshoher Kasten. In der unteren Hälfte sind die Fächer für die Platten, in der Mitte die Lautsprecher, verborgen hinter einem Holzgitter und einer dunkelgrünen Seidenbespannung. Zuoberst ist der Plattenspieler. Um ihn zu bedienen, muß Karl auf einen Stuhl steigen. Der Deckel ist schwer. Auch die Kurbel, mit der man den Apparat aufzieht, ist schwer.
»Was willst du hören?«
»Die Zigeunerin.«
»›Carmen‹?«
»Ja, ›Carmen‹.«
Auf der Plattenhülle ist das Bild einer Frau. Sie trägt eine ausgeschnittene Bluse und einen weiten Rock mit vielen Volants. Im Haar hat sie einen hohen Kamm, und darüber fällt ein Spitzenschleier. In der Hand hält sie einen Fächer. Sie ist ganz in Schwarz, nur die Rose im Ausschnitt der Bluse ist rot. Im Hintergrund sieht man eine Arena und zwei Männer, einen Torero und einen Soldaten.
Mein Bruder hat mir die Geschichte von Carmen schon einmal erzählt, aber ich will sie jetzt wieder hören. Von der Zigarettenfabrik, in der sie arbeitet, von den Schmugglern, vom Kartenschlagen, von dem Brigadier, der sich in sie verliebt und der sie aus Eifersucht umbringt.
»Und der Torero? Was macht der Torero?«
»Er bringt den Soldaten um.«
Ich bin Carmen, und mein Bruder ist der Torero.
Aus der Truhe im Flur holen wir uns die Faschingskostüme. Ich nehme das Zigeunerkleid, Karl setzt den Torerohut auf und bindet sich eine rote Schärpe um. Wir haben auch Stifte zum Schminken. Karl malt sich einen kleinen Schnurrbart und ich mir rote Lippen.
Das Grammophon beginnt zu spielen.
»Die Liebe vom Zigeuner stammt . . .«
Wir schlagen den Teppich zurück und beginnen zu tanzen. In der Glasscheibe des Bücherschranks sehe ich unser Spiegelbild. Mein roter Rock fliegt, das offene Haar fliegt. Hinter mir ist der Schatten meines Bruders. Das Parkett vibriert unter seinen Absätzen. Mit einer Hand dreht er mich wie einen Kreisel. Ich könnte ewig weitertanzen . . .
Das Ende kommt, wie es kommen muß. Plötzlich steht meine Mutter in der Tür. Eine kleine Gestalt in einem dunklen Kleid, ohne Schuhe an den Füßen. Sie ist kaum größer als ihr zehnjähriger Sohn. Warum tanzt sie denn nicht mit uns?
»Das ist jetzt das dritte Mal!«
Ihr Blick ist auf Karl gerichtet.
»Du weißt, was dich für eine Strafe erwartet. Ich habe dich gewarnt.«
Ich laufe zu ihr.
»Karl ist nicht schuld!«
Sie nimmt meine Hand und führt mich ins Bad.
»Wasch dir das Gesicht!«
Sie bleibt neben mir stehen.
»Du hast immer noch Rot auf den Lippen.«
Ich empfinde das Waschen als Strafe, aber ich verstehe die Strafe nicht.
»Du hast immer noch Rot auf den Lippen«, wiederholt meine Mutter.
Ich reagiere nicht.
Sie nimmt Seife und Waschlappen. Schaum kommt mir in den Mund und in die Augen. Ich reiße mich los.
»Du darfst Karl nicht bestrafen! Er war fertig mit dem Lernen.«
»Das werde ich ja sehen, wenn ich ihn abfrage.«
»Er will nicht mehr in die Schule. Er hat Geld gespart. Er geht fort. Er kommt nie mehr zurück.«
»Ich weiß, ich weiß, damit hat er mir auch schon gedroht.«
»Er wird es tun.«
»Er will mir nur angst machen, weiter nichts.«
Sie hat sich vor mich hingekniet und löst die Kordel, die den Zigeunerrock hält.
»Männer sind so. Männer müssen immer drohen, das starke Geschlecht spielen . . .«
Männer – täglich höre ich dieses Wort aus ihrem Mund. Es drückt Mißtrauen aus, Kritik, Spott, Feindschaft. Immer ein Warnruf.
Aus der Wohnung unter uns kommt Mundharmonikamusik. Es ist Kurt, der achtjährige Sohn der Familie Ratgeber. Einen Monat lang war er im Krankenhaus. Gestern haben sie ihn heimgeholt. Er trägt einen dicken Verband am linken Bein und humpelt. Ich möchte ihn besuchen, aber meine Mutter verbietet es. Kurt ist ihr Feind, und sie will, daß auch ich in ihm einen Feind sehe.
»Wenn er auf der Treppe ist, geh einfach vorbei, schau überhaupt nicht hin!«
»Wenn er vor dem Haus ist und mit dir spielen will, laß ihn einfach stehen, hörst du?«
»Wenn er dich in die Wohnung lockt, geh nicht mit ihm!«
Ich breche die Verbote täglich, und meine Mutter wiederholt sie täglich.
Kurt ist ganz anders als mein Bruder. Man hört Kurt nie kommen; plötzlich taucht er auf, hinter einer Tür, aus einem dunklen Eck, lautlos, das Gesicht zu einer Grimasse verzogen. Nachts schleicht er um das Haus und gibt seltsame Laute von sich, oder er hockt unter der Treppe und lauert auf ein Opfer, das er erschrecken kann.
»Ein Teufel«, sagt meine Mutter.
Aber ich mag ihn.
Es ist immer lustig mit ihm. Er zeigt mir, wie man schielt, wie man Grimassen schneidet. Er zeigt mir, wie man schleicht, so daß einen niemand kommen hört; wie man Türen öffnet und schließt, ohne ein Geräusch zu machen, und wie man durch die Finger pfeift.
Wegen seiner Krankheit soll er viel ruhen und viel an der Luft sein, nicht in der Sonne allerdings. So hat er eine Decke, auf der er liegt und mit der er dem Schatten folgt. Am Morgen kampiert er unmittelbar am Haus, und seine Mutter kann ihm die Spielsachen durch das Fenster herausgeben. Mittags verschwindet er hinter das Haus, zu den Wellblechgaragen, der Schreinerwerkstatt und den Holzstapeln, oder er hockt auf den Stufen des Kanals und angelt. Am Nachmittag hat er seinen Platz unter dem Nußbaum des Nachbarhauses.
Eines Morgens ist seine blau-rote Decke nicht da – dafür steht ein kleines Zelt im Hof. Mein Bruder läuft sofort hinunter. Vom Fenster aus sehe ich, wie er mit Kurt verhandelt, dann schlüpfen die beiden hinein.
Meine Mutter steht neben mir am Fenster.
»Du wirst dieses Zelt nicht betreten, hörst du?«
Am Nachmittag brennt ein Feuerchen vor dem Zelt, Kurt brät Kartoffeln, mein Bruder ist sein Gast. Ich sitze mit meiner Mutter in unserem Vorgarten. Der Wind trägt den Duft des Feuers und der Kartoffeln zu uns herüber. Mein Bruder winkt mir, zu ihnen zu kommen.
»Darf ich?«
Sie läßt das Nähzeug sinken, blickt zu dem Zelt und dem Feuer.
»Du bleibst hier.«
»Aber Karl darf doch auch.«
»Das ist etwas anderes.«
»Bitte!«
»Nein.«
»Nur ein bißchen zuschauen.«
»Nein.«
Das Nein meiner Mutter macht die Versuchung unwiderstehlich.
Ich erinnere mich nicht, wie ich schließlich doch in Kurts Zelt kam. Ich weiß nur, es war ein heißer Tag, und in dem Zelt war es noch heißer als im Freien. Sägemehl bedeckte den Boden. Kurt hatte die Schuhe und die Kniestrümpfe ausgezogen. Man sah die tiefen Narben an seinem linken Bein. Am Knöchel trug er einen Verband. Seine Handflächen waren rot und gelb von dem Brausepulver, das er dauernd schleckte. Er hatte mir ein Päckchen geschenkt, aber ich hob es mir auf. Mein Bruder war gegangen, um Limonade zu holen. Er mußte jeden Moment zurück sein.
Es ist ganz still, nur von der Schreinerei kommt das gleichmäßige Geräusch der Kreissäge. Kurt liegt auf der Erde und beobachtet durch einen Spalt den Hof.
Plötzlich hebt er den Kopf.
»Deine Mutter, schau!«