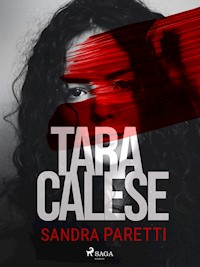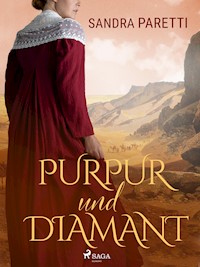
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geliebte Caroline
- Sprache: Deutsch
Zwei Liebende, eine Familie, eine lange Reise. Sehnsüchtig wartet der Herzog von Belômer in Lissabon auf Wort von seiner entführten Frau Caroline. Was er nicht weiß: Caroline ist es gelungen, ihren Entführern zu entkommen. Trotzdem begibt sie sich auf ihrer Reise durch die Nordafrikanische Wüste in große Gefahr und denkt dabei unaufhörlich an ihre junge Familie. Wird sie ihren Mann und ihr Kind jemals wiedersehen? Dies ist der dritte Teil von Sandra Parettis Caroline-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Paretti
Purpur und Diamant
Saga
Purpur und Diamant
Copyright © 2022 by Helmut and Anka Schneeberger, represented bei AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1971 by Krüger Verlag, Stuttgart
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1971, 2022 Sandra Paretti und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728469385
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1
Es war eine der Nächte, in denen im Hafenviertel von Lissabon die Türen doppelt verriegelt wurden und die Männer, die noch unterwegs waren, die Hand am Griff ihrer Waffen hatten.
Seit dem Einbruch der Dämmerung war die Einfahrt in den Hafen für Schiffe zu gefährlich. Das Wasser dampfte. Dem heißen Junitag des Jahres 1816 war eine kalte Nacht gefolgt. In die Tejo-Bai herein schoben sich die weißen Dunstballen.
Am Hafendamm türmten sie sich auf, quollen über die Brüstung, krochen am Boden weiter. Der Westwind trieb sie vor sich her.
Lautlos breitete sich der Nebel aus, löschte das Licht der Laternen, dämpfte das Rauschen des gegen die Kaimauern brandenden Meeres – und machte den Mann, der am Hafendamm stand, zu einem Schemen, das auftauchte und wieder verschwand.
In einem dunklen, die ganze Gestalt verhüllenden Umhang stand er dort und blickte in die Richtung, wo, verborgen von dem Gebirge aus weißem Gewölk, das Meer sein mußte. Sein Gesicht war blaß. Auf seinem hellen Haar hatte der Nebel einen feuchten Film gebildet. In seinen Augen war der Glanz und die Starre des Wartens.
Jeden Tag, zur Zeit der einbrechenden Dämmerung, kam der Herzog von Belômer hierher. Eine Kutsche brachte ihn bis zum Largo Calatayud. Bei jedem Wetter harrte er auf seinem Platz aus, den Blick auf das Meer gerichtet, als müßte es ihm endlich die erwartete Botschaft bringen.
Die Leute, die am Hafen lebten, die Besitzer der Schenken, die Handwerker, die Arbeiter der Lagerhäuser und der Docks, hatten sich an seinen Anblick gewöhnt. Sie hatten herausgefunden, wer dieser Mann war. Sie kannten die Legende seiner Geschichte; sie wurden nicht müde, daran weiterzuspinnen, mit dem Vorgefühl, eines Tages vielleicht selbst Mitwirkende in diesem Drama zu sein.
Die beiden Soldaten der Hafenwache, die ihre stündliche Patrouille machten, blieben stehen, als sie in der Ferne den Schatten auftauchen sahen. Der Ältere schüttelte den Kopf. »Gestern stand seine Kutsche die halbe Nacht am Largo Calatayud.«
»Und alles wegen einer Frau . . .«
»Wenn sie so schön ist, wie man sagt, versteh! ich ihn.«
»Und wenn sie gar nicht mehr lebt? Eine Belohnung von tausend Escudos – für die winzigste Nachricht über ihren Verbleib. Wo gibt es das? Ich kenne keinen Kapitän und keinen Handelsagenten, der nicht versucht hätte, die tausend zu verdienen. Und vergiß nicht, daß Bibi Lupin und seine Leute seit drei Monaten für ihn arbeiten – vergeblich . . . Wenn Lupins trübe Quellen versiegen, dann gebe ich keinen Réis mehr für das Leben dieser Frau.«
Der Ältere zuckte die Achseln. »Es würde mich interessieren, wie eine Frau sein muß, für die ein Mann vergißt, daß es auch noch andere gibt.«
Sie waren weitergegangen. »Ich kenne einen aus Lagos. Miguel.« Der jüngere dämpfte seine Stimme. »Er hat sie gesehen, damals, bevor Don Santis Leute ihr Schiff kaperten und sie an die Sklavenküste verschleppten. Miguel sagte, für eine solche Frau würde er sich sofort vom Cabo de São Vicente herunterstürzen.«
»Es gibt solche Frauen – aber meistens ist kein Glück um sie . . .«
»In seiner Kutsche liegt immer ein Damenmantel aus schwarzer Seide bereit«, spann der Jüngere seine Gedanken weiter. »Das weiß ich von seinem Kutscher. Und in seinem Haus, in der Casa Trestorres, steht ein ganzes Zimmer mit ihren Koffern voll. Niemand darf sie anrühren. Niemand läßt er hinein.«
»Nun hör schon auf damit. Ich schlage vor, wir wärmen uns beim alten Pera erst einmal auf.«
Die beiden Soldaten blickten noch einmal zurück. Der Mann stand noch immer am Hafendamm, ein paar Schritte von ihnen entfernt. Als er sich jetzt umwandte, flog sein Mantel auf. Er blieb stehen wie jemand, der aus tiefem Sinnen aufschreckt. Er schien Sekunden zu brauchen, um sich zu erinnern, wo er sich befand. Aber auch dann bemerkte er seine Zuschauer nicht.
Er schlug den Mantel wieder um sich, hielt ihn über der Brust zusammen. Er stand dort, wartend, lauschend. Mit einer Bewegung, als befreie er sich von unsichtbaren Fesseln, begann er zu gehen. In seinen Mantel gehüllt, schritt er dahin, schnell, ungeduldig, zurück zum Largo Calatayud, wo seine Kutsche wartete.
Die beiden Soldaten waren ihm gefolgt. Sie hörten, wie er dem Kutscher zurief: »Zur Casa Trestorres!« Sie blieben stehen, bis der Wagen im Nebel verschwunden war. Der Jüngere seufzte. Der Ältere steuerte zielstrebig auf Peras Schenke zu.
Die Casa Trestorres lag außerhalb von Lissabon, am nördlichsten Punkt der Vorstadt Belém, hoch über der Zone des Nebels. Hinter alten Bäumen und einer hohen Mauer aus rohbehauenen Granitquadern erhob sich der maurisch-gotische Bau mit seinen schmalen, vergitterten Fenstern und den drei Türmen, mehr Burg als Haus. Die Einfahrt war ein gewaltiges Gewölbe, das die ganze Tiefe des Gebäudes einnahm. Auf die alten eisernen Fackelhalter hatte man verglaste Lampen montiert. Seit der neue Besitzer das Haus bewohnte, brannten sie Tag und Nacht.
Das Gewölbe hallte vom Hufschlag der Pferde wider, als die Kutsche hereinrollte. Noch bevor sie zum Stehen kam, öffnete sich der Schlag, und der Herzog von Belômer sprang heraus. Den schwarzen Damenmantel über dem Arm, eilte er die Steinstufen hinauf, die ins Innere des Hauses führten.
Wärme schlug ihm entgegen, als er die Halle betrat, der strenge Geruch alten Gemäuers, alter Balken. Yeppes, der Vorsteher des Hauswesens, ein dreißigjähriger Mann mit den schrägen geschlitzten Augen und dem glatten schwarzen Haar eines portugiesischasiatischen Mischlings, trat aus dem Dunkel auf den Herzog zu. Er verbeugte sich. Er vermied es dabei, den Herzog anzusehen. Es war immer sein Ehrgeiz gewesen, Herren zu dienen, die nicht waren wie die anderen. Aber in diesen Augenblicken, wenn der Herzog von seinen nächtlichen Wachen am Hafen zurückkehrte, mit den Augen, die nichts wahrnahmen, war er Yeppes unheimlich. Wußte dieser Mann überhaupt, wo er sich befand?. Daß er nicht mehr draußen in der Nacht war, nicht mehr aufs Meer hinausstarrte?
Der Herzog war stehengeblieben. Aus einer angelehnten Tür drangen Männerstimmen. Er sah fragend auf. Yeppes machte eine Geste zu der angelehnten Tür hin, aus der jetzt lautes Lachen schall. »Fragt mich nicht, wer diese Leute alle sind, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß Ihr allzu nachsichtig mit diesem Gesindel seid. Senhor Lupin tut nachgerade, als wäre das sein Haus.«
»Irgendwelche Nachrichten?« fragte der Herzog.
»Wenn, dann hat Senhor Lupin sie mir nicht anvertraut.« Der Ausdruck seines Gesichts sagte deutlich, was Yeppes über Bibi Lupin und seine Spitzel dachte. Daß die Berichte, die Bibi Lupin dem Herzog über die angestellten Nachforschungen erstattete, so gut wie nichts Konkretes enthielten, konnte Taktik sein. Vielleicht wollte Lupin diese fette Pfründe einfach so lange wie möglich ausschöpfen. Vielleicht war es auch die Vorsicht des gerissenen Spions, das Material erst herauszugeben, wenn es keine Lücken mehr enthielt. Die eine wie die andere Vorstellung paßte Yeppes nicht.
Der Herzog war an die Tür getreten. Er öffnete sie halb, warf einen Blick in den Raum. Die Beine in eine Felldecke gehüllt, saß Bibi Lupin in der Nähe des Feuers. Der Schein der Flammeń lag auf seinem Fuchsgesicht. Wie immer waren seine Augen leicht zugekniffen. Um ihn herum lagerten zechende Männer. Der Herzog trat von der Tür zurück.
Yeppes hielt es nicht mehr aus. Er mußte sich Luft machen. »Seit drei Monaten ernährt und bezahlt Ihr diese Männer, und was haben sie Euch gebracht? Seit drei Monaten tischen sie Euch Märchen auf, nichts als Märchen.« Yeppes sah, daß der Herzog ihm nicht zuhörte, trotzdem sprach er weiter. »Ihr solltet sie alle zum Teufel jagen. Ihr könntet genausogut alle Kartenlegerinnen Lissabons hier einquartieren. Es macht keinen guten Eindruck, diese Leute im Haus zu haben. Euer Ruf . . .« Yeppes verstummte. Unsicher starrte er dem Herzog ins Gesicht, von dem der abwesende Ausdruck gewichen war. In den grauen Augen waren Spott und Härte.
Der Herzog, immer noch in den Umhang gehüllt, immer noch den Damenmantel aus schwarzer Seide über dem Arm, ging an Yeppes vorbei. Mit schnellen Schritten stieg er die Treppe hinauf. Er hatte das Haus gemietet, ohne es vorher gesehen zu haben. Er bewohnte es seit drei Monaten, ohne den Dingen, die ihn umgaben, die geringste Aufmerksamkeit zu schenken.
Er war erleichtert, keinen der Bedienten in seinen Räumen zu treffen. Er verriegelte die Tür und breitete den Damenmantel behutsam über einen Sessel. Er ging zu einem der Fenster, zog die Vorhänge auseinander, öffnete es. Als er in die Casa Trestorres eingezogen war, hatten Bäume vor dem Fenster gestanden. Er hatte sie fällen lassen, damit die Sicht zum Meer frei wurde.
Das Meer. Von hier aus behinderte kein Nebel den Blick. Das Meer war wie ein Spiegel des Himmels in dieser Nacht. Die Lichter der auf dem offenen Meer ankernden Flotte funkelten heller als die Sterne. In einer Stunde würde auch in der Hafenbai kein Nebel mehr sein. Schon jetzt begannen sich die dichten weißen Ballen aufzurollen, durchsichtig zu werden. Wie phantastische, zwischen unsichtbaren Pfosten gespannte Fischernetze hingen sie längs der Ufer, vom Wind leicht bewegt.
Was erwartete er eigentlich von seinen abendlichen Fahrten zum Hafen? Was erhoffte er sich von Bibi Lupins Nachforschungen? War er nicht vollkommen sicher, daß Caroline lebte? Gab ihm dieser absolute Glaube nicht die Kraft, diese Zeit des ohnmächtigen Wartens zu überstehen? Und doch verlangte es ihn nach einem Zeichen.
Er trat vom Fenster zurück und nahm die Lampe vom Tisch. Er öffnete die Tapetentür, hinter der sich eine Wendeltreppe verbarg. Sein Schatten huschte neben ihm her, sich in die Krümmungen der Mauer schmiegend. Durch das Gitter eines schmalen Fensters zwängte sich ein Zweig. Dann stand er vor der Tür des Turmzimmers.
Der Raum, den er betrat, war angefüllt mit Schiffskisten, Koffern aus Zedernholz, ledernen Handkoffern in allen Größen. Es roch nach vertrockneten Rosenblättern, nach Dingen, die einer Frau gehörten und die ihren Duft in sich aufgenommen hatten.
Der Herzog stellte die Lampe ab. In seinen Bewegungen war jetzt nichts Abwesendes, Mechanisches mehr. Vorsichtig öffnete er einen dunkelbraunen Lederkoffer, schlug den mit weißem Moiré bezogenen Innendeckel zurück. Er nahm einen Schmuckkasten heraus, trat damit zur Lampe. Seine Finger berührten den Verschluß. Sie schienen zu kraftlos, um ihn zu öffnen. War es Ungeduld, die sie lähmte? War es Angst?
Den Blick abgewandt, schlug er den Deckel hoch. Auf purpurnem Samt lag ein taubeneigroßer Diamant. In seinem Glanz war etwas vom Gold der afrikanischen Sonne – und noch etwas anderes, eine geheime Kraft. Der Herzog stand da, verloren in den Anblick des Steins, den Caroline ihm geschenkt hatte. Er glaubte ihre Stimme zu hören, die Worte, mit denen sie ihm am Tag der Hochzeit den Stein, ihr Geschenk, überreicht hatte. »Siehst du, wie er lebt. Er wird leben, solange ich lebe.«
Er hatte sie damals in die Arme geschlossen, aber hatte er ihre Worte verstanden? Wirklich verstanden hatte er sie erst an jenem Abend in Lagos, als er in das Haus mit den roten Läden zurückkehrte, ohne sie, als er nachts schlaflos in dem Bett lag, das noch ihren Duft bewahrte. Am Boden standen ihre Pantoffeln. Über dem Hocker lag ihr Negligé. In der Vase stand der Fliederzweig, den sie zwei Tage vorher geschnitten hatte, persischer Flieder, dessen violette Blüten den Duft von Vanille verströmten. All diese Dinge hatten ihm nicht geholfen. Im Gegenteil. Sie sagten ihm dauernd, was geschehen war, sie wiederholten es ununterbrochen: Sie ist fort. Geraubt. Du kanntest deine Gegner. Du wußtest, daß die Santis ihr Imperium des Sklavenhandels mit allen Mitteln verteidigen würden. Sie war das beste Mittel, dir die Hände zu binden. Vor deinen Augen haben sie es getan, und du hast zugesehen, tatenlos.
Er wußte nicht mehr, ob es im Traum oder im Wachen geschehen war. Plötzlich hatte er diesen Stein vor sich gesehen. Es war wie ein Zwang gewesen. Eine unsichtbare Hand hatte ihn zu der Schmuckschatulle geführt. Und dann, plötzlich, hatte er gewußt, daß der Stein ihm ihr Schicksal verraten würde – daß in dem Augenblick, in dem Caroline stürbe, auch dieser Stein zerfiele . . .
Der Diamant lag funkelnd vor ihm. Seine Finger schlossen sich um den Stein. War das, was ihn erfüllte, wirklich nur törichte Hoffnung?
Das Meer und der Stein. Das waren die beiden Pole, zwischen denen er lebte. Das Meer, das er täglich nach Zeichen absuchte, nach Zeichen von ihr. Das Meer, das ihn sie täglich von neuem verlieren ließ – und der Stein, der sie ihm täglich zurückgab.
Er legte den Diamant auf den purpurnen Samt. Er verschloß die Schmuckschatulle, stellte sie in den Koffer zurück. Er nahm die Lampe und verließ das Turmzimmer.
Seine Schritte machten kein Geräusch. Der große Mann schien nicht mehr Gewicht zu haben als sein Schatten.
2
Die Strahlen der aufgehenden Sonne zerrissen die fahle Dämmerung, in deren Dunst sich Wüste und Himmel zu einer einzigen Unendlichkeit verwoben. Waagerecht flutete das Licht über die Ebene. Die geringsten Erhebungen traten scharf hervor, warfen lange violette Schatten. Für ein paar Augenblicke wurde die vom Sand verwehte Karawanenstraße zu einer deutlichen Spur, die sich in einem sanften Bogen nach Nordosten zog.
Rasim, der Anführer des kleinen Trupps, stieß seine rauhen, nur den Tieren verständlichen Schreie aus, um die Kamele zum Halten zu bringen. Er zwang sein Tier in die Knie und wartete, bis auch die beiden Reiter zu Pferd den Kamm der Anhöhe erreicht hatten. Mit ausgestreckter Hand wies er in die Wüste. Auf seinem scharfgeschnittenen Gesicht stand Freude. Er liebte die Wüste mit der überschwenglichen Zärtlichkeit des Beduinen. Er liebte ihre Grenzenlosigkeit, ihr Schweigen und die Gelassenheit, mit der sie den Menschen herausforderte.
»Morgen abend sind wir in Timbuktu«, sagte er. Erfüllt von diesem Morgen, an dem die Welt in den Schmelz der ersten Schöpfungsstunde getaucht schien, vergaß Rasim ganz, daß auf dem Weg zwischen Abomey, der Hauptstadt von Dahomey, und Timbuktu dieses letzte Stück, das vor ihnen lag, das gefahrvollste war.
Während der langen Reise war bisher alles gutgegangen. Sie hatten Steppen, Savannen und die Urwälder längs des Niger durchquert, die Regionen der Schakale, der Löwen und der Schlangen. Sie hatten keines ihrer Tiere verloren; sie waren in kein Wetter geraten; das Fieber hatte sie verschont. Dabei hatte Rasim das Schlimmste befürchtet, als er am Abend des ersten Tages entdeckt hatte, daß der eine der Reiter eine Frau war. Eine Weiße, eine Christin! Rasim war zwar ein Mann ohne Glauben, ohne Familie, ein Mann, der nur ein Zuhause hatte: die Wüste, die ihn jahrelang als Räuber ernährt hatte – aber eine Reise mit einer Christin war etwas, das alle Abenteuer, die ihm die Wüste bisher aufgegeben hatte, überstieg. Immer wieder hatte er Umwege gewählt, immer wieder hatte er lieber die Gefahren der Natur auf sich genommen, nur um der Begegnung mit Menschen auszuweichen und diese Christin vor dem blinden Haß der Eingeborenen zu bewahren. Anfangs hatte er die Verantwortung, die er trug, nur als Last empfunden, aber inzwischen war daraus der leidenschaftliche Ehrgeiz geworden, sie lebend durch diese Hölle zu führen.
Die beiden schwarzen Treiber hatten ihre Gebetsteppiche auf der Erde ausgerollt und knieten gegen Osten gewandt nieder. Die beiden Reiter blieben zu Pferd. Sie waren noch in die wollenen Tücher gehüllt, die sie gegen die Kälte der Nacht geschützt hatten. Mit einer Bewegung voller Ungeduld löste der eine jetzt die um Kopf und Hals geschlungenen Schals. Aus der Vermummung tauchte ein Frauengesicht, blauschwarzes Haar fiel den Rücken hinunter. Caroline richtete sich in den Steigbügeln auf. Die Sonnenscheibe wuchs mit jeder Sekunde. Schon begannen die Schatten kürzer zu werden. An den fernen Hügeln verweilten sie noch, ein letzter zitternder Hauch, um auf einen Schlag zu verschwinden. Es war Tag, grelle, erbarmungslose Helligkeit, die zwölf Stunden andauern würde. Sie legte die Hand über die Augen. Dort, im Osten, würde irgendwann die Kuppel der Moschee von Timbuktu auftauchen. Es hatte viele Stunden gegeben, in denen die Wüste auf Caroline wie Opium wirkte, eine Droge des Vergessens, der sie sich begierig hingab. Aber an diesem Morgen empfand sie nur Ungeduld. Ihr Blick folgte der verwehten Spur, die sich breit wie eine Straße durch den gelben Sand zog.
Die Karawane. Seit vielen, vielen Wochen verfolgten sie die nach Timbuktu ziehende Goldkarawane aus Abomey, an ausgetretenen Feuerstellen, Essensresten und dem Kot der Kamele ablesend, wie viele Tagesmärsche sie von ihr trennten. Viel zu langsam für Carolines Ungeduld hatte der Abstand sich verringert. Gestern abend endlich hatte Rasim, auf einen abgefressenen Distelbusch deutend, stolz verkündet, daß die Karawane nur noch zwölf Stunden Vorsprung haben könne. Einen Tagesritt noch, dann würden sie sie eingeholt haben, und Caroline würde ihr Kind in den Armen halten. In Timbuktu sollte Sinaida mit dem Kind warten, falls es ihr nicht vorher schon gelingen sollte, zur Karawane zu stoßen.
Giliane, ihr Kind. Bei dem Gedanken schlug Carolines Herz schneller. Nein, sie konnte nicht mehr warten bis Timbuktu. Sie mußten die Karawane schon vorher einholen. Sie mußte weiter. Ihre Unruhe übertrug sich auf das Pferd. Es warf den Kopf hin und her, tänzelte nervös. Warum gab der Anführer nicht das Zeichen zum Aufbruch?
Die schwarzen Treiber hatten ihr Gebet beendet, ihre Gebetsteppiche zusammengerollt und verschnürt. Es war Rasim, von dem die Verzögerung ausging. Er war an den Rand einer Senke getreten. Caroline lenkte ihr Pferd an seine Seite. Rasim wies den Rand der Senke hinunter, und jetzt sah auch Caroline, was er entdeckt hatte: in einer Mulde, halb von Treibsand zugeweht, lag der Kadaver eines Kamels. Die durchschnittenen Gurte, an denen ursprünglich Warenballen befestigt gewesen sein mußten, hingen schlaff über den Rücken. Caroline wandte den Blick. Sie hatte auf Rasims Gesicht noch nie einen solchen Ausdruck des Entsetzens gesehen wie jetzt. Er hatte einem der schwarzen Treiber ein Zeichen gegeben. Dieser ließ sich den Abhang hinuntergleiten. Er beugte sich über das tote Tier, untersuchte es. Als er zurückkam, rief er Rasim in einem für Caroline unverständlichen Dialekt etwas zu.
»Was gibt es?« fragte Caroline unwillig. »Ist nicht jeder Karawanenweg mit Kadavern gesäumt? Warum reiten wir nicht weiter?«
Wieder antwortete Rasim nicht sofort. Mit Augen, die zu Schlitzen verengt waren, starrte er in die Wüste hinaus, als suche er dort Antwort. Was sollte er erwidern? Es war richtig. Überall unter dem Sand lagen die Gebeine von Menschen und Tieren. Aber dieses Kamel war nicht an Entkräftung gestorben. Es war von einer Kugel getötet worden, ohne daß es dafür einen Grund gab – es sei denn . . . Er hob den Kopf. »Es ist ein Tier der Goldkarawane. Es war stark und gesund, als es getötet wurde.«
»Heißt das, die Goldkarawane ist überfallen worden?« Ramon Sterne hatte diese Frage gestellt.
»Das ist es, was mich beunruhigt«, sagte Rasim zögernd. »Die Goldkarawane hat einen starken Geleitschutz. Niemand würde es wagen, sie anzugreifen.« Nur einer, dachte Rasim, nur einer begann seine Angriffe auf diese Art: Khalaf. Aber der Name kam nicht über seine Lippen. Ihn auszusprechen hieß das Unglück heraufbeschwören.
Noch war es kühl. Ein, zwei Stunden konnten die Tiere noch im Trab laufen. Vielleicht war es das beste, sich der großen Karawane anzuschließen, dachte Rasim. Die Goldkarawanen von Dahomey waren bewaffnet, als zögen sie in den Krieg. Er, Rasim, konnte ihnen sagen, wie man sich gegen die Überfälle Khalafs verteidigen mußte; nicht umsonst war er drei Jahre mit Khalafs Räuberbanden durch die Wüste gezogen. Er trieb sein Kamel an.
Der Himmel hatte sich mit einem weißen Dunstschleier bezogen. Wind war aufgekommen, ohne Kühlung zu bringen. Kein Laut war zu vernehmen, außer dem Tritt der Tiere und dem harten Rascheln des Sandes, der vor dem heißen Wind dahinkroch. Rasim trieb die Kamele zur Eile. Auf den Höhenkämmen im Westen lagerten regungslos dichte Schwaden bläulichen und gelblichen Dunstes. Er wußte, was das zu bedeuten hatte. Schon lange beobachtete er diese Vorzeichen des Sturmes. Immer wieder suchte er den Horizont nach der Silhouette der Dattelpflanzung ab, die den nächsten Brunnen markierte. Dort würde auch die Karawane haltmachen. Es konnte nicht mehr weit sein. Jeden Augenblick mußte der weiße Lichtschleier zerreißen und die Oase sichtbar werden. Rasim klopfte seinem Reittier aufmunternd den Hals, als er den Schatten gewahrte, der über den Himmel glitt. Die gelbe Wolke hatte sich von den Bergkämmen gelöst und entrollte sich jetzt wie ein riesiges Tuch. Während es näher kam, bildeten sich vor ihm zwei gewaltige Staubsäulen.
»Absitzen! Stellt die Tiere im Kreis auf!«
Erst Rasims Schreie machten Caroline auf die Gefahr aufmerksam. Sie hatte wohl den Wind gespürt, der ihr glühenden Sand ins Gesicht peitschte, aber ihre Gedanken waren ihr weit vorausgeeilt. Sie schwang sich vom Pferd. Die schwarzen Treiber versuchten die widerstrebenden Kamele zu einem dichten Kreis zusammenzudrängen. Die Sonne war verschwunden, ausgelöscht von Schwaden gelbgrauen Dunstes. Ein gespenstisches, ockerfarbenes Flakkern war in der Luft, hüllte den Trupp ein. Für Sekunden hatte der Wind ausgesetzt. Je näher die Wolke kam, um so dunkler wurde sie. Caroline fühlte sich von zwei Armen ergriffen. Ein Tuch fiel über ihr Gesicht. Im selben Augenblick stürzte eine Flut von Staub und Sandkörnern aus dem Himmel. Mit doppelter Gewalt wirbelte der Sturm den Sand um Tiere und Menschen.
Wie von unsichtbaren Händen gestoßen, taumelte Caroline voran. Der Sturm, der jede Sekunde aus einer anderen Richtung zu kommen schien, riß den Mantel, den Sterne um sie geschlagen hatte, weg. Sand peitschte ihr in Augen und Mund. Fast blind, ohne jedes Gefühl für die Richtung, hastete sie an der Seite Sternes vorwärts. Irgendwoher klangen das ängstliche Wiehern der Pferde, das Schreien der Kamele und dazwischen Rasims verzweifelte Rufe. Durch den Schleier des wirbelnden Sands sah Caroline, wie eines der Kamele sich vom Führungsseil der Treiber losriß. Der Sturm erfaßte das große Tier. Die schweren, prallgefüllten Wasserschläuche an seinem Leib schlugen hin und her. In wildem Galopp jagte das Kamel auf eine Sanddüne zu. Die Vorderbeine sanken zur Hälfte ein. Noch ein Satz – wie ein Spielzeug versank das Tier, der gelbe Sand schloß sich über dem braunen Tierkörper.
Caroline riß sich von Sterne los. »Das Kamel mit dem Wasser!« schrie sie. »Das Wasser!« Aber Sterne hielt sie zurück. Er zog sie mit sich. Sie stolperten über entwurzelte Sträucher. Vom Sturm ausgerissene Grasbüschel flogen durch die Luft. Der Sand drang durch Carolines Gewänder. Sie hatte die Körner auf den Lippen, im Mund, im Hals. Sie konnte kaum noch atmen. Rasims Rufe waren nicht mehr zu hören. Die ängstlichen Schreie der Tiere waren verstummt. Es gab nur noch das Zischen und Fauchen des Sturms, den glühenden Regen aus Sand, der auf sie herunterprasselte.
Caroline wußte nicht, ob Minuten oder Stunden vergangen waren, als es plötzlich hell vor ihren Augen wurde. Ebenso jäh wie der Sandsturm sie überfallen hatte, ließ er von ihnen ab. Benommen blieb sie stehen, blickte um sich. Ein paar Meter hinter ihnen jagte die Wetterwand, die unvermittelt eine neue Richtung genommen hatte, gegen Süden. Sie schlug den Schal aus dem Gesicht. Weit und breit war niemand zu sehen. Kein Laut, keine Spur. Rasim, die schwarzen Treiber, die Kamele, die Pferde – es war, als hätte der Erdboden sie verschluckt.
Caroline sah wieder das im Sand versinkende Kamel vor sich. Bei dem Gedanken spürte sie Durst. Ihre Zunge klebte am Gaumen. Sie hatte den Mund voll Sand. Sie versuchte zu schlucken, aber ein krampfartiger Schmerz zog ihr die Kehle zusammen. Sie befanden sich in einem wirren Geäder flacher, ausgetrockneter Flutrinnen. Die sandige Fläche war mit Blöcken aus rotem Stein übersät, grotesk aufgetürmt und von Sandstürmen so unterhöhlt, daß sie jeden Augenblick umzufallen drohten. Caroline hob den Kopf. Ein menschlicher Laut, das Echo eines Rufes lief das Tal entlang, brach sich jenseits an den grüngrau gestreiften Felsen, die wie die Mauerreste einer versunkenen Stadt aus dem Sand ragten.
Sterne legte die Hände an den Mund, erwiderte den Ruf. Sie warteten. Endlich hörten sie aus einem Seitental die Antwort. Minuten später tauchte zwischen den Felsen der blaue Mantel Rasims auf. Er war allein und zog ihre beiden Pferde am Zügel hinter sich her. Die Tiere wieherten ängstlich. Es war, als begriffe Caroline erst jetzt, was geschehen war. Sie blickte an sich hinunter. Sie sah die dicke gelbe Schicht auf ihren Stiefeln. Sie schüttelte den Sand aus ihren Gewändern. Sie riß sich die Schals herunter. Überall am Körper spürte sie den Sand, hart und trocken, Millionen von Stacheln, die sich in ihre Haut bohrten. Überall war Sand, in den Schuhen, unter den Fingernägeln.
Langsam kam Rasim näher. Sein Gesicht war mit einer Schicht aus gelbem Sand bedeckt, die nur den nach Luft ringenden Mund und die tief in den Höhlen liegenden Augen freiließ. Ohne ein Wort übergab er Sterne die Pferde und zog dann ein Stück zusammengelegtes Papier aus seinem Gewand. Es war eine abgegriffene, an den Falten zerschlissene Karte. Sorgsam faltete Rasim sie auseinander und breitete sie auf dem Boden aus. Er kniete sich hin und beugte sich darüber. »Wo sind wir hier?« fragte Caroline. »Sind wir weit vom Weg abgekommen?«
Rasim kniete über der Karte, in der Hand den Kompaß. Zwischendurch blickte er auf. Suchend glitten seine Augen über die Ebene hin. In der Ferne tauchten jetzt winzig klein die Treiber mit den Kamelen auf. Rasim faltete die Karte zusammen und erhob sich. »Der Sturm hat uns weit abgetrieben.« Er blickte Caroline und Sterne an. »Und wir haben keinen Tropfen Wasser mehr.«
»Dann haben wir das Kamel mit den Wasservorräten verloren?« fragte Caroline.
Rasim nickte. »Es ist in den Treibsanddünen umgekommen.« Er sah an ihr vorbei in die Wüste. Dieses Gebiet war ihm nicht fremd. Es war eine der unwegsamen Gegenden, die Khalafs Bande mit Vorliebe als Schlupfwinkel benützte. Keine Stunde weit von hier gab es, wie ihm seine Karte verraten hatte, einen Brunnen mit gutem Wasser. Es war eine der geheimen Wasserstellen, die kein Karawanenführer kannte. Sie gehörte Khalaf, und es war Wahnsinn, dort hinzureiten, vor allem mit diesen Fremden. Er war jetzt beunruhigt. Zuerst das von Khalafs Leuten getötete Kamel. Dann der Sandsturm. Der Verlust der Wasservorräte. Hatte das Glück sie verlassen? »Es gibt eine Wasserstelle«, sagte er, »eine Stunde von hier, aber es ist gefährlich, sie aufzusuchen.«
»Gefährlicher, als zu verdursten?«
Rasim sah Caroline an. Ihr Gesicht lag im Schatten der weißen Tücher. Auf ihren feingezeichneten, dunklen Brauen haftete etwas Sand, glitzernd wie Tau. Während der ganzen zehn Wochen der Reise von Dahomey bis hierher hatte er keinen Augenblick der Schwäche an dieser Frau erlebt. Nicht einmal jetzt schien sie erschöpft.
Er lächelte. »Ihr habt recht. Aber wir müssen auf der Hut sein. Der Brunnen könnte von seinem Besitzer bewacht werden. Bewaffnet euch.« Wieder vermied er es, den Namen Khalafs auszusprechen.
Die Treiber waren mit den Kamelen herangekommen. Das rauhe, struppige Fell der Tiere starrte vor Sand. Rasim zog die gelockerten Gurte des Gepäcks nach. Er öffnete die Munitionstasche und nahm Patronen heraus. Er verteilte sie an die beiden Treiber, die sie in ihren Gürteln verschwinden ließen. Er nahm vier Flinten aus dem Ledersack, prüfte sie und gab jedem eine. Er selbst behielt zwei.
Caroline saß bereits im Sattel. Sie spürte Sternes Blick auf sich. Immer waren seine Augen da, etwas Warmes, das sie umfing und ihr sagte, daß sie nicht allein war, daß zwischen ihr und der Gefahr jemand stand. Sie sah ihm zu, wie auch er die Pistole aus der Satteltasche zog und das Magazin füllte. Mit wilden Rufen trieb Rasim die Kamele zum Aufbruch.
Das Wadi El-rek verlief wie eine breite, friedvolle Straße zwischen den senkrechten Bergwänden. Der Boden war von Lehmstreifen durchzogen, die sich nach Überflutungen abgesetzt hatten und die, von salzigem Schlamm zersetzt, so brüchig waren, daß die Kamele bei jedem Schritt durch die obere Sandlage bis zu den Fesseln durchbrachen. Nach vier Meilen mündete das Wadi in eine Art Arena aus messerscharfem Kiesel. Die Tiere zuckten bei jedem Schritt zusammen. Die Treiber mußten sich Sandalen anschnallen, um sich nicht die Füße aufzureißen. Rasim hatte diesen für Tiere und Treiber so unangenehmen Weg mit Absicht gewählt, denn er wurde von Khalafs Leuten nur im Notfall benützt. Er verlangsamte das Tempo seines Tieres, als er in den hinter blauschwarzen Lavafelsen versteckten Talkessel einbog. Vorsichtig Ausschau haltend, bahnte er den Weg durch das dichte Dornengestrüpp. Am Boden konnte er keine Spuren entdecken, aber das besagte nichts. Sein Blick suchte die mit Tamariskengestrüpp bewachsenen Hänge des Talkessels nach den weißen Burnussen von Khalafs Leuten ab, doch das Muster, das die gefiederten Zweige zusammen mit dem hellen Sand bildeten, war nirgends unterbrochen.
Rasim hatte sein Tier angehalten. Seine geübten Augen hatten den Brunnen in der Mitte des engen Talkessels entdeckt. Er ließ sein Kamel in die Knie gehen und stieg ab. Mit bloßen Händen begann er die dünne Sandschicht beiseite zu fegen, bis die Bretter sichtbar wurden, die den gemauerten Brunnen abdeckten.
Caroline zügelte ihr Pferd. Sie sah, wie Rasim die Bretter wegschob. Der Rand des Brunnens wurde sichtbar. Es schien ihr, als wäre es plötzlich kühler.
Sterne reichte ihr den Becher, den er vom Brunnen geholt hatte. Sie trank von dem Wasser. Es war kalt und leicht salzig. Vor ein paar Minuten noch war sie vor Verlangen nach diesem Wasser fast gestorben. Jetzt kostete es sie Überwindung, davon zu trinken. In ihrem Rücken war ein Frösteln. Was ließ die Sonne plötzlich so kalt werden, daß sie fror? Sie hörte Rasims Rufe. Er als einziger hatte sich keine Zeit genommen zum Trinken. Er hatte die Wasserschläuche gefüllt und im Gepäck der Tiere verstaut. Er trieb die Schwarzen zur Eile an, als fürchte er diesen Ort.
Caroline spürte das Beben, das durch ihr Pferd lief. Sie fuhr ihm beruhigend durch die Mähne. Ein leises Knistern war plötzlich in der Luft, das Geräusch rieselnden Sandes. Caroline wandte sich im Sattel um. Die Hänge des Talkessels begannen Schatten zu werfen. Die sinkende Sonne verwandelte die Luft in Millionen goldener Plättchen. Der Reiter, den Caroline jenseits am Rand des Talkessels auftauchen sah, schien aus einem goldenen Vorhang zu treten. Er war ganz in Weiß, der Turban, der Burnus, die Stiefel. Ein weißes Phantom auf einem weißen Pferd. In seiner Hand blitzte etwas auf. Ein Schuß peitschte durch die Luft. Der Sand vor den Hufen von Carolines Pferd wirbelte auf. Caroline zügelte ihr aufsteigendes Pferd. Sie riß das Tier herum – da erblickte sie hinter sich zwei andere Reiter. Lautlos waren sie herangeritten, auch sie ganz in Weiß, auf weißen Pferden. In ihren Händen lagen funkelnd die entsicherten Waffen.
3
Caroline umklammerte die Zügel, stemmte sich fester in die Steigbügel. So überrumpelt sie von diesem Überfall auch war, so furchtlos blickte sie den Männern entgegen. Sie wußte, daß sie in eine neue Gefangenschaft nicht gehen würde. Die drei Reiter nicht aus den Augen lassend, zog sie die Pistole. Sie entsicherte die Waffe, als eine Hand sich über die ihre legte. Es war Sterne, der nahe an sie herangeritten war.
»Steckt die Waffe weg«, flüsterte er. »In einem Kampf würden wir immer unterliegen. Ich werde mit den Männern reden.«
Er ritt den Beduinen entgegen, den Arm halb gehoben zum Zeichen, daß er unbewaffnet war. Sie hörte, wie er den fremden Reitern den Gruß anbot, mit dem die freien Beduinen der Wüste sich begrüßten. Ohne Hast zog Sterne jetzt etwas aus seinem Gürtel. Es war ein viereckiges Stück grüner Seide, auf das mit Goldfaden arabische Schriftzeichen gestickt waren. Er hielt es den Reitern hin.
Mit Verwunderung blickte Caroline auf dieses Zeichen, und ebenso groß schien die Überraschung bei den Reitern zu sein. Sie ließen die Waffen sinken. Ihre Mienen, auf denen Kampflust stand, hellten sich auf, blieben aber mißtrauisch. Es schien, daß sie lieber Feinden begegnet wären als diesen Fremden, die sich als Freunde entpuppten. »Was ist Euer Ziel?« fragte der Ältere schließlich, ein Mann mit gelber Haut und einem schwarzen Knebelbart.
»Timbuktu«, antwortete Sterne. »Wir sind in einen Sandsturm geraten und dadurch vom Weg abgekommen. Und wir haben das Kamel mit dem Wasservorrat verloren.«
»Und zufällig habt Ihr diesen Brunnen gefunden!« Der Blick des Beduinen ging in die Runde. Seine Augen wurden hart, als er Rasim gewahr wurde. Es schien fast, als würde er die Beherrschung verlieren, denn er hob die Waffe und richtete sie auf den Anführer des Trupps. Doch dann besann er sich anders. Er rief seinen beiden Begleitern einen Befehl zu. Rasim stand wie versteinert da. Sein sonst so lebhaftes Gesicht war stumpf und von jeder Regung entleert. Er wehrte sich nicht, als die Beduinen sich auf ihn stürzten, ihm die Waffen entrissen, ihn durchsuchten. »Bindet ihn auf sein Kamel«, rief der Beduine mit dem Knebelbart, »und nicht zu zaghaft. Wir werden schnell reiten, und wir wollen ihn nicht verlieren. Nicht wahr, Rasim, du brennst schon darauf, Khalaf wiederzusehen?«
Das rachsüchtige Lächeln stand noch auf dem Gesicht des Beduinen, als er sich an Sterne wandte. »Ihr tragt zwar das Zeichen des Deys von Algier mit Euch«, fuhr der Beduine fort, »doch muß ich Euch bitten, mit uns zu kommen.«
Caroline hatte nur verstanden, daß sie mit diesen Männern reiten sollte. Warum? Was gab ihnen das Recht? Wer waren sie, daß allein ihr Erscheinen genügte, um jeden Widerstand im Keim zu erstikken? Die Arme auf den Rücken gefesselt, saß Rasim auf dem Kamel. Wie konnte es sein, daß dieser unerschrockene Mann, als den sie ihn kannte, sich so widerstandslos in sein Schicksal ergab, als hätte ihn allein der Anblick der Beduinen gelähmt? Die schwarzen Treiber, immer noch bewaffnet, standen stumm daneben. Caroline hätte ihnen am liebsten den Befehl zu schießen gegeben. In ihr bäumte sich alles auf. Es war unsinnig, daß sie, die in der Überzahl waren, sich dem Willen der drei Beduinen unterwarfen. Jetzt noch hatten sie es in der Hand, sich zu befreien. Sie blickte zu Sterne. Den Kopf etwas geneigt, die Hände auf dem Hals des Pferdes, saß er im Sattel. Caroline verstand ihn nicht. Sie fühlte sich von ihm im Stich gelassen.
Auf den Befehl des Anführers der Beduinen lieferten die beiden schwarzen Treiber ihre Waffen ab und bestiegen dann zu zweit eines der Kamele. Die Beduinen steckten die erbeuteten Waffen in einen Ledersack und schwangen sich zu Pferd. Jeder führte ein Kamel am Zugseil. Die Seile strafften sich, als die Beduinen ihre Pferde unvermittelt herumrissen und mit lauten Schreien den Hang des Talkessels hinaufsetzten. Caroline, die noch immer auf eine plötzliche Wendung hoffte, sah plötzlich den Mann mit dem Knebelbart neben sich. Er griff ihr in die Zügel. Das Pferd gehorchte seinem Willen, und wie vorher der Sturm, so riß sie jetzt das Pferd mit sich fort.
Sie flogen in einer Wolke rosafarbenen Sands dahin. Die Pferde schienen die Erde kaum zu berühren. Das Schlagen ihrer Hufe wurde zu einem unwirklichen Geräusch, zum jagenden Rhythmus einer unterirdischen Trommel, die sie immer schneller vorwärtstrieb. Die Pferde waren naß vor Schweiß. Der Beduine, der zwischen Caroline und Sterne ritt, wich nicht von ihrer Seite. Als Mann, der Menschen danach beurteilte, wie sie zu reiten verstanden, war sein Mißtrauen gegen die beiden Fremden während des halsbrecherischen Ritts in Sympathie umgeschlagen. Wer immer sie waren, als Reiter waren sie ebenbürtig; sie waren zu Recht im Besitz des Zeichens des Wilden Omar, des Deys von Algier.
Die Sonne war untergegangen. Der Abend stieg herauf, tauchte alles in rötliche Glut: die weißen, flatternden Mäntel der Beduinen, das glänzende Fell der Schimmelstuten – und auch die weißen Zelte, die plötzlich im Schatten eines dürftigen Palmenhains sichtbar wurden. In vollem Galopp sprengten die Männer darauf zu. Sie parierten die Pferde erst, als sie auf dem freien Platz inmitten der Zelte angelangt waren. Für Augenblicke war alles in Staub gehüllt. Stimmen schwirrten durcheinander. Als der Staub sich legte, sah Caroline eine Traube von Männern, die Rasim umringte.
Die Beduinen hatten Rasim vom Kamel losgebunden. Sie zerrten ihn an seinen Fesseln zu Boden. Noch immer war sein Benehmen das eines Schlafwandlers. Ihn vor sich her stoßend, führten sie Rasim weg zu dem großen Zelt im Hintergrund.
»Was werden sie mit ihm machen?« sagte Caroline.
»Er hat einen Brunnen benützt, der Khalaf gehört.«
Caroline sah Sterne verständnislos an. »Die Brunnen der Wüste gehören allen.«
»Aber die Wüste gehört Khalaf.«
»Ist er ein Scheich?«
»Er ist ein Räuber. Ein Freibeuter, der sich sein eigenes Königreich geschaffen hat, als er sah, daß alle anderen Königreiche schon verteilt und verbrieft waren. Sie nennen ihn den Herrn der Wüste.«
»War das Khalafs Zeichen, das Ihr den Beduinen gezeigt habt?« fragte sie. »Woher habt Ihr es?«
»Es ist das Zeichen des Deys von Algier, den sie den Wilden Omar nennen, den Herrn der Meere. Khalaf ist sein Sohn.«
Caroline hörte nicht mehr zu. Was würde mit ihnen geschehen? Wie lange würde das Zeichen sie schützen können? Warum warteten sie? Warum nutzten sie nicht die Gelegenheit? Noch saßen sie zu Pferd. Die Männer waren abgelenkt. Keiner würde es merken, oder erst, wenn sie außer Schußweite waren. Caroline straffte sich.
Sterne'erriet ohne Worte, was in ihr vorging. Er selber hatte während des ganzen Ritts an nichts anderes gedacht. Aber in diesem Augenblick wäre es Wahnsinn gewesen. »Geduldet Euch! Laßt uns warten, bis es Nacht ist«, flüsterte er ihr zu.
Caroline senkte den Kopf wie immer, wenn es ihr nicht gelang, ihren Willen auf Anhieb durchzusetzen. Warten war etwas, das sie nicht konnte und das sie nie lernen würde. Sie spürte die Nähe der großen Karawane. Sie mußte zu ihrem Kind. »Und die Karawane?« sagte sie.
»Khalafs Männer werden uns den Weg zu ihr weisen.« Sterne wollte nicht weitersprechen, Caroline nicht beunruhigen; aber er sah, daß sie die Wahrheit bereits ahnte, und außerdem war sie eine Frau, die die Wahrheit vertrug. »Bisher war es nur eine Vermutung«, fuhr er fort, »aber jetzt bin ich sicher. Rasim muß es auch geahnt haben. Khalaf wird die Goldkarawane überfallen.«
»Noch in dieser Nacht?«
»Es ist die letzte Nacht vor Timbuktu, und damit die beste. Sie werden sich schon in Sicherheit glauben, wenn er angreift.« Sterne brach ab. Einer der Männer kam auf sie zugelaufen, machte ihnen ein Zeichen, ihm zu folgen.
Rasim war verschwunden; die Kamele und die schwarzen Treiber hatte man weggeführt. Sie ritten dem Beduinen nach, an leeren Zelten und gelöschten Feuerstellen vorbei, auf einen Platz, der von den Hufen der Pferde aufgewühlt war. Ein Trupp Reiter war eben aufgesessen. Die Pferde tänzelten unruhig, aber Caroline hatte nur Augen für den Mann auf dem weißen Hengst in der Mitte.
»Das ist er, Khalaf«, flüsterte Sterne. Er hätte es nicht zu sagen brauchen. Der Herr der Wüste saß stolz im Sattel. Sein purpurroter Burnus fiel über den Rücken des Schimmels. In seinem Gürtel funkelte der mit Smaragden besetzte Knauf eines Dolchs. Sein Gesicht lag im Schatten des breit ausladenden Turbans aus purpurrotem Kaschmir. Mit einem herrischen Wink bedeutete er Caroline und Sterne, näher zu kommen. Er musterte sie schweigend. »Man sagte mir, daß ihr das Zeichen meines Vaters bei euch tragt. Zeigt es mir!«
Sterne zog das Stück grüner Seide aus dem Gürtel. Er beugte sich über den Kopf seines Pferdes und reichte es Khalaf. Khalaf nahm das Tuch in beide Hände, drückte es an die Stirn, dann an die Lippen.
Einen Augenblick spielte Sterne mit dem Gedanken, sich zu erkennen zu geben. Aber was hätte es für einen Sinn, da er entschlossen war, noch in dieser Stunde das Gastrecht, das ihm Khalaf gewähren würde, zu brechen und ihn zu verraten.
»Die Freunde meines Vaters sind auch meine Freunde«, sagte Khalaf. »Seid willkommen.« Er wies über das Lager. »Man wird ein Zelt für euch herrichten. Ruht euch aus. In einigen Stunden werde ich nach euch schicken. Ich hoffe, ihr erweist mir die Ehre, an meinem Mahl teilzunehmen.« Er gab seinen Männern ein Zeichen. Mit einer Hand die Zügel führend, setzte er sich an die Spitze der Reiter. Die plötzlich hereinbrechende Dunkelheit verschluckte den Mann in dem purpurroten Burnus. Nur die flatternden weißen Mäntel seiner Männer blieben sichtbar.
Lautlos, als hätten die Pferde Watte unter den Hufen, verschwand der Trupp in der Nacht.
Dunkelheit hatte sich über alles gebreitet, schwarze, undurchdringliche Nacht. Caroline und Sterne kauerten schweigend in dem Zelt, in das ein Beduine sie geführt hatte. Sie hörten, wie er draußen die Pferde anpflockte und ihnen Heu hinwarf. Sie warteten, bis seine Schritte sich entfernten.
Ramon Sterne erhob sich. »Ich bin gleich zurück. Wartet hier.« Er schlüpfte aus dem Zelt ins Freie.
Caroline erschien es wie eine Ewigkeit, und doch waren es nur Minuten, bis er zurückkam, so lautlos, daß sie ihn erst bemerkte, als er mit dem weißen Mantel vor ihr stand. Er legte den Burnus um Carolines Schultern, den anderen streifte er selber über. »Diese Mäntel werden uns besser schützen als die Dunkelheit.« Er teilte den Zeltvorhang. Geduckt traten sie hinaus. Sie blickten um sich, lauschten. Das Lager schien verlassen. Auch die Feuerstellen waren ausgetreten.
Sie schlichen leise zu den hinter dem Zelt angepflockten Pferden. Sterne durchsuchte die Satteltaschen. Ihre Waffen waren noch da. Er reichte Caroline ihre Pistole, einen Beutel mit Patronen. Er wandte sich zum Gehen. »Und die Pferde?« fragte Caroline.
Sterne schüttelte den Kopf. »Unsere Tiere sind zu müde. Ich weiß, wo wir schnellere finden.« An den verlassenen Zelten vorbei eilte er voraus, zu dem Gehege der Pferde. Die Tiere drängten sich an den Zaun und hoben schnaubend die Köpfe. Über einem Pfosten hingen Sättel und Zaumzeug.
Sterne führte zwei Pferde aus dem Gehege, sattelte sie, alles fast ohne Geräusch. Er ließ Caroline die Zügel halten. Er zerriß den mitgebrachten groben Rupfen in Streifen, bückte sich und umwikkelte damit die Hufe der Pferde. Seine Augen leuchteten, als er sich aufrichtete.
Es war zu dunkel, um die Spur von Khalafs Reitertrupp zu erkennen, aber die Pferde folgten ganz von selbst der Witterung. Nach einer knappen Viertelstunde tauchte vor ihnen die schemenhafte Silhouette des Trupps auf. Der Boden, auf dem sie ritten, mußte hartes Gestein sein, denn das Geklapper der Hufe klang deutlich herüber. Sterne lenkte sein Pferd seitwärts, und Caroline folgte ihm. Etwa achtzig Fuß weiter links fanden sie eine mit Sand bedeckte Flutrinne, ein Untergrund, auf dem der Tritt der umwikkelten Hufe unhörbar war, selbst wenn sie scharfen Trab anschlugen.
In der Ferne tauchte ein Lichtschein auf. Noch konnten sie nicht erkennen, ob es das Signal eines Beduinenpostens war oder die Karawane. Sie verhielten einen Augenblick, um sich zu orientieren. Die Nacht war still. Das Hufgeklapper von Khalafs Leibwache war verstummt. Die Männer mußten ihr Versteck, von dem aus sie die Karawane überfallen wollten, erreicht haben. Vielleicht warteten sie auch, um sich mit ihren anderen Trupps zu vereinigen.
Caroline und Sterne ritten weiter. Sie trieben ihre Pferde zur Eile. Längst hatten sich die Stoffetzen von den Hufen gelöst. Vor ihnen öffnete sich ein breites Tal.
In weiter Ferne kam eine Prozession schwankender Lichter gezogen. Die Karawane! Gedämpft drang das monotone Ho-ho-ho der Treiber durch die Stille. Auch Khalafs Männer würden es hören, überall in den Schlupfwinkeln, in denen sie auf das Zeichen zum Angriff warteten. An die Gefahr, entdeckt zu werden, durften Caroline und Sterne jetzt nicht mehr denken.
»Jetzt gilt es«, flüsterte Sterne. »Reitet, ohne Euch umzusehen. Wenn wir die Karawane erreicht haben, aber erst dann, trennen wir uns. Ich werde mit den Führern sprechen. Ihr versucht, Sinaida zu finden. Frauen und Kinder ziehen meist in der Mitte der Karawane.«
Caroline nickte. Die sich immer wiederholenden Rufe der Treiber hatten etwas Friedliches. Sie glaubte ihr Kind vor sich zu sehen, in warme Tücher gehüllt, schlafend, gewiegt vom Schritt eines Kamels. Sternes Augen ruhten auf Caroline. Etwas, das stärker war als er, trieb ihn zu ihr hin. Einen Atemzug lang war ihm, als käme von der Frau, deren Burnus seine Hand streifte, eine stumme Antwort. Er wollte schon nach der Hand greifen, dieser Hand, die zu schmal und zu zart schien, um Pferde lenken und Waffen zu führen – aber dann sah er ihre Augen, die hinaus in die Nacht gerichtet waren, dorthin, wo die endlose Raupe der Karawane das Tal entlangkroch.
Sterne riß das Pferd herum und galoppierte ins Tal hinunter.
Die Lanzenspitzen des bewaffneten Trupps, der vor der Karawane herzog, stachen silbern in das Blau der Nacht. Caroline und Sterne parierten ihre Tiere. Sterne rief dem Anführer den Gruß des Friedens zu. Im nächsten Augenblick waren sie von der Reiterschar umringt. Caroline konnte nicht genug Arabisch, um den Wortschwall des Anführers zu verstehen. Endlich gelang es Sterne, sich ihm begreiflich zu machen. »Bringt die Karawane zum Stehen! Khalafs Bande sammelt sich, dort oben in den Hügeln. Jeden Moment können sie auftauchen. Bewaffnet alle.«