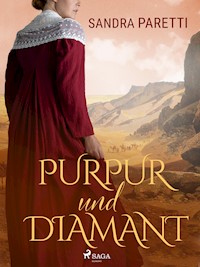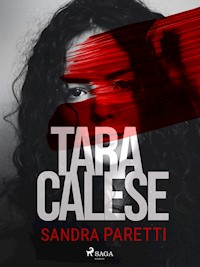Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise, die das Leben für immer verändert. Als die Passagier*innen ihre Reise auf dem Traumschiff Berlin antreten, können sie noch nicht ahnen, dass danach nichts mehr so sein wird wie zuvor. Maja trifft an Bord eine verflossene Liebe wieder und weiß nicht, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen soll. Soll sie dafür etwa ihre langjährige Ehe aufs Spiel setzen? Auch der erfahrene Kapitän trifft bei dieser Reise auf die ein oder andere Überraschung. Ein Roman voller Gefühl und Urlaubsfeeling.Sandra Parettis Erfolgsroman diente als Vorlage zur beliebten TV-Serie "Das Traumschiff" und brachte so den Duft der weiten Welt in die deutschen Wohnzimmer.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Paretti
Südseefieber – Roman zur TV-Serie „Das Traumschiff”
Saga
Südseefieber – Roman zur TV-Serie „Das Traumschiff”
Copyright © 2022 by Helmut and Anka Schneeberger, represented bei AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1986 by Goldmann Verlag, München
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1986, 2022 Sandra Paretti und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728469439
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Leuchtturm Roter Sand
Kapitän Krüger stand auf der Backbordkanzel der Brücke und sah den Wolken zu, die der Westwind über den blauen Himmel trieb. Die Wolken Hollands, die Wolken seiner Kindheit, so niedrig, daß man glaubte, sie fangen zu können.
Aus dem Innern des Schiffes kam das leise Dröhnen der Motoren, für andere Ohren fast unhörbar, für ihn eine vertraute Stimme. Es entging ihm keine Nuance, kein Wechsel im Rhythmus. Jetzt war es ein leises Vibrieren, später nach dem Lichten der Anker, beim Auslaufen aus Bremerhaven, wenn die Schlepper die Berlin weserabwärts zögen, würde es ein zufriedenes Brummen der zwei mächtigen Dampfturbinen werden; draußen im offenen Meer schließlich wird ein Aufatmen durch das Schiff gehen, wird es eintauchen in sein eigentliches Element, seinen Rhythmus finden im Rhythmus der anlaufenden See, die Motoren werden mit voller Kraft drehen und einstimmen in das machtvolle a-Moll des Atlantiks.
Jan Krüger, halb Deutscher, halb Holländer, war ein großer breitschultriger Mann mit einem Seemannsbärtchen im Gesicht. Er strahlte die Ruhe und Wärme eines Menschen aus, der mit seinem Leben zufrieden ist, auch wenn nicht alles so gekommen war, wie er es sich erträumt hatte. Seit vierzig Jahren fuhr Krüger zur See. Auf der Queen Mary hatte er sich vom Kadetten zum Offizier hochgedient; auf der United States war er als Leutnant neben dem Kapitän der zweite Mann an Bord gewesen. Seit 21 Jahren fuhr er nun als Kapitän auf Kreuzfahrten. Dies würde seine letzte sein. Dann ging er in Pension. Seine Frau drängte ihn schon lange, den Schritt zu tun, aber er hatte ihn von Jahr zu Jahr hinausgezögert.
Dorothy. Immer wenn er an sie dachte, regte sich sein schlechtes Gewissen. Er wußte, wie sehr sie sich darauf freute, ihn bald ganz für sich zu haben, ihm dagegen wurde bange bei der Vorstellung, 365 Tage im Jahr in Hamilton zu sitzen – nur noch Ehemann. Dorothy liebte ihn mehr als er sie, viel mehr. Sie hatte ihn geheiratet, nicht er sie, wie das oft so ist bei Männern, die es zu leicht haben bei den Frauen und im entscheidenden Moment nicht wissen, welche die richtige ist. Dorothy überschüttete ihn mit Liebe. Jedes Telefongespräch war ein Gefühlsausbruch. Auf Distanz war das halbwegs erträglich; in den Ferien wurde es bereits zu einer Geduldsprobe, aber wie sollte er das nach der Pensionierung durchstehen. Der Gedanke machte ihm angst. Er würde täglich auf den Golfplatz flüchten, nur um ein paar Stunden Pause zu haben und auszulüften. Tutti von Falkenhayn hatte ihn gewarnt vor Dorothy, drastisch wie es ihre Art war: »Zu viele Gefühle sind für einen Mann wie Prügel für einen Hund. Er läuft dauernd mit schlechtem Gewissen herum.« Weise Tutti. Ihretwegen hatte wahrscheinlich nie ein Mann ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie hatte keinen angeschmachtet, sie hatte die Männer schmachten lassen. Und sie fand immer noch Verehrer, obwohl sie bald siebzig war. Aber vielleicht machte er sich unnötig Sorgen, vielleicht war Dorothy im Alltag nicht so anstrengend, wie er fürchtete. Im Grunde hatten sie bisher keine Ehe geführt, sondern nur Urlaube zusammen verbracht. Da hast du dir was Schönes eingebrockt, sagte er sich, das Schwierigste hast du dir für den Schluß aufgehoben – ein Ehemann zu werden.
Die Schiffssirene unterbrach seine Gedanken. Der lange dunkle Ton signalisierte, daß man nun die Gangway einholen würde. Die Sirene war noch nicht verklungen, da ging die Tür auf, und Zahlmeister Stanek kam herein.
Stanek hatte einen Vornamen wie jeder getaufte Christ, aber den kannte niemand, alle nannten ihn nur Stanek. Er war mittelgroß und unscheinbar; man sah ihm nicht an, daß er fast unbegrenzt belastbar war. Nicht einmal in den hektischen Stunden vor Abfahrt des Schiffes gab es Anzeichen dafür, daß Stanek aus der Reserve seiner Nervenkraft schöpfte. Im Gegenteil, je größer der Streß, desto ruhiger wurde Stanek. Wenn alles drunter und drüber ging, wie heute mit den Arabern, entwickelte er die wunderbare Fähigkeit, im voraus zu ahnen, wo sich eine Katastrophe anbahnte, egal ob im Laderaum, in der Küche oder am Swimmingpool – und sie in letzter Sekunde zu verhindern.
Kapitän Krüger sah Stanek fragend an: »Alles unter Kontrolle?«
Stanek blies die Backen auf und stieß die Luft aus: »Was heißt unter Kontrolle. Der Laderaum ist ein Falkenhof. Und vom Gepäck reden wir lieber nicht, zwanzig Koffer, richtige Schiffskoffer, wie man sie sonst gar nicht mehr hat.«
Krüger lachte: »Das Gepäck ist unbegrenzt.«
»Gepäck schon, aber Jagdfalken, läuft das auch unter Gepäck?«
»Haben Sie Scheich Mehmed die Safes in den Kabinen gezeigt?«
»Ja, aber er möchte nichts deponieren.«
»Und wenn etwas wegkommt?«
»Er hat Leibwächter. Und er behauptet, seine Leibwächter hätten bisher noch jeden Dieb erwischt, bevor er auch nur eine Dollarnote klauen konnte.« Stanek griff in die Jackentasche. »Wenn der Scheich Dollarnote sagt, meint er so was.« Er hielt Käptn Krüger eine 500-Dollarnote hin. »Nicht schlecht, was. Der Scheich nannte es eine kleine Aufmerksamkeit, und ich sagte, ein Trinkgeld von der Größe nähme ich nur mit Autogramm, denn ich hätte keine Lust, von seinen Leibwächtern über Bord geworfen zu werden.« Stanek steckte den Geldschein wieder zu sich.
»Wie viele Leibwächter sind es eigentlich?«
»Zwei. Aber die diversen Diener scheinen mir auch scharf zu sein.«
»Haben Sie die Passagierliste mitgebracht? Ich würde sie gern mit Ihnen kurz durchgehen.«
»Tut mir leid, aber wir sind noch nicht komplett. Es gibt immer wieder Leute, die glauben, auf ein Schiff kann man im letzten Moment aufspringen wie auf eine U-Bahn.«
Man wollte gerade die Gangway wegnehmen, als ein hupendes Taxi auf dem Columbus Kai auftauchte. Mit quietschenden Bremsen hielt es bei der Berlin, und Petra Koch sprang heraus. »Wartet«, rief sie den Männern an der Gangway zu, »wartet doch.« Während Irene den Taxifahrer bezahlte, nahm Petra ihr Gepäck aus dem Kofferraum und rannte zur Gangway. »Wir sind ja schon da!«
Der Erste Offizier, der oben an der Gangway stand, schluckte. Eine Rothaarige, ich werd’ verrückt, eine Rothaarige, und was für eine. Er gab den Männern ein Zeichen zu warten.
Atemlos kam Petra die Gangway herauf. Sie schleppte einen Koffer und eine große Reisetasche. Sie war Anfang Dreißig. Das rote Haar flog im Wind, unter dem feinen Leder ihrer roten Jacke zeichneten sich deutlich die Brüste ab. Stefan hatte einen Blick dafür, sie trug keinen BH. Er setzte die Mütze etwas tiefer in die Stirn und machte sein Dienstgesicht. »Willkommen an Bord. Das war knapp.«
Petra tat erstaunt: »Sind wir die letzten?«
»Wir dachten, daß Sie nicht mehr kommen. Sie sind seit einer Stunde überfällig. Wir haben Ihre Kabine vergeben, tut mir leid.«
»Wie war das?« Petra stellte den Koffer ab und ließ die Reisetasche direkt vor Stefans Füße plumpsen. »Sie haben unsere Kabine weggegeben?«
»Tut mir leid, jemand von der Warteliste. Wir waren überbucht.«
»Aber . . .«
»Wie ich schon sagte, Sie sind seit einer Stunde überfällig, aber vielleicht finden wir eine Lösung. Könnte sein, daß der Erste Offizier seine Kabine abtritt.«
Bei Petra fiel der Groschen. »Der Erste Offizier, so so. Ich nehme an, das sind Sie.«
Stefan lächelte so unverschämt, wie ihm zumute war, und stellte sich vor. »Stefan Hansen, zu Ihren Diensten, und für Sie einfach Stefan.«
Sie nahm seine Hand. »Petra Koch aus Berlin. Für Sie einfach Petra.« Sie machte eine kleine Pause »Und wo würden Sie schlafen, wenn ich auf Ihr Angebot zurückkäme? Auf einem Deckstuhl?«
»Ich würde in Ihrer Nähe bleiben, immer zu Ihren Diensten.«
Inzwischen kam auch Irene die Gangway herauf. Sie war im gleichen Alter wie ihre Freundin Petra, eine hellhäutige Blondine, kaum geschminkt. Der dicke rosa Kaschmirschal, Jeans, ein weiter Trenchcoat und eine große Patchworktasche verrieten Modegeschmack.
Der Chefsteward war herbeigeeilt, um die beiden Nachzüglerinnen in Empfang zu nehmen.
Stefan zwinkerte ihm zu »Wir bringen die beiden Damen selbst zu ihrer Kabine.«
Die Männer nahmen das Gepäck und gingen voran. Petra und Irene folgten ihnen. Petra flüsterte Irene zu: »Sieht unverschämt gut aus, dieser Stefan, nicht wahr?«
»Stefan, welcher Stefan?«
»Der Erste Offizier.«
»Du weißt schon seinen Vornamen, das geht aber schnell.«
»Er hat mir seine Kabine angeboten, falls ich Bedarf haben sollte.« Petra liebte es, Dichtung und Wahrheit zu vermischen.
»Sag mal, eben noch im Taxi hast du geschworen, du willst nichts mehr mit Männern zu tun haben, du hättest sie satt.«
»Hab’ ich auch. Die Berliner. Ein Berliner kriegt bei mir nie mehr den Fuß zwischen die Tür. Stefan ist ein Seefahrer, das ist was anderes, oder.«
»Ein Seefahrer, das ist allerdings was anderes. Aber du als Matrosenliebchen? Zu Hause hocken und warten?«
»Ach was, wenn ich wieder in Berlin bin, hab’ ich den doch schon lange vergessen.«
Irene und Petra waren seit Jahren befreundet. Beide arbeiteten im Kaufhaus des Westens – in Berlin kurz KaDeWe genannt – Petra in der Parfümerie, Irene als Dekorateurin. Es war eine wirkliche Freundschaft, vielleicht gerade weil sie beide so verschieden waren. Jede hatte Eigenschaften, die der anderen fehlten. Petra bewunderte Irenes Beständigkeit, und Irene hätte gern etwas von Petras Leichtsinn gehabt, vor allem wenn es um Männer ging.
230 und 232 waren geräumige Außenkabinen mit großen Fenstern und Doppelbetten, und sie hatten eine Verbindungstür. Max Leupold, ein vermögender Geschäftsmann – Holzimport und Export – war Witwer. Er hatte seine neunjährige Tochter Gaby mitgenommen auf die Reise und deren Privatlehrerin Monique. Während Max Leupold und Monique auspackten, lief Gaby, ihren großen Pink Panther im Arm, hin und her, verglich die Bildqualität der Fernseher und konnte sich nicht entscheiden, ob sie ein Madonna-Video anschauen sollte oder Charlie Brown.
Als Max Leupold seine Sachen in Schrank, Kommode und Bad verstaut hatte, wollte er Gaby bei ihrem Koffer helfen, aber sie hinderte ihn daran. »Meine Sachen kommen zu Monique.« Max Leupold war erstaunt. »Ich dachte, wir zwei . . .« Sie schüttelte eigensinnig den Kopf.
»Ich schnarche nicht, Ehrenwort.«
»Nicht deswegen.« Sie stockte, sie hatte sich die kleine Rede, die jetzt folgte, genau zurechtgelegt. »Es sind deine Ferien, du brauchst Ruhe, du hast seit zwei Jahren keinen Urlaub mehr gehabt.«
Max Leupold legte den Arm zärtlich um seine Tochter: »Du hast vollkommen recht, meine kleine Krankenschwester, aber Monique will sicher auch mal allein sein. Auch für sie sind es Ferien.«
Gaby senkte den Blick und schwindelte: »Ich hab’s Monique aber schon versprochen . . .«
»Ja dann . . .« Es klang enttäuscht, und Gaby sagte tröstend: »Du kannst Pinky haben, dann bist du nicht allein.«
»Schon gut.« Max Leupold fuhr Gaby übers Haar, nahm ihren Koffer und brachte ihn nach nebenan. »Meine Tochter hat sich für Sie entschieden. Ich hoffe, es ist Ihnen wirklich recht, daß Gaby bei Ihnen schläft.«
»Selbstverständlich.« Monique hatte einen schwarzen Badeanzug in der Hand und wußte nicht wohin damit. »Wir werden uns schon vertragen. Das Bett ist so groß, darin hätte eine ganze Familie Platz.«
Er lächelte, nickte und ging wieder. So war das immer, mehr als zwei Sätze an einem Stück wurden es selten zwischen Monique und Max Leupold.
Er war der rücksichtsvollste und gleichzeitig der schüchternste Mann, der Monique je begegnet war. Manchmal hatte sie den Eindruck, er hätte noch gar nicht registriert, daß sie eine junge Frau war. Es mußte mit dem Tod seiner Frau zusammenhängen. Er hatte einen Knacks. Monique kannte diesen Zustand aus eigener Erfahrung. Sie hatte sich ihren Knacks von einer heimlichen Liebesgeschichte mit einem verheirateten Mann geholt. Er hatte an der gleichen Schule unterrichtet, niemand durfte etwas merken, nicht einmal ins Kino konnten sie gemeinsam gehen. Nach fünf Jahren Versteckspiel war sie ein Nervenwrack. Sie ließ sich auf unbegrenzte Zeit beurlauben und nahm die Stellung bei den Leupolds als Privatlehrerin an, im gottverlassenen Furth im Wald.
Zwei Leute mit einem Knacks, nach den Regeln der Mathematik, daß minus und minus plus ergibt, müßte es zwischen uns irgendwann mal funken, dachte sie, und es war nicht das erstemal, daß sie sich dabei ertappte, über Max Leupold nachzudenken.
Gaby hatte die Tür hinter ihrem Vater geschlossen. Sie setzte sich aufs Bett. »Monique, ich muß mit dir reden.« Monique, die vor der Kommode kniete, blickte über die Schulter.
»Ich höre.«
»So geht es nicht, setz dich zu mir . . . es ist was Ernstes.«
»Was Ernstes?« Monique setzte sich zu Gaby »Schieß los, was hast du auf dem Herzen?«
»Ich möchte, daß Vati wieder heiratet. Zu Hause hat das nie geklappt. Oma vertreibt jede. Deshalb habe ich gedacht, ich muß auf dieser Reise eine Frau für ihn finden. Aber allein schaff ich es nicht, du mußt mir helfen.«
Monique nickte. In dem knappen Jahr, seit sie Gabys Privatlehrerin war, hatte sie schon einige Überraschungen erlebt.
»Natürlich helfe ich dir, aber ob es so einfach geht, wie du denkst. Die meisten Frauen, die auf so eine Kreuzfahrt gehen, sind verheiratet.«
»Nein, nein, es gibt viele Frauen, die einen Mann suchen. Ein paar sind sicher an Bord.«
»Wie soll sie denn sein, blond?«
Gaby protestierte vehement. »Niemals blond. Sie muß unbedingt dunkles Haar haben. Weißt du, ich möchte, daß sie so aussieht, daß sie meine Mutter sein könnte. Und nicht zu groß. Auch mit hohen Absätzen muß sie kleiner sein als Vati.« Sie sah Monique an. »Wie groß bist du?«
»Einssechzig.«
»Das ist ideal.« Gaby musterte Monique ungeniert. »Du hättest auch die richtige Haarfarbe – aber es geht nicht mit dir, du bist zu gescheit.«
Monique verbiß sich ein Lachen. Gaby war sehr empfindlich. Sie reagierte mit Wutausbrüchen, wenn sie sich nicht ernst genommen fühlte.
»Aber du willst doch keine dumme Frau für deinen Vater.«
»Nein, das nicht, aber man darf ihr nicht ansehen, daß sie gescheit ist. Mein Vater hat nicht studiert. Mein Vater hat nur geerbt.«
»Dein Vater ist ein Experte in Edelhölzern, das ist eine Wissenschaft, sag ich dir. Und er ist ein guter Kaufmann, auch dazu braucht man Köpfchen.«
»Aber er macht Rechtschreibfehler. Bei schwierigen Worten muß er im Duden nachschauen. Meinst du, wir finden eine, die zu ihm paßt?«
»Na ja, es liegt nicht nur an uns. Er muß auch einverstanden sein.«
»Wenn sie mir gefällt, gefällt sie auch ihm.«
Monique war versucht, die Brille abzunehmen und Gaby zu fragen, ob sie ohne Brille weniger gescheit aussähe, aber sie hatte plötzlich Hemmungen. Sie stand auf. »Komm, jetzt packen wir deinen Koffer aus.«
»Ich möchte heute abend das Organdykleid anziehen.«
»Das wird aber zerknautscht sein.«
»Dann bügeln wir es eben. Der Steward hat gesagt, auf jedem Deck gibt es eine Bügelstube.«
In Kabine 327 lief Musik; sie kam aus dem Recorder und war ein Eigenverschnitt aus allen möglichen Schlafzimmersongs von Donna Summer bis zu Gainsborough & Tochter. Jürgen Kling hatte das Band mit viel Sorgfalt für diese Kreuzfahrt zusammengestellt, die nach sieben Jahren als verspätete Hochzeitsreise gedacht war. Jürgen besaß ein kleines, gut florierendes Taxi-Unternehmen – sechs Personenwagen und ein Ausflugbus – in Frankfurt am Main; er hatte es zusammen mit seiner Frau Maja aufgebaut. Sie hatten alles andere zurückgestellt, er war rund um die Uhr gefahren, und Maja hatte die Zentrale gemacht. Diese Kreuzfahrt sollte die Belohnung sein für alles, auf das sie verzichtet hatten, Hochzeitsreise, Ferien, Kinder. Jürgen hatte beschlossen, der beste Anfang für die Reise wäre ein Champagner-Schäferstündchen.
Maja war noch im Bad. Wenn sie aus der Wanne stiege, würde sie merken, daß er alle Tücher und auch den Bademantel weggenommen hatte. Feucht sollte sie sein, wenn er sie in die Arme nahm.
Jürgen stand vor dem Schrankspiegel und zerrte an dem Lederschnürchen des winzigen getigerten Tangas. Die zehn Stunden unter der Höhensonne hatten sich gelohnt, und auch das Training mit dem Expander. Wenn er so weitermachte, würde noch ein Rocky aus ihm. Er schloß den Schrank und öffnete die Champagnerflasche, die in einem Eiskübel bereitstand.
Die Vorstellung, seine eigene Frau zu verführen, erregte ihn mehr, als er erwartet hatte. Andächtig füllte er zwei Gläser.
Die Tür des Badezimmers ging auf. »Da sind keine Tücher . . .« Maja stand nackt dort, das weiße Neonlicht des Badezimmers machte die Konturen weich. Sie war langbeinig und schmalhüftig. Bis zur Taille hatte sie die Figur eines mageren Jünglings, aber dann waren da plötzlich umwerfende Brüste, voll und fest wie bei einer Siebzehnjährigen. Ihr Gesicht hatte etwas Mädchenhaftes, herb, lebendig. Sieben Jahre war er ihr Mann, und doch hatte er dieses Gesicht, diese Augen, diesen Mund nie ganz gelöst, nie voller Leidenschaft gesehen.
»Komm her zu mir.«
»Ich bin ganz naß.«
»Komm her.«
Sie gehorchte zögernd, den Kopf leicht gesenkt. Er zog sie auf das Bett »Ich habe die Tücher weggenommen. Ich wollte, daß du naß bist.«
Sie wurde steif. »Ich will unbedingt bei der Abfahrt an Deck sein.«
»Eine Kapelle spielt einen Marsch, das ist alles, dann ziehen Schlepper das Schiff aus dem Hafen.«
»Es ist meine erste Schiffsreise, ich will es sehen.« Sie versuchte ihm zu entschlüpfen. Er hielt sie mit der rechten Hand fest und griff mit der linken nach dem Champagnerglas.
»Jetzt trinken wir erst mal was, schließlich sind wir auf unserer Hochzeitsreise.« Er goß den Champagner über sie, und sie schrie auf: »Laß das, ich mag das nicht.« Sie stieß ihn weg.
»Dageblieben.« Er verlor die Balance. Beim Versuch, sich aufzufangen, zerschlug er das Glas an der Bettkante und schnitt sich in den Handballen. Die Wunde war tief und blutete stark. Jürgen fluchte.
Maja erschrak. »Du meine Güte, das blutet ja wie verrückt.« Sie zog schnell das breite Elastikband vom Kopf und wickelte es um Jürgens Hand. »Komm mit ins Bad, ich muß die Wunde desinfizieren.«
Sie stiegen auf der Seite aus dem Bett, wo keine Scherben lagen. Bis sie im Bad waren, tropfte das Blut bereits durch das Band. Über dem Waschbecken goß Maja ein Desinfektionsmittel über die Wunde. Erst jetzt, im hellen Licht, sah sie, wie tief der Schnitt war. »Das muß genäht werden, verbinden nützt da nichts, du mußt ins Spital, vielleicht sind Splitter drin. Halt die Hand hoch, ich will versuchen sie abzubinden.«
Jürgen hatte bisher keinen Ton von sich gegeben, jetzt begann er zu fluchen. »Deine verdammte Ziererei, nur deswegen ist es passiert. Hättest du normal reagiert – aber du reagierst ja nie normal.«
Maja, die in der Hausapotheke nach einer Bandage suchte, blickte nicht einmal auf. »Ich bin wieder mal schuld.«
»Du bist einfach nicht normal«, wiederholte Jürgen gehässig, während Maja die Bandage anlegte, »nicht normal, nicht normal.«
Plötzlich hatte Maja genug. »Es reicht«, unterbrach sie ihn scharf. »Eine normale Frau hätte sich schon längst von dir scheiden lassen. Wir hätten lieber zum Anwalt gehen sollen und die Scheidung einreichen, als diese Kreuzfahrt machen.« Wie immer, wenn sie mit Scheidung drohte, wurde Jürgen kleinlaut. Er lenkte sofort ein. »Entschuldige, so war’s nicht gemeint.« Maja befestigte die Bandage »Halt die Hand hoch.« Sie machte aus einem Schal eine Schlinge.
»Du wärst eine prima Ärztin geworden«, murmelte er. Aber sie war nicht versöhnlich gestimmt: »Wegen dir habe ich das Studium aufgegeben. Ich kann wirklich nicht normal sein. Ich hatte schon das Physikum in der Tasche, und dann werfe ich alles hin. Wegen dir habe ich mein ganzes Leben verpfuscht.«
»Bitte Maja –«
»Du hast ja recht, eine normale Frau hätte das nie getan. Normale Frauen sind nicht so dumm.«
»Vergiß das blöde Wort, bitte, es war nicht so gemeint.«
Sie stand wortlos auf und begann sich anzuziehen.
Das Hospital befand sich auf dem B-Deck, und sie verliefen sich zweimal, bis sie es fanden. Sie waren nicht die einzigen, die ärztliche Hilfe brauchte. Ein alter Herr hatte sich den Fuß verstaucht, einem Küchenjungen war kochendes Fett ins Auge gespritzt, und ein Rollstuhl-Passagier hatte Probleme mit dem Kreislauf. Die Schwester in der Aufnahme nannte das einen ruhigen Anfang. Während sie Jürgens Personalien aufnahm, kam ein Telefonanruf. Die Schwester nahm den Hörer ab. »Tut mir leid, ich kann Sie nicht mit Dr. Becker verbinden. Er hat einen Patienten. Ja, ich richte es Dr. Becker aus.«
Maja, die in einer Illustrierten blätterte, hielt inne. Dr. Becker. Es war immer dasselbe, wenn sie den Namen Bekker hörte, fing ihr Herz zu hämmern an. Toni Becker, ihre große Jugendliebe, so was saß tief. Dummes Ding, sagte sie sich, dieser Dr. Becker hinter der weißen Tür dort ist wahrscheinlich ein feiner älterer Herr mit weißem Haar und einem dunklen Punkt in der Vergangenheit. Und mein Becker ist längst verheiratet und hat mich vergessen.
Jürgen spürte Majas Unruhe. »Geh an Deck und schau dir die Abfahrt an. Das hier dauert sicher noch eine Weile.«
»Nein, nein, ich bleibe.«
»Lieb von dir, aber –«, er kam näher, »ich muß heute vorsichtig sein mit dem, was ich sage.«
Sie sah ihn an.
»Du wolltest sagen lieb aber blöd.« Sie lächelten sich an. Jürgen war auf attraktive Weise häßlich. In seinen Zügen mischten sich Sinnlichkeit, Brutalität und ein naiver Optimismus. Der schwarze Lacoste Trainingsanzug stand über der Brust offen. Alle ihre Freundinnen beneideten sie um diesen Mann; ihre Eltern liebten ihn.
Die Tür des Sprechzimmers öffnete sich; ein Rollstuhl wurde sichtbar, ein älterer Herr, in einer Schottenjacke, und dann der Mann im weißen Kittel. Maja hatte das Gefühl, ihr Herz setzte aus.
Toni. Der blonde Haarschopf, zerzaust wie immer, die Augen nachdenklich wie immer, die Schultern leicht nach vorne gezogen wie immer.
Sie senkte den Kopf und wandte sich ab, und verharrte so, bis sie sicher sein konnte, daß er wieder im Sprechzimmer verschwunden war. Nachdem die Tür sich geschlossen hatte, stand sie auf und sagte zu ihrem Mann: »Ich glaube, ich geh’ doch mal nach oben.« Jürgen sah sie an und küßte sie. »Mach keine Dummheiten.«
Die Gangway war verschwunden. Die Berlin hatte abgelegt, und vier Schlepper zogen sie aus dem Hafen. Am Pier spielte eine Blaskapelle die letzten Takte von Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus. Die Passagiere auf den Decks winkten mit Taschentüchern und Schals, und dann, nachdem die Musik verklungen war, kam vom Schiff die Abschiedssirene, Schiff geht auf große Fahrt, drei lange, dunkle Töne, deren Schwingungen die Luft erzittern ließen und den Menschen ans Herz griffen, ohne daß sie wußten, woher diese plötzliche Rührung kam. Die Schlepper antworteten mit demselben Signal, mit drei langen, dunklen Tönen.
Maja fühlte sich wackelig und setzte sich in einen Deckchair. Ein Steward brachte ihr eine Decke und legte sie ihr um die Schultern. Ein Passagier in einem englischen Trenchcoat und einer Pfeife sprach sie an, aber Maja reagierte so frostig, daß er schnell weiterging.
Jetzt kamen wieder Schritte, und Maja sah eine dünne alte Dame in einem hellen knöchellangen Wollmantel. Um den Kopf hatte sie ein silbergraues Tuch, das wie ein Turban geschlungen war. »Sie haben da ein schönes windgeschütztes Eckchen«, sagte sie mit dunkler verrauchter Stimme. »Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich mich zu Ihnen setze.« Sie streckte Maja die Hand hin: »Tutti von Falkenhayn.«
»Maja Kling.«
»Mein Gott, Ihre Finger sind ja wie Eis.« Sie sah Maja forschend an. »Und ein Gesicht machen Sie, als hätten Sie ein Gespenst gesehen.«
»Hab’ ich auch«, hörte Maja sich antworten.
Tutti von Falkenhayn nickte. »Das kann nur ein Mann sein, stimmt’s? Die Gespenster im Leben einer Frau sind immer Männer. Also erzählen Sie mir von Ihrer alten Liebe.«
»Woher wissen Sie –«
»Ach, mein Kind, ich war auch mal jung. Ein romantischer Treffpunkt, so ein Schiff.«
»Ich wollte ihn nicht treffen«, sagte Maja sich unversehens verteidigend. »Wir haben vor acht Jahren Schluß gemacht. Ich habe nie mehr was von ihm gehört. Wenn ich gewußt hätte, daß er auf diesem Schiff ist, wäre ich nie an Bord gegangen.«
Tutti legte die Hand auf Majas Arm. »Ist es so schlimm?«
»Ich bin total durcheinander. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll.«
»Wie hat er denn reagiert?«
»Überhaupt nicht. Er weiß es noch nicht.«
»Soll das heißen, Sie haben ihn gesehen, ohne daß er Sie erkannt hat – wie romantisch, beneidenswert, ich werde so etwas nie mehr erleben. Ich bin alt. Meine Jugendlieben gibt es nicht mehr. Die Männer haben die üble Angewohnheit, vor uns zu sterben.«
»Was soll ich bloß tun, wenn ich ihm begegne.«
»Ist es ein Passagier oder jemand vom Schiff?«
»Er ist der Schiffsarzt.«
»Toni Becker?«
»Sie kennen ihn?«
»So einen Mann übersehe ich nicht. Nicht mal wenn ich blind wäre.« Der Decksteward brachte auch Tutti von Falkenhayn eine Decke. Nachdem sie eingewickelt war, lehnte sie sich mit einem Seufzer zurück und nahm das Gespräch wieder auf. »Sie tragen einen Ehering, wo ist Ihr Mann?«
»An Bord.«
»Sternzeichen?«
»Schütze.«
»Und Sie?«
»Zwilling.«
»Wie lange sind Sie verheiratet?«
»Genau sieben Jahre – das ist unsere verspätete Hochzeitsreise.«
»Und da sitzen Sie allein auf Deck herum? Wo steckt er?«
»Er hat sich mit einem Champagnerglas in die Hand geschnitten.«
»Ich kann mir die Szene vorstellen. Männer sind so rührend, stimmt’s. Und jetzt ist er bei Dr. Becker. Ich kann verstehen, daß Sie durcheinander sind. Die Situation ist nicht einfach.«
Tutti von Falkenhayn lachte leise.
»Sagen Sie mir, was ich tun soll.«
»Auf jeden Fall sollten Sie sich fürs Abendessen ganz besonders schön machen. Dr. Becker wird im Speisesaal sein. Er sitzt am Tisch des Kapitäns. Kommen Sie ein bißchen zu spät, nicht viel, nur ein bißchen, bevor man anfängt zu essen – dann muß er sie sehn.«
»Und was sage ich meinem Mann?«
»Ach ihr jungen Frauen – nichts sagen Sie ihm. Wenn Sie reden, ist die Sache vorbei, bevor sie angefangen hat. Das wäre doch schade. Wenn das Schicksal eine Sache so hübsch einfädelt, oder.«
»Er wird es merken.«
»Dummes Zeug, nichts merkt er. Es geht ihn auch nichts an.« Tutti wickelte sich aus der Decke »Kommen Sie, mein Kind, wir gehen nach vorn, gleich sind wir bei den Leuchttürmen.«
Die Berlin hatte den Hafen verlassen und wurde nicht mehr von den Schleppern gezogen. Allmählich gewann sie an Fahrt. Nach dem Container Terminal war links und rechts von der Wesermündung nur noch flaches Land. Dann kamen die Leuchttürme, zuerst der Leuchtturm Hoher Weg, dann der Leuchtturm Alte Weser und schließlich, das Land war schon nicht mehr zu sehen, der Leuchtturm Roter Sand mit seinen gefürchteten Sandbänken, an denen schon manches Schiff gestrandet war.
Dodo die Sängerin und ihr Freund Saki, der auf der Berlin als Kabinensteward arbeitete, hatten gemeinsam auf dem Schiff angeheuert. Ein exotisches Pärchen, sie Kreolin, er Marokkaner, sie dreißig, er zweiundzwanzig, sie durchtrieben, er naiv und nicht gerade intelligent. Arm in Arm standen sie an der Reling des Hauptdecks und schmiedeten Zukunftspläne. Eine Piano Bar in Nassau spukte in Dodos Kopf. Jahrelang wartete sie schon auf so eine Gelegenheit, jetzt stand eine zum Verkauf. Gestern hatten sie noch nicht gewußt, woher das Geld nehmen, jetzt schien ihr, als böte das Schicksal selbst eine Lösung an: Scheich Mehmed war an Bord, einer der reichsten Männer der Welt. Sie kannte ihn von St. Moritz, er hatte im Palace gewohnt, und sie hatte in der Bar gesungen. Scheich Mehmed hatte die Angewohnheit, große Trinkgelder zu geben. Zu diesem Zweck stand immer ein kleiner Krokokoffer in seinem Zimmer, gefüllt mit großen Dollarnoten.
Von diesem Koffer erzählte Dodo ihrem Saki, während die Berlin