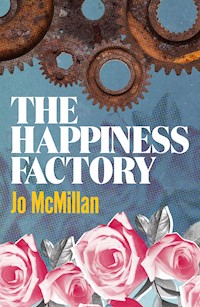9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
"Was für eine DDR! Jo McMillan erzählt aus dem Inneren eines Sogs: wie es war, dort, wo alle wegwollten, hinzuwollen. Sie erzählt so anrührend, mit einem so feinen Sinn fürs Absurde, daß man in diesen Sog sofort hineingerissen wird." Antje Rávic Strubel "Ich hatte nicht erwartet, dass die Berliner Mauer sauber und weiß und glatt sein würde. Sie sah mehr wie die Einfassung eines Schwimmbads aus als die Grenze zum Kalten Krieg. Auf dem Gras des Niemandslandes hoppelten dicke Kaninchen herum und fraßen, als würde niemand sie je jagen und nichts könnte sie aus der Ruhe bringen. Das war ihr Gebiet, hier herrschten sie. Berlin bestand aus drei Teilen: Ost, West und Kaninchenland." Als Jess mit ihrer Mutter Ende der 70er Jahre nach Ost-Berlin kommt, ist die Engländerin überrascht davon, wie anders die Welt jenseits des Eisernen Vorhangs aussieht. Für ihre Mutter geht ein Lebenstraum in Erfüllung: Endlich ist für die glühende Kommunistin der Sozialismus tatsächlich real existierend, ist die Lehrerin geachtet und nicht mehr belächelte Minderheit. Jess hingegen erfährt bald, was es heißt, im Land der Gleichen anders zu sein. Aus anfangs kuriosen Unterschieden werden kaum auszuhaltende Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit, und bald steht Jess vor einer schweren Entscheidung – zwischen ihrer Mutter und ihrer Freiheit. Ein warmherzig-humorvoller Roman über das Erwachsenwerden unter ganz besonderen Bedingungen – und eine Zeitreise in eine vergangene Welt, die aus dieser Perspektive noch nie betrachtet wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Als Jess mit ihrer Mutter Ende der 70er Jahre nach Ost-Berlin kommt, ist die Engländerin überrascht davon, wie anders die Welt jenseits des Eisernen Vorhangs aussieht. Für ihre Mutter geht ein Lebenstraum in Erfüllung: Endlich ist für die glühende Kommunistin der Sozialismus tatsächlich real existierend, ist die Lehrerin geachtet und nicht mehr belächelte Minderheit. Jess hingegen erfährt bald, was es heißt, im Land der Gleichen anders zu sein. Aus anfangs kuriosen Unterschieden werden kaum auszuhaltende Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit, und bald steht Jess vor einer schweren Entscheidung – zwischen ihrer Mutter und ihrer Freiheit. Ein warmherzig-humorvoller Roman über das Erwachsenwerden unter ganz besonderen Bedingungen – und eine Zeitreise in eine vergangene Welt, die aus dieser Perspektive noch nie betrachtet wurde.
Die Autorin
Jo McMillan lebt in Berlin, ihr Debütroman PARADISE OST basiert in Teilen auf ihrer eigenen Kindheit.
Jo McMillan
Paradise Ost
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Höbel
Ullstein
Die englische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Motherland bei John Murray, London.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1318-4
© 2015 by Jo McMillan © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: soleil 420/Getty Images; © shutterstock
E-Book: L42 Media Solutions Ltd., Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für Guy
Ach, wir Die wir den Boden bereiten wollten für die Freundlichkeit Konnten selber nicht freundlich sein.
Bertolt Brecht, »An die Nachgeborenen«1
1
Den Morning Star verkaufen
Tamworth, April 1978
Es war noch nie leicht, einer Stadt wie Tamworth den Sozialismus zu verkaufen. Aber hier standen wir wieder, am Samstagmorgen, und zogen die Zeitungen aus unseren Co-op-Tüten. Meine Mum füllte ihre Lungen mit der Luft der Einkaufspassage – heiß, säuerlich, blutig vom Fleischer. Sie holte so tief Luft, dass man es hören konnte. Wie ein letztes Einatmen, bevor das Schiff sinkt.
»Die Wahrheit, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit! Der Morning Star!«
Die Einkaufspassage Middle Entry hallte von den Stimmen der Passanten beim Einkaufen und den harten Absätzen korpulenter Frauen wider. Ich kannte diese Frauen von all den Samstagen davor, ihr Haar war orangerot gefärbt und im Nacken fransig geschnitten, die Kleidung in sich beißenden Farben war aus glänzendem Rayon, und hinter den Brillen sahen ihre Augen aus wie Murmeln.
»Alles klar, meine Gute?«
»Alles klar.«
»Und das Baby?«
»Das macht sich, meine Gute, kann man so sagen.« Das waren die Neuigkeiten über das neue Urenkelkind. Sie beugten die runden Schultern und steckten die Nasen in den Kinderwagen der jeweils anderen, im Arm trugen sie Riesenpackungen Wegwerfwindeln und Dosen mit Milchpulver, außerdem hatten sie, weil Ostern gerade vorbei war, Kartons mit herabgesetzten Ostereiern gekauft, die, wenn sie Glück hatten, auch nächstes Jahr noch gut sein würden, und dann hätte das Baby schon Zähne.
»Der Morning Star! Zwölf Pence, günstig für den Preis.«
Die Leute in Tamworth kauften gern günstig ein. In den Schaufenstern der Geschäfte wurden Sonderangebote angepriesen, die Schreibweise war nach Gehör, die Buchstaben standen kreuz und quer. Und die Leute in Tamworth machten gern Großeinkäufe. Wer ein Auto hatte, fuhr damit zum Cash&Carry und lud den Kofferraum voll. Die anderen schoben ihren Einkaufswagen durch den Supermarkt und deckten sich für schlechte Zeiten ein. Das machten meine Mum und ich auch, nur dass wir uns für den Weltuntergang rüsteten, den Tag, wenn die Amerikaner auf den Knopf drückten und den Dritten Weltkrieg auslösten. Unsere Küchenschränke waren mit Packungen und Dosen gefüllt, die uns bis ans Ende aller Zeiten reichen und das Kochen überflüssig machen würden.
Gerade schlug es zwölf von der Kirchturmuhr. Die Uhr von St. Editha maß die Zeit in Tamworth in Viertelstunden. Bisher hatte sie vierhundertvierzigtausend Mal geschlagen – die Zahl wurde aus Gründen der Moral abgerundet. Aber zu Hause in unserem Wohnzimmer hatten wir drei Uhren, die auf die Zeiten von Havanna, Moskau und Hanoi gestellt waren. Zu Hause konnte ich in jeder Zone des Ostblocks wohnen, ganz wie ich wollte.
»Nur eine Stunde lang erhältlich! Der Morning Star!«
Meistens kam jemand forschen Schrittes vorbei, zwinkerte uns zu und rief »Morgen!« zu uns hinüber. Oder jemand guckte mit übertriebener Bewegung auf seine Uhr und sagte, es sei aber schon Nachmittag.
»Nur noch zehn Exemplare, beeilen Sie sich, greifen Sie zu!«
Zu Eile war kein Anlass, auch wenn alle Einwohner sich in der Stadt drängten. Oder fast alle. Die vornehmen Leute von Tamworth fuhren nach Lichfield oder Ashby, wo sie Antiquitäten und Pflanzen für ihre Terrasse aussuchten. Aber die echten Tammies, die in Reihenhäusern aus rotem Backstein wohnten, wo die Stromleitungen alt und brüchig waren und die Tapeten aus Großvaters Zeiten, die waren hier. Auch die neuen Tammies, die aus Birmingham hierhergezogen waren und in Sackgassen mit Wasser evozierenden Namen wie Redlake, Seaton, Waveney, Purbrook wohnten, kauften hier ein.
Meine Mum hatte eine Schülerin erspäht. »Mandi-mit-i. Eine Ehemalige, gerade erst abgegangen.« Sie winkte mit ausholenden Bewegungen, so dass alle sich angesprochen fühlten. Meine Mum hatte einen Riecher für Schüler. Sie entdeckte sie in großer Ferne und wusste jedes Mal den Namen. Sie unterrichtete in einer Schule im Kohlerevier von Warwickshire, wo Hunderte von Kindern, deren Familien aus allen Ecken der Welt hierhergekommen waren, zusammen mit Hunderten anderer Kinder lernten, die ihr Dorf nie verlassen hatten. Oder wenn doch, dann mit dem Bus, um in Tamworth einen Einkaufstag zu verbringen. Mandi schob einen Buggy, in dem ein Baby saß, und hatte ein Kleinkind an der Hand, das hinter sich eine Spur von Smarties auswarf.
»Das wusste ich ja gar nicht!«, sagte Mum zu dem blassen, reglosen Kind im Buggy. Der pummelige Kloß hieß Darren. Er war vier Monate alt.
»Ist das Ihre Tochter, Miss? Sieht aus wie Sie, Miss.«
Meine Mum unterhielt sich mit ihr über Babys und Stillen. Sie stieß mich in die Rippen. Sie sei von mir im Krankenhaus völlig leer getrunken worden, ich allein sei
Schuld an ihrem Brustumfang. Sie brachte Mandi zum Lachen und verkaufte ihr eine Zeitung. Sie war herzensgut, meine Mum. Von Herzen gut, sagte sie immer. Manchmal, wenn sie trübsinnig war, sagte sie: »Ich bin die Herzdame«, weil es so in dem Song hieß: »To the queen of hearts is the ace of sorrow, he’s here today, he’s gone tomorrow.« Das stimmte. Mein Vater ist nicht gleich gestorben, nachdem er meine Mum kennengelernt hatte, aber er lebte nicht lange. Und alle, die danach kamen, blieben nur für eine Nacht.
Meine Mum rief: »Nur noch neun übrig. Greifen Sie zu, bevor es zu spät ist. Der Morning Star!« Unter dem Plexidach schwollen unsere Stimmen an. Deswegen stellten wir uns darunter auf – damit wir nach Masse klangen, sagte meine Mum, denn darum ging es ja, um die Massen, und damit wir jede Woche da sein konnten, bei jedem Wetter. Sie las die Überschriften auf der ersten Seite: »Carter erklärt Ende der Neutronenbombe! Keine Modernisierung von Lance!« Keine Ahnung, wer das war. Das mit der Neutronenbombe war gar nicht die Überschrift der heutigen Ausgabe, aber es klang reißerischer als »Gebräu der Tory-Partei stinkt nach Apartheid«. Und meine Mum hielt viel von Frieden, sie hielt viel von den Menschen. Dass die Menschen friedlich miteinander lebten. Nett zueinander waren. Dass sie sich nicht gegenseitig umbrachten, wenn möglich.
Aber mit dem Ende der Neutronenbombe hatte es niemand eilig.
Vielleicht war es den Leuten von Tamworth gleichgültig. Nach dem Abwurf einer Neutronenbombe sähe die Stadt immer noch so aus wie ihr Postkartenbild: St. Editha, die Wiesen am Fluss, die Burg, die Castle Pleasure Grounds am Fuße der Burg, wo die Wildgänse durch die Minigolfanlage watschelten und auf Brotrinden von den Minigolfspielern hofften. Meine Mum stöhnte vor Anstrengung und Hitze. Sie blies sich kühle Luft in den Ausschnitt. Es war ein brütend heißer Tag im April, der erste heiße Tag, seit ich denken konnte. Sie zog den Pullover aus und band ihn sich um die Taille. Darunter hatte sie dasselbe an wie am Vortag: ein T-Shirt mit der Aufschrift Sechzig Jahre Sozialismus, das Rot zu Rosa verwaschen, während Hammer und Sichel abblätterten, was an dem Co-op-Waschpulver lag. Unter dem engen T-Shirt zeichneten sich die kleinen Brüste ab, die Rippen darunter konnte man zählen.
Manchmal, wenn meine Mum vor dem Badezimmerspiegel stand und ein bisschen in die Knie ging, um sich mit dem Waschlappen der zugeordneten Farbe zu waschen, sagte sie, sie habe den Wuchs einer Balletttänzerin. Mit acht wollte sie Balletttänzerin werden. Der Krieg war gerade vorbei, und 1945 schien alles möglich, auch für ein Mädchen aus Bermondsey, dessen Bett in den ersten Jahren die untere Schublade einer Kommode gewesen war. Auch für die Tochter eines Taxifahrers und einer Köchin. Später wollte sie in den Diplomatischen Dienst eintreten und für den Frieden durch die Welt reisen. Aber da hatte sie keine Chance, mit ihrem Samstagsjob bei Woolworth und dem bisschen Schulfranzösisch und ihrem Mangel an diplomatischem Geschick.
Meine Mum zog sich das T-Shirt aus der Hose und fächelte sich damit Luft zu. Sie guckte auf ihren Bauch. Der war weiß und leer. Wir hatten seit dem Frühstück nichts gegessen. Seit sieben Uhr waren wir auf, in Hanoi war das zwei Uhr nachmittags, und wir konnten uns einbilden, wir wären spät aufgestanden. Wir hatten das übliche Frühstück gegessen – ein Dreieinhalb-Minuten-Ei, dazu Toast, den wir in Streifen schnitten. Den ganzen Vormittag hatten wir im Schlafanzug am Küchentisch gesessen und Dinge erledigt, die auf der Liste standen. Heute waren es verschiedene Protokolle: das der »Kampagne für nukleare Abrüstung«, das der Lehrergewerkschaft, das der Kommunistischen Partei. Ich hatte ihr aus ihrem dicken Heft diktiert, in das sie mit kräftiger, für die Tafel geeigneter Handschrift Notizen gemacht hatte. Eigentlich brauchte meine Mum mich nicht. Sie konnte Schreibmaschine schreiben. Sie konnte sogar blindtippen und gleichzeitig sprechen – ein Satz, der aus ihren Fingern kam, ein anderer, der aus ihrem Mund kam. Aber es ging schneller, wenn ich ihr die Notizen vorlas, nicht ganz im normalen Sprechtempo und etwas tiefer – als würde man eine 45er Schallplatte bei 33 abspielen. Und dass es schnell ging, war wichtig, Zeit war immer knapp. »Des Menschen höchstes Gut«, sagte meine Mum. Was nicht stimmte. Sie wusste, dass sie den Satz falsch zitierte. Das Leben war des Menschen höchstes Gut. Aber das Leben wurde in Zeit gemessen, und davon gab es nie genug. Ich las also vor, die Hände meiner Mum flogen über die Tasten, und durch unser Haus hallte das Klappern der Schreibmaschine – leiser, seit wir eine elektrische hatten. Und von Ron und Reg nebenan konnte man gedämpft das Gemurmel von Tiswas, dem Kinderprogramm am Samstagmorgen, hören.
Ich stieß meiner Mum in die Rippen. Der Fleischer bedachte uns durch die blinkende Fensterscheibe mit bösen Blicken – das machte er jede Woche, aber diesmal waren die Blicke besonders giftig. Wahrscheinlich hatte er das Hammer-und-Sichel-Emblem gesehen. In seinem Fenster hing ein Union Jack, und er verkaufte englisches Fleisch an Engländer, die englisch kochten. Heute hatte er Lammbraten aus Lichfield im Angebot. In dieser Stadt schlachtete und aß man die in der hiesigen Landwirtschaft gezüchteten Tiere. Er schüttelte den Kopf, fasste mit blutigen Fingern in eine Stahlschale, deren Rand mit grünen Plastikhalmen geschmückt war, warf einen Braten erst in die Luft, dann auf die Waage und blitzte uns, das geschärfte Messer in der Hand, böse an. Ich zupfte meiner Mum am T-Shirt. Sie wusste, was ich damit meinte. Auch sie wäre gern ins Co-op-Café gegangen, um sich auszuruhen und einen Kaffee zu trinken. Mit schweigenden Eltern am Nebentisch und Kindern, die aus Würstchen und Kartoffelbrei sexuell eindeutige Skulpturen machten. »Noch eine Viertelstunde, Jess.« Meine Mum gab nie vor dem Ende auf. Meine Mum gab nie auf. Manchmal, wenn die Stunde fast vorbei war, wurde sie langsamer wie ein Grammophon und zog die Wörter, die sie an den Fleischer richtete, undeutlich zusammen, und man hörte »Mon-ster« statt »Morning Star«. Aber meistens sang sie zum Abschluss ein Lied, gedämpft, weil das Plexidach den Schall verstärkte, und mit Wörtern aus den Nachrichten. Jetzt hörte ich, wie sie die erste Strophe probierte und sich vergewisserte, dass sie die Wörter wusste: »Völker, hört ihr das Bombengewitter, wie es laut donnert und kracht? Wie der Himmel reißt und zittert und der Fallout das Leben wertlos macht …«
Weiter kam sie nicht, weil ein Mann aus dem Fleischerladen trat und sich vor uns aufbaute. Breitbeinig stand er da, und in der Tüte an seiner Seite schwang das tote Fleisch. Er war halslos, hatte einen spitzen Kopf, ein Schrank von einem Mann und so groß, dass er einen Schatten über uns warf. »Ich kaufe eine Zeitung.«
»Wie bitte?« Das hatte Mum nicht erwartet. Ich auch nicht. Er sah nicht aus wie ein Morning-Star-Leser. Allerdings sahen die meisten Leute nicht so aus.
»Ich nehme eine von Ihren Zeitungen.« Er sah uns höflich an, aber ich mochte nicht, wie er aussah – das helle Hemd mit Schweißflecken, die Narben im Gesicht, die von Akne in der Jugend herstammten. Aber das fiel meiner Mum nicht auf. Sie schüttelte imaginierte Rumbarasseln. »Na, siehst du, Jess! Zwei verkauft! Ist doch toll!«
Der Mann nahm die Zeitung, hielt sie mit ausgestreckten Armen vor sich und blätterte sie durch. Wir konnten die Haarbüschel auf seinen Fingern sehen. Er kam mir bekannt vor, aber jeder in Tamworth kam mir bekannt vor. Jeder kannte jeden, jeder war mit jedem verwandt. Obwohl die Stadt als Eisenbahnknotenpunkt berühmt war. Die Strecken verliefen von Nord nach Süd und von Ost nach West, so dass man die Stadt in jede Richtung verlassen konnte, aber kaum einer tat das. Man wurde hier geboren, heiratete hier und starb hier. Und da fiel mir ein, warum er mir bekannt vorkam. Der Mann arbeitete im Bestattungsunternehmen des Co-op. Im Fenster war ein Schild, auf dem stand: Unsere Limousinen können auch für Hochzeiten gemietet werden. Manchmal sah ich den Mann auf meinem Weg zur Schule. An manchen Tagen hängte er ein Schild ins Fenster, auf dem ein günstiger Tarif für Bestattungen angeboten wurde, oder er stellte einen Blumenstrauß hin – frische Lilien für die Toten.
Jetzt war er auf der letzten Seite angekommen und überflog Caytons Wetttipps für das Rennen in Newbury und die Namen der Gewinner in Kempton. Er rollte die Zeitung zusammen und klemmte sie sich unter den Arm. »Muss ganz schön schwer sein, die Zeitung hier zu verkaufen.« Das stimmte nicht, wir wurden immer alle Exemplare los, weil wir die unverkauften in der Möbelabteilung des Co-op auslegten – auf Beistelltischchen, Fußhockern oder Gartenliegen, so als würde jedes moderne Haus die Zeitung abonnieren. Manchmal gingen wir am Schluss noch einmal in die Möbelabteilung und guckten, ob die Zeitungen noch da waren. Sie waren immer alle weg, was für meine Mum der Beweis war. »Die Redaktion braucht das Geld«, sagte sie. »Ist doch egal, wer sie bezahlt, Hauptsache, die Botschaft wird verbreitet. Hauptsache, die Zeitung wird gelesen.«
Der mächtige Körper des Mannes vor uns schob sich näher, an den dicken Füßen trug er Socken und Sandalen. »Sie tun mir leid. Sie sind jede Woche hier, und niemand interessiert sich auch nur im Geringsten für das hier. Alle sind gegen Sie eingestellt.«
»Nicht niemand. Nicht alle.«
»In dieser Stadt wollen die Leute nur den Herald.«
Auch wir kauften den Tamworth Herald, weil wir sehen wollten, ob unsere Leserbriefe abgedruckt wurden. Jede Woche schrieben wir an den Herausgeber – über Frieden, Arbeitslosigkeit, Rassismus. Außerdem mussten wir uns auf dem Laufenden halten, sagte meine Mum, und über das Leben der normalen Menschen Bescheid wissen. Manchmal sagte sie »normale Menschen«, manchmal sagte sie »die in der Arbeiterklasse«. Sie meinte damit, dass wir wissen müssten, wer die Menschen waren, die auf unserer Seite sein sollten, es aber nicht waren, noch nicht.
Der Mann sagte: »Außer dem Herald und einem Hobby braucht man nichts. Das reicht, um die Zeit totzuschlagen.« Denn das taten die Leute in dieser Stadt mit ihrer Zeit: Sie schlugen sie tot. Man bekam bei der Geburt nämlich nicht ein Leben geschenkt, sondern zu viel Zeit. Der Mann sagte übrigens »Erald« und »Obby«. In Tamworth hatten alle Leute ein Obby ohne H: Eimwerkern, Andarbeiten, istorische Interessen … Istorische Interessen waren besonders beliebt. Die Geschichte der Stadt ging bis zu Offa und seinen Befestigungsanlagen zurück, bis zu den Römern. Watling Street war eine römische Straße, die mitten durch die Stadt ging. Meine Mum fuhr die Strecke zur Arbeit, und da die A5 immer geradeaus ging, brauchte man nicht zu lenken, was gut war, denn meine Mum war oft unausgeschlafen.
Der Mann musterte uns von oben bis unten. Sein Blick ging zwischen uns hin und her, und er sah die Ähnlichkeit – ähnliches Gesicht, ähnliche Statur. Wir wären ein und dieselbe Person, wären da nicht achtundzwanzig Jahre und anderthalb Zentimeter, die uns trennten. »Scheinbar liegt es in der Familie.« Das stimmte. Wir stammten aus einer Familie toter Kommunisten: meine Großeltern, meine Großonkel, meine Großtanten. Sogar mein Vater war in die Kommunistische Partei eingetreten, bevor er alt genug war – weil er so begeistert war, haben sie ihn früher reingelassen. Auch gestorben ist er, bevor er alt genug war, auch da haben sie ihn früher reingelassen – in den Himmel, in die Hölle, ins Fegefeuer, in eine Dose, die meine Mum in ihrer Wäscheschublade aufbewahrte. Unsere Familie war entweder jüdisch oder schottisch, auf der Flucht vor Hitler oder vor den Mücken. Ein Zweig ließ sich im East End von London nieder, in der Nähe der Cable Street. Die Kinder wurden in die Internationale Brigade geschickt und kamen in Spanien um. Einige wurden in Francos Kerkern eingesperrt, und ihre Schädel wurden von den Faschisten ausgemessen. Meine Großmutter hat im Zweiten Weltkrieg Pullover für die Rote Armee gestrickt. Das ganze Land strickte Pullover für Stalin. Nach dem Krieg trat meine Mum in die Young Communist League ein und verkaufte unten bei den Werften die Zeitung Challenge. Sie hat ihr Leben lang ungeliebte Zeitungen verkauft.
Der Mann steckte seine Hand in die Gesäßtasche. »Was schulde ich Ihnen?«
»Nehmen Sie schon«, sagte Mum. »Als Geschenk. Ich bin froh, wenn jemand sie liest.«
Als der Mann die Hand aus der Tasche zog, hatte er darin ein Feuerzeug. Er fuhr mit seinem dicken Daumen über den Feuerstein, der Nagel war dunkel und wahrscheinlich abgestorben. Er drückte ein paarmal auf den Anzünder. Dann klickte das Feuerzeug, und die Flamme schoss in die Luft. Er hielt sie an die Zeitung. Eine Ecke verfärbte sich erst gelb, dann braun, dann schwarz. Aber die Zeitung brannte nicht. Er wedelte damit, bis sich die Flammen durch das Papier fraßen. Dann wedelte er die Zeitung vor unseren Nasen. Die Luft über der Zeitung wurde heiß. Ich warf einen Blick in die Fleischerei, wo verschwommene Gestalten feixten. Er sagte: »Das haben wir früher gemacht, wenn es Ärger gab. Wir haben ein Feuer draus gemacht.«
Inzwischen war um uns eine Menschenmenge zusammengelaufen. Manch einer überlegte wahrscheinlich, ob dies ein Fall für die Feuerwehr sei. Sie sagten sich die Fernsehwerbung vor: Deckung suchen, Hilfe rufen. Sie erzählten sich die Geschichte von einem Nachbarn, der umgekommen war, als er Doughnuts machte. Er hatte Wasser in die Fritteuse gegossen und konnte nur anhand seiner Zähne identifiziert werden. Ich warf einen Blick auf meine Mum. Sie hatte die Lippen zusammengepresst und die Augen geschlossen, Tränen bildeten sich in den Augenwinkeln. Ich wusste nicht, ob das von der Hitze kam oder ein Ausdruck von Trauer war. Meine Mum hatte nah am Wasser gebaut, schon die Neun-Uhr-Nachrichten brachten sie zum Weinen – Tränen, die auf die Fliesen im Wohnzimmer tropften, wo sie lange nicht trockneten. Und die ganze Zeit wrang sie im Schoß die Hände.
Meine Mum tastete nach meiner Hand. Sie verschränkte unsere Finger ineinander, so dass wir nebeneinander stehen bleiben mussten. Durch schmale Lippen, um nicht einatmen zu müssen, sagte sie: »Denk an die Guerillas, denk an die Vietnamesen.« Also schloss ich die Augen und dachte: Ganze Dörfer gehen in Flammen auf, die Luft wird aus dem Himmel gesogen. Verkohlte Leichen, vom Feuer entstellt, und ein nacktes Mädchen, alle Rippen sichtbar, die Haut hängt in Fetzen herab, ihre Arme zwei gebrochene Flügel.
Als ich die Augen aufmachte, war der Mann weg. Weiße Ascheflocken waren auf meine Schuhe gefallen. Wir waren in Tamworth an einem heißen Tag im April, aber dies hätte Schnee sein können. Meine Mum strich sich die Ascheflocken aus dem Haar und klopfte sich ihre sowjetische Brust ab. Das, was von den Nachrichten geblieben war – die Neutronenbombe, das Gebräu der Konservativen –, züngelte am Boden, als wäre es lebendig. Ich drehte mich zu meiner Mum um und hob mein Gesicht anderthalb Zentimeter zu ihrem Gesicht mit den starken Konturen, auf dem jetzt Ascheflocken lagen. Das grelle Sonnenlicht brannte herab und wischte die Farben aus, es machte meine Mum schwarz-weiß – es vereinfachte die komplexe Struktur ihres Gesichts.
»Können wir jetzt nach Hause gehen?«
»Oder ins Co-op-Café? Hast du Hunger?«
Mir war schlecht. »Was sollen wir jetzt machen?«
Meine Mum legte mir den Arm um die Taille und zog mich zu sich, so dass wir an den Hüften verbunden waren. »Wir lassen uns nicht unterkriegen, Jess. Das weißt du. Wir Lassen Uns Nicht Unterkriegen.«
2
An Eltern statt
Tamworth, April 1978
Meine Mum vergaß »Die Verbrennung«. Sie erwähnte den Vorfall nie wieder. Es war, als hätte es ihn nicht gegeben. Aber der Geruch hatte das ganze Wochenende an mir gehangen, und jetzt war er immer noch da. Ich wartete vor dem Büro der Direktorin, Miss Downing, und sah ihr zu, wie sie unter ihrer Robe nach den Schlüsseln suchte. So etwas dauert eben länger, wenn man nur einen Arm hat. Über ihrem Kopf hing die Gedenktafel mit goldener Schrift, die zu Ehren der zweimal gefallenen Gymnasiasten dort angebracht war: für König und Vaterland. Ich stand in dem Geruch des verbrannten Morning Star und dem von Nachtisch mit Vanillesoße, während Frauen mit Haarnetzen sich stumm zwischen Dampfschwaden und Stahlkesseln zu schaffen machten. Herr, wir danken dir für das, was wir von dir empfangen haben. Sogar die Serviererinnen hielten inne und beteten mit.
Die Direktorin war in den Geschichtsunterricht hineingeplatzt, hatte die Lehrerin keines Blickes gewürdigt und war schnurstracks zu der Landkarte von Tamworth zur Zeit der Angelsachsen marschiert. Mit ausgestrecktem Arm war sie an der lila Linie entlanggefahren, die um die Stadt gemalt war. »Offas Befestigungsanlage hat uns vor all den Menschen bewahrt, die unser Leben zu zerstören drohten. Wisst ihr, wer die waren?«
Hände flogen in die Luft.
»Die Dänen.«
»Die Wikinger.«
»Die Jütländer.«
»Die Normannen.«
»Die Russen.« Das erntete Gelächter.
»Jessica.«
Ich sah die Direktorin verständnislos an. Ich wusste nicht, warum sie meinen Namen nannte. »Du, Jessica Mitchell, kommst mit mir.«
Miss Downing stieß die Tür auf. Sie ging zu einem Sessel und warf sich mit ihrer ganzen Körperfülle hinein. Dabei fiel sie fünf Zentimeter durch die Luft, und ihre Füße hoben vom Boden ab. Ihre Schuhe hatten in dem flauschigen Teppich Spuren hinterlassen. Aus dieser Perspektive hatte ich die Direktorin noch nie gesehen, ihr Oberkopf ein metallisches Grau. Gewöhnlich stand sie einen guten Meter über der versammelten Schülerschaft und deklamierte Auszüge aus The Christian Assembly, wobei sie das Fehlen des einen Arms mit ausholenden Bewegungen des anderen kompensierte.
Sie bedeutete mir, auf dem Stuhl ihr gegenüber Platz zu nehmen. Ich setzte mich auf die Kante, lehnte mich aber nicht zurück, damit nicht der Eindruck von Wohlbehagen entstand.
»Sitzt du bequem?« Augenblicklich war mir unbequem, und ich wusste, dass wir nicht zusammen eine Schulfunksendung anhören würden. »Jessica, warum, meinst du, habe ich dich hergebeten?«
Das klang wie eine Falle.
»Ich weiß nicht, Miss.«
»Wirklich nicht?«
»Ist es was Gutes oder was Schlechtes?«
»Ich würde sagen, etwas Gutes. Es ist gut und an der Zeit, dass wir zwei uns unterhalten.«
Es klang immer noch wie eine Falle.
Auf dem Tischchen standen zwei Gläser und eine Wasserkaraffe. Miss Downing goss Wasser in die beiden Gläser, setzte sich wieder zurecht und legte den einen Arm auf die Lehne. Niemand wusste, was mit dem anderen Arm passiert war, nur, dass er ehrenhaft abhandengekommen war, Gerüchten zufolge im Krieg. Nie hätte sie ihn aus Achtlosigkeit verloren. Und ein genetischer Fehler war es auch nicht.
»Erzähl mir von deiner Mutter.«
»Meiner Mum?«
Schweigen. Durch die Tür hörte man gedämpft die »The Planets« von Gustav Holst. Die Musiklehrerin spielte auf dem Klavier ein paar Takte aus »Mars«. Das Schulorchester spielte sie nach. Miss Downing wartete. Sie zupfte an ihrer Robe. Darunter trug sie ein schwarzes Kostüm – sie trug immer Schwarz –, dessen große Knöpfe ihre Brust einfassten.
»Sie arbeitet, richtig?«
»Sie ist Lehrerin.«
Ihr Nicken bedeutete, dass sie das bereits wusste. »Und das heißt, dass sie den ganzen Tag weg ist.«
So wie sie es sagte, fühlte ich mich herausgefordert zu erwidern: »Nicht den ganzen Tag. Abends kommt sie nach Hause.« Das klang nicht so, wie ich es meinte. Deswegen sagte ich noch: »Sie ist zu Hause, wenn ich komme.«
Miss Downing machte ein verschlossenes Gesicht, das ausdrückte, dass sie mir nicht glaubte. »Natürlich sind es schwierige Umstände.«
Ich wusste nicht, was sie damit meinte. »Was sind das für welche?«
»Dein Vater.«
»Er ist tot.«
»Das ist mir bekannt. Ich weiß, dass es bei dir zu Hause keinen Vater gibt.«
Es klang seltsam: bei dir zu Hause. Als könnte mein Vater eines Tages zurückkommen. Eines Tages käme ich von der Schule nach Hause, stürmte in die Küche, nähme mir einen Keks, und er wäre da, auf dem Sofa, den Arm auf der Rückenlehne, so wie auf dem Foto, das meine Mum bei der Urne hatte. Miss Downing wartete, dass ich mehr über meinen Vater sagte. Ich guckte in eine andere Richtung. Ich besah die Dinge auf ihrem Schreibtisch – Glocken, Schlüssel, Trillerpfeifen, Bibeln, das Lineal, das in Zoll Maß an ihrem Löschblock nahm. Schließlich sagte sie: »Krebs, richtig?«
Das wussten alle. Das stand in meinem Ordner. Die Schulsekretärinnen hielten ihn in der ausgestreckten Hand, als wäre Krebs ansteckend. Manchmal erriet ich ihre Gedanken hinter den Augen: Es geht nie gut aus, wenn kein Vater da ist.
Meine Mum erzählte es so: Eines Tages sei mein Vater aufgewacht und habe meiner Mutter die Hand auf den Bauch gelegt und die Schwellung befühlt. Dann sei er aufgestanden und habe sich vor dem Badezimmerspiegel die Haare gekämmt und eine Schwellung am Kopf gespürt. Einen Monat später war er tot. Ich war im Bauch meiner Mum bei der Beerdigung dabei. »Ihr wart nur Zentimeter voneinander getrennt«, sagte sie oft. »Er im Sarg, du im Bauch. Beide knapp nicht im Leben.«
Miss Downing sagte: »Für deine Mutter muss es schwer sein.«
»Ja, Miss, das stimmt.« Doch es war nicht die Wahrheit. Ich sagte es aus Mitleid mit ihr. Als Ausgleich dafür, dass meine Mum Lehrerin und den ganzen Tag nicht zu Hause war. Aber eigentlich war es, das sagte wenigstens meine Mum, gar nicht so schwer. Bis zu dem Tag, als mein Vater starb, war sie überzeugt, er würde wieder gesund. Sie hatte an seinem Bett gesessen und Pläne für die Zukunft gemacht, bis eine Krankenschwester kam, ihre Hand nahm und sagte, er habe aufgehört zu atmen. Das bedeutete, dass sie sich nicht von ihm verabschiedet hatte. Nicht direkt jedenfalls. Wahrscheinlich war das gut so, denn für meine Mum war ein Abschied kein Wort, es war ein Drama – es war eine Umarmung und ein Kuss auf die Wange, ein Händedrücken, ein Händeschütteln, ein Küssen aller Finger einzeln. Der ausgedehnte Abschied meiner Mum war vielleicht mehr, als mein Dad hätte ertragen können.
»Sie hat nie wieder geheiratet, richtig? Deine Mum ist allein.«
»Sie ist nicht allein. Ich lebe bei ihr. Sie lebt mit mir.«
»Ich meinte, es gibt keinen Stiefvater. Oder Ähnliches.«
Nein, Mum hatte nichts Ähnliches. Keine Zeit, sich umzusehen. Außerdem, kein Sinn. Nicht in Tamworth.
»Und eure Verwandten?«
»Die sind auch tot.«
»Das stimmt nicht, Jessica. Und es ist nicht freundlich. Deine Großmutter lebt noch.«
Woher wusste Miss Downing das mit Granma?
»Aber anscheinend seid ihr nicht sehr nah.«
»Sie lebt in Weymouth.«
»Ich meinte, die Bindung ist nicht sehr eng.«
Die Granma betete für uns. Als mein Dad plötzlich starb, fing sie erst mit einer Diät an, dann trat sie einer Glaubensgemeinschaft mit einer zusammengestoppelten Religion und mitreißenden Chorälen bei, die Granma auf der Orgel spielte. Sie lebte in einem weiß gestrichenen Haus und hatte ein Kruzifix aus Mahagoni und eine Vase mit gelben Rosen, die – wie immer sie das hingekriegt hatte – nie welkten.
»Also besteht deine Familie praktisch nur aus deiner Mutter.« Miss Downing holte das Glas heran und trank einen Schluck Wasser. »Und ich weiß von ihren Neigungen.« Darauf neigte ich den Kopf, weil ich nicht genau wusste, was sie meinte. »Von ihren kommunistischen Überzeugungen. Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei. Chronisch.« Als wäre es ein Krankheitszustand. »Du hast selbst einen Verstand, weißt du. Du musst nicht das tun, was deine Mutter dir sagt. Du bist alt genug, um selber zu denken.«
»Das tue ich auch. Und ich tue es gerne. Wir tun das zusammen, und es gefällt mir.« Das klang nicht so überzeugend, wie ich gehofft hatte. Deswegen sagte ich noch: »Es ist wichtig, die Botschaft zu verbreiten.«
»Und was ist die Botschaft?«
Ich glaubte, dass es viele Botschaften gab, und sagte: »Das, was an dem Morgen auf dem Morning Star steht.«
Miss Downings Finger wanderten unter ihre Robe und streichelten den leeren Ärmel, der zu einer Tasche zusammengenäht war. Ich beobachtete ihr Handgelenk – es war kräftig, vom Glockenläuten. Wegen ihres Hobbys war sie einmal im Herald gewesen. »Weißt du, Jessica, ich mache mir Sorgen. Die politischen Überzeugungen deiner Mutter sind nicht sehr … englisch. Wer weiß, wohin ein solches Spektakel führen kann.«
Es dauerte einen Moment, bis ich »ein solches Spektakel« mit dem Vorfall vom Samstag in Verbindung gebracht hatte. »Ich habe Sie am Samstag gar nicht in Middle Entry gesehen.«
»Ich war auch nicht da. Aber ihr seid ziemlich auffällig, deine Mutter und du, in einer Stadt, in der viel geredet wird. Es wurde mir zugetragen. Und mit einem Spektakel muss man rechnen, wenn man in einer Stadt wie Tamworth subversive Schriften verbreitet.«
»Aber es war am Samstag. Am Samstag habe ich frei.«
»Du vertrittst diese Schule an jedem Tag in der Woche. Vom Gymnasium hast du nie frei.« Miss Downing hielt mir ihre Nase entgegen, die feinen Härchen in den Nasenlöchern bewegten sich bei jedem Atemzug. »Diese Schule handelt für jeden Schüler an Eltern statt. Und wie wir gerade festgestellt haben, gilt das für dich besonders.« Damit meinte sie, dass ich mit einem toten Vater und einer kommunistischen Mutter praktisch Waise war.
Dann fing sie mit dem Thema Freundinnen an. »Ich vermute, es fällt dir schwerer als anderen, Freundinnen zu finden.«
Hin und wieder fand sich jemand, der sich mir anschließen wollte – einmal war es die einzige Zeugin Jehovas an der Schule, die sich im Umkleideraum herumtrieb und den Wachtturm in Jackentaschen stopfte, dann das Mädchen, deren Mutter mit einem Liebhaber abgehauen war und deren Vater zum Alkoholiker geworden war, dann der Schülersprecher, der im Herald bloßgestellt wurde, weil er in der Unterwäsche seiner Schwester in den Pleasure Grounds herumgelaufen war und dafür von der Schule verwiesen wurde. Immer waren es die Unbeliebten, Ungepflegten und Unberechenbaren, die sich mit mir anfreunden wollten. Aber meine Mum hatte recht, wenn sie sagte: »In einer Stadt wie dieser ist es schwer, Freunde zu finden. Es gibt einfach keine Grundlage.« Außerdem hatte es keinen Sinn. Für Freunde brauchte man Zeit. Man musste sie pflegen. Wir mochten Menschen, meine Mum und ich, aber wir hatten einfach keine Zeit für sie. Von Rosie abgesehen, vielleicht.
»Meine Mum hat eine Freundin. Rosie.« Sie unterrichtete Darstellendes Spiel als Vertretungslehrerin im Overspill. Das bedeutete, dass sie die meiste Zeit zu Hause war und Kerzen für die Bewegung machte oder in der Hängematte lag und den CND-Newsletter faltete, den Rundbrief der Campaign for Nuclear Disarmament, der Kampagne für Nukleare Abrüstung, oder Bücher mit Eselsohren las und dabei kubanische Zigarren rauchte, deren blauer Rauch sich an der Decke kräuselte. Sie langweilte sich in Tamworth – das erzählte sie mir ganz oft –, aber statt sich in den Zug zu setzen, reiste sie in ihren Träumen: in Warten auf Godot war es eine alte Landstraße, in Einer flog über das Kuckucksnest eine psychiatrische Anstalt. Miss Downing sagte: »Rosemary ist eine gute Freundin, vermute ich.«
»Meine Mum sagt, sie ist ein Pfundskerl.« In Wirklichkeit sagte sie: ›Sie hat zwar nicht den Durchblick, aber sie ist ein Pfundskerl, daran besteht kein Zweifel.‹
»Und deine Freundinnen?«
»Rosie ist auch meine Freundin.«
»Ich meine, in deiner Altersgruppe.«
Die in meiner Altersgruppe glaubten, das Klassensystem habe etwas mit der Schule zu tun und Lenin sei einer der Beatles.
»Mädchen in deiner Altersgruppe, wie …«
Ich blickte zu Boden. Der Teppich vor dem Sessel war von ähnlichen Gesprächen abgenutzt. Ich versuchte, mit meinen Füßen den Flor wieder aufzurichten.
»… wie Rebecca Caldor. Du sitzt im Unterricht doch neben ihr.«
Während des Unterrichts hatte ich Zeit, sie von der Seite zu betrachten. Ich kannte ihre Hände so gut, dass ich sie aus dem Kopf hätte zeichnen können: die sauberen Halbmonde ihrer Nägel, die Sommersprossen auf den Handrücken. Ich hätte sie im Dunkeln an ihrem Shampoo erkennen können – das in letzter Zeit von einem Parfum überlagert war. Weil ich neben ihr saß, kam ich nicht oft in ihre Sichtlinie, aber wenn sie mich einmal ansah, dann mit einem fernen Blick. Ich war für sie so unscharf, dass ich ebenso gut nicht da sein konnte.
»Sie hat dich eingeladen, habe ich gehört. Zu einer Geburtstagsparty. Wie war das?«
Ich hatte Kuchen gegessen. Selbstgebackenen. Bis dahin hatte ich immer nur Kuchen von der Greggs, der Bäckerei, oder aus einer Packung vom Co-op gegessen. Mrs Caldor hatte die Tür aufgemacht und mich mit einem Winken ihrer mehlbestäubten Hand begrüßt. Aus den Tiefen des Hauses hörte ich das aufgeregte Geschnatter von Mädchen, die kurz davor waren, Teenager zu werden. »Schuhe«, hatte Rebecca gesagt. Damit meinte sie: Zieh sie aus. Ich wartete im Flur, bis der Geruch meiner Socken verflogen war. An der Wand hingen alte Stiche von Tamworth, von Staffordshire-Hunden, von einer Pistole, mit der Frances Caldor in den Krimkrieg gezogen war. Es gab sogar ein Gästebuch. Alle Mädchen in meiner Klasse hatten sich eingetragen. Rebecca war die Erste, die dreizehn wurde. Sie hatte gesagt, ich müsse unbedingt zu der Party kommen, denn alle anderen kämen auch, und die Vorstellung, dass alle außer mir da sein würden, überzeugte mich, und ich ging hin.
Später sagte Rebecca: »Meine Mutter fragt, ob du jemals in den Spiegel guckst.«
»Unser Spiegel ist verbogen.« Wir hatten die Löcher auf gut Glück gebohrt und die falschen mit Klopapier gefüllt und konnten dann die Schrauben nicht richtig anbringen.
»Das erklärt, warum du so liederlich aussiehst.«
»Was heißt liederlich?«
»Dass du schmutzig bist.«
Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Ich wusste, dass ich manchmal schmutzig war. Aber man musste schmutzig sein, bevor man sich wusch. Das war doch der Sinn.
Rebecca sagte: »Du weißt, dass Reinlichkeit gleich nach Göttlichkeit kommt.«
Ein weiterer guter Grund, sich nicht zu waschen.
Jetzt bewegte Miss Downing sich auf ihrem Sessel, als wäre der Boden darunter uneben. Sie stemmte sich hoch und trat hinter meinen Stuhl, wobei sie den Geruch von Teerseife verbreitete. Ich erinnerte mich an den Geruch von meiner Nan, das war viele, viele Jahre her. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Direktorin denselben Geruch wie die freundliche alte Dame in Streatham hätte, die mir Reispudding mit Haut drauf zu essen gegeben und Pullover für die Russen gestrickt hatte. Einen Moment lang war mir Miss Downing fast sympathisch. Sie blieb vor der Wand mit den Fotos stehen. Für jedes Jahr, seit sie Direktorin war, hing dort ein Foto. Wir waren alle abgebildet, auf Breitbildaufnahmen, die auf dem Schulhof gemacht worden waren, Reihen von Schülern in angelsächsischen Kutten. »Das sind deine Altersgenossen, Jessica.« Sie gab mir ein Zeichen, neben sie zu treten. Ihr Finger wanderte von einem Gesicht zum nächsten. Sie nannte die Namen der Mädchen in meiner Klasse und erklärte, was jede von ihnen am Samstag zu ihrer Vervollkommnung tat – eine spielte in der Blaskapelle der Stadt, eine andere strebte beim Schwimmen nach Ruhm, eine dritte war Pfadfinderin.
»Und das bin ich, ich verkaufe den Morning Star und mache mich zu einem Spektakel. Ich bringe Schande über die Schule.«
Es rutschte mir so heraus. Der Vollständigkeit halber.
Es entstand eine Pause, die so lang war, dass ich mich zu Miss Downing umdrehte. Ich sah die hervortretenden Adern an ihrem Hals und hörte das Rascheln ihrer Robe, ich sah das Aufblitzen der Anstecknadel auf ihrem Revers. Dann spürte ich einen scharfen Schlag auf meinem Handrücken. Einen Moment lang war mein Körper wie betäubt. Dann setzte der Schmerz ein. Er rollte über meine Fingerknöchel und raste den Arm hinauf. Ich legte meine Hand schützend in die Armbeuge. Ich dachte, die Direktorin hätte mir die Knochen gebrochen.
»Genau das wird in dem Milieu gefördert. Versprich mir, dass du nie wieder so frech antwortest.«
Ich konnte nicht sprechen und presste meine Zähne auf die Unterlippe, auf keinen Fall würde ich anfangen zu weinen. Der Schmerz wanderte von meiner Hand hinter meine Augen. Der Druck wurde immer größer. Miss Downings Umrisse verschwammen.
»Antworte.«
»Nein, Miss.«
»Wie bitte?«
»Ja, Miss.«
Sie legte das Lineal hin. »Ich handle an Eltern statt. Das ist meine Aufgabe. Eines Tages wirst du zurückblicken und mir dankbar sein.« Sie streckte mir die Hand entgegen, jetzt schon in Erwartung meiner Dankbarkeit. Ich konnte meine rechte Hand nicht bewegen und gab ihr meine linke in einem unbeholfenen Handschlag. Ihre Haut war kalt, die Finger steif. »Ich habe dich aus dem Geschichtsunterricht geholt.« Sie warf einen Blick auf die Uhr. »In dieser halben Stunde wirst du ganze Jahrzehnte versäumt haben.«
Das war das Problem mit Geschichte. Manchmal zogen große Stücke davon einfach an einem vorbei.
Als am Nachmittag die Schulglocke läutete, war ich die Erste am Tor. Beim Rennen tat die Hand noch mehr weh, also ging ich in einer Art Laufschritt nach Hause. Nebenan saß Mr Howard am Fenster, sein glänzender Schädel wie eine Trophäe auf der Fensterbank. Ich versuchte, ihn nicht zu sehen. Er würde nur rauskommen und mit mir reden wollen – über die Hitze, über den Gartenschlauch, über seinen braunen Rasen. Aber offenbar hatte er gesehen, dass ich mich vorbeischleichen wollte, und er nickte mir nur zu und sagte stumm durch die Fensterscheibe: »Alles in Ordnung, Jess?«
Im Wohnzimmer fand ich eine noch warme Tasse Tee und eine halb gegessene Scheibe Toast. Meine Mum hatte mir einen Zettel hingelegt: War da, bin wieder weg. Komme … weiß noch nicht, wann. Guck im Kühlschrank, ob du was findest. Im Kühlschrank lag auf einer tiefgefrorenen Pizza noch ein Zettel: Das hier? Aber dazu müsste ich den Grill über dem Herd anmachen und warten. Sonst war noch ein Glas mit eingelegten Eiern da, die ich eine Weile lang gern gegessen hatte, und seitdem ich sie nicht mehr mochte, standen sie im Kühlschrank. Dann war da noch eine letzte Scheibe Leberkäse, die der Mann mit der Duschhaube an der Fleischtheke im Co-op für meine Mum abgeschnitten hatte und die jetzt am Fettpapier festklebte. Früher war er ein Schüler meiner Mum gewesen, und jetzt fragte er immer nach Neuigkeiten von der Schule. »Immer dasselbe, immer dasselbe«, sagte sie jede Woche, ohne Fehl.
Die Kühlschranktür schloss sich mit einem Seufzer. Ich nahm die halbe Scheibe Toast und aß sie auf dem Weg nach oben. Inzwischen war meine Hand lila angelaufen. Ich ging ins Bad und hielt sie vorm Spiegel hoch, denn obwohl der Spiegel verbogen war, konnte man manchmal in der Reflektion klarer sehen – als gehörten die Körperteile nicht zum Körper. Aber die Zahnpastaspritzer versperrten die Sicht, und es war schwer zu entscheiden, ob ich verbogen war oder der Spiegel. Ich guckte im Badezimmerschrank nach und fand eine Packung Paracetamol, ein Abführmittel, eine Desinfektionslösung, Staubflusen. Ich versuchte mich in meine Mum zu versetzen. Sie würde sagen: Denk an die Guerillas. Hände zu zertrümmern war üblich. Es gehörte zum Training. Ich achtete nicht auf den Schmerz und drückte meine Finger mit aller Kraft an das Porzellan, während ich das Silberfischchen beobachtete, das am Abfluss entlangglitt, und drückte so lange, bis alle Fingerkuppen weiß waren und ich glaubte, ein Klicken zu hören. Auf einer Skala von eins bis zehn war es eine Sieben: schlimmer als nicht zuerst zu blinzeln und schlimmer als den Arm verdreht zu bekommen, aber nicht so schlimm wie Wasserfolter. Einmal hatte meine Mum mich halb bewusstlos aus der Wanne gezogen, dabei hatte sie so laut geschrien, dass die Nachbarn sie bestimmt hören konnten, und mir so lange auf den Rücken geklopft, bis ich eine Lungenladung von Wasser und Speichel ausspuckte. Nachdem ich mich davon erholt hatte, setzte ich mein Testament auf. Ich vermachte dem Morning Star mein Sparkonto und meiner Mum die Urne mit meiner Asche. Sie war entsetzt und sagte, ich dürfte nicht versuchen zu sterben. Aber ich hatte keine Angst. Keine echte Angst. Wenn ich stürbe, dann wäre es heldenhaft. Ich würde nie an Reinlichkeit sterben.
Vom Badezimmer aus konnte ich in das Zimmer meiner Mum gucken. Auf dem Fußboden lagen die sichtbaren Zeichen ihrer Eile, zu der Versammlung zu kommen – die losen Papiere in ihrer Schultasche, die in die Ecke geworfenen Sachen vom blitzschnellen Umziehen. Ich wand mich einhändig aus meiner Schuluniform und legte meine Sachen auf den Haufen Wäsche. Ich setzte mich auf ihr Bett. Es war April, aber in ihrem Zimmer roch es nach Weihnachten von Rosies Duftkerzen. Trotz des Weihnachtsgeruchs konnte ich an der Bettwäsche meine Mum riechen, das Oil of Olaz, das Rosenwasser. Ich sah die gelbe Kuhle, wo sie auf dem Bauch gelegen hatte und Speichel im Schlaf auf das Laken gelaufen war. Ein Becher Tee vom Abend zuvor, halb leer, stand auf dem Nachttisch, an der Innenseite braune Ränder von altem Tee. Auf dem Fußboden lagen Kekskrumen. Auf dem Nachttisch die Ohrstöpsel, wenn der Wecker zu laut tickte, und der zweite Wecker, wegen der Ohrstöpsel.
Ich ging in mein Zimmer und nahm das Schwarze Heft – ein altes Schulheft – hervor und las die Namen all der Menschen, die in der Revolution erschossen werden würden: James Callaghan, Jimmy Carter, Bob Monkhouse, Granma, Pinochet, Benny Hill, Rebecca Caldor, ihre Mum, die Osmonds – die hatte meine Mum vorgeschlagen, was ich schwierig fand, denn insgeheim mochte ich die Osmonds. Oder zumindest die B-Seite von »Long-Haired Lover from Liverpool«. Ich konnte keinen Einspruch erheben, schließlich waren sie Mormonen und Amerikaner, aber manchmal, wenn ich im Bett lag und schlecht gelaunt war oder einfach Hunger hatte, sang ich unter der Decke »Mother of Mine«.
Ich nahm meinen Füller, den mit der goldenen Feder in der schwarzen samtenen Schachtel, und mein Tintenfass, denn ein Todesurteil verlangte eine gewisse Zeremonie. Oder zumindest das richtige Schreibzeug. Ich füllte den Füller mit Tinte und wischte ihn sauber, alles mit einer Hand, und fragte mich, wie Menschen ohne Hände ganze Bilder auf Weihnachtskarten malten. Mein Mittelfinger färbte sich türkis von der Tinte. Ich hatte nicht die Geduld zu warten, bis die Tinte getrocknet war, und drückte das Löschpapier drauf, so dass einzelne Buchstaben von MISS DOWNING in Spiegelschrift darauf zu lesen waren.
Bitte.
Erledigt.
So gut wie tot.
Danach muss ich eingeschlafen sein, denn als Nächstes erinnere ich mich, dass ich der Länge nach auf dem Boden lag, den Rücken voller Teppichhaare und auf dem ganzen Körper eine Gänsehaut. Draußen war es dunkel. Ich lauschte, ob von unten etwas zu hören war. Ich steckte den Kopf zur Tür raus und rief nach meiner Mum, dann presste ich das Ohr an den Fußboden.
Nichts.
Meine Hand fühlte sich schwer an, der Schmerz ein gleichbleibendes Dröhnen. Ich hielt die Hand zum Fenster hoch. Das Licht der Straßenlaterne färbte sie orange, die Finger rot, als wären sie in der Bibliothek gestempelt worden. Ich stieß die Tür mit dem Fuß auf und rief lauter.
Stille.
Das bedeutete, dass meine Mum wirklich nicht zu Hause war.
Ich wusste nicht, wie spät es war, aber die Versammlung musste längst vorbei sein. Also war sie in den Tankstellen-Imbiss gegangen, um eine Portion gebratener Leber und Pommes zu essen. Sie wird auf einem Hocker am Fenster gesessen haben, mit Blick auf den Verkehr auf der A5, während im Hintergrund ein einarmiger Bandit blinkte und aus dem Radio die Musik von BBC1 plätscherte. Und auf dem Weg nach Hause wäre sie noch schnell ins Hamlets gegangen, auf einen späten Drink. Nur einen, daran hielt sie sich, da war sie eisern. Da wäre meine Mum jetzt. Bryan hätte schon das Glas genommen, bevor sie an der Bar war, und gesagt: »Ein doppelter Whisky. Kein Eis. Kein Wasser. Nichts. Pur. Ein doppelter.« Das sagte er jedes Mal, es war eine Wiederholung von dem, was meine Mum beim ersten Mal gesagt hatte. Sie würde zum Tesco-Supermarkt rübergucken, wo ein angeketteter Papagei saß, der gelernt hatte, »Hallo« zu sagen. Sie würde über die Versammlung nachdenken und mit den Fingern das in den Holzsitz eingeritzte »FUCK OFF« befühlen. Und wenn sie zu dem Schluss gekommen war, dass die Versammlung eigentlich nicht so schlecht verlaufen war, nicht wirklich schlecht, würde sie in den Minivan steigen und hoffen, auf dem kurzen Weg vom Hamlets nach Hause nicht angehalten zu werden.
Und wenn sie das nicht riskieren wollte, würde sie zu Fuß nach Hause gehen. Sie würde durch die Little Church Lane gehen, vor dem Zeitungsladen stehen bleiben, in dessen Schaufenster ihr Gesicht sich verschwommen spiegelte, und sich an den Bonbongläsern sattsehen. Zitronendrops, Rhabarber-mit-Vanille-Drops, Birnendrops. Birnendrops mochte meine Mum für ihr Leben gern.
Ich legte mich ins Bett und strich mit den Füßen das verkrumpelte Laken glatt. Ich zog mir das Oberlaken über den Kopf und blies so lange, bis mir schwindelig wurde und ich im Bett warm war. Durch die Wand hörte ich das Klopfen der Wasserrohre – das war Mr Howard, der sich die Zähne putzte und das Gesicht wusch, bevor er ins Bett ging. Und das bedeutete, dass es kurz vor halb elf war. Er stand um sechs Uhr auf, »Punkt sechs, ohne Wecker, solche Gewohnheiten ändern sich nie«. Mr Howard war Bergarbeiter gewesen. Wenn er am Ende eines Arbeitstages nach Hause kam, hatte Nancy einen Auflauf im Ofen und einen Mr-Kipling-Kuchen zum Nachtisch vorbereitet, im Kamin brannte das Feuer, von Kohlen, die sie umsonst bekamen. Einmal hatte ich zu Mr Howard gesagt: »Wenn man ein Kohlestück ganz fest drücken könnte, hätte man einen Diamanten.«
»Und was soll ich mit einem Diamanten?«, hatte er gesagt, als hätte er alles, was er sich wünschte, und wäre ganz zufrieden.
Und dann starb Nancy.
Sie hatte am Wohnzimmerfenster gesessen und den Menschen auf der Straße zugesehen, die nach Hause kamen, ihre Fußgelenke waren von Flüssigkeit geschwollen, wogegen keine Tabletten etwas ausrichten konnten, und dann war »sie einfach zusammengebrochen – Herzversagen«, sagte Mr Howard. Aber sie war nicht umgefallen wie ein Baum. Sie hatte im Sessel gesessen, die Arme auf den Lehnen, die Augen geöffnet, und hatte ausgesehen wie lebendig, nur dass sie nicht mehr atmete. Ihm fiel erst auf, dass sie tot war, als ihr Körper schon kalt wurde. Er war es gewohnt, dass sie nicht antwortete, wenn er ihr zur Unterhaltung kleine Geschichten erzählte, weil sie ihr Hörgerät oft ausschaltete.
So hat er es mir erzählt.
Er beerdigte Nancy auf dem Wigginton Cemetery, in einem Grab, in dessen Nähe es ein Feld mit Holunder, Beinwell und Eselsdisteln gab und in dem er auch Platz haben würde. Als er von der Beerdigung nach Hause kam, mit feuchten Flecken unter den Achseln, und sich das Gesicht mit einem Taschentuch trockentupfte – er schob es auf die Hitze –, sagte er: »Sie liegt in guter Erde, Jess.« Davon verstand er etwas. Schließlich hatte er sein Leben unter der Erde verbracht. Als ich das meiner Mum erzählte, sagte sie: »Ich hätte nicht gedacht, dass ein Bergarbeiter so viele Pflanzennamen kennen würde.«
Ich lauschte wieder auf die Geräusche von nebenan. Bei Mr Howard war jetzt alles still. Sicherlich zog er sich seinen Schlafanzug mit Paisley-Muster an, den er jeden Donnerstag zum Trocknen draußen auf die Leine hängte. Er würde ein paar Worte zu dem Foto auf seinem Nachttisch sagen und sich auf seine Bettseite legen – es würde immer seine Bettseite bleiben – und sofort einschlafen. Das alles wusste ich, weil Mr Howard gern redete und ich manchmal dazu aufgelegt war, ihm zuzuhören – wenn ich zu Hause war und meine Hausaufgaben gemacht hatte und meine Mum noch nicht zurück war und es ein warmer Abend war und er und ich hinten im Garten waren.
Ich hörte, wie ein Bus in das Depot einbog. Ich stand auf und ging zum Fenster. Ich guckte nach Norden, in die Richtung, aus der der Minivan kommen musste. Ich richtete meinen Blick auf die Kurve und versuchte mit einer Willensanstrengung zu erreichen, dass der Minivan um die Kurve bog – das senfgelbe Auto, der krächzende Motor, das weichgezeichnete Gesicht meiner Mum am Steuer. Dann blickte ich nach Süden, in die Richtung, aus der sie kommen würde, wenn sie zu Fuß ging – über den Friedhof, leise vor sich hin singend –, an St. Editha vorbei, wo die Glocken gerade die volle Stunde geläutet hatten.
3
Eine Einladung
Tamworth, April 1978
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war meine Mum zu Hause. Bei weichgekochtem Ei und Toast erzählte ich ihr, was passiert war, und zeigte ihr die verletzte Hand.
»Diese Miss Downing ist nicht an meiner statt da. Man schlägt Leute nicht.«
Aber manchmal brachte man sie um – wenn sie es verdient hatten. Dazu war das Schwarze Buch da. Meine Mum wollte nicht auf die Revolution oder die Erschießungen warten. Sie wollte umgehend bei der Schule Beschwerde einlegen. Mir wurde das Herz schwer. Ich hatte noch fünf Jahre als Schülerin dort vor mir. Ich sagte: »Victor Jara wurde auch die Hand zerschmettert.«
»Und er ist gestorben.«
»Das lag daran, dass sie ihn erschossen haben.«
Und ich sah, wie sich ihre Stirn umwölkte. Chile hatte diese Wirkung auf sie. Aber ich wusste, dass Victor Jara ein gutes Stichwort war. Meine Mum hob meine Hand in die Höhe, hielt sie am Küchenfenster ins Licht und drehte sie wie eine Trophäe. Ich sah, wie ihre Sorge sich in Stolz wandelte. Dann fiel ihr ein Lied ein. Keins über Victor Jara – zu spanischen Lieder konnte sie nur improvisierte Wörter mitsingen –, aber sie kannte ein Lied über Hände, von Pete Seeger: »One man’s hands can’t tear a prison down; two men’s hands can’t tear a prison down, but if two and two and fifty make a million, we’ll see the day come round; we’ll see the day come round.« Nur dass das entmutigend war, denn zwei und zwei und fünfzig ergaben keine Million. Nicht im Mathe-Grundkurs. Nicht in einem, der zum O-Level-Abschluss führte. Aber über das Lied geriet die Beschwerde in Vergessenheit, und statt dass ich mit Miss Downing im Clinch leben musste, war sie einfach weiterhin die tägliche Erscheinung bei der Morgenversammlung. Hin und wieder begegnete ich ihr im Flur, und sie bedachte mich mit einem bedeutungsvollen Blick, in Erwartung meiner Dankbarkeit. Ich guckte zur Seite und versuchte, die Teerseife zu erschnüffeln.
Dass ich meiner Mum das mit »an Eltern statt« gesagt hatte, war ein Fehler gewesen, denn offenbar beunruhigte sie das. Der Gedanke, dass jemand anders ihre Rolle übernehmen könnte, missfiel ihr, also übernahm sie die Rolle selbst – sie spielte sich als Mutter auf und wies mir die Rolle der Tochter zu. Sie kaufte massenhaft Bananen und erklärte, ich brauche Vitamine. Sie roch unter ihren eigenen Achseln und behauptete, ich müsse baden. Und dann erzählte sie mir, dass ein James von der Partei vorbeikäme und es besser wäre, ich wäre nicht bei der Versammlung.
»Warum ist es so geheim?«
»Du weißt, dass ich nichts Geheimes mache.«
»Bleibt er über Nacht?«
»Darauf gebe ich keine Antwort. Aber nein.«
Manchmal blieb nämlich jemand über Nacht: Neil, der Gitarrist, Trevor, der Automechaniker, Eamonn, der Labour-Abgeordnete. Und dieser James schien noch am ehesten qualifiziert, wenn er in der Partei war. Ich unterhielt die Übernachtungsgäste so gut ich konnte und machte mich dann für den Rest des Abends dünn. Wenn ich ihnen zuwinkte und gute Nacht wünschte, wusste ich, dass ich sie nicht wiedersehen würde. Am nächsten Morgen war immer alles so wie sonst.
»Wieso kann ich nicht dabei sein? Ich bin immer bei den Versammlungen dabei.«
»Weil du hier wohnst.«
»Und damit es mehr sind.«
»Das auch.«
»Und warum diesmal nicht? Ich kann das Protokoll schreiben.«
»Weil er nicht mit einer Tochter rechnet. Weil er mich eingeladen hat«, und sie tippte sich hart auf das Brustbein, so wie ein Arzt es tat, wenn er einen auf eine Infektion hin untersuchte. Das Wort »mich« klang entsprechend hohl. »Später, Jess. Später erzähle ich dir alles. Es könnte etwas Gutes sein. Für uns beide.«
Aber mütterliche Distanz war anstrengend, und meine Mum hatte keine Kraft dazu. Sie brachte es nicht fertig, sich gegen meine dreizehn Jahre zu stemmen, sich meinem Leben zu widersetzen. An dem Abend, als James kommen sollte, fragte ich, ob ich in dem Kabäuschen unter der Treppe sitzen und zuhören konnte. Die Tür war aus dünnem Sperrholz, ein Blatt undurchsichtiger Luft, und man konnte alles mithören. Meine Mum sagte: »Du weißt, dass ich keine Tricks mag. Aber solange ich nicht weiß, ob du da bist. Solange ich nicht diejenige bin, die das mit den Tricks macht.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.