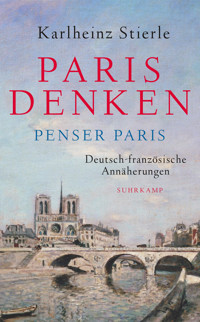
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Paris kommt die Stadt zu Bewußtsein. Keine andere Stadt hat mit vergleichbarer Intensität versucht, ihre eigene Identität in der Literatur zu erfassen. In seinem neuen Buch analysiert Karlheinz Stierle neue Aspekte der Parisliteratur und schlägt dabei einen Bogen bis ins 21. Jahrhundert. Dabei geht es ihm auch um deutsch-französische Interferenzen. So macht er zum Beispiel Peter Handke als den Kolumbus der Pariser Banlieue aus, die dieser in seinem Roman Mein Jahr in der Niemandsbucht beschwört. Er fragt, ob Friedrich Schlegels Vorstellung einer grenzenlos wachsenden Universalpoesie ein Modell war für die Stadtvision Victor Hugos. Stierle erläutert, inwiefern die Begegnung mit Paris Rainer Maria Rilke erst eigentlich zu seiner eigenen dichterischen Sprache geführt hat. Und wie Walter Benjamin in seinem berühmten Passagenwerk die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts entdeckte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Karlheinz Stierle
Paris denken – Penser Paris
Deutsch-französische Annäherungen
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Einleitung
I Penser Paris
1 Stadtbewußtsein und Pariser Stadtdiskurs
2 Der Tod der großen Stadt. Paris als neues Rom und neues Karthago
3 Paris und Berlin: Zwei Hauptstädte des Wissens
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
4 Phänomenologie der modernen Welt. Balzacs
Le Colonel Chabert
Das Wissen
Die Geschichte
Der Diskurs
5 Imaginäre Räume. Eisenarchitektur in Paris
I
II
III
IV
II Paris denken
1 Großstadt und Geistesleben. Georg Simmels Begegnung mit Balzac
2 »Manche freilich müssen drunten sterben«: Hugo von Hofmannsthals Pariser Weltformel
3 Rilkes Pariser Bilder
4 Walter Benjamin: ein Leser von Paris
5 Abschied von Paris: Peter Handkes
Mein Jahr in der Niemandsbucht
und die Entdeckung der Pariser Banlieue
Nachweis der Erstveröffentlichungen
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Einleitung
Die große Stadt in ihrer Überfülle verschlägt die Sprache. Die Stadt zu denken, ihrer schreibend inne zu sein, entreißt sie der Stummheit. Keine Stadt hat sich so so hellsichtig und erfinderisch im Gedanken erfaßt und durch die Jahrhunderte selbst dargestellt wie Paris.
Der erste Teil des Bandes umfaßt fünf Momente aus der Geschichte des »Penser Paris«, in denen die Stadt sich selbst reflektiert. Das erste Kapitel, »Stadtbewußtsein und Pariser Stadtdiskurs«, entwirft gleichsam eine Strukturgeschichte der Parisreflexion, für die Paul Valéry die Formel »Penser Paris« gefunden hat. Es folgt ein Kapitel über die ihr eigenes Ende imaginierende Stadt. Das dritte Kapitel geht auf die revolutionäre und postrevolutionäre »Hauptstadt des Wissens« ein und setzt sie in Bezug zu Berlin, das nach Pariser Vorbild sich gleichfalls als eine Hauptstadt des Wissens organisiert. Das nachrevolutionäre Paris mit seiner neuen sozialen Mobilität, dem Balzac sein monumentales Erzählwerk gewidmet hat, ist Gegenstand des nächsten Kapitels. Eine neue Herausforderung für das Selbstverständnis der Stadt ist schließlich die Eisenarchitektur, deren Innovationen die Physiognomie der Stadt tiefgreifend verändert haben.
»Penser Paris« ist die Devise eines Parisdiskurses, in dem die einzelnen Bemühungen, Paris zu denken, wie Räder einer großen Denkmaschine ineinandergreifen. »Paris denken« könnte die Devise der im zweiten Teil dargestellten deutschsprachigen Hinwendungen zu Paris lauten, die jeweils ein singuläres, einsames Projekt verfolgen. So entstehen Verdichtungen einer Parisfaszination von eigenem Anspruch und eigenem Gewicht jenseits der aseptischen Klischees der Stadt der Liebenden oder des banausischen Geredes von Paris als »Museum«.
Georg Simmels fundamentaler Aufsatz »Die Großstädte und das Geistesleben« und seine Philosophie des Geldes sind nicht denkbar ohne Balzacs Comédie humaine und seine Phänomenologie des Pariser Lebens im Zeichen des alles beherrschenden Geldes. Das erste Kapitel schlüsselt diese wesentliche Beziehung auf. Hugo von Hofmannsthals poetische Weltformel »Manche freilich« hat ihren Grund gleichfalls in Balzacs Paris. Rainer Maria Rilke hat in der Begegnung mit Paris, der Dichtung Baudelaires und Rodins Kunst erst eigentlich seine poetische Identität gewonnen Dies ist der Gegenstand des dritten Kapitels. Walter Benjamin hat als ein denkender, grübelnder Leser in neuen Lesevollzügen die Lesbarkeit der »Hauptstadt des 19. Jahrhunderts« erschlossen. Peter Handkes Roman Mein Jahr in der Niemandsbucht ist ein Abschied von Paris, der von den imaginären Energien des »Penser Paris« lebt und mit der Banlieue von Paris, die der Parisdiskurs ausgegrenzt hatte, ein neues Feld der Parisimagination eröffnet.
I Penser Paris
1 Stadtbewußtsein und Pariser Stadtdiskurs
Unter den großen Gegenständen der Philosophie fehlt die Stadt. Die Philosophen vom Fach kennen sie nicht. Wäre der Grund dafür, daß Philosophie und Stadt so eng miteinander verbunden sind, daß die Stadt sich den Meistern des Denkens durch eine zu große Nähe entzieht? Es sind vor allem die Philosophen in einem weiteren Sinn, die Denker, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die angesichts der Stadt ins Staunen kommen, ihr Geheimnis zu durchdringen suchen und sich bemühen, eine Sprache, einen Diskurs zu finden, um sich ihrer Beobachtungen und Reflexionen zu vergewissern. So schreibt Paul Valéry in seinem großen Essay »Pariser Gegenwarten«: »Es entsteht in mir und entmutigt mich zugleich das absurde Verlangen, Paris zu denken.«1 Aber Paris denken, die große Stadt denken, von ihr ein zureichendes Bewußtsein gewinnen, ist dies überhaupt möglich? Dem Denker, der am Morgen erwacht, erscheinen die Geräusche, das Lärmen der Stadt, wie das Tohuwabohu eines fernen Meers. Wäre ein Bewußtsein des Meers möglich? Angesichts des Meeres schweigt die Philosophie wie angesichts der großen Stadt. Aber das Unmögliche zu versuchen ist vielleicht die größte Herausforderung für das Bewußtsein.
Den Denker, der sich der »Gegenwart von Paris« ausgesetzt sieht, führen seine Beobachtungen dazu, »diese Stadt als einen Sternennebel von Ereignissen aufzufassen, der seinen Ort am äußersten Rand unserer intellektuellen Möglichkeiten hat«. (S. 1014) Die Gegenwart von Paris zu denken, heißt, Paris zu Bewußtsein zu bringen. Vor dieser unmöglichen Aufgabe wendet das Bewußtsein sich auf sich selbst zurück und begreift sich im Bild der Stadt, die sein Objekt war. Die Gegenwart von Paris wird zum Bild des sich selbst reflektierenden Bewußtsein[s]«: »Paris denken? … Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr fühlt man sich, ganz im Gegenteil, von Paris gedacht.« (S. 1015)
Paul Valéry ist ein überraschter Denker der Stadt, er verfällt vor ihr ins Staunen, als ob er als erster die Notwendigkeit empfunden hätte, Paris zu Bewußtsein zu bringen. Es ist jedoch Valéry, dem wir eine Einsicht in den Anfangspunkt des großen Projekts verdanken, die Stadt sich ihrer selbst bewußt werden zu lassen. In seinem Essay »Die Rückkehr aus Holland«2 erinnert er an den Brief vom 5. Mai 1631, den René Descartes an Guez de Balzac schrieb, um ihn zu einem Besuch von Amsterdam einzuladen. Der ländlichen Einsamkeit, in die Balzac sich zurückgezogen hatte, um sich den mühseligen Verpflichtungen des Hofs zu entziehen, stellt Descartes die Einsamkeit seines eigenen Lebens entgegen. Er rühmt ihm die Vorzüge einer großen, freien und handeltreibenden Stadt, in der er sich bewegt, als einsame und unabhängige Seele unter so vielen geschäftigen Menschen, denen er absolut unbekannt ist: »Und in dieser großen Stadt, in der ich mich aufhalte und in der es keinen Menschen außer mir selbst gibt, der nicht den Kaufmannsberuf ausübt, ist jeder so sehr mit seinen eigenen Plänen beschäftigt, daß ich hier mein ganzes Leben zubringen könnte, ohne jemals von irgendeinem Menschen wahrgenommen zu werden. Ich ginge jeden Tag inmitten des Durcheinanders einer großen Menge mit ebenso viel Freiheit und Ruhe spazieren, als Sie dieses in Ihren Alleen tun könnten.«3 Gegen das Horazische »scriptorum chorus omnis amat nemus et fugit urbem« (der ganze Chor der Dichter liebt die Wälder und flieht die Stadt) stimmt Descartes hier das Lob der modernen kosmopolitischen Stadt mit ihrer bürgerlichen Freiheit an. Wie der Sokrates des Dialogs Eupalinos von Valéry, der einen Augenblick zwischen dem Konstruieren und dem Erkennen schwankt, scheint Descartes hier am Rand eines neuen Stadtbewußtseins zu stehen, bevor er sich jenem Bewußtsein seiner selbst zuwendet, das das unerschütterliche Fundament, das »fundamentum inconcussum« seiner neuen Philosophie des Bewußtseins werden wird, die sein Discours de la méthode (Abhandlung über die Methode, 1637) begründet.
Es sollte weitere 40 Jahre dauern, bevor auf den Philosophen in der Stadt jener Schriftsteller folgte, den man zu Recht den ersten Philosophen der Stadt nennen könnte. Jean de La Bruyère ist der wahre Begründer eines Diskurses der Stadt, der die neue Erfahrung der großen Stadt und der »Sitten dieses Zeitalters« verkörpert. Vor seine Übersetzung der Charaktere des griechischen Naturforschers und Philosophen Theophrast, eines unmittelbaren Schülers des Aristoteles, die seinen eigenen Charakteren vorausgeht4, stellt La Bruyère eine Rede auf Theophrast, die im wesentlichen ein Vergleich ist zwischen dem alten Athen und dem gegenwärtigen Paris, zwischen den einfachen Sitten des klassischen Athen und dem Paris »dieses Jahrhunderts«.5 Hinter der Beschreibung der Sitten erscheint jedesmal das, was man den Geist der Stadt nennen könnte. Vermittels der Charaktere Theophrasts gewinnt La Bruyère eine Vorstellung vom Geist des alten Athen. In Wirklichkeit aber ist dieses Athen nichts anderes als eine Negation des Paris seiner Zeit.
Was wird von Paris übrigbleiben in einer Zukunft, die unserer Gegenwart so fern ist wie die unsere von der des antiken Athen? Verglichen mit diesem Athen fehlt Paris alles, was den Zauber einer demokratischen Stadt ausmacht: »Man wird von der Hauptstadt eines großen Königreichs berichten, wo es keine öffentlichen Plätze, keine Bäder, weder Brunnen noch Amphitheater, noch Galerien, noch Triumphbögen, noch Spazierwege gab und die gleichwohl eine wundervolle Stadt war.« (S. 11) Das Volk fehlt in dieser glänzenden Hauptstadt: »Man wird erfahren, daß das Volk in dieser Stadt nur erschien, um vorüberzustürzen: keine Unterhaltung, keine nachbarliche Nähe, alles war abweisend und wie vom Lärm der Kutschen aufgeschreckt, die es zu vermeiden galt.« (a. a. O.) Dem einfachen Leben der Athener, die wie die ersten Menschen »groß sind durch sich selbst und unabhängig von den tausend äußerlichen Dingen, die seither erfunden wurden, um vielleicht jene wahre Größe zu ersetzen, die es nicht mehr gibt« (S. 12), kontrastiert Paris als Stadt der »tausend äußerlichen Dinge«, die nur als Supplemente fungieren. Es scheint so, als ob die Theorie Rousseaus von der Ungleichheit unter den Menschen, bei der das Supplement zum Instrument einer Kultur wird, die sich mehr und mehr von der Natur entfernt, hier seinen Anfangspunkt hat. Während Paris eine Stadt der durch die Kutsche, dem Statussymbol par excellence, beschleunigten Kommunikation ist, ist Athen eine einfache und egalitäre Stadt, in der die Bürger noch zu Fuß gehen: »Athen war frei, es war die Mitte einer Republik, seine Bürger waren gleich. Sie erröteten nicht voreinander, sie gingen fast unbegleitet und zu Fuß in einer sauberen, friedlichen und geräumigen Stadt.« (S. 13)
Die Sprache der Athener, vervollkommnet durch die Urbanität des gewöhnlichen Zusammenlebens, ist bewundernswert in ihrer Einfachheit. Theophrast, der kein Athener von Geburt war, bedient sich ihrer mit Eleganz. Dennoch bekennt La Bruyère seine Unfähigkeit, ihm nachzueifern. Er befindet sich in einem Dilemma. Er würde gern wie Theophrast ein naives Bild des Paris seiner Zeit wiedergeben, aber um ein getreues Bild von ihm zu malen, genügt eine Darstellung nicht, die sich auf »jene simple Figur reduzieren läßt, die man Beschreibung oder Aufzählung nennt«. (S. 14) Es bedarf vielfältiger und komplexer Darstellungsformen, um das Leben des neuen Athen mit seinen »tausend äußerlichen Dingen« darzustellen, die ihm wesentlich zugehören. La Bruyère rühmt an den Reflexionen oder Sentenzen und moralischen Maximen des Duc de La Rochefoucauld (1665), daß sein einziger Gedanke, jener der triumphierenden Eigenliebe, »wie in tausend unterschiedlichen Aspekten vervielfältigt, durch die Wahl der Wörter und die Vielfalt der Ausdrucksweisen stets die Grazie der Neuheit hat«. (S. 15) Auch La Bruyère sucht den Charme der Neuigkeit, indem er auf immer neue Weise die tausend äußerlichen Dinge vergegenwärtigt, in denen sich der Geist der Stadt im Gegensatz zum Geist des Hofs bekundet. Es geht nicht darum, einfach zu beschreiben oder aufzuzählen. La Bruyère bemüht sich darzustellen, was den tausend Dingen ihre Bedeutsamkeit verleiht und was von höchstem Interesse für den Blick des Moralisten ist, der beobachtet. La Bruyère dringt hinter den schönen Schein, um die Arbeit, den Ehrgeiz, das Elend aufzudecken, das sich verbirgt wie in seiner Reflexion über die Financiers, die ›Finanzdienstleister‹. (S. 187) Wenn er mit energischem Pinsel das Bild der Bauern malt, die für die Pariser inexistent sind, so zeigt er sie zuerst aus der Perspektive einer vorüberfahrenden Kutsche, aus der ein Bürger von Paris hochnäsig und ignorant nichts als Tiere erkennen kann, die in der Erde wühlen. (S. 339) Der Moralist der Stadt mit seiner Fülle an Supplementen entrinnt nicht der Notwendigkeit, seiner eigenen Zeit anzugehören und für ein Publikum seiner Zeit zu schreiben. Auch wenn er die Sprache der Mode und der gesellschaftlichen Distinktion zu entziffern weiß, die diesem unerschöpflichen Leser des Buchs der Stadt offenbar sind, so bewahrt er sich doch eine tiefe Nostalgie für dieses alte einfache und republikanische Athen, wo die Philosophie einer Kommunikation zwischen Gleichen entsprang. La Bruyère, der Philosoph, sieht sich noch in der Tradition der antiken Philosophen. Der Philosoph ist nach seiner Auffassung ansprechbar, er ist, wie er großartig sagt, »trivial wie ein Randstein an der Ecke der Plätze«. (S. 183) Der Philosoph in einer Stadt von frenetischem Ehrgeiz, mit seinen tausend Dingen, die an die Stelle einer einfachen und tugendhaften Lebensweise getreten sind, spielt wie Descartes in Amsterdam sein Spiel für sich. In seinem Portrait, wo er die Reichen und Armen einander gegenüberstellt, zeigt La Bruyère sie gelähmt durch ein enges und unbewegliches Bewußtsein. Der Philosoph dagegen ist frei, er ist Herr seines Bewußtseins, das für alle Phänomene seiner Stadt offen ist, die er als einfacher Fußgänger durchquert wie die antiken Philosophen und selbst die Könige der Antike, aber auch wie die Ahnen der Pariser seiner Zeit: »Sie verließen nicht ein schlechtes Diner, um in ihre Karossen einzusteigen, sie waren davon überzeugt, daß der Mensch Beine hat, um zu gehen und sie gingen.« (S. 219)
La Bruyère hat den Weg zu einem Stadtdiskurs gewiesen, der einem neuen Bewußtsein der Stadt in allen ihren Aspekten antworten sollte. In der Tat kann man behaupten, daß in Paris das Bewußtsein der Stadt erwachte und daß dort seine Darstellungsformen erfunden wurden. Es gibt keine große Stadt, wenigstens in der westlichen Welt, die sich nicht am Pariser Stadtdiskurs ein Beispiel genommen hätte, der unvergleichlich war in seiner Kohärenz, seiner Dynamik und seiner Kreativität. Mobilis in mobili: dies ist in dem Roman Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer (1870) von Jules Verne die Devise des Unterseeboots Nautilus und seines Kapitäns Nemo. »Mobilis in mobili« könnte auch die Devise des Stadtdiskurses von Paris nach La Bruyère sein. Den Geist der Stadt in der ganzen Vielfalt seiner Aspekte und in allen Farben des Augenblicks durch den Geist eines Beobachters zu erfassen, dies wird durch alle seine Metamorphosen hindurch das große Projekt des Pariser Stadtdiskurses sein.
Auf die Caractères, mit denen La Bruyère die moralische Physiognomie des Paris seiner Zeit entworfen hat, folgen im Frühlicht des neuen Jahrhunderts Montesquieus Lettres persanes (1721). Montesquieu, der elegante und systematische Philosoph des Geists der Gesetze (1748), hätte gewiß ein ähnliches Werk über den »Geist von Paris« verfassen können. Statt dessen hat er den geistreichen Gedanken einer Korrespondenz zwischen drei Persern, die sich ihre Erfahrungen mit den großen Städten Europas mitteilen und wo philosophisches und oft ironisches Staunen sich mehr und mehr in Bewunderung verwandeln. Diese Folge frei angeordneter und auf die Wahrnehmung des gegenwärtigen Paris bezogener Beobachtungen durch einen exotischen und auf intelligente Weise naiven Reisenden gibt den »tausend äußerlichen Dingen der Stadt« einen neuen Sinn und eine neue Funktion, die sie von den moralistischen Reflexionen des Autors der Caractères weit entfernt halten.
Gegen die Vorurteile seines Freundes Rhedi verteidigt Usbek leidenschaftlich die Wissenschaften und Künste, wie sie im Okzident gepflegt werden. Was die Stadt in Tätigkeit setzt, ist nicht die Macht eines Monarchen, sondern vielmehr das Eigeninteresse, das »der größte Monarch der Erde ist«.6 Die Arbeitsteilung will, daß jene, »die die Annehmlichkeiten einer Kunst genießen, verpflichtet sind, eine andere auszuüben«. (S. 212) Jeder arbeitet, jeder erfindet und jeder erfreut sich an der Arbeit und an den Erfindungen der anderen. Paris ist ein System wechselseitiger Abhängigkeiten, wo auch »jene, die nur dem Genuß oder der Phantasie dienstbar sind« (S. 213), ihren Platz haben. Der Eigennutz setzt »diese Zirkulation des Reichtums, diesen Fortschritt der Einkünfte in Bewegung, der hervorgeht aus der Abhängigkeit, in der die Künste auf einander bezogen sind.« (S. 213) Der Überfluß, die Supplemente, wie La Bruyère gesagt hätte, ist notwendig für das Glück eines jeden: »Der Herrscher muß daher alles tun, damit seine Untergebenen im Wohlstand leben: er muß sich mühen, um ihnen jede Art von Überflüssigkeiten mit ebenso großer Aufmerksamkeit zu bereiten, wie die Dinge, die in der Stadt lebensnotwendig sind.« (S. 213f.)
Descartes, La Bruyère und Montesquieu haben gleichsam das erste Kapitel in der Geschichte des Parisdiskurses geschrieben. Drei Philosophen und Literaten werden dem Stadtdiskurs einen neuen Elan geben: Rousseau, Diderot und Sébastien Mercier, alle drei philosophisch gestimmte Literaten und große Fußgänger in Paris.
Paris repräsentiert im vielgestaltigen Werk Jean-Jacques Rousseaus den fortgeschrittensten Zustand der Kultur und damit zugleich den Zustand, der sich von der Natur am meisten entfernt hat. Die Entfremdung zwischen Kultur und Natur hat hier ihren Höhepunkt erreicht. Rousseau, der nie auf den Titel eines »Bürgers von Genf« verzichtet hat, der ein Liebhaber der Natur sein will, ist ein Denker von Paris. Paris ist der strategische Ort par excellence seiner Kulturphilosophie. Sein Bewußtsein von Paris ist konditioniert durch seine Kulturphilosophie, wie diese konditioniert ist durch sein Bild von Paris. Sein erster, der Akademie von Dijon vorgelegter Diskurs »Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs« (»Ob die Wiedererweckung der Wissenschaften und Künste dazu beigetragen hat, die Sitten zu reinigen«; 1749), ist eine direkte Reaktion auf die Lettres persanes und vor allem auf den Brief Usbeks über den Fortschritt der Künste und die Legitimität des Luxus. In seiner Argumentation scheint Rousseau auf La Bruyère und dessen Lob der frühen Menschen zu rekurrieren, die für ihre Größe noch keine Supplemente brauchten. Rousseau leugnet die Vorteile des Fortschritts vor allem in der großen Stadt nicht. Aber er wägt sie ab gegen ihre negativen Seiten. In seinem 2. Diskurs »L'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes« (»Über den Ursprung und die Grundlage der Ungleichheit unter den Menschen«; 1754) entwickelt er eine unauflösbare Dialektik zwischen Fortschritt und Degeneration, zwischen Freiheit und Sklaverei, zwischen Fähigkeit und Mißbrauch. Der Mensch, der die Mittel findet, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, schafft notwendigerweise neue Bedürfnisse, die ihn noch weiter von seiner natürlichen Ausstattung entfernen. In Paris ist diese Dialektik oder besser diese Zweideutigkeit auf ihrem Höhepunkt angekommen. In der Nouvelle Héloise (1756-58) macht Saint-Preux, nachdem er Julie verlassen hat, eine Reise, die ihn zuerst nach Paris führt, den magischen Ort, der diesen »Bewohner eines kleinen Städtchens am Fuß der Alpen« erschüttert. Sein erster Eindruck, den er sogleich seiner Geliebten mitteilt, ist dem vergleichbar, den Descartes in Amsterdam empfand: »Ich bin nie weniger einsam als wenn ich einsam bin, sagte ein Philosoph des Altertums: ich dagegen bin nur einsam in der Menge.«7 Trotz aller Ungleichheiten in der Stadt, die sich schon beim ersten Anblick zeigen, ist Saint -Preux verführt von der Urbanität der Kommunikation und von der Geschliffenheit der Sitten: »Suche ich nach Aufklärung und Unterrichtung? Hier ist ihre liebenswürdige Quelle und man ist sogleich bezaubert vom Wissen und von der Vernunft, die man in den Unterhaltungen findet, nicht allein der Gelehrten und Literaten, sondern der Menschen aller Stände und sogar der Frauen; der Ton der Konversation ist fließend und natürlich, er ist weder schwerfällig noch frivol: er ist wissend ohne Pedanterie, fröhlich ohne Tumult, höflich ohne Ziererei, galant ohne Geschmacklosigkeit, geistreich ohne Zweideutigkeiten.«8 Aber dieses so glänzende Paris ist ein Ort des Scheins, der Widersprüche und einer grenzenlosen Wandlungsfähigkeit.
In Paris bedarf es eines Maximums an Geistesgegenwart und Urteil, um einer Stadt antworten zu können, die beständig in Bewegung ist. Es gibt keinen anderen Ort, wo man so schnell seine Fähigkeiten, seine Tugenden, aber auch seine Laster entdecken kann, die in einem einfachen Leben fern vom Wirbelsturm der Stadt unentdeckt blieben. Wenn Rousseau dem einfachen Leben nachtrauert, so kann sein Genie doch durch die Präsenz von Paris entflammt werden. Die Zerrissenheit Saint-Preux' und Emiles, des Helden von Rousseaus gleichnamigem Erziehungsroman, in der Begegnung mit Paris ist auch Rousseaus eigene, die er in seinem »Rousseau, Richter über Jean-Jacques«9 darstellt. Rousseau und Jean-Jacques sind zwei Personen in einer. In seinem Dialog mit dem Franzosen, der voller Vorurteile gegen die Schriften von Jean-Jacques ist, der sich als vollendeter Misanthrop aus der Pariser Welt zurückgezogen hat, schlägt Rousseau, der Pariser, der ebenso gesellig ist wie sein Gesprächspartner, vor, zwischen ihm und Jean-Jacques, den er, wie er versichert, leicht treffen kann, eine Begegnung zu arrangieren. »Ich habe ihn«, bekräftigt Rousseau, »in einer einmaligen und fast unglaublichen Lage gefunden, einsamer inmitten von Paris als Robinson auf seiner Insel.« (S. 826) Es ist Jean-Jacques, zum Naturmenschen geworden, wenn eine solche Regression denn möglich wäre, der die Erfahrung der Stadt als pure Präsenz macht, die er sozusagen mit einer Unschuld des Auges und einer von allen Stereotypen der Wahrnehmung befreiten Frische erfährt.
Die zerrissene, entfremdete Existenz in Paris, Ort der am weitesten fortgeschrittenen Kultur, findet ihr fröhlich-zynisches Pendant bei Diderot in der Person von Rameaus Neffen.10 Man möchte sagen, daß Paris, für Rousseau die am weitesten fortgeschrittene Versinnbildlichung der Zerrissenheit zwischen Kultur und Natur und der tiefen Zweideutigkeit der Kultur selbst, sich in der Gestalt von Rameaus Neffen verkörpert, so wie er in den Augen eines zugleich faszinierten und zurückgestoßenen philosophischen Ich erscheint. Hat die bizarre Person ein Bewußtsein von Paris? Sie ist selbst Paris mit seinem Elend und seinem Glanz, seinen Lastern und seinen Tugenden, seinen Zärtlichkeiten und Grausamkeiten. Sein Genie ist das der Stadt selbst. Ohne von der Stadt ein Bewußtsein zu haben, macht er sie bewußt durch eine zugleich zynische, ironische und fröhliche Bejahung. Der Neffe Rameaus, dieses Komponisten, der der erbitterte Feind Rousseaus, des Musiktheoretikers war, hat die Gabe der Pantomime. Er versteht es, die Stadt spielerisch darzustellen, indem er alle ihre Charaktere und die Physiognomie ihrer Bewegung darstellt. Es ist ein Philosoph nach Art der antiken Philosophen, aber im Herzen des modernen Paris. Indem er den Armen wie den Reichen, den Bedeutenden wie den Bedeutungslosen nachahmt und parodiert, schafft er eine neue Form der Gleichheit in der Ungleichheit.
Nach Goethe, der den Text zuerst bekanntmachte, war Hegel von Diderots bizarrem Neveu fasziniert. In seiner Phänomenologie des Geistes (1807) macht er ihn zum Emblem des unglücklichen Bewußtseins, Ergebnis der Bewußtseinsarbeit der Aufklärung. Der mit seinem Körper sich zur lebenden Pantomime von Paris machte, wird so zur Allegorie einer Geschichte des Bewußtseins auf der Suche nach sich selbst. Hegel illustriert damit zugleich noch einmal das Schweigen der Philosophie vor der Stadt. Als Hegel, der Denker des absoluten Bewußtseins, sich dank eines Stipendiums des Königs von Preußen in Paris befindet, bleibt er stumm. Seine Beobachtungen über die Stadt, die er den privaten Briefen an seine Frau anvertraut, sind von einer Plattheit, die bei diesem Meister der Philosophie erstaunt.
Sébastien Mercier ist als Autor weder La Bruyère noch Rousseau noch Diderot vergleichbar. Dennoch ist er es, der auf den Fundamenten seiner Vorgänger in der Geschichte des Bewußtseins von Paris Epoche gemacht hat. Mercier hat keine Formel mehr für den Geist der Stadt. In den 12 Bänden seines Tableau de Paris, die am Vorabend der Revolution zwischen 1782 und 1788 erschienen, vereint er mehr als 1000 Kapitel, die eine wahre Summe der »gigantischen Hauptstadt« darstellen. Eine unendliche Vielzahl von Aspekten werden hier in kleinen Notizen oder etwas ausgearbeiteteren Essays wachgerufen, die immer wieder durch ihre Neuheit frappieren. Es genügt, einige Titel aus dem ersten Band zu zitieren: Bäche, Metzgereien, verpestete Luft, Ertrunkene, Kohledämpfe, möblierte Zimmer, Kutschen, Wasserträger. Mehr als Rousseau oder Diderot ist Mercier ein Beobachter von Details der Stadt in ihren frappierenden Kontrasten. So stellt er vor unsere Augen die Räder, deren es bedarf, um die große Maschine der Stadt in Gang zu setzen. Mercier zeigt den Geist der Stadt in einem Kaleidoskop, das den Leser einlädt, an einem Prozeß der Bewußtwerdung teilzuhaben, der niemals zu einer endgültigen Gestalt kommen kann. Die Kapitel folgen ohne jegliche systematische Ordnung aufeinander in einem Geist, der zumindest grundsätzlich jedem Phänomen der Stadt denselben Wert zuspricht. Jede politische, religiöse oder soziale Hierarchie wird in einer gewollten thematischen Anarchie außer Kraft gesetzt. Was in der Stadt eng benachbart ist, wird auf Distanz gesetzt, was in Distanz steht, wird angenähert, um den Leser einzuladen, seiner Stadt mit anderen Augen zu begegnen. So befinden sich die Kapitel »Abt« und »Bischof« zwischen den Kapiteln »Möblierung« und »Abfolge der Moden«, dem Kapitel »Messe« gehen die Kapitel »Feuerwerk« und »abgedroschener Witz« voraus, der Artikel »Nachtmesse« ist umgeben von den Artikeln »Spitzel« und »Boutique von Perückenmachern«. Der Gang des Lesers von Kapitel zu Kapitel ist voller Überraschungen und läßt ihn niemals auf einem ausgetretenen Weg zur Ruhe kommen. Indem der Leser die Abfolge der Kapitel selbst variiert, könnte er eine unendliche Kombinatorik erzeugen, um auf diese Weise ein Stadtbewußtsein hervorzubringen, das grenzenlos wäre.
La Bruyère hatte bereits beobachtet, daß die tausend äußerlichen Dinge, die das Paris seiner Charaktere von dem Athen Theophrasts unterscheiden, vor allem als soziale Zeichen fungieren. Mercier ist der erste, der der Vielfalt der Zeichen und der Zeichensysteme, deren die große Stadt bedarf, um die Zirkulation der Personen, Waren und Werte zu regulieren, eine besondere Aufmerksamkeit zuwendet. In dem Kapitel »Mangel an Zeichen«11 beobachtet er höchst zutreffend, daß »die Fülle der Zeichen der Fülle der Bedürfnisse entsprechen muß und wir sind verzehrt von Bedürfnissen«. Hier denkt Mercier an das Papiergeld, das die Geldzirkulation beschleunigen könnte. Aber in anderen Kapiteln zeigt er, wie diese Perspektive sich verallgemeinern ließe.
Mit seinem Tableau de Paris macht Mercier Paris zur bestbekannten Hauptstadt der ganzen Welt. Niemals ist eine Stadt so genau studiert worden. Dieses Werk, das einen Parisdiskurs abschließt, der bemerkenswert ist durch seine innere Kohärenz, öffnet zugleich einen neuen Stadtdiskurs. Das Tableau de Paris steht am Ursprung einer neuen subliterarischen Gattung, die vor allem nach der Revolution florierte. Diese neue Form der Annäherung an die Stadt in ihrer ganzen Komplexität hat während langer Zeit kaum das Interesse der Literaturgeschichte gefunden. Aber sie ist der Ursprung einer unerhörten Dynamik, mit der der Parisdiskurs des 19. Jahrhunderts einem neuen Bewußtsein der Stadt antwortet. Das Tableau de Paris mit seiner Aufmerksamkeit auf die Veränderungen der Stadt in all ihren Aspekten hat nicht nur eine Beschreibungsform geschaffen, die in der Lage war, aus der Nähe die Wandlungen der Stadt zu erfassen, sondern er hat auch eine Schule der Aufmerksamkeit und des Bewußtseins für seine Leser hervorgebracht.
Der Titel »Die Epoche ohne Namen«, unter dem Auguste Bazin seine Pariser Skizzen von 1830-1833 versammelt, charakterisiert den Geist der Stadt nach der Juli-Revolution. In dieser Phase tiefer politischer Ungewißheit gewinnt das Tableau de Paris ein neues Aussehen. Das Livre des cent-et-un (Buch der Einhunderteinen), das in 15 Bänden zwischen 1831 und 1838 erschien, vereint Beiträge von Schriftstellern, Journalisten und Liebhabern, die die neue Physiognomie der Hauptstadt entziffern wollen. Das Bewußtsein der Stadt wird so ein Bewußtsein mit vielen Stimmen, das den Leser einlädt, sich seiner Stadt in einer Vielzahl von Perspektiven zu nähern. Diese neue glückliche Formel des kollektiven Tableau de Paris wird unmittelbar gefolgt von einem Neuen Tableau de Paris des 19. Jahrhunderts12, das den Blick auf die Wirklichkeiten der Stadt noch weiter öffnen möchte. In den vierziger Jahren gewinnt das Tableau de Paris noch weiter an Bedeutung durch die Illustrationen der besten Karikaturisten und Zeichner wie Daumier, Gavarni und Grandville. Es sind die kollektiven Tableaux de Paris, wie Die Franzosen, von ihnen selbst gemalt13, Der Teufel von Paris14 und Die große Stadt, neues komisches, kritisches und philosophisches Tableau de Paris15, wo der Stadtdiskurs sich auf die Geste des Zeichners öffnet.
Aber was in erster Linie die dreißiger Jahre in der Geschichte des Stadtdiskurses heraushebt, ist eine Erfindung, deren Bedeutung man nicht überschätzen kann. In diesem Jahrzehnt entsteht eine neue Form des Romans, in dem Paris nicht mehr, wie in manchen Romanen des 17. und 18. Jahrhunderts, ein Hintergrund, eine Dekoration ist. Die Stadt selbst wird jetzt der wahre Held des Romans. Es sind zwei Romane, Notre-Dame de Paris von Victor Hugo und Das Chagrinleder von Honoré de Balzac, beide 1831 nach der Juli-Revolution erschienen, die aus der Form des Romans ein komplexes Instrument geschaffen haben, um ein neues Stadtbewußtsein zu artikulieren. In Notre-Dame de Paris evoziert Hugo mit den leuchtenden Farben einer romantischen Imagination den dramatischen Augenblick der Konfrontation zweier Epochen in der Paris-Geschichte, jener, die Notre-Dame erschaffen hat, das erhabene Monument aus Stein, und der des gedruckten Buchs, die zur Aufklärung und zur Revolution geführt hat. »Dieses wird jenes töten« (Ceci tuera celà), diese Formel ist das Emblem jenes entscheidenden Augenblicks, wo das Zeitalter des Buchs das Zeitalter des Steins ablöst. Hugo entwirft daraus ein romantisches Drama, in dessen Mittelpunkt die Legende von Quasimodo und der schönen Esmeralda steht.
Im selben Jahr veröffentlicht Honoré de Balzac seinen ersten Parisroman, Das Chagrinleder. Dieser Roman der Aktualität führt eine Stadt im Wirbel eines neuen Geistes vor Augen. Das Paris von La peau de chagrin vibriert vor Energie einer neuen, egalitären Welt, die angetrieben wird vom Geld und von der Begierde zu reüssieren. Die tausend Stadtbilder des Tableau de Paris von Mercier waren erstarrte Momentaufnahmen des Bewußtseins. Die integrative Form des Romans setzt die Stadtbilder in Bewegung. Seine neue Konstruktion dient als Grundlage für ein dynamisches und komplexes Stadtbewußtsein. Wir folgen dem Helden bei seinen Gängen durch die Stadt, wir folgen ihm in den dramatischen Augenblicken seines Aufstiegs oder seines sozialen Absturzes. Balzac, der von seinen ersten Parisromanen allmählich zur großen umfassenden Vision seiner Comédie humaine übergeht, macht daraus ein großes Epos der sozialen Mobilität. Balzac hat einen geschärften Sinn für die historischen Schichten der Stadt und ihre schnellen Verwandlungen seit der Revolution. Seine Helden sind gezeichnet durch die politischen Umstürze. Der Colonel Chabert, der Père Goriot sind lesbare Scharaden der Überlagerung der Zeiten.
Balzac, der selbst als geistreicher Autor von Pariser Bildern angefangen hat und seine Städtebilder in seine Dramen der postrevolutionären Stadt einbrachte, hat auch ein Bewußtsein von der Dialektik zwischen Gegenwart in der Stadt und Totalität der abwesenden Stadt. Deshalb ist er fasziniert von der semiotischen und vor allem metonymischen Dimension von allem, was in der Stadt gegenwärtige Erscheinung wird. Die Erzählung erlaubt es, diesen Verweisungen auf andere Gegenwarten zu folgen. So wird der Cousin Pons zum Beispiel mit seinen aus der Mode gekommenen Kleidern ein lesbares Buch der Stadt, das das Auge des semiologischen Beobachters zu entziffern weiß. Der Autor und sein Erzähler sind Leser von Zeichen, die sie in imaginäre Gegenwart verwandeln. So wird der Leser des Balzacschen Romans seinerseits zum Leser der Stadt. Lektüre des Romans und Lektüre der Stadt verschränken und ergänzen sich. Der Roman, der aus der Stadt, oder besser aus Paris, seinen wahren Helden macht, und der den Leser des Romans in einen Stadtleser verwandelt, ist zum Modell des Romans als eines Instruments für eine neue Bewußtwerdung der dynamisierten Stadt geworden.
Das Bewußtsein der Stadt findet seine konzentrierteste Form in der lyrischen Dichtung. Wenn Hugo und Balzac die Pioniere des Stadtromanss sind, so ist Charles Baudelaire der Pionier einer neuen lyrischen Dichtung des intensivierten Stadtbewußtseins. Auch Baudelaire bezieht sich auf die Tradition des Tableau de Paris, die von Mercier eröffnet wurde. »Tableaux parisiens« ist der Titel, den Charles Baudelaire einer Gruppe seiner Parisdichtungen gibt, die er in die 2. Auflage seiner Blumen des Bösen16 integriert hat. In der Einleitung seiner Sammlung von Kleinen Prosa-Gedichten (Le Spleen de Paris) spricht Baudelaire von den »plötzlichen Sprüngen des Bewußtseins«17, denen der Flaneur sich aussetzt, der die moderne Stadt durchquert. Es sind in der Tat Sprünge des Bewußtseins, um die sich die Poesie der Stadt organisiert: die Choc-Erscheinung eines entwichenen Schwans, der Anblick der Blinden, der kleinen alten Bettlerinnen, der sieben Greise. Ihr plötzliches pantomimisches Erscheinen greift das Bewußtsein mit einem Maximum an Intensität an und wird so zum Kern einer lyrischen Organisation. Traditionell war die Stadt Gegenstand der Satire. Bei Baudelaire wird sie zur Figur dessen, was das Bewußtsein überschreitet. Nach Kant ist dies genau die Definition des Sublimen. Baudelaire ist in der Tat der erste, der der Erfahrung des Erhabenen in der Stadt eine Stimme gab.
Mit den »Tableaux parisiens« Baudelaires schließt sich ein Kreis von Akten des Bewußtseins und ihrer Transposition in eine diskursive Form. Dennoch behält der Diskurs von Paris bis zum heutigen Tag, weit entfernt, sich zu erschöpfen, eine erstaunliche Produktivität. Das Bewußtsein der Stadt könnte sich niemals seines beweglichen Objekts bemächtigen, ohne daß eine Mehrheit des Nichtbewußten zurückbliebe. Jeder Diskurs öffnet eine Dimension des noch Unformulierten. Auf Balzac folgt Zola, der sich für einen Naturalisten hielt, aber in Wirklichkeit ein Romancier der Bewußtmachung des Paris des 2. Empire mit seinen radikalen Wandlungen ist. Zola ist ein Phänomenologe jenes Bewußtseins, mit dem seine Helden sich von der Gegenwart der Stadt gefangennehmen lassen. Das Bauwerk aus Gußeisen der Hallen in Der Bauch von Paris (Le ventre de Paris; 1873), das große wechselnde Panorama von Paris in Une page d'amour (1878), die Passagen in Nana, das große Kaufhaus in Zum Paradies der Damen (Au bonheur des dames; 1883) sind gefärbt vom Bewußtsein ihrer Helden. In Das Werk (L'Œuvre; 1886) scheitert Florent Lantier, der Maler, schließlich vor der Aufgabe, für sein eigenes Bewußtsein der großen Gegenwarten des neuen Paris eine Formel zu finden.
Der Surrealismus des neuen Jahrhunderts sucht in riskanten Experimenten das Unterbewußtsein der Stadt zu erforschen und eine Sprache für seine psychischen Energien zu finden, für das, was Aragon den »Fluß« nennt, »der täglich zwischen der Bastille und der Madeleine unglaubliche Fluten von Träumerei und Sehnsucht transportiert«.18 Georges Perec sucht im Gefolge des Surrealismus den Rhythmus der Stadt in Akten der Aufmerksamkeit zu erfassen, die sich auf das Gewöhnliche jenseits des Gewöhnlichen der Stadt richten, mit der grenzenlosen und verzweifelten Hoffnung, eine Erinnerung wiederzufinden, die sich für immer verschließt. Nur hingewiesen sei abschließend auf den fortdauernden Reichtum des Parisdiskurses, der nicht müde wird, neue Horizonte für das Bewußtsein der Stadt zu eröffnen, die sich ausweiten und vertiefen.
Bewußtwerdung ist kein positives Wissen. Ohne genaues Wissen über alle Sphären des Lebens könnte eine große Stadt nicht existieren. Die Statistikbureaus, die in Paris seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden sind, haben ein Netz des positiven Wissens von herausragender Bedeutung für die Entwicklung der Stadt geschaffen. Maxime Du Camp, Verfasser von Paris. Seine Organe, seine Funktionen und sein Leben19 ist einer der seltenen Autoren, denen eine Synthese zwischen dem Wissen über die Stadt auf der Grundlage einer neuen Statistik und einem Stadtbewußtsein als Organ oder Maschine geschaffen hat: »Da Paris ein großer Körper ist, habe ich versucht, seine Anatomie zu beschreiben. Mein ganzer Ehrgeiz ist es, dem Pariser mitzuteilen, wie er lebt und auf der Grundlage welcher physikalischen Gesetze jene Verwaltungsorgane funktionieren, deren er sich in jedem Augenblick bedient, ohne jemals daran gedacht zu haben, die verschiedenen Räder eines so großen, geistreichen Mechanismus zu studieren.«20 Und dennoch bleibt der Unterschied zwischen diesem positiven Wissen und dem Prozeß der Bewußtwerdung der Stadt fundamental. Bewußtwerdung bedeutet Perspektivismus der Wahrnehmung, und das heißt Subjektivismus. Es gibt keine Bewußtwerdung ohne wahrnehmendes Subjekt. Diese Bewußtwerdung wird immer gefärbt sein von einem Temperament, und vor der Unendlichkeit der Stadt in ihrer konkreten Bewegtheit wird sie immer partial bleiben. Das Ganze, auf das sie sich bezieht, ist nichts anderes als ein Horizont, vor dem sie sich situiert. Aber damit diese Bewußtwerdung sich nicht im Ungefähren und Unbestimmten verliert, muß sie Sprache werden. Die Stadt, die beginnt, von sich selbst ein Bewußtsein zu gewinnen, beginnt zu sprechen. Wie Maurice Merleau-Ponty in seiner Phänomenologie der Wahrnehmung sagt, die sich nicht auf das Problem der Wahrnehmung der Stadt bezieht, aber die sich ihrer hätte bedienen können: »Damit die Bewußtwerdung vollständig wird, muß sie die äußere Einheit wiederfinden, in der die Zeichen und Zeichenbedeutungen zuerst erscheinen.«21 Jede Bewußtwerdung, die sich in der Rede objektiviert, muß eine Ordnung des Diskurses erfinden. Aber dieser Diskurs steht vor einem zweiten Horizont, jenem des Diskurses selbst. Es gibt keinen Diskurs, der aus dem Nichts entsteht. Wir haben gesehen, daß jede Bewußtwerdung der Stadt, die sich in einem Diskurs objektiviert, sich, um sich zu entäußern, in einen schon vorhandenen Diskurs einschreibt. Valéry, der glaubte, er könne Paris ohne diskursive Referenz und ohne intertextuelle Referenz denken, hat sich getäuscht. Mit den Etappen seiner Heraufkunft macht der Diskurs von Paris, das Paradigma eines jeden Stadtdiskurses, der zur Sprache drängt, sich immer vielfältiger und vielstimmiger. Jede neue Manifestation dieses Diskurses vermehrt die Virtualität seines Bewußtseins, aber auch seinen intertextuellen Raum. Der Diskurs von Paris ist auf exemplarische Weise eine intertextuelle Verknüpfung von Bewußtseinsakten im zweifachen Horizont der Stadt, die sich verändert und die dennoch dieselbe bleibt, und dem Diskurs selbst und der Konstellation seiner Werke.
Ein solcher Diskurs, einmal in Bewegung gesetzt, dessen können wir sicher sein, wird nicht mehr an ein Ende kommen. In seinen Analysen der Struktur des Mythos hat Claude Lévi-Strauss herausgestellt, daß der Mythos durch seine Struktur selbst unabschließbar wird.22 Der Diskurs der Bewußtwerdung, den Paris aus sich hervorzubringen wußte, ist ein wesentlicher Aspekt dessen, was man sich angewöhnt hat, als Mythos von Paris zu bezeichnen. Mythos von Paris, Diskurs von Paris: wie das Bewußtsein selbst, das keine Grenzen hat, die es anzuhalten vermöchten, hat dieser Diskurs sich seit seinen großen Augenblicken im 19. Jahrhundert nicht erschöpft. Und auch in Zukunft wird er seinem erfindungsreichen Elan keine Grenzen setzen.
2 Der Tod der großen Stadt. Paris als neues Rom und neues Karthago
Condita est civitas Roma velut altera Babylon et velut prioris filia Babylonis.
Augustin, De Civitate Dei, XVIII, 22
Die lineare Fortschrittszeit ist in einem besonderen Sinne die Zeit des 19. Jahrhunderts. Dennoch ist der geschichtsphilosophische Optimismus dieses Jahrhunderts begleitet von Ahnungen und Visionen des Niedergangs.1 Je mehr die Kulturentwicklung sich über alles bisher Gekannte hinaushebt, desto bedrängender meldet sich die Vorstellung, es könnte das Äußerste des Fortschritts schon der Umschlagpunkt für den Rückfall in die neue, geschichtslose Uranfänglichkeit sein. So ist das Bewußtsein der Moderne immer auch durchzogen vom Bewußtsein ihrer Gefährdung. Damit gewinnt der Antagonismus von linearer und zyklischer Zeit, der das geschichtliche Denken der Renaissance bestimmt hatte, neue Aktualität. Auch ist es kein Zufall, daß gerade das 19. Jahrhundert die Epochenanschauungen der Renaissance und ihres Gegenbildes, der Dekadenz, hervorgebracht hat, die beide dem Modell der zyklischen Zeit folgen. Das 19. Jahrhundert lernt, sich im epochalen Bild der Dekadenz zu begreifen2 und sein epochales Selbstbewußtsein in jener Epoche zu spiegeln, in der die Bewegungsgesetze des kulturellen Niedergangs unmittelbar zutage zu treten scheinen, der Spätantike, die sich jetzt zu einer eigenen epochalen Gestalt verdichtet.3
Besonders anschaulich wird das Verhältnis von dominanter linearer Zeitauffassung und unterschwellig virulenter zyklischer Zeitauffassung im Zentrum des modernen Selbstbewußtseins, der großen Stadt, vor allem aber in jener Hauptstadt, die das Bewußtsein der Moderne zu größter Ausdrücklichkeit und Differenziertheit gebracht hat, Paris.4
Paris ist die erste der europäischen Kapitalen, die ein Bewußtsein von sich selbst gewonnen hat. Mit der Spätaufklärung beginnt ein Diskurs der Stadt Paris, dessen Darstellungsformen für das moderne großstädtische Bewußtsein exemplarisch geworden sind. Eigentlicher Anfangspunkt dieses neuen Stadtdiskurses, der sich das Ganze der großen Stadt zu Bewußtsein zu bringen sucht, ist, am Vorabend der Französischen Revolution, Merciers Tableau de Paris (21782-1789). Für Mercier ist das Selbstbewußtsein der Stadt bezogen auf die Anschauungsformen des weltgeschichtlichen Prozesses der Kultur, der in Paris als dem höchsten Ausdruck der fortgeschrittensten Kulturentwicklung gipfelt. Die moderne Universalstadt Paris wird bei Mercier in der unübersehbaren Vielfalt ihrer Aspekte erstmals erschlossen, sie wird der zweiten großen Universalstadt der Jetztzeit, London, vergleichend entgegengesetzt, vor allem aber wird sie von den Weltstädten der Antike abgehoben und visionär in ihrem zukünftigen Schicksal gespiegelt. Mercier hat in seiner Utopie L'an deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fût jamais (11770) das Idealbild eines zukünftigen Paris entworfen, dessen strahlende Vollkommenheit sich den Unvollkommenheiten der Stadt der Gegenwart entgegensetzt. In den Entretiens du Palais Royal (1786) gibt er seinen Gedanken über die ideale Stadt die Form eines »Rêve singulier«. Mercier erzählt, wie ihm im Traum ein Riese erschienen sei, dessen gigantische Kräfte es vermocht hätten, die Stadt mit einem Zauberschlag zu verjüngen und zu verschönern. In ganz anderer Art aber wird im Tableau de Paris die Zukunft der Stadt zum bedrängenden Schauspiel. Im 355. Kapitel mit dem Titel »Que deviendra Paris« fragt Mercier nach der Zukunft von Paris, und zwar indem er zunächst des Schicksals jener großen Städte der Antike gedenkt, von denen kaum mehr als ein Ruinenfeld und ein großer Name zurückgeblieben sind:
Theben, Tyr, Persepolis, Karthago, sind nicht mehr. Diese Städte, die sich stolz auf dem Erdball erhoben, deren Größe, Macht und Festgefügtheit eine fast ewige Dauer zu versprechen schienen, haben nur zweideutige Spuren des Orts hinterlassen, den sie einst besetzten.5
Vor diesem Hintergrund wird die Sterblichkeit auch der Großstädte der Moderne zur Gewißheit:
Ach! die großen modernen Städte werden einst denselben Umsturz erfahren. (Ebd.)
Der Begriff der révolution, der hier Verwendung findet, gehört zu den Anschauungsformen der zyklischen Zeit. Wie die Gestirne mit Notwendigkeit die ihnen vorgezeichnete Umlaufbahn durchmessen, so ereilt mit Notwendigkeit das Schicksal auch die mächtigste und lebensvollste Stadt. Ihr zukünftiges Schicksal erscheint im Bild der Gegenwart des Vergangenen:
Andere einst blühende und volkreiche Städte haben heute in einer erschreckenden Wüste nur einige verstreute Säulen, einige zerbrochene Monumente hinterlassen, trauriger Rest ihrer vergangenen Größe. (Ebd.)
Wenn die Imagination den nachdenklich-melancholischen Betrachter der Spuren vergangener Größe von den gegenwärtigen Bildern der Ruinen und des Zurückfalls der Kultur an die Natur zur einstigen Lebendigkeit der Großstadt führt, aus der alles Leben gewichen ist, so sieht der nachdenkliche Betrachter der gegenwärtigen Großstadt schon ihre zukünftige Zerstörung.6 Man könnte dies imaginäre Inversion nennen: wie die gegenwärtige Vergangenheit im Blick des Betrachters zur vergangenen Gegenwart wird, so die Gegenwart selbst zur zukünftigen Vergangenheit.7 Mercier ist der erste, der diese Denkfigur, die zugleich eine Figur der historischen Einbildungskraft ist, auf die Stadt Paris bezieht. Ihr zukünftiges Bild ist dem gleich, das die verfallenen und entschwundenen Kapitalen einer vergangenen Welt dem gegenwärtigen Betrachter darbieten. Auch die Moderne wird einmal Antike sein und sich dann von dieser nicht mehr unterscheiden. Alle geschichtliche Differenzierung wird durch die geduldige oder plötzliche Arbeit der Natur entdifferenziert und in ihr Eigentum zurückgeholt:
Dieser von mächtigen, aus Steinen errichteten Quais umgrenzte Fluß, wird, von gewaltigen Überresten behindert, über seine Ufer treten und sumpfige, krankheiterregende Teiche bilden, die Ruinen der Bauwerke werden jene schnurgeraden Straßen versperren und auf den Plätzen, wo eine unzählige Menge einherwogte, werden giftige Reptilien, Kinder der Fäulnis, um umgestürzte und halb versunkene Säulen kriechen. (S. 175)
Dies ist nicht Reflexion, sondern bildhaft-konkrete Meditation, die die gegenwärtige Anschauung des Vergangenen in eine offene Zukunft verlängert. Wie die Reisenden, die die versunkene Stadt Palmyra aufsuchen, heute aus den Ruinen Reste vergangenen Lebens entdecken können, oder wie die Ausgrabungen von Pompeji und Herculanum in der Lava fixiert das vergangene Leben festhalten, so wird einst der Zufall die Spuren der versunkenen Stadt Paris ans Licht bringen:
Gott! ach, wenn die Erde gefühllos diese Überreste bedecken wird, wenn das Korn auf jener Anhöhe wachsen wird, wo ich jetzt schreibe, wenn von dem Königreich und seiner Hauptstadt nur noch eine verworrene Erinnerung bleiben wird, wird der Pflug des Bauern, wenn er die Erde aufreißt, vielleicht an den Kopf der Reiterstatue Ludwigs XV. stoßen; die versammelten Archäologen werden endlose Mutmaßungen anstellen, wie heute über die Überreste Palmyras. (S. 176f.)
So sicher das Schicksal scheint, das eines Tages die große Stadt ereilen wird, so ungewiß scheint seine Ursache:
Wird der Krieg, die Pest, die Hungersnot, ein Erdbeben, ein Brand, eine politische Revolution diese großartige Stadt vernichten? Oder werden mehrere Gründe die Ursache dieser großen Zerstörung sein?
Sie ist unvermeidlich unter der langsamen und grausamen Hand der Jahrhunderte, die die mächtigste Herrschaft unterminiert, die Städte und Königreiche auslöscht und die auf der erloschenen Asche der alten Völker neue herbeiruft. (S. 175f.)
Ungewiß aber bleibt auch, was einmal aus den Ablagerungen der Zerstörung und des Vergessens wieder zutage gefördert werden wird. Der Zufall wird dem Wissen die Hand führen, und vielleicht wird ein heute mißachtetes Werk – etwa jenes, in dem Mercier selbst die Physiognomie seiner Stadt in einer Genauigkeit festhält, wie sie noch nie einer Stadt zuteil wurde – auf solche Weise zu höchstem Ansehen gelangen. Auch hier läßt die gegenwärtige Erfahrung der vergangenen und verschütteten antiken Welt sich mühelos ins Offene der Zukunft projizieren.
Mercier ist ein Meister in der Entdeckung ungewöhnlicher Blickpunkte, mit denen er Paris erst in der Dichte städtischer Wirklichkeit erfahrbar werden läßt. Unter diesen ist zweifellos der ungewöhnlichste jener, der die Moderne als zukünftige Antike ansichtig macht. Wenn aber die Bilder des zukünftigen Niedergangs argumentative, geschichtsphilosophische Funktion haben, so sind sie doch zugleich einer modisch-interessanten Poetik der Ruine verpflichtet.8 Eine Eintragung in Merciers Mon Bonnet de Nuit (1784) macht dies noch deutlicher. Sie hält das Bild einer ›interessanten‹ Ruinenlandschaft fest:
Man sieht, nicht ohne Interesse, einen Hirten mit seinen Ochsen unter diesem zerborstenen Portikus bei dieser majestätischen und umgestürzten Säule. Sie ist noch unversehrt und stützt die Hütte eines armen Holzfällers, der einst nicht gewagt hätte, den Vorhof dieses Palasts zu betreten. Dieser Kontrast bewegt uns, berührt uns und große Gedanken entstehen in unserer Brust.9
Bis in den Sprachduktus hinein glaubt man hier einer jener Bildbeschreibungen zu folgen, die Merciers Freund Diderot in seinen Salons dem Ruinenmaler Robert gewidmet hat.10 Robert hat in Rom und an römischen Sujets die Sprache der Ruinenmalerei gelernt. Mit Piranesi, dessen »Vedute di Roma« das Bewußtsein des 18. Jahrhunderts von der Ruinenlandschaft Roms maßgeblich bestimmten, war er befreundet. Robert aber malte nicht nur die klassischen Ruinenlandschaften Italiens, sondern die Ruinen der modernen Hauptstadt Paris.11 Wenn Diderot seine Ästhetik der Ruine und ihrer ›interessanten‹ Wirkungen wesentlich in Auseinandersetzung mit Robert entwickelte und Mercier seine eigene Ruinenpoesie an Diderot ausrichtete, so war es schließlich wohl Mercier, der nun seinerseits Robert die Idee gab, die Grande Galerie des Louvre im Zustand ihres zukünftigen Verfalls gleichsam als antike Ruine zu malen. Das Bild der Ruine der Louvre-Galerie, das Robert 1796 im Salon ausstellte und das heute in der Grande Galerie des Louvre selbst zu sehen ist, scheint wie eine Illustration zu Merciers im Tableau de Paris vor Augen geführter Vision der zukünftigen Pariser Ruinenlandschaft. Seinen besonderen Effekt erhält dies Bild aber dadurch, daß es auf ein anderes Bild Roberts bezogen ist, in dem dieser einen eigenen Vorschlag zum Umbau der Grande Galerie mit Oberlicht – eine Lösung, die erst 1947 verwirklicht wurde – als schon verwirklicht darstellt.12 So greift der Maler auf eine Zukunft vor, die er selbst durch eine Nahzukunft aufhebt. Robert malt eine noch zu bauende Konstruktion und läßt genau diese im zweiten Bild als schon Ruine geworden erscheinen. Hier wird ein Bewußtsein von der Temporalität der großen Stadt zwischen Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft und zukünftiger Vergangenheit bildlich inszeniert, das zuerst bei Mercier artikuliert worden war.13
Der Einschnitt der Französischen Revolution gibt den Meditationen über den Tod der großen Städte und dem Verfall der mächtigen Reiche der Vergangenheit neue Aktualität. 1791 erscheint, noch inmitten der Revolutionswirren, Volneys Die Ruinen oder Meditationen über den Umsturz der Weltreiche, eine Betrachtung, deren eindrucksvolle Kulisse die Ruinen Palmyras sind, wo der Geist der Geschichte den Reisenden über das Wesen der menschlichen Gesellschaft belehrt.14 Im Anblick der einsamen Ruinen wird der Reisende zur Vorstellung des vergangenen Lebens geführt, das einst die Stadt erfüllt haben muß. Erst dann tritt das melancholische Gegenbild der Zerstörung vor Augen:
Und jetzt, was ist von dieser mächtigen Stadt geblieben, ein düsteres Skelett! Was bleibt von einer mächtigen Herrschaft, eine dunkle, vage Erinnerung! Auf das geschäftige Treiben, das sich unter den Säulengängen drängte, folgte eine tödliche Einsamkeit. Das Schweigen der Gräber ist auf das Murmeln der öffentlichen Plätze gefolgt. Der Reichtum einer Kaufmannsstadt hat sich in häßliche Armut verwandelt, die Paläste der Könige sind zur Zuflucht wilder Tiere geworden, die Herden lagern vor der Schwelle der Tempel, und schmutzige Reptilien hausen in den Heiligtümern der Götter! Wie konnte so großer Ruhm erlöschen? Wie konnten so große Werke zunichte werden?… So vergeht, was die Menschen hervorgebracht haben, so stürzen Reiche und Nationen zusammen!15
Solche melancholischen, von der Unmittelbarkeit der Anschauungen und der Imagination genährten Gedanken verdichten sich zu der Frage:
Große Götter! woher kommen so verhängnisvolle Umbrüche? Was ist der Grund, daß das Geschick dieser Gegenden sich so gewandelt hat? Warum sind so viele Städte zugrunde gegangen? Warum hat die alte Bevölkerung sich nicht behauptet? (S. 59)
Liegt die Geschichte im Bann einer »aveugle fatalité«, so müssen auch die großen Städte und Reiche vergehen. Wieder wendet sich, wie bei Mercier und Robert, der Blick von der antiken Vergangenheit auf die Zukunft der gegenwärtigen Moderne:
Wer weiß, sagte ich mir, ob nicht unsere Gegenden eines Tages gleichfalls verlassen sein werden. Wer weiß, ob an den Ufern der Seine, der Themse oder der Zuidersee, wo jetzt im Wirbelsturm so vieler Zerstreuungen Herz und Augen nicht ausreichen für die Vielzahl der Empfindungen, wer weiß, ob ein Reisender wie ich, sich nicht eines Tages auf stummen Ruinen niederlassen und einsam die Asche der Völker und die Erinnerung ihrer Größe betrauern wird? (S. 61f.)
Da wird der Reisende aus seiner rêverie herausgerissen durch den Geist, der sich ihm zeigt und ihm die tiefsten Gesetze der menschlichen Gesellschaft vor Augen führt. Damit aber verändert sich zugleich die Schreibart: War die Vorstellung des Niedergangs an konkrete Bilder und Erfahrungen, den Vorstellungsraum der einen verödeten Stadt gebunden, so erhebt sich nun der Blick vom Einzelnen zum Ganzen und gewinnt einen imaginären Standort der Überschau, von wo aus das Ganze der menschlichen Geschicke betrachtbar wird. Da aber zeigt sich, daß der melancholische Gedanke einer blinden Fatalität des menschlichen Schicksals nur der Stimmung des Augenblicks entsprang und daß die tiefere Betrachtung auf die Möglichkeit des Fortschritts der menschlichen Verhältnisse stößt. Die Menschen leben nicht mehr in den Wäldern, sie haben immer bessere Gesellschaftsformen, immer vielfältigere Annehmlichkeiten ersonnen, sie treten nicht zuletzt dank der neuzeitlichen Druckkunst in eine glückliche »Gemeinschaft der Meinungen«, die immer weitere Teile der Menschheit erfaßt und bildet:
(…) es hat sich eine fortschreitende Menge an Kenntnissen gebildet, eine Atmosphäre der wachsenden Aufklärung, die fortan eine solide Verbesserung herbeiführt. (S. 133)
Die noch bevorstehende Revolution in Frankreich wird zum großen Zeichen, daß die Menschheit in eine neue Phase ihrer Geschichte eingetreten ist:
Ja, fuhr er fort, mein Ohr erreicht schon ein dumpfer Lärm, ein Schrei Freiheit ausgestoßen an fernen Ufern hat im alten Kontinent Widerhall gefunden. Bei diesem Schrei erhebt sich bei einer großen Nation ein geheimes Murren gegen die Unterdrückung, eine heilsame Unruhe erhebt sich über ihre Lage, sie fragt sich, was sie ist und was sie sein sollte und, bestürzt über ihre Schwäche, fragt sie, was ihre Rechte sind und ihre Möglichkeiten, was das Verhalten ihrer Anführer war … Noch ein Tag, ein Nachdenken … und eine immense Bewegung wird entstehen; ein neues Jahrhundert wird sich öffnen, ein Jahrhundert des Erstaunens für das einfache Volk, der Überraschung und des Erschreckens für die Tyrannen, der Befreiung für ein großes Volk und der Hoffnung für den ganzen Erdball. (S. 136f.)
Die Ruine als Zeichen des Abbruchs einer Lebenskontinuität und einer avancierten kulturellen Kontinuität bleibt für das 19. Jahrhundert ein Topos kulturgeschichtlicher Selbstbesinnung, der sich, anders als bei Volney, mit der Vorstellung zyklischer Zeit und mit der Dominanz der natürlichen über die historische Zeit verbindet, wenngleich diese Vorstellung selbst als eine sekundäre geschichtliche Anschauungsform die dominante geschichtliche Anschauungsform der Linearität begleitet. Der poetische Diskurs, den die Anschauungsform des geschichtlichen Niedergangs seit der Nachrevolutionszeit ausbildet, ist nicht nur Funktion einer eigenen Ästhetik des Interessanten, die in die Ästhetik des Romantischen übergeht. Er ist mehr noch Ausdruck eines Bewußtseins, das sich gleichsam beschwörend einer abgedrängten geschichtlichen Anschauungsform zuwendet und dieser als Meditation, rêverie, Traum oder Alptraum zu Wort verhilft.16 Dabei ist dann aber vorzugsweise der Diskurs des Niedergangs auf die sinnlich erfaßbare oder imaginär konkretisierbare Einheit, sei es des einzelnen Bauwerks oder mehr noch der Einheit der in sich abgegrenzten Stadt, bezogen, von deren gewesener Identität noch immer ein großer Name und eine überschaubare Ruinenlandschaft zeugen. Die große Stadt ist das eigentliche Thema, das sich mit der Anschauungsform des Niedergangs verbindet.17
Chateaubriand und Madame de Staël nehmen die spätaufklärerische Aktualisierung der Niedergangs- und Ruinenthematik wieder auf und geben ihr aus nachrevolutionärer Perspektive eine neue Dimension geschichtsphilosophischer Skepsis und Melancholie, die sich indes verbindet mit neuen, modisch gewordenen antiquarischen Interessen am archäologischen Freilegen der Zeugnisse der verschütteten Welt des Altertums. Melancholie und positives Geschichtsinteresse gehen dabei eine neue Verbindung ein. In Chateaubriands René (1802), dem großen Zeugnis eines neuen, romantischen Lebensgefühls, findet die Ruinenpoesie eine große, denkwürdige Darstellungsgebärde. Der Held, dessen Leben vom Weltschmerz verdüstert ist, erinnert sich seiner Empfindungen im Anblick des niedergesunkenen Rom:
Ich besuchte zuerst die Völker, die nicht mehr sind; ich setzte mich nieder auf den Ruinen Roms und Griechenlands: Länder starker und geistreicher Erinnerung, wo die Paläste von Staub bedeckt sind und die Mausoleen der Könige unter Dornengestrüpp verborgen liegen. Kraft der Natur und Schwachheit des Menschen: ein Grashalm durchbohrt oft den härtesten Marmor dieser Gräber, die alle diese Toten, die einst so mächtig waren, niemals emporheben werden.
Manchmal zeigte sich eine hohe, einsame, aufrecht stehende Säule in verlassener Landschaft wie ein großer Gedanke sich von Zeit zu Zeit in einer Seele erhebt, die Zeit und Unglück verwüstet haben.18
Noch einmal wird in dem berühmten Brief an Fontane von 1804 die Campagna um Rom zum Gegenstand einer poetisch-melancholischen Schattenbeschwörung. Vom ästhetischen Reiz der Ruine und besonders der christlichen, nordisch-gotischen Ruine spricht Chateaubriand in seiner ästhetisierenden Verteidigung des christlichen Glaubens, dem Génie du Christianisme (1802). Seine Martyrs (Märtyrer: 1809) sind der Versuch, imaginär das 3. Jahrhundert n. Chr. mit den Christenverfolgungen unter Diokletian zu vergegenwärtigen. Die Martyrs sind nach Barthélemys Voyage du jeune Anarcharsis en Grèce (Reise des jungen Anarcharsis nach Griechenland; 1788) einer der frühesten Versuche eines archäologischen Romans. Der Itinéraire Paris-Jérusalem (Reise Paris – Jerusalem; 1811), Darstellung der Reise, die Chateaubriand unternahm, um sich für seinen Roman der Christenverfolgung zu dokumentieren, ist erneut eine Folge von Begegnungen mit den Ruinen der großen Städte des Mittelmeerraums von Athen bis Karthago, die in den Wechselfällen der Geschichte zugrunde gingen.
Madame de Staël gibt nach Chateaubriand in ihrem Roman Corinne (1807) noch einmal ein großes Gemälde der Ruinen Roms, durch die Corinne, die geniale Dichterin und Schauspielerin, den sie bewundernden englischen Lord Nelvil hindurchführt. Ausdrücklich geht Madame de Staël dabei auf die Wirkung der Anschauung für die geschichtliche Reflexion ein:
Oswald wurde nicht müde, die Spuren des alten Rom von der Höhe des Kapitols aus zu betrachten, wohin Corinne ihn geführt hatte. Die Lektüre der Geschichte, die Überlegungen, die sie weckt, wirken weniger auf unsere Seele als diese umhergeworfenenen Steine, als diese Ruinen, vermischt mit neuen Wohnhäusern. Die Augen sind von allmächtiger Wirkung auf die Seele: wenn man die römischen Ruinen gesehen hat, glaubt man an die alten Römer, als hätte man in ihrer Zeit gelebt. Die Erinnerungen des Geistes werden durch Studium erworben; die Erinnerungen der Imagination entstehen aus einem unmittelbareren und intimeren Eindruck, der dem Gedanken Leben verleiht und uns sozusagen zu Zeugen dessen macht, was wir gelernt haben.19
Bei Chateaubriand wie bei Madame de Staël ist die Beschwörung der Ruinen Roms nicht ohne politischen Bezug auf das napoleonische Frankreich, zu dem sie skeptische Distanz bewahren. Wenn Napoleon sein Empire in der Kontinuität des Imperium Romanum begreift, Paris als neues Rom zum Zentrum der Welt machen will, so ist die Schattenbeschwörung des zerfallenen Rom zugleich die Beschwörung einer zukünftigen Vergangenheit, die nicht mehr Rom, sondern Paris betrifft.





























