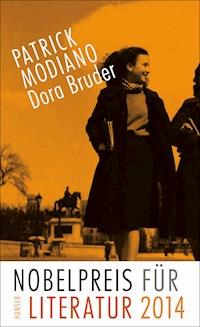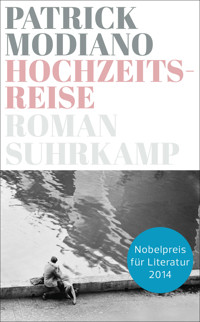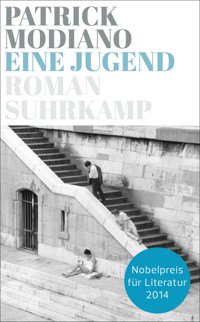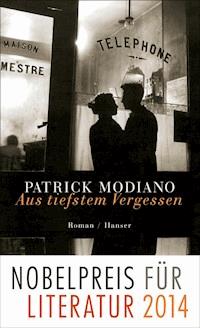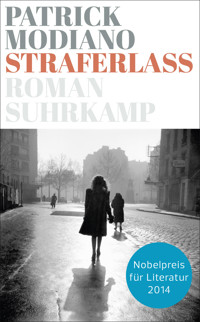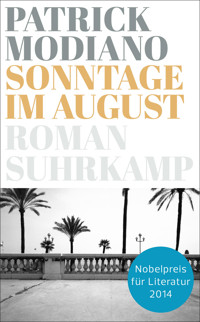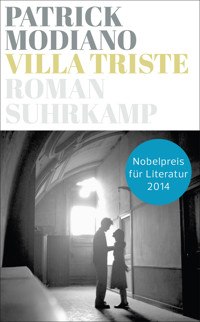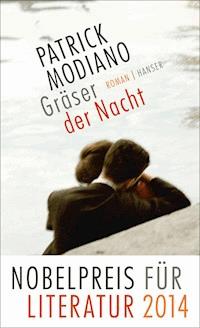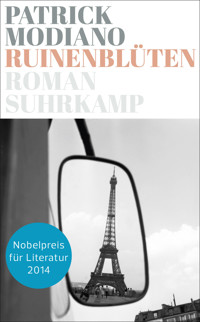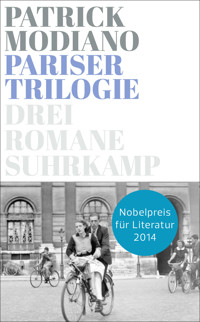
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Bücher hat Patrick Modiano unter dem Titel Pariser Trilogie zusammengefaßt: Abendgesellschaft, Außenbezirke und Familienstammbaum. Wie wird man zum Verräter, wie läßt es sich verhindern? Diese Fragen stellt sich ein junger Franzose, der sich, für die Gestapo arbeitend, einer Résistance-Gruppe anschließt. In einer ebenso sanften wie unnachgiebigen Erzählung nähert sich Modiano einer Vergangenheit an, die er selbst nicht erlebt hat. Mit seiner unverwechselbaren Musikalität erweckt er Worte zum Leben und überführt sie in eine fantastisch anmutende Abendgesellschaft. In den Außenbezirken, außerhalb von Paris, sucht Serge Alexandre seinen Vater. Wieder befinden wir uns in der Zeit der Besatzung. Wer ist dieser Vater? Was macht er, als Jude unter all den zwielichtigen Gestalten? Warum erkennt er seinen Sohn nicht mehr? Bis zuletzt folgt der Erzähler den Spuren seines geisterhaften Vaters. »Ich war siebzehn, und es blieb mir nichts anderes übrig, als ein französischer Schriftsteller zu werden«, schreibt Modiano im Familienstammbuch und legt uns in 14 Erzählungen seine Jugenderinnerungen vor. Autobiographisches, aber auch Imaginiertes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Drei Bücher hat Patrick Modiano unter dem Titel Pariser Trilogie zusammengefaßt: Abendgesellschaft, Außenbezirke und Familienstammbaum.
Wie wird man zum Verräter, wie läßt es sich verhindern? Diese Fragen stellt sich ein junger Franzose, der sich, für die Gestapo arbeitend, einer Résistance-Gruppe anschließt. In einer ebenso sanften wie unnachgiebigen Erzählung nähert sich Modiano einer Vergangenheit an, die er selbst nicht erlebt hat. Mit seiner unverwechselbaren Musikalität erweckt er Worte zum Leben und überführt sie in eine fantastisch anmutende Abendgesellschaft.
In den Außenbezirken, außerhalb von Paris, sucht Serge Alexandre seinen Vater. Wieder befinden wir uns in der Zeit der Besatzung. Wer ist dieser Vater? Was macht er, als Jude unter all den zwielichtigen Gestalten? Warum erkennt er seinen Sohn nicht mehr? Bis zuletzt folgt der Erzähler den Spuren seines geisterhaften Vaters.
»Ich war siebzehn, und es blieb mir nichts anderes übrig, als ein französischer Schriftsteller zu werden«, schreibt Modiano im Familienstammbuch und legt uns in 14 Erzählungen seine Jugenderinnerungen vor. Autobiographisches, aber auch Imaginiertes.
Patrick Modiano, geboren 1945 bei Paris als Sohn einer Schauspielerin und eines jüdischen Emigranten, publizierte bereits im Alter von 22 Jahren seinen ersten Roman. 1978 erhielt er für Die Gasse der dunklen Läden den Prix Goncourt. 2014 wurde Modiano der Nobelpreis verliehen.
Im Suhrkamp Verlag sind von ihm u.a. erschienen: Eine Jugend (st 4615), Villa Triste (st 4616), Die Gasse der dunklen Läden (st 4617), Straferlaß (st 4619), Sonntage im August (st 4620) sowie Hochzeitsreise (st 4621).
Patrick ModianoPariser Trilogie
AbendgesellschaftAußenbezirkeFamilienstammbuch
Drei Romane
Aus dem Französischen vonWalter Schürenberg
Die Originalausgaben vo Abendgesellschaft, Außenbezirke und Familienstammbuch erschienen 1969, 1972 und 1977 unter den Titeln La ronde de nuit, Les boulevards de ceinture sowie Livret de famille bei Gallimard.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4618
© Suhrkamp Verlag Berlin 1989
© Éditions Gallimard, 1969, 1972, 1977
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Scherl/SZ Photo
Umschlag: hißmann, heilmann, hamburg
eISBN 978-3-518-73979-2
www.suhrkamp.de
Abendgesellschaft
Warum mußte ich mich gerade mit denenidentifizieren, die meinen Abscheuoder mein Mitleid erregten?
F. Scott Fitzgerald
Schallendes Gelächter in der Nacht. Der Khedive hebt den Kopf.
»Sie spielten also Mahjong, während Sie auf uns warteten?« Und er verstreut die Elfenbeinsteine auf dem Schreibtisch.
»Allein?« fragt Monsieur Philibert.
»Haben Sie uns schon lange erwartet, mein Kleiner?«
Ihre Stimmen sind mal flüsternd, mal unvermittelt laut. Monsieur Philibert lächelt und macht eine unbestimmte Geste. Der Khedive neigt den Kopf nach links und verharrt so, mit der Wange fast die Schulter berührend. Wie der Vogel Marabu.
In der Mitte des Salons steht ein Flügel. Lila Tapeten und Vorhänge. Große Vasen mit Dahlien und Orchideen. Das Licht der Lüster ist verschleiert, wie in bösen Träumen.
»Vielleicht etwas Musik zur Entspannung?« regt Monsieur Philibert an.
»Sanfte Musik, wir brauchen sanfte Musik«, erklärt Lionel de Zieff.
»Zwischen heute und morgen?« schlägt der Graf Baruzzi vor. »Das ist ein Slow-Fox.«
»Ich hätte lieber einen Tango«, erklärt Frau Sultana.
»O ja, bitte«, fleht Baronin Lydia Stahl.
»Du, du gehst an mir vorbei«, summt Violette Morris in klagendem Ton.
»Also: Zwischen heute und morgen«, entscheidet der Khedive.
Die Frauen sind viel zu stark geschminkt. Die Männer sind auffallend grell gekleidet. Lionel de Zieff trägt zum orangefarbenen Anzug ein Hemd mit ockergelben Streifen, Pols de Helder ein grünes Jackett und himmelblaue Hosen, Graf Baruzzi einen aschgrauen Smoking. Einige Paare formieren sich. Costachesco tanzt mit Jean-Farouk de Méthode, Gaétan de Lussatz mit Odicharvi, Simone Bouquereau mit Irène de Tranzé … Monsieur Philibert hält sich abseits, gegen das linke Fenster gelehnt. Als einer der Brüder Chapochnikoff ihn zum Tanzen auffordert, zuckt er nur die Achseln. Der Khedive, am Schreibtisch sitzend, pfeift und schlägt den Takt.
»Sie tanzen nicht, mein Kleiner?« fragt er. »Nervös? Beruhigen Sie sich, Sie haben viel Zeit … so viel Zeit, wie Sie wollen.«
»Wissen Sie«, erklärt Monsieur Philibert, »die Polizei ist nichts anderes als eine endlose Geduldsprobe.« Er geht zu dem Wandbrett und nimmt ein in blaßgrünes Maroquin gebundenes Buch heraus: Anthologie der Verräter von Alkibiades bis Hauptmann Dreyfus. Er blättert es auf mit all den Einlagen zwischen den Seiten – Briefen, Telegrammen, Visitenkarten, getrockneten Blumen – und legt das Buch auf den Schreibtisch. Der Khedive scheint sich lebhaft dafür zu interessieren.
»Ihre Nachttischlektüre, mein Kleiner?«
Monsieur Philibert reicht ihm eine Photographie. Der Khedive betrachtet sie lange. Monsieur Philibert hat sich hinter ihn gestellt. »Seine Mutter«, murmelt der Khedive und zeigt auf die Photographie. »Stimmt's nicht, Kleiner? Ihre Frau Mutter?« Und er wiederholt: »Ihre Frau Mutter …« Zwei Tränen rollen über seine Wangen bis herab zu den Mundwinkeln. Monsieur Philibert hat seine Brille abgenommen. Seine Augen sind geweitet. Auch er weint. In diesem Moment erklingen die ersten Takte von Bei zärtlicher Musik. Es ist ein Tango, aber sie haben nicht genug Platz, um sich schwungvoll zu entfalten. Sie rempeln sich gegenseitig an, manche stolpern sogar und rutschen auf dem Parkett aus. »Sie tanzen nicht?« fragt Baronin Lydia Stahl. »Los, gewähren Sie mir den nächsten Rumba.« – »Lassen Sie ihn in Ruhe«, murmelt der Khedive. »Der junge Mann hat keine Lust zu tanzen.« – »Nur eine Rumba, eine Rumba«, fleht die Baronin. – »Eine Rumba! Eine Rumba!« heult Violette Morris. Unter dem Licht der beiden Lüster laufen sie rot an, das Blut steigt ihnen in den Kopf, sie werden fast dunkelviolett. Der Schweiß tropft von ihren Schläfen, ihre Augen weiten sich. Das Gesicht von Pols de Helder wird immer schwärzer, es wirkt wie verkohlt. Die Wangen des Grafen Baruzzi werden hohl, die Ringe um die Augen Rachid von Rosenheims vertiefen sich. Lionel de Zieff greift sich ans Herz. Costachesco und Odicharvi sind wie von Stumpfsinn befallen. Die Schminke der Frauen blättert ab, ihr Haar nimmt immer grellere Töne an. Sie alle lösen sich gleichsam auf und werden gewiß auf der Stelle verfaulen. Ob sie es bereits selbst merken?
»Reden wir nicht viel, aber vernünftig, Kleiner«, säuselt der Khedive. »Haben Sie inzwischen Kontakt mit dem aufgenommen, den man allgemein ›die Prinzessin von Lamballe‹ nennt? Wer ist das? Wo hält er sich auf?«
»Hörst du?« murmelt Monsieur Philibert. »Henri wünscht nähere Auskünfte über die sogenannte Prinzessin von Lamballe.«
Die Platte ist zu Ende. Alle verstreuen sich über die Diwane, die Hocker und Fauteuils. Jean-Farouc de Méthode öffnet eine Flasche Cognac. Die Brüder Chapochnikoff gehen hinaus und erscheinen wieder mit Tabletts voller Gläser. Lussatz füllt sie bis zum Rand. »Stoßen wir an, Freunde«, schlägt Hayakawa vor. – »Auf das Wohl des Khediven«, ruft Costachesco. – »Auf das von Inspektor Philibert«, sagt Mickey de Voisins und – »einen Toast auf Madame de Pompadour«, kreischt die Baronin de Stahl. Gläser klingen. Alle leeren sie auf einen Zug.
»Die Adresse von Lamballe«, murmelt der Khedive. »Sei nett, mein Liebling. Verschaff uns die Adresse.«
»Du weißt genau, daß wir die Stärkeren sind, mein Lieber«, flüstert Monsieur Philibert.
Die anderen unterhalten sich leise im Verschwörerton. Das Licht der Lüster wird schwächer, schillert zwischen Blau und dunklem Violett. Die Gesichter sind nicht mehr zu erkennen. – »Im Hotel Blitz geht es immer kleinlicher zu.« – »Seid unbesorgt. Solange es mich gibt, habt ihr Blankovollmacht von der Botschaft.« – »Nur ein Wort von Grafkreuz, mein Lieber, und das Blitz wird endgültig gestorben sein.« – »Ich werde bei Otto intervenieren.« – »Ich bin eine intime Freundin von Doktor Best. Wollt ihr, daß ich mit ihm spreche?« – »Ein Telefonanruf bei Delfanne – und alles geht in Ordnung.« – »Wir müssen unsere Mittelsmänner hart anfassen, andernfalls nutzen sie es nur aus.« – »Kein Pardon!« – »Um so weniger, da wir sie doch decken!« – »Sie sollten uns dafür dankbar sein.« – »Von uns nämlich wird man Rechenschaft verlangen, nicht von ihnen.« – »Die werden sich da schon aus der Affäre ziehen. Ihr werdet sehen! Während wir …!« – »Wir haben unseren letzten Trumpf noch nicht ausgespielt.« – »Die Nachrichten von der Front sind ausgezeichnet. Ausgezeichnet!«
»Henri will die Adresse der Lamballe wissen«, wiederholt Monsieur Philibert. »Streng dich an, Kleiner.«
»Ich kann Ihre Bedenken durchaus verstehen«, sagt der Khedive. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag: zunächst werden Sie uns die Orte nennen, wo man noch in dieser Nacht alle Mitglieder der Verschwörung festnehmen kann.«
»Das läuft ganz von selbst«, fügt Monsieur Philibert hinzu. »Danach wird es für Sie viel leichter sein, uns die Adresse der Lamballe zu verraten.«
»Die Falle soll noch heute nacht zuschnappen«, murmelt der Khedive. »Wir hören auf dich, mein Kleiner.«
Ein gelbes Notizbuch, das in der Rue Réaumur gekauft wurde. Sie sind Student? hat die Ladeninhaberin gefragt. (Man interessiert sich für die jungen Leute. Die Zukunft gehört ihnen, man möchte ihre Ziele und Absichten kennenlernen, man überhäuft sie mit Fragen.) Eine Stabtaschenlampe wäre nötig, um die richtige Seite in dem Notizbuch zu finden. In diesem Halbdunkel sieht man nichts. Man blättert darin, die Nase dicht auf dem Papier. Die erste Adresse ist in Großbuchstaben notiert: es ist die des Leutnants, des Haupts der Verschwörung. Man bemüht sich, die dunkelblauen Augen zu vergessen und die warme Stimme, mit der er sagte: »Geht's denn, Kleiner?« Man sähe ihn lieber mit allen Fehlern behaftet: kleinlich, anmaßend, ein falscher Fuffziger. Dann wäre alles einfacher. Aber man findet kein Staubkorn in diesem klaren Diamanten. Bleiben als letztes die Ohren des Leutnants. Man braucht nur diese knorpeligen Gebilde zu sehen, und es wird einem sofort speiübel. Wie können menschliche Wesen solche monströsen Auswüchse haben? Man stellt sie sich vor, dort auf dem Schreibtisch, viel größer als in natura, rot angelaufen und mit Äderchen durchzogen. Hastig wird der Ort genannt, an dem er sich an diesem Abend aufhält: die Place du Châtelet. Dann läuft alles wie von selbst. Ein Dutzend Namen und Adressen werden genannt, ohne auch nur einmal das Notizbuch zu konsultieren. Wie brave Schüler, die eine Fabel von La Fontaine herunterleiern.
»Wir haben alle Aussicht auf einen schönen Fischzug«, sagt der Khedive. Er zündet sich eine Zigarette an, richtet seine Nase zur Decke und bläst Rauchringe. Monsieur Philibert hat sich an den Schreibtisch gesetzt und blättert in dem Notizbuch. Offenbar prüft er die Richtigkeit der Adressen.
Die anderen unterhalten sich weiter. – »Wie wär's, wenn wir noch etwas tanzten? Mir kribbelt es in den Beinen.« – »Zarte Musik, wir brauchen eine zarte Musik!« – »Jeder sage, was er am liebsten hören möchte! Eine Rumba!« – Serenata ritmica! – So stell ich mir die Liebe vor! – Coco Seco! – Whatever Lola wants! – Guapo Fantoma! – No me dejes de querer! – »Und wenn wir Verstecken spielten?« Sie klatschen in die Hände. – »Ja, ja! Verstecken!« Die Dunkelheit erzittert von ihrem schallenden Gelächter.
Ein paar Stunden davor. Der große Wasserfall im Bois de Boulogne. Das Orchester quälte sich mit einem Walzer von den Antillen. Zwei Personen hatten an unserem Nachbartisch Platz genommen. Ein älterer Herr mit perlgrauem Schnurrbart und weißem Filzhut, eine ältere Dame in dunkelblauem Kleid. Der Wind ließ die Lampions in den Bäumen hin- und herschwanken. Coco Lacour rauchte seine Zigarre. Esmeralda trank bedächtig eine Orangeade. Sie sprachen nicht. Eben deshalb habe ich sie gern. Ich möchte die beiden genau beschreiben. Coco Lacour: rothaarig, riesengroß, mit den Augen eines Blinden, in denen von Zeit zu Zeit eine unendliche Traurigkeit aufscheint. Oft verbirgt er sie hinter einer dunklen Brille, und sein schwerfälliges, zögerndes Gehabe gibt ihm etwas von einem Schlafwandler. Das Alter von Esmeralda? Sie ist winzig, wie ein kleines Mädchen. Ich könnte mich über sie noch in vielen rührenden Einzelheiten ergehen, aber erschöpft lasse ich es sein. Coco Lacour, Esmeralda, diese beiden Namen werden dem Leser genügen, wie auch mir ihre schweigsame Gegenwart am Nachbartisch genügt. Esmeralda betrachtete verwundert die grobschlächtigen Musikanten im Orchester. Coco Lacour lächelte. Ich bin ihr Schutzengel. Jeden Abend werden wir in den Bois de Boulogne kommen, um die Lieblichkeit des Sommers zu genießen. Wir treten ein in dieses geheimnisvolle Fürstentum mit seinen Teichen, seinen schattigen Alleen und seinen im Grünen verborgenen Teesalons. Hier hat sich seit unserer Kindheit nichts verändert. Erinnerst du dich? Du liefst mit dem Reifen die Alleen des Pré Catelan entlang. Der Wind streichelte Esmeraldas Haar. Ihr Klavierlehrer hatte mir gesagt, sie mache Fortschritte. Sie lernte das Notenlesen nach der Methode Beyer, und bald würde sie kleine Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart spielen können. Coco Lacour zündete sich eine Zigarette an, schüchtern, als wollte er sich entschuldigen. Ich liebe die beiden. Meine Liebe ist frei von jeder Sentimentalität. Ich denke: Wenn es mich nicht gäbe, würde man sie zertrampeln. Elend und schwächlich, wie sie sind. Immer schweigsam. Ein Atemhauch, eine kleine Bewegung würde genügen, sie zu zerbrechen. Aber mit mir haben sie nichts zu befürchten. Manchmal überkommt mich das Verlangen, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Ich würde die günstigste Gelegenheit wählen. Heute abend, zum Beispiel. Ich würde aufstehen und leise zu ihnen sagen: »Wartet hier auf mich, ich bin gleich wieder zurück.« Coco Lacour würde den Kopf heben. Das trostlose Lächeln von Esmeralda. Ich müßte die ersten zehn Schritte tun, ohne mich umzuwenden. Danach ginge alles wie von selbst. Ich würde zum Wagen rennen und den Motor anlassen. Das Schwierigste ist: die Umklammerung während der paar Sekunden nicht zu lösen, die dem Tod durch Ersticken vorangehen. Welch unendliche Erleichterung spürt man in dem Augenblick, wenn der Körper nachgibt und ganz langsam zu Boden sinkt. Das gilt ebenso für das Erdrosseln in der Badewanne wie für den Verrat, der darin besteht, jemanden bei Nacht und Nebel im Stich zu lassen, nachdem man ihm versprochen hat, bald zurück zu sein. Esmeralda amüsierte sich mit einem Strohhalm. Sie blies hinein und brachte ihre Limonade zum Moussieren. Coco Lacour rauchte seine Zigarre. Wenn mich das Verlangen überkommt, sie zu verlassen, sehe ich mir beide nacheinander genau an, achte auf die kleinste Geste von ihnen, erspähe jeden Ausdruck auf ihren Gesichtern, wie man sich an ein Brückengeländer klammert. Wenn ich sie aufgebe, werde ich in die Einsamkeit des Anfangs zurückfallen. Schließlich ist Sommer, sage ich mir, um mir Mut zu machen. Im nächsten Monat wird alle Welt zurück sein. Ja wirklich, es war Sommer, aber er zögerte sich auf verdächtige Weise hinaus. Kein einziges Fahrzeug mehr in Paris. Kein einziger Fußgänger mehr. Von Zeit zu Zeit durchbrachen die Schläge einer Turmuhr die Stille. An der Biegung einer Avenue im hellen Sonnenschein mußte ich plötzlich denken, ich träumte einen schlechten Traum. Im Juli hatten die Menschen Paris verlassen. Abends fanden sie sich ein letztes Mal auf den Terrassen der Champs-Élysées und des Bois de Boulogne ein. Nie hatte ich die Tristesse des Sommers deutlicher als in diesen Augenblicken empfunden. Die Feuerwerk-Saison. Eine ganze Menschheit, im Begriff unterzugehen, vergnügte sich knallend unter dem Blätterdach und den Lampions. Die Leute rempelten sich gegenseitig an, kniffen einander, redeten übertrieben laut, lachten und kicherten nervös. Man hörte Gläser zersplittern, Autotüren zuschlagen. Der Exodus begann. Tagsüber spaziere ich durch diese sich selbst überlassene Stadt. Aus den Kaminen steigt Rauch auf: Sie verbrennen ihre alten Akten und Briefe, ehe sie sich selbst davonmachen. Sie wollen sich nicht mit unnötigen Dingen belasten. Autoschlangen rollen auf die Ausfalltore von Paris zu; ich setze mich auf eine Bank. Ich würde sie gern auf ihrer Flucht begleiten, aber ich habe nichts, was ich retten müßte. Wenn sie fort sind, werden sich Schatten erheben und einen Kreis um mich bilden. Ein paar Gesichter werde ich wiedererkennen. Die Frauen sind viel zu stark geschminkt, die Männer sind von negerhafter Eleganz: Schuhe aus Krokodil-Leder, Anzüge in mehreren Farben, Siegelringe aus Platin. Manche prunken sogar bei jeder Gelegenheit mit ganzen Reihen goldener Zähne. Ich befinde mich hier in den Händen von nicht sehr vertrauenswürdigen Gesellen: Ratten, die eine Stadt einnehmen, nachdem die Pest die Bevölkerung dezimiert hat. Sie geben mir einen Polizei-Ausweis, einen Waffenschein und bitten mich, ich solle mich in eine »Verschwörung« einschleichen, um sie auffliegen zu lassen. Seit meiner Kindheit habe ich so viel versprochen, was ich nicht gehalten habe, so viele Rendezvous verabredet, zu denen ich nicht gegangen bin, daß es mir »kindisch« vorkommt, mich als Musterbeispiel eines Verräters anzuführen. »Warten Sie, ich komme zurück …« Der letzte Blick auf all diese Gesichter, ehe sie im Dunkel der Nacht versanken … Manche konnten sich nicht vorstellen, daß ich sie verlassen würde. Andere blickten mich aus hohlen Augen an: »Hören Sie, Sie kommen doch wieder?« Ich erinnere mich auch dieser sonderbaren Herzstiche jedesmal, wenn ich auf meine Uhr sah: man erwartet mich seit fünf, zehn, zwanzig Minuten. Vielleicht hat man das Vertrauen in mich noch nicht verloren. Ich hatte den dringenden Wunsch, die Verabredung einzuhalten, und dieses unentschlossene Schwanken dauerte gewöhnlich eine Stunde. Wenn man denunziert, ist die Sache viel leichter. Nur ein paar Sekunden Zeit, um in größter Hast die Namen und Adressen durchzugeben. Polizeispitzel. Ich werde sogar zum Mörder werden, wenn sie es wollen. Ich werde meine Opfer mit einem Schalldämpfer erledigen. Alsdann sehe ich mir ihre Brillen, Schlüsselbunde, Taschentücher, Krawatten an – armselige Besitztümer, die nur für den von Wichtigkeit sind, dem sie gehören, und die mich mehr rühren als das Gesicht eines Toten. Bevor ich sie umbringe, heftet sich mein Blick auf eine ganz untergeordnete Partie der betreffenden Person: die Schuhe. Man glaubt zu Unrecht, daß ein Zucken der Hände, ein Verziehen des Gesichts, ein Blick oder die Modulation der Stimme allein imstande wären, uns vom ersten Augenblick an zu rühren. Das eigentlich Rührende sind für mich die Schuhe. Und wenn wegen dieser Toten mein Gewissen schlägt, denke ich nicht an ihr Lächeln und nicht an ihr herzliches Wesen, sondern an ihre Schuhe. Im übrigen ist die Arbeit im niederen Polizeidienst sehr einträglich. Ich habe die Taschen voller Banknoten. Mein Reichtum dient mir dazu, Coco Lacour und Esmeralda zu beschützen. Ohne die beiden wäre ich sehr einsam. Manchmal stelle ich mir vor, daß es sie gar nicht gibt. Ich selbst bin dieser blinde Rotschopf und dieses winzige, verletzliche Persönchen. Eine glänzende Gelegenheit, über mich selbst gerührt zu sein. Nur noch etwas Geduld. Die Tränen werden schon kommen. Endlich werde ich die Süße des »self-pity«, wie es die Engländer zu nennen pflegen, kennenlernen. Esmeralda lächelte mir zu, Coco Lacour zog an seiner Zigarre. Der alte Herr und die alte Dame in dem dunkelblauen Kleid. Rings um uns die leeren Tische. Die Lüster, die man zu löschen vergessen hat … Jeden Augenblick fürchte ich, ihre Autos auf dem Kiesweg knirschen zu hören. Die Türen würden schlagen, sie würden auf uns zukommen, mit langsamem, etwas schlingerndem Gang. Esmeralda machte Seifenblasen und sah mit gerunzelten Brauen zu, wie sie davonflogen. Eine zerplatzte an der Wange der alten Dame. Es raschelte in den Bäumen. Das Orchester spielte die ersten Takte eines Csárdás, dann einen Foxtrott und einen Militärmarsch. Bald weiß man nicht mehr, um was für eine Musik es sich handelt. Die Instrumente geraten außer Atem, haben Schluckauf, und ich sehe wieder jenen Mann vor mir, den sie in den Salon geschleppt hatten, die Hände mit einem Gürtel zusammengeschnürt. Er wollte Zeit gewinnen und lächelte ihnen zuerst freundlich zu, als wollte er sie ablenken. Als er dann seiner Angst nicht mehr Herr wurde, hat er versucht, sie aufzugeilen: Er warf ihnen eindeutige Blicke zu, entblößte seine rechte Schulter mit kleinen ruckartigen Bewegungen, versuchte eine Art Bauchtanz, wobei er an allen Gliedern zitterte. Ich darf keine Sekunde länger hier bleiben. Die Musik wird noch einmal aufschluchzen und dann ersterben. Die Lüster werden verlöschen.
»Spielen wir ein bißchen ›Blindekuh‹?« – »Ausgezeichnet!« – »Wir brauchen uns nicht mal die Augen zu verbinden.« – »Ja, es ist dunkel genug.« – »Machen Sie den Anfang, Odicharvi!« – »Los, verteilt euch!«
Sie gehen auf leisen Sohlen. Man hört, wie die Tür eines Schrankes geöffnet wird. Zweifellos wollen sie sich darin verstecken. Dann hat man den Eindruck, daß sie rund um den Schreibtisch kriechen. Der Fußboden knarrt. Jemand stößt an irgendein Möbelstück. Die Silhouette eines anderen hebt sich gegen das Fenster ab. Lautes Gelächter. Seufzer. Überstürzte Bewegungen. Anscheinend laufen sie alle durcheinander. – »Da habe ich Sie, Baruzzi.« – »Pech gehabt, ich bin Helder.« – »Und wer geht da?« – »Raten Sie mal!« – »Rosenheim?« – »Nein!« – »Costachesco?« – »Nein.« – »Geben Sie's auf?«
»Heute nacht werden wir sie schnappen«, erklärt der Khedive. »Den Leutnant und alle von der Verschwörung. ALLE. Die arbeiten gegen uns.«
»Sie haben mir noch nicht die Adresse von Lamballe gesagt«, murmelt Monsieur Philibert. »Wann werden Sie sich entschließen, Kleiner? Los! …«
»Laß ihn erst Luft holen, Pierrot.«
Plötzlich geht das Licht wieder an. Alle blinzeln. Da sind sie rund um den Schreibtisch. – »Meine Kehle ist trocken.« – »Trinken wir, Freunde, trinken wir!« – »Ein Chanson, Baruzzi! Ein Chanson!« – »War einst ein kleines Segelschiffchen …« – »Weiter, Baruzzi, weiter!« – »… das war noch nie, nie, nie zur See …« – »Soll ich Ihnen meine Tätowierungen zeigen?« schlägt Frau Sultana vor. Sie reißt ihre Bluse auf. Auf jeder ihrer Brüste sieht man einen Marine-Anker. Baronin Lydia Stahl und Violette Morris werfen sie zu Boden und fangen an, sie auszuziehen. Sie wehrt sich, entwindet sich ihrer Umklammerung und reizt sie noch durch kleine Aufschreie. Violette Morris verfolgt sie durch den ganzen Salon, wo in einer Ecke Zieff an einem Hühnerflügel kaut. »In diesen kargen Zeiten zu prassen macht Spaß. Wissen Sie, was ich soeben gemacht habe? Ich habe mich vor einen Spiegel gestellt und mein Gesicht mit Gänseleberpastete eingeschmiert! Gänseleber zu 15 000 Francs die Portion!« (Er lacht laut auf.) »Einen kleinen Cognac?« schlägt Pols de Helder vor. »Es gibt ihn kaum noch. Hunderttausend Francs der Viertelliter. Englische Zigaretten? Ich bekomme sie direkt aus Lissabon. 20 000 Francs das Päckchen.«
»Bald wird man mich mit Herr Polizeipräfekt anreden«, erklärt der Khedive in scharfem Ton. Dann verliert sich sein Blick im Leeren.
»Auf das Wohl des Präfekten!« brüllt Lionel de Zieff. Er kippt um und fällt auf den Flügel. Das Glas ist ihm aus der Hand geglitten. Philibert blättert zusammen mit Paulo Hayakawa und Baruzzi in einem Aktenstück. Die Brüder Chapochnikoff machen sich an dem Grammophon zu schaffen. Simone Bouquereau betrachtet sich im Spiegel.
Die NachtDie MusikUnd dein Mund
trällert die Baronin Lydia und improvisiert einen Tanzschritt.
»Eine sexologisch-paneurhythmische Séance?« wiehert der Wahrsager Ivanoff.
Der Khedive betrachtet sie melancholisch. »Man wird mich mit Herr Polizeipräfekt anreden.« Er hebt die Stimme: »Herr Polizeipräfekt!« Er schlägt mit der Faust auf den Schreibtisch. Die anderen schenken dieser launischen Anwandlung keinerlei Beachtung. Er erhebt sich, öffnet das linke Fenster im Salon. »Kommen Sie zu mir, mein Kleiner, ich brauche Ihre Nähe! Ein so sensibler junger Mann wie Sie! Und so empfänglich … Sie wirken beruhigend auf meine Nerven!«
Zieff schnarcht auf dem Flügel. Die Brüder Chapochnikoff haben es aufgegeben, das Grammophon in Gang zu bringen. Statt dessen inspizieren sie die Blumenvasen, eine nach der anderen, rücken hier eine Orchidee zurecht oder streicheln die Blütenblätter einer Dahlie. Von Zeit zu Zeit blicken sie sich ängstlich nach dem Khediven um. Simone Bouquereau scheint von ihrem Gesicht im Spiegel fasziniert zu sein. Ihre veilchenblauen Augen weiten sich, und ihr Teint wird immer blasser. Violette Morris hat sich neben Frau Sultana auf das mit Velours bezogene Sofa gesetzt. Beide halten ihre weißen Handflächen dem Wahrsager Ivanoff hin.
»Es wird eine Hausse in Wolfram gemeldet«, erklärt Baruzzi. »Ich kann euch welches besorgen, zu günstigen Preisen. Ich habe Kontakt zu Guy Max vom Einkaufsbüro in der Rue Villejust.«
»Ich dachte, der befaßt sich nur mit Textilien«, sagt Monsieur Philibert.
»Er hat sich eines Besseren besonnen«, sagt Hayakawa. »Hat seine Aktien an Macias-Reoyo verkauft.«
»Vielleicht interessieren Sie sich mehr für Rohleder?« fragt Baruzzi. »Boxcalf ist um hundert Francs gestiegen.«
»Odicharvi hat von drei Tonnen Kammgarn gesprochen, die er gern loswerden will. Da habe ich an Sie gedacht, Philibert.«
»Was würden Sie von 36 000 Päckchen Spielkarten halten, die ich Ihnen morgen früh liefern kann? Sie könnten sie mit gutem Gewinn weiterverkaufen. Im rechten Moment. Spielkarten beherrschen die Aktion Schwerpunkt seit Anfang des Monats.«
Ivanoff liest der Marquise aus der Hand. – »Pst, kein Wort!« ruft Violette Morris. »Der Magier sagt ihr die Zukunft voraus! Kein Wort, bitte!«
»Was halten Sie davon, mein Kleiner?« fragt mich der Khedive. »Ivanoff dirigiert die Frauen mit seinem Stöckchen! Seinem berühmten biegsamen Stöckchen! Sie kommen nicht mehr von ihm los! Geheimlehren, mein Lieber! Die macht er sich zunutze! Der alte Clown!« Er lehnt sich auf die Brüstung des Balkons. Unter ihm liegt einer jener stillen Plätze, wie es sie noch im XVI. Arrondissement gibt. Die Straßenlaternen werfen ein seltsames bläuliches Licht auf die Blätter der Bäume und den Musikpavillon. »Wissen Sie, mein Sohn, daß dieses Privathaus, in dem wir uns jetzt befinden, vor dem Krieg einem Monsieur de Bel-Respiro gehört hat?« (Seine Stimme klingt immer gedämpfter.) »In einem Schrank habe ich Briefe gefunden, die er an seine Frau und seine Kinder geschrieben hat. Er hatte noch Familiensinn! Sehen Sie, da ist er!« Er zeigt auf ein Porträt in Lebensgröße, das zwischen den beiden Fenstern hängt. »Monsieur de Bel-Respiro höchstpersönlich, in der Uniform eines Spahi-Offiziers! Sehen Sie nur all diese Orden! Das nenne ich mir einen Franzosen!«
»Zwanzigtausend Meter Kunstseide?« bietet Baruzzi an. »Ich verkaufe sie Ihnen für einen Pappenstiel! Fünf Tonnen Zwieback? Die Waggons stehen an der spanischen Grenze. Die Zertifikate für die Freigabe sind ganz leicht zu bekommen. Ich verlange nur eine kleine Provision, Philibert.«
Die Brüder Chapochnikoff streichen um den Khediven herum und trauen sich nicht, ihn anzureden. Zieff schläft mit offenem Mund. Frau Sultana und Violette Morris lassen sich von Ivanoff und seinen Sprüchen einlullen: astrale Lichtwellen … heiliges Pentagramm … große tellurische Bewegungen … verzaubernde Paneurhythmie … Bételgeuse … Aber Simone Bouquereau legt ihre Stirn an den Spiegel.
»Alle diese Transaktionen interessieren mich nicht«, sagt Monsieur Philibert abschließend.
Baruzzi und Hayakawa sind enttäuscht; sie torkeln zu dem Sessel, in dem Lionel de Zieff sitzt, und tippen ihm auf die Schulter, um ihn aufzuwecken. Monsieur Philibert blättert suchend in einer Akte, Schreibstift in der Hand.
»Sehen Sie, mein Lieber«, fährt der Khedive fort (und man könnte glauben, daß er gleich in Tränen ausbrechen wird), »ich habe überhaupt keine Erziehung genossen. Ich war ganz allein, als man meinen Vater begrub, und ich habe die ganze Nacht an seinem Grab verbracht. Es war eine sehr kalte Nacht. Mit vierzehn Jahren die Strafkolonie von Eysses … das Strafbataillon … Fresnes … Da gab es nur solche Rotzjungen wie mich … Das Leben …«
»Aufwachen, Lionel!« brüllt Hayakawa.
»Wir haben Ihnen wichtige Dinge zu sagen«, fügt Baruzzi hinzu.
»Wir besorgen Ihnen fünfzehntausend LKW's und zwei Tonnen Nickel, wenn Sie uns eine Provision von 15 Prozent geben.« Zieff blinzelt und wischt sich die Stirn mit einem himmelblauen Taschentuch ab. »Alles, was ihr wollt, solange wir nur fressen können, bis die Schwarte kracht. Finden Sie nicht auch, daß ich in den letzten zwei Monaten zugenommen habe? Ein besonderes Vergnügen in diesen Zeiten der Rationierungen.« Er wendet sich torkelnd der Couch zu und schiebt eine Hand in den Blusenausschnitt von Frau Sultana. Die wehrt sich heftig und ohrfeigt ihn mit aller Kraft. Ivanoff erlaubt sich ein höhnisches Grinsen. »Alles, was ihr wollt«, wiederholt Zieff mit etwas heiserer Stimme. – »Also abgemacht, auf morgen, Lionel?« fragt Hayakawa. »Ich könnte deswegen mit Schiedlausky sprechen? Wir bieten Ihnen einen Waggon Kautschuk als Vorleistung.«
Monsieur Philibert schlägt nachdenklich ein paar Töne auf dem Flügel an.
»Und dennoch, mein Lieber«, nimmt der Khedive das Thema wieder auf, »hat es mich schon immer nach Achtbarkeit und Ansehen verlangt. Bitte, werfen Sie mich nicht mit den Leuten hier in einen Topf …«
Simone Bouquereau prüft ihr Make-up vor dem Spiegel. Violette Morris und Frau Sultana haben die Augen geschlossen. Der Magier befragt offenbar die Sterne. Die Brüder Chapochnikoff stehen beim Flügel. Der eine baut das Metronom auf, der andere hält Monsieur Philibert ein Notenheft hin.
»Lionel de Zieff zum Beispiel!« kichert der Khedive. »Ich könnte Ihnen stundenlang über diesen Halsabschneider erzählen! Und über Baruzzi! Hayakawa! All die anderen! Ivanoff? Ein schmieriger Gesangskünstler! Die Baronin Lydia Stahl, eine Edelnutte!«
Monsieur Philibert blättert in den Noten. Von Zeit zu Zeit schlägt er einen Ton an. Die Brüder Chapochnikoff werfen ihm ängstliche Blicke zu.
»Sehen Sie, mein Kleiner«, fängt der Khedive wieder an, »alle Ratten haben sich die ›laufenden Ereignisse‹ zunutze gemacht, um wieder nach oben zu kommen! Ich selbst … aber das ist eine andere Geschichte. Lassen Sie sich nicht vom äußeren Anschein täuschen. In Kürze werde ich in diesem Salon die angesehensten Leute von Paris empfangen. Man wird mich mit Herr Präfekt anreden! Herr Polizeipräfekt, verstehen Sie?« Er wendet sich um und weist auf das lebensgroße Porträt. »Ich selbst! Als Offizier der Spahis! Beachten Sie die Orden! Ehrenlegion! Kreuz zum Heiligen Grabe! Sankt-Georgs-Kreuz von Rußland! Danilo de Montenegro, Schärpe und Degen von Portugal! Nichts, worum ich Monsieur de Bel-Respiro beneiden müßte! Das muß er mir schon gut honorieren!«
Er schlägt die Hacken zusammen.
Plötzlich Stille.
Monsieur Philibert spielt einen Walzer. Die Kaskaden der Töne kommen zögernd, breiten sich aus, entfalten sich auf den Dahlien und Orchideen. Er sitzt ganz gerade, hat die Augen geschlossen.
»Sie verstehen, mein Kleiner?« fragt der Khedive. »Sehen Sie sich seine Hände an! Pierre kann Stunden und Stunden spielen, ohne sich zu verhaspeln. Völlig mühelos, ohne jeden Krampf. Ein wahrer Künstler!«
Frau Sultana wiegt leicht den Kopf. Bei den ersten Akkorden ist sie aus ihrer Erstarrung aufgewacht. Violette Morris erhebt sich und walzt allein bis ans andere Ende des Salons. Paulo Hayakawa und Baruzzi sind verstummt. Die Brüder Chapochnikoff lauschen mit offenem Mund. Selbst Zieff scheint von den Händen Monsieur Philiberts hypnotisiert zu sein, die wie verrückt über die Tasten hetzen. Ivanoff, mit vorgestrecktem Kinn, hat den Blick starr auf die Decke gerichtet. Nur Simone Bouquereau vollendet gleichgültig ihr Make-up vor dem venezianischen Spiegel, als ginge sie das alles nichts an.
Er legt seine ganze Kraft in die Akkorde, neigt sich vor, hält die Augen geschlossen. Der Walzer wird immer ausgelassener.
»Sie lieben das, mein Kleiner?« fragt der Khedive.
Monsieur Philibert hat den Klavierdeckel zugeschlagen. Er steht auf, reibt seine Hände und geht auf den Khediven zu. Nach einem Augenblick:
»Wir haben heute einen geschnappt, Henri. Verteilte Flugschriften. Wir haben ihn auf frischer Tat ertappt. Breton und Reocreux befassen sich mit ihm, unten im Keller.«
Die anderen stehen noch im Bann des verklungenen Walzers. Sie sagen nichts und verharren reglos da, wo die Musik sie gelassen hat.
»Ich habe ihm von dir erzählt, Pierre«, murmelt der Khedive. »Ich sagte ihm, daß du ein empfindsamer Bursche bist, ein Melomane ohnegleichen, ein Künstler …«
»Danke, danke, Henri. Stimmt, aber ich hasse große Worte! Du hättest diesem jungen Mann klarmachen sollen, daß ich ein Polizist bin, nichts weiter!«
»Flic Nummer eins von Frankreich! Ein Minister hat das gesagt!«
»Das ist lange her, Henri!«
»Damals, Pierre, hätte ich Angst um dich gehabt. Inspektor Philibert! Hu! Wenn ich Polizeipräfekt bin, ernenne ich dich zum Kommissar, mein Lieber!«
»Schweig!«
»Aber du liebst mich trotzdem?«
Ein Aufschrei. Dann zweimal. Dann dreimal. Schrill und gellend. Monsieur Philibert sieht auf seine Uhr. »Schon drei Viertelstunden. Der Typ muß klein beigeben! Ich gehe mal nachsehen.« Die Brüder Chapochnikoff folgen ihm auf dem Fuße. Die anderen haben anscheinend nichts gehört.
»Du bist die Schönste«, erklärt Paulo Hayakawa der Baronin Lydia und reicht ihr ein Glas Champagner. »Wirklich?« Frau Sultana und Ivanoff blicken einander in die Augen. Baruzzi will sich auf Zehenspitzen Simone Bouquereau nähern, aber Zieff stellt ihm ein Bein. Baruzzi stürzt und reißt dabei eine Vase mit Dahlien um. »Man will den Frauenhelden spielen? Und hat keinen Blick mehr für den großen Lionel?« Zieff bricht in Gelächter aus und fächelt sich mit seinem himmelblauen Taschentuch Luft zu.
»Das ist der Typ, den sie geschnappt haben«, sagt der Khedive leise, »er verteilte Flugblätter! Man befaßt sich mit ihm! Am Ende wird er schlapp machen, mein Lieber. Willst du ihn sehen?« – »Auf das Wohl des Khediven!« brüllt Lionel de Zieff. – »Auf das von Inspektor Philibert«, fügt Paulo Hayakawa hinzu, während er den Nacken der Baronin liebkost. Wieder ein Aufschrei. Dann noch zweimal. Dann ein langgezogenes Schluchzen.
»Sprich oder krepiere!« kläfft der Khedive.
Die anderen achten überhaupt nicht darauf. Außer Simone Bouquereau, die sich gerade vor dem Spiegel schminkt. Sie wendet sich um. Ihre großen blauen Augen sind geweitet. Am Kinn hat sie einen Streifen Lippenrot.
Noch einige Minuten lang hörten wir die Musik. Sie verstummte in dem Augenblick, als wir den Carrefour des Cascades überquerten. Ich chauffierte. Coco Lacour und Esmeralda saßen ebenfalls vorn. Wir glitten die Straße an den Seen entlang. Das Schattenreich beginnt am Saum des Waldes: Boulevard Lannes, Boulevard Flandrin, Avenue Henri-Martin. Dieses Wohnviertel ist das unheimlichste von Paris. Die Stille, die hier einst nach acht Uhr abends herrschte, hatte etwas Beruhigendes. Stille der Plüsch-Bourgeoisie, es roch nach Samt und guter Erziehung. Man sah förmlich die Familien nach dem Diner im Salon vereint. Jetzt weiß man nicht mehr, was hinter den hohen dunklen Fassaden vorgeht. Von Zeit zu Zeit überquerte vor uns ein Auto mit völlig abgeblendeten Lichtern die Straße. Ich fürchtete jedesmal, es könnte anhalten und uns den Weg versperren.
Wir bogen in die Avenue Henri-Martin ein. Esmeralda schlief. Nach elf Uhr abends fällt es kleinen Mädchen schwer, die Augen offen zu halten. Coco Lacour amüsierte sich mit dem Autoradio, drehte an dem Knopf der T. S. F. Sie wußten beide nicht, wie zerbrechlich ihr Glück war. Ich allein machte mir Sorgen. Wir waren wie drei Kinder, die in einem plumpen Automobil die unheildrohende Finsternis durchfuhren. Und wenn zufällig in einem Fenster Licht war, durfte ich ihm doch nicht trauen. Ich kannte diesen Bezirk gut. Der Khedive beauftragte mich oft, diese Privathäuser nach Kunstgegenständen zu durchstöbern: Häuser im Stil des zweiten Empire, Extravaganzen nach der Manier des XVIII. Jahrhunderts, Häuser von 1900 mit bunten Glasfenstern, Neogotik. In ihnen hauste höchstens noch eine verängstigte Concierge, die der Eigentümer bei seiner Flucht vergessen hatte. Ich läutete am Portal, zeigte meinen Polizei-Ausweis und inspizierte die Räume. Ich erinnere mich noch an lange Spaziergänge: Ranelagh, la Muette Auteuil, das waren so meine Rastplätze. Ich setzte mich auf eine Bank im Schatten der Kastanienbäume. Kein Mensch auf den Straßen. Ich hatte zu allen Häusern des Viertels Zutritt. Die Stadt gehörte mir.
Place du Trocadéro. An meiner Seite Coco Lacour und Esmeralda, diese beiden steinernen Gäste. Mama sagte immer: »Man hat die Freunde, die man verdient.« Worauf ich erwiderte, daß die Menschen für meinen Geschmack viel zu geschwätzig sind und daß ich die blauen Fliegenschwärme, die ihnen aus dem Mund kommen, nicht ertragen kann. Ich bekomme davon Kopfschmerzen. Es nimmt mir den Atem, wo ich ohnehin schon kurzatmig bin. Der Leutnant zum Beispiel ist ein fürchterlicher Schwätzer. Jedesmal, wenn ich in sein Büro komme, beginnt er seine Rede mit »mein junger Freund« oder »mein lieber Junge«. Und dann überstürzen sich die Worte in einem verrückten Tempo, wobei er sich nicht einmal die Zeit nimmt, sie ganz auszusprechen. Er verlangsamt seine Rede, aber nur, um mich im nächsten Augenblick mit einem noch heftigeren Wortschwall zu überschütten. Seine Stimme wird immer schriller. Schließlich schreit er nur noch, und die Worte bleiben ihm im Hals stecken. Er stampft mit dem Fuß auf, rudert mit den Armen, verkrampft, verschluckt sich, dann verfinstert sich seine Miene, und er setzt mit monotoner Stimme die Rede fort, die mit einem »Nur sachte, mein Lieber« schließt, hingehaucht am Rande der Erschöpfung.
Zu Anfang hat er mir gesagt: »Ich brauche Sie. Wir werden gute Arbeit leisten. Ich bleibe mit meinen Männern im Verborgenen. Ihr Auftrag: sich bei unseren Gegnern einzuschleichen. Uns so diskret wie möglich über die Pläne dieser Halunken zu informieren.« Dabei zog er eine genaue Grenze zwischen uns: für ihn und seinen Stab die reine Weste und den heroischen Nimbus. Für mich das niedrige Geschäft des Spionierens und des doppelten Spiels. Als ich an jenem Abend die Anthologie der Verräter von Alkibiades bis Hauptmann Dreyfus wieder in die Hand nahm, schien mir alles in allem das doppelte Spiel und – warum nicht? – der Verrat zu meiner unsteten Natur zu passen. Nicht genug Seelenstärke für einen Heroen, viel zu lässig und unkonzentriert, um einen richtigen Bösewicht abzugeben. Dagegen war ich flink und wendig und besaß eindeutig Charme.
Wir fuhren die Avenue Kléber hinauf. Coco Lacour gähnte. Esmeralda war eingeschlafen, und ihr Köpfchen rollte auf meiner Schulter hin und her. Es wird Zeit, daß sie ins Bett kommen. Avenue Kléber. An jenem Abend damals hatten wir den gleichen Weg genommen, als wir aus dem L'Heure mauve, einem Cabaret der Champs-Élysées kamen. Eine reichlich dekadente Menschheit saß um die mit rotem Samt bezogenen Tische und auf den Hockern vor der Bar: Lionel de Zieff, Costachesco, Lussatz Méthode, Frau Sultana, Odicharvi, Lydia Stahl, Otto da Silva, die Brüder Chapochnikoff … Schummrige Beleuchtung. Ägyptische Parfums. Es gab in Paris solche kleinen Oasen, wo man sich angestrengt bemühte, »das vor einigen Tagen hereingebrochene Desaster« nicht zur Kenntnis zu nehmen, und wo sich die Lebensfreude und die frivole Stimmung der Vorkriegszeit gehalten hatten. Beim Anblick all dieser Gesichter fiel mir ein Satz wieder ein, den ich irgendwo gelesen hatte: »Hochstapelei mit dem Geruch von Verrat und Meuchelmord …« Neben der Bar lief ein Grammophon:
BonsoirJolie madameJe suis venuVous dire bonsoir …
Ich verließ zusammen mit dem Khediven und Monsieur Philibert das Lokal. Ein weißer Bentley wartete unten an der Rue Marbeuf. Sie nahmen neben dem Chauffeur Platz, und ich setzte mich nach hinten. Die Straßenlaternen verbreiteten ein sanftes bläuliches Licht.
»Keine Sorge«, erklärte der Khedive, auf den Fahrer weisend, »Eddy sieht auch im Dunkeln.«
»Zur Zeit gibt es für einen jungen Mann eine Fülle von Möglichkeiten«, hatte dann Monsieur Philibert zu mir gesagt und mich beim Arm genommen. »Man muß sich nur für die beste entscheiden, und ich will Ihnen gern dabei behilflich sein, mein Junge. Wir leben in einer gefährlichen Epoche. Sie haben schmale weiße Hände und sind von zarter Gesundheit. Passen Sie auf. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann den, nicht den Helden zu spielen. Halten Sie sich ruhig. Arbeiten Sie mit uns: Das ist Ihre Chance, denn sonst bleibt Ihnen nur die Wahl zwischen dem Märtyrertod oder dem Sanatorium.« – »Zum Beispiel so ein kleines bißchen Spitzelei, wäre das nichts für Sie?« fragte mich der Khedive. – »Sehr großzügig honoriert«, fügte Monsieur Philibert hinzu. »Und völlig legal. Wir geben Ihnen einen Polizeiausweis und einen Waffenschein.« – »Es handelt sich darum, Sie in einen geheimen Zirkel einzuschleusen, um ihn auffliegen zu lassen. Sie werden uns über die Kontakte dieser Herren informieren.« – »Bei einem Minimum an Vorsicht wird niemand Verdacht gegen Sie schöpfen.« – »Mir scheint, Sie flößen Vertrauen ein.« – »Ihnen würde man ohne Beichte die Absolution erteilen.« – »Sie haben ein einnehmendes Lächeln.« – »Und schöne Augen, mein Junge!« – »Verräter haben immer einen klaren Blick.« Sie redeten immer schneller. Schließlich hatte ich den Eindruck, sie sprächen gleichzeitig. Diese blauen Schmetterlinge, die aus ihrem Munde kamen … Alles, was sie nur wollten … Spitzel, gedungener Mörder, wenn sie nur manchmal den Mund halten und mich schlafen lassen würden. Spitzel, Verräter, Mörder, blaue Schmetterlinge …
»Wir nehmen Sie mit in unser neues Hauptquartier«, entschied Monsieur Philibert. »Es ist ein Privathaus, Nr. 3 Square Cimarosa.« – »Wir werden dort ein Einweihungsfest geben«, fügte der Khedive hinzu. »Mit allen unseren Freunden!« – Home, sweet home, intonierte Monsieur Philibert.
Als ich den Salon betrat, fiel mir wieder jener mysteriöse Satz ein: »Hochstapelei mit dem Geruch von Verrat und Meuchelmord.« Sie waren alle da. Und jeden Augenblick kamen andere: Danos, Codébo, Reocreux, Vital-Léca, Robert le Pale … Die Brüder Chapochnikoff reichten Champagner herum. – »Ich möchte Ihnen ein kleines Tête-à-tête vorschlagen«, flüsterte mir der Khedive zu. »Wie finden Sie das? Sie sind ganz blaß. Etwas zu trinken?« Er hielt mir ein randvolles Glas mit einer rosaroten Flüssigkeit hin. – »Wissen Sie«, sagte er, während er die Fenstertür öffnete und mich auf den Balkon zog, »ich herrsche von heute an über ein ganzes Reich. Es handelt sich nicht nur um einen polizeilichen Hilfsdienst. Wir kurbeln enorme Geschäfte an! Beschäftigen über fünfhundert Agenten! Philibert wird mir in der Verwaltung helfen. Ich habe es verstanden, die ungewöhnlichen Ereignisse der letzten Monate zu nutzen.« Die Hitze lastete so schwer, daß die Fenster des Salons beschlugen. Man brachte mir noch ein Glas von dieser rosaroten Flüssigkeit, das ich, eine aufsteigende Übelkeit unterdrückend, rasch leerte … – »Und außerdem (er streichelte mir mit dem Handrücken die Wange) könnten Sie mir Ratschläge geben, mich manchmal etwas anleiten. Ich habe keine Bildung mitbekommen. (Er sprach jetzt immer leiser.) Mit vierzehn Jahren die Strafkolonie von Eysses, dann das Strafbataillon, die Ausweisung … Aber es verlangt mich nach Achtbarkeit, Sie verstehen!« Seine Augen blitzten zornig: »In Kürze werde ich Polizeipräfekt sein! Man wird mich mit Herr Präfekt anreden!« Er hämmerte mit den Fäusten auf die Balkonbrüstung: »Herr Präfekt … Herr Präfekt!« Und dann verliert sich sein Blick im Leeren.
Die Bäume unten auf dem Platz strömten Duft aus. Ich hatte Lust zu gehen, aber dazu war es nun zu spät. Er würde mich beim Handgelenk packen, und selbst wenn ich mich freimachte, müßte ich mir quer durch den Salon einen Weg durch die dichten Gruppen bahnen, müßte mich den Stichen einer Million summender Wespen aussetzen. Mir schwindelte. Große leuchtende Kreise, deren Mittelpunkt ich war, drehten sich immer schneller, und mein Herz schlug zum Zerspringen.
»Ein Unwohlsein?« Er nimmt mich beim Arm, zieht mich mit und nötigt mich, auf einem Diwan Platz zu nehmen. Die Brüder Chapochnikoff – wie viele waren es eigentlich? – eilen von allen Seiten herbei. Graf Baruzzi holte aus einer schwarzen Aktentasche ein Bündel Banknoten und zeigte es Frau Sultana. In einiger Entfernung von uns unterhielten sich Rachid von Rosenheim, Paulo Hayakawa und Odicharvi lebhaft miteinander. Da waren noch andere, die ich nicht genau ausmachen konnte. Mir kam es so vor, als ob alle diese Leute sich auf der Stelle auflösten, schuld daran waren ihre forcierte Eloquenz, ihre hektischen Gesten und die schweren Düfte, die sie verströmten. Monsieur Philibert reichte mir eine grüne Karte mit einem roten Querbalken. – »Sie stehen von jetzt an in meinem Dienst; ich habe Sie unter dem Namen ›Swing Troubadour‹ registriert.« Alle umringten mich mit hoch erhobenen Champagnergläsern. – »Auf das Wohl von Swing Troubadour!« rief Lionel de Zieff mir zu und brach in ein Lachen aus, das sein Gesicht krampfhaft verzerrte. – »Auf das Wohl von Swing Troubadour!« kreischte Baronin Lydia.
In eben diesem Moment, wenn ich mich recht erinnere, überkam mich plötzlich das Verlangen, Einspruch zu erheben. Ich sah wieder das Gesicht von Mama vor mir. Sie beugte sich wie an jedem Abend, ehe sie das Licht ausmachte, über mich und flüsterte mir ins Ohr: »Du wirst auf dem Schafott enden!« – »Auf Ihr Wohl, Swing Troubadour«, sagte leise einer der Brüder Chapochnikoff und berührte mich schüchtern an der Schulter. Die anderen umdrängten mich von allen Seiten, hefteten sich an mich wie ein Mückenschwarm.
Avenue Kléber. Esmeralda redet im Schlaf. Coco Lacour reibt sich die Augen. Es wird Zeit für sie, zu Bett zu gehen. Weder er noch sie wissen, wie zerbrechlich ihr Glück ist. Von uns dreien mache ich allein mir Sorgen.
»Es tut mir leid, mein Junge«, sagte der Khedive, »daß Sie diese Schreie gehört haben. Auch ich halte nichts von Gewaltanwendung, aber dieser Kerl verteilte Flugblätter. Das ist sehr schlimm.«
Simone Bouquereau betrachtet sich von neuem im Spiegel und erneuert ihr Make-up. Die anderen geben sich entspannt und entfalten eine Liebenswürdigkeit, die vollkommen der Umgebung angepaßt ist. Wir befinden uns sozusagen in einem bürgerlichen Salon nach dem Diner, wenn gerade die erlesenen Liköre gereicht werden.
»Ein kleiner Schluck, um Sie aufzumöbeln, mein Kleiner«, schlägt der Khedive vor.
»Die ›trüben Zeiten‹, die wir durchmachen«, bemerkt der Magier Ivanoff, »wirken auf die Frauen wie ein Aphrodisiakum.«
»Die meisten Leute dürften in diesen kargen Zeiten wohl vergessen haben, wie ein guter Cognac duftet«, spottet Lionel de Zieff. »Ihr Pech!« – »Was wollen Sie«, murmelt Ivanoff, »wenn es schon mit der Welt bergab geht … Aber Achtung, mein Freund, ich nutze das nicht aus. Bei mir ist alles von Grund auf sauber.«
»Boxcalf …« beginnt Pols de Helder von neuem.
»Ein ganzer Waggon Wolfram …« fährt Baruzzi fort.
»Und eine Vermittlungsgebühr von fünfundzwanzig Prozent …« ergänzt Jean-Farouk de Méthode.
Monsieur Philibert kommt mit ernster Miene in den Salon und geht auf den Khediven zu. – »Wir brechen in einer Vierstelstunde auf, Henri. Erstes Ziel: der Leutnant, Place du Châtelet. Dann die anderen Mitglieder der Verschwörung, jeder unter seiner Adresse. Ein schöner Fang! Der junge Mann da wird uns begleiten, nicht wahr, mein kleiner Swing Troubadour? Halten Sie sich bereit! In einer Viertelstunde!« – »Ein Schlückchen Cognac, um Ihnen Mut zu machen, Troubadour?« meint der Khedive. – »Und vergessen Sie nicht, uns die Adresse von Lamballe zu verraten«, fügt Monsieur Philibert hinzu. »Verstanden?«
Einer der Brüder Chapochnikoff – wie viele sind es eigentlich? – steht mitten im Raum, mit einer Geige am Kinn. Er räuspert sich und beginnt dann mit einer sehr schönen Baßstimme zu singen:
Nurnichtaus Liebe weinen …
Die anderen klatschen im Takt in die Hände. Der Bogen fährt ganz langsam über die Saiten, beschleunigt das Auf-und-ab, beschleunigt noch mehr … Die Musik wird immer schneller und schneller.
Die leuchtenden Kreise werden immer größer, als hätte man einen Stein ins Wasser geworfen. Anfangs haben sie sich nur um den Fuß des Geigers gedreht, und jetzt berühren sie schon die Wände des Salons.
Es gibt aufErden …
Der Sänger ringt nach Atem, man meint, er werde einen letzten Schrei ausstoßen und ersticken. Der Bogen streicht mit wachsender Geschwindigkeit über die Saiten. Werden sie denn noch lange mit ihrem Händeklatschen im Takt bleiben können?
Nicht nur den einen …
Jetzt rotiert der ganze Salon, dreht sich, und der Geiger ganz allein bildet den ruhenden Pol.
Es gibt so viele …
Als Kinder hattet ihr immer Angst in diesen Karussells, die sich immer rascher drehen und die man auch Raupenbahn nennt. Erinnert euch …
auf dieser Welt …
Ihr habt geheult, aber das nutzte nichts, die Raupe kreiste immer weiter.
Ich liebe jeden …
Dabei wolltet ihr unbedingt auf diese Raupenbahn. Warum?
der mir gefällt …
Sie stehen auf und klatschen in die Hände … der Salon dreht und dreht sich, man könnte sogar sagen, er neigt sich. Gleich werden alle das Gleichgewicht verlieren, die Vasen mit den Blumen werden auf dem Fußboden zerschellen. Der Geiger singt, seine Stimme überschlägt sich.
Es muß ja Lüge sein …
Ihr weintet, aber das nutzte nichts. Kein Mensch konnte euch im Lärm des Jahrmarktes hören.
Ich lüge auch …
Das Gesicht des Leutnants. Zehn, zwanzig andere Gesichter, die zu erkennen man keine Zeit hat. Der Salon dreht sich viel zu schnell, ganz wie damals die Raupenbahn »Sirocco« im Lunapark.
Nach fünf Minuten kreiste die Bahn so schnell, daß man nicht einmal mehr die Gesichter der am Rande Stehenden unterscheiden konnte.
Und doch erhaschte man manchmal im Vorbeisausen eine Nase, eine Hand, ein Gelächter, aufblitzende Zähne oder weit aufgerissene Augen. Die dunkelblauen Augen des Leutnants. Zehn, zwanzig andere Gesichter. Von denen, deren Adressen man soeben verraten hat und die noch diese Nacht ihrer Verhaftung entgegengehen. Zum Glück sausen sie schnell vorbei, im Takt der Musik, und man hat keine Zeit, ihre Gesichtszüge zu addieren.
Seine Stimme hetzt noch mehr, er klammert sich mit verstörtem Gesicht wie ein Schiffbrüchiger an seine Violine.
Die anderen klatschen und klatschen in die Hände, sie blasen ihre Backen auf, funkeln wild mit den Augen, gleich wird sie alle der Schlag treffen …
Das Gesicht des Leutnants. Zehn, zwanzig andere Gesichter, deren Züge man jetzt genauer erkennt. All diese Menschen werden gleich verhaftet werden. Es ist, als forderten sie von einem Rechenschaft. Ein paar Minuten lang bereut man nicht mehr, ihre Adressen weitergegeben zu haben. Vor diesen Helden, die einen aus ihren hellen Augen forschend ansehen, wäre man sogar versucht, sich laut zu seiner Rolle als Spitzel zu bekennen. Aber allmählich bröckelt der Firnis von ihrem Gesicht ab, sie verlieren ihre Arroganz, und die schöne Entschlossenheit, die sie beseelte, erlischt wie eine Kerze, die man ausbläst, einem von ihnen läuft eine Träne über die Wange. Ein anderer senkt den Kopf und blickt dich traurig an. Und noch ein anderer fixiert dich mit starrem Blick, als hätte er das nicht von dir erwartet …
Als ihr bleicher Leib im Wasser …
Ihre Gesichter kreisen und kreisen ganz langsam. Wenn sie an dir vorbeikommen, machen sie dir sanfte Vorwürfe. Dann mit jeder neuen Umdrehung verhärten sich ihre Züge, sie beachten dich nicht einmal mehr, der Ausdruck ihrer Augen und Münder zeugt von fürchterlicher Angst. Gewiß denken sie an das Schicksal, das sie erwartet. Sie sind wieder zu jenen Kindern geworden, die sich im Dunkeln fürchten und nach ihrer Mutter rufen …
Von den Bächen in die größeren Flüsse …
Du erinnerst dich all der Freundlichkeiten, die sie dir erwiesen haben. Einer las dir immer die Briefe seiner Verlobten vor …
Als ihr bleicher Leib im Wasser …
Ein anderer trug Schuhwerk aus schwarzem Leder. Und noch ein anderer wußte die Namen von allen Sternen. Gewissensbisse. Diese Gesichter werden nicht aufhören zu kreisen, und du wirst von nun an schlecht schlafen. Aber da fällt dir ein Satz ein, den der Leutnant gesagt hat: »Die mit mir verschworenen Männer sind alle fest entschlossen. Wenn es nötig ist, werden sie sterben, mit zusammengebissenen Zähnen.« Also, um so besser. Ihre Gesichter verhärten sich wieder. Die dunkelblauen Augen des Leutnants. Zehn, zwanzig andere blicken dich voller Verachtung an. Wenn sie schon in Schönheit krepieren wollen – dann meinetwegen!
In Flüssen mit vielem Aas …
Er ist verstummt. Er hat seine Geige an den Kamin gelehnt. Die anderen kommen allmählich zur Ruhe. Eine Art von Ermattung befällt sie. Sie rekeln sich auf dem Sofa und in den Sesseln. – »Sie sind ganz blaß, mein Kleiner«, murmelt der Khedive. »Nur keine Bange. Die Razzia wird ganz ordnungsgemäß verlaufen.«
Es ist angenehm, auf einem Balkon zu stehen, an der frischen Luft, und für einen Augenblick diesen Raum zu vergessen, in dem einem vom Duft der Blumen, dem Geplauder und der Musik fast schwindelig wurde. Eine Sommernacht, so still und mild, daß man glauben könnte, verliebt zu sein.
»Zugegeben, wir wirken durchaus wie eine Gangsterbande. Die Männer, deren ich mich bediene, unsere brutalen Methoden, die Tatsache, daß ich ausgerechnet Ihnen mit Ihrem süßen Jesusknabengesicht diese Spitzeltätigkeit angeboten habe – das alles spricht nicht gerade für uns, leider …«
Die Bäume auf dem Platz und der Kiosk sind in rötliches Licht getaucht. – »Und dann diese fragwürdigen Vertreter der Menschheit im Dunstkreis unserer ›Giftküche‹, wie ich unser Büro zu nennen pflege: skrupellose Geschäftemacher, Halbwelt, entlassene Polizeibeamte, Morphinisten, Nachtlokalbesitzer und schließlich alle diese Marquis, Grafen, Barone und Fürstinnen, die nicht im Gotha stehen …«
Unten längs des Gehsteiges eine Reihe von Wagen, ihre Wagen. Trübe Flecke im Dunkel der Nacht.
»All das – ich verstehe – kann einen wohlerzogenen jungen Mann schon befremden. Aber (und seine Stimme klingt etwas gereizt) wenn Sie sich heute nacht in so wenig ehrbarer Gesellschaft befinden, so ist das, weil wir, trotz Ihrer süßen Chorknaben-Visage … (fast zärtlich) allesamt vom selben Schlag sind, Monsieur.«
Das Licht des Kronleuchters brennt auf ihren Gesichtern, zerfrißt sie wie Säure. Ihre Wangen werden hohl, die Haut vertrocknet, ihre Köpfe werden wahrscheinlich die winzigen Dimensionen jener Köpfe erreichen, wie sie die Jivaro-Indianer sammeln. Bald werden von dieser ganzen Gesellschaft nur noch kleine Luftblasen übrig sein, die an der Oberfläche eines trüben Tümpels zerplatzen. Schon waten sie in einer rötlichen Brühe, die immer höher steigt und ihnen bereits bis an die Knie reicht. Sie haben nicht mehr lange zu leben.
»Man langweilt sich hier«, erklärt Lionel de Zieff.
»Höchste Zeit aufzubrechen«, sagt Monsieur Philibert. »Erste Etappe: Place du Châtelet. Der Leutnant!«
»Sie kommen mit, Kleiner?« fragt der Khedive. Draußen Verdunklung, wie gewöhnlich. Sie verteilen sich auf die Autos, wie es gerade kommt. – »Place du Châtelet!« – »Place du Châtelet!« Türenknallen. Lautes Anfahren. – »Überhol sie nicht, Eddy!« befiehlt der Khedive. »Der Anblick all dieser braven Leute gibt mir moralischen Halt.«
»Sich vorzustellen, daß wir diese nichtsnutzige Bande unterhalten!« seufzt Monsieur Philibert. – »Ein bißchen Nachsicht, Pierre. Wir machen Geschäfte mit ihnen. Es sind unsere Partner. Auf Gedeih und Verderb.«
Avenue Kléber. Sie hupen, strecken die Arme aus dem Fenster, regen sich ganz unnötig auf. Sie kommen ins Schleudern und Rutschen, die Autos stoßen leicht gegeneinander. Bei der Verdunkelung riskiert der am meisten, der den meisten Lärm macht. Champs-Élysées. Concorde. Rue de Rivoli. – »Wir kommen jetzt in ein Viertel, das mir sehr vertraut ist«, sagt der Khedive. »Die Hallen, wo ich meine ganze Jugend damit verbracht habe, Gemüsekarren abzuladen …«
Die anderen sind verschwunden. Der Khedive zündet sich mit seinem goldenen Feuerzeug eine Zigarette an. Rue de Castiglione. Zur Linken ahnt man die Säule auf der Place Vendôme. Place des Pyramides. Das Auto fährt immer langsamer, als wäre es in einen Grenzbereich gelangt. Jenseits der Rue de Louvre scheint die Stadt plötzlich dahinzuwelken.
»Wir kommen jetzt in den ›Bauch von Paris‹«, bemerkt der Khedive.
Ein zunächst unerträglicher Gestank, an den man sich aber allmählich gewöhnt, nimmt einem trotz der geschlossenen Fenster fast den Atem. Anscheinend wird in den Hallen jetzt eine Abdeckerei betrieben.
»Der Bauch von Paris«, wiederholt der Khedive.
Der Wagen gleitet über das schmierige Pflaster. Kotspritzer auf dem Kühler. Schlamm? Blut? Jedenfalls eine lauwarme Masse.
Wir überqueren den Boulevard de Sébastopol und gelangen auf einen großen freien Platz. Man hat alle Häuser ringsum abgerissen. Es stehen nur noch die nackten Mauern mit Fetzen der ehemaligen Tapeten. An deren Spuren erkennt man, wo einmal Treppen waren, Kamine, Schränke. Und die Begrenzung der Zimmer. Die Stelle, wo das Bett gestanden hat. Hier ein Heizkessel. Dort ein Waschbecken. Die einen bevorzugten Tapeten mit Blumenmuster, die anderen etwas in der Art von Jouy. Einmal glaubte ich sogar einen Farbdruck zu sehen, der noch an der Wand hing.
Place du Châtelet. Das Café Zelly's, wo der Leutnant und Saint-Georges mich um Mitternacht treffen sollen. Wie werde ich mich verhalten, wenn sie auf mich zukommen? Als wir, der Khedive, Philibert und ich, eintreten, haben die anderen schon an den Tischen Platz genommen. Sie drängen sich nun um uns. Jeder will uns als erster die Hand schütteln. Sie hängen sich an uns, umarmen uns, schütteln uns. Einige bedecken unser Gesicht mit Küssen, andere tätscheln uns im Nacken, und andere wieder streicheln liebevoll über unsere Anzugrevers. Ich erkenne Jean-Farouk de Méthode, Violette Morris und Frau Sultana. – »Wie fühlen Sie sich?« fragt mich Costachesco. Wir bahnen uns einen Weg durch das Gedränge. Die Baronin Lydia zieht mich an einen Tisch, an dem bereits Rachid von Rosenheim, Pols de Helder, der Graf Baruzzi und Lionel de Zieff sitzen. – »Etwas Cognac?« versucht mich Pols de Helder zu animieren. »Man bekommt keinen mehr in Paris, der Viertelliter kostet jetzt hunderttausend Francs. Trinken Sie!« Er zwingt mir den Flaschenhals zwischen die Zähne. Dann steckt von Rosenheim mir eine englische Zigarette in den Mund und läßt ein mit Smaragden besetztes Platinfeuerzeug aufflammen. Das Licht wird allmählich schwächer; ihre Gesten und Stimmen entfalten sich in einem sanften Halbdunkel, und plötzlich steht mit ungewöhnlicher Klarheit das Gesicht der Prinzessin de Lamballe vor mir, die ein Nationalgardist gerade im Gefängnis de la Force abholen will: »Erheben Sie sich, Madame, ich muß Sie ins Gefängnis de l'Abbaye bringen.« Und ich sehe vor mir ihre Piken und ihre gemeinen Fratzen. Warum hat sie nicht geschrien »Vive la Nation!«, wie man es von ihr verlangte? Wenn einer von ihnen mir mit seiner Pike die Stirn ritzte: Zieff? Hayakawa? Rosenheim? Philibert? der Khedive? – dieser kleine Blutstropfen würde genügen, und sie würden sich wie Haie auf mich stürzen. Nur nicht bewegen. Und so oft sie wollen »Vive la Nation!« schreien. Mich ausziehen, wenn es verlangt wird. Alles, was sie nur wollen! Bitte, noch eine Minute, Herr Scharfrichter. Um alles in der Welt. Rosenheim steckt mir wieder eine englische Zigarette in den Mund. Die letzte vor der Hinrichtung? Offenbar ist sie noch nicht für diese Nacht vorgesehen. Costachesco, Zieff, Helder und Baruzzi bezeigen mir die größte Freundlichkeit. Sie sind um meine Gesundheit besorgt. Ob ich genügend Geld bei mir habe? Ja, gewiß. Die Tatsache, daß ich ihnen den Leutnant und alle seine Mitverschwörer in die Hände gespielt habe, wird mir an die hunderttausend Francs einbringen, mit denen ich mir ein paar Schals bei Charvet und einen weichen Wollmantel für den Winter kaufen werde. Wenn sie nur nicht schon hier und jetzt ihre Rechnung mit mir begleichen. Feiglinge haben scheinbar immer einen schmachvollen Tod zu erwarten. Der Arzt sagte mir, daß jeder Mensch sich vor seinem Tode in eine Music-Box verwandelt und daß man für den Bruchteil einer Sekunde die Melodie hört, die am besten deinem Leben, deinem Charakter und deinen Bestrebungen entspricht. Bei den einen ist das ein Musette-Walzer, bei den anderen ein Militärmarsch. Wieder ein anderer spielt eine Zigeunerweise, die in einem Schluchzer oder einem Schreckensschrei endet. Bei Ihnen, mein Bürschchen, wird es der Lärm eines Mülleimers sein, den man mit einem Fußtritt durch die Nacht poltern läßt. Und eben jetzt, als wir diesen Platz auf der anderen Seite des Boulevard de Sébastopol überquerten, dachte ich: »Genau hier wird das Abenteuer deines Lebens enden.« Ich erinnere mich gut des sanft abfallenden Weges, der mich bis zu diesem Platz, einem der trostlosesten von Paris, geführt hat. Das alles fängt im Bois de Boulogne an. Erinnerst du dich? Du übst dich im Reifenspiel auf den Rasenflächen des Pré Catelan. Jahre vergehen, du gehst die Avenue Henri-Martin entlang und findest dich beim Trocadéro wieder. Dann die Place de l'Etoile. Vor dir eine von Kandelabern gesäumte Avenue. Sie erscheint dir wie ein Zukunftsbild: voll von schönen Versprechungen – wie man so sagt. Auf der Schwelle dieser königlichen Straße raubt dir die Begeisterung den Atem, aber es sind nur die Champs-Élysées mit ihren internationalen Bars, ihren Luxusweibchen und dem Claridge, jener Absteige, wo noch das Gespenst von Stavisky umgeht. Die Tristesse des Lido. Etappen wie Fouquet's und des Colisée sind äußerst bedrückend. Alles von Anfang an auf Schwindel angelegt. Die Place de la Concorde, du trägst Schuhe aus Eidechsenleder und eine Krawatte mit weißen Punkten und die süße Fratze eines Gigolo. Nach einem Umweg durch das Viertel Madeleine-Opéra, ebenso lasterhaft wie die Champs-Élysées, folgst du weiter dem dir bestimmten Plan und widmest dich unter den Arkaden der Rue de Rivoli dem, was der Arzt deine Moralische Zersetzung nennt. Continental, Meurice, Saint James und d'Albany, wo ich mich als professionelle Hotelratte betätige. Die reichen Hotelgäste lassen mich manchmal auf ihre Zimmer kommen. Im Morgengrauen durchwühle ich ihre Handtaschen und stehle ihnen einige Schmucksachen. Etwas weiter Rumpelmayer mit seinen Gerüchen nach welkem Fleisch. Die Tunten, die man nachts in den Jardins du Carrousel überfällt, um ihnen Hosenträger und Brieftasche abzunehmen. Aber plötzlich nimmt die Vision klarere Konturen an: Ich befinde mich warm und geborgen im Bauch von Paris. Wo genau verläuft da die Grenze? Man braucht nur die Rue du Louvre zu überqueren oder den Platz am Palais-Royal. Du dringst zu den Hallen vor, indem du den schmalen übelriechenden Gäßchen folgst. Der Bauch von Paris ist ein Dschungel mit Streifen von Neonlicht in allen möglichen Farben, wie ein buntes Zebra. Rings um dich umgestürzte Gemüsekarren und dunkle Gestalten, die auf Handwagen riesige Büffelhälften wegfahren. Für einen Moment tauchen fahle, grell geschminkte Gesichter auf und verschwinden dann wieder. Von nun an ist einfach alles möglich. Man wird dich für die niedrigsten Dienste rekrutieren, ehe man endgültig mit dir abrechnet. Und wenn es dir durch eine letzte List, eine letzte Niedertracht gelingt, diesem Volk von Marktweibern und Fleischern zu entkommen, wirst du etwas weiter weg, auf der anderen Seite des Boulevard de Sébastopol auf diesem freien Platz den Tod finden. In diesem Niemandsland. Der Doktor hat es vorausgesagt. Du bist jetzt am Endpunkt deiner Lebensfahrt, und es gibt kein Zurück. Zu spät. Die Züge fahren nicht mehr. Unsere Sonntagsspaziergänge auf dem inneren Stadtring, dieser ehemaligen Bahnlinie … Ihr folgend wanderten wir rund um Paris. Porte de Clignancourt. Boulevard Pereire. Porte Dauphine. Danach: Javel … Man hatte die Bahnhöfe an dieser Linie in Lagerschuppen oder Cafés umgewandelt. Manche hatte man intakt gelassen, und ich konnte mir vorstellen, daß im nächsten Moment ein Zug hier durchkommen würde, aber die große Bahnhofsuhr zeigte seit fünfzig Jahren dieselbe Stunde an. Meine besondere Liebe hat schon immer dem Gare d'Orsay gegolten, und das ging so weit, daß
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: