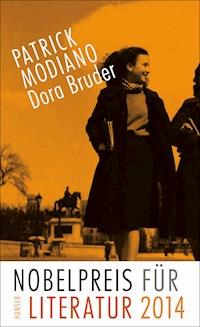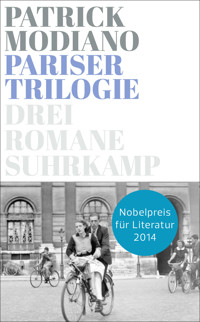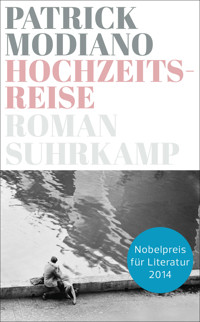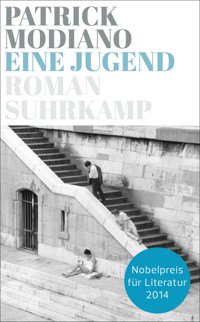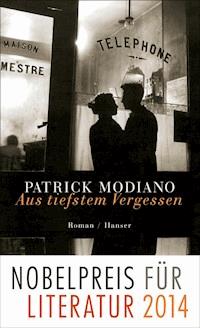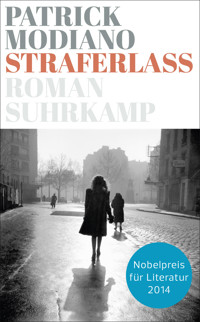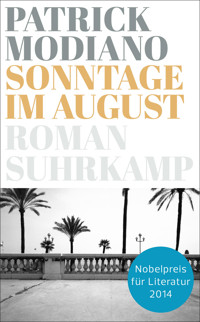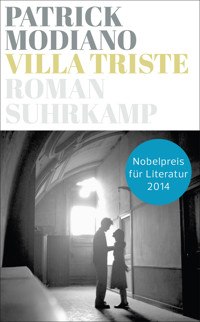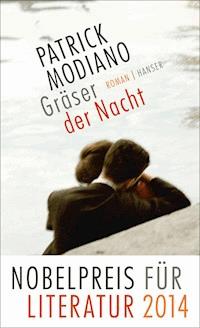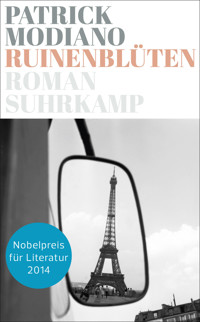7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jimmy Sarano ist Autor eines endlosen Feuilletons mit dem Titel »Die Abenteuer Ludwigs XVII.«, das eine Radiostation ins Leere sendet. Er lebt in einer namenlosen Stadt am Mittelmeer, die vom Rhythmus der Muezzinrufe und dem Sprachengewirr seiner Bewohner geprägt ist. Als er eines Tages in einem Café eine junge Frau erblickt, bahnt sich eine Kindheitserinnerung einen Weg in sein Gedächtnis. Plötzlich wird er wieder von dieser Leere heimgesucht, »wie andere Leute von Malariaanfällen«, und vor ihm scheint sein früheres Leben auf; eine verdrängte Identität, aus der er sich vor langer Zeit in einem Befreiungsschlag lösen mußte. Damals hieß er noch Jean Moreno und lebte in Paris. Damals schrieb er keine Geschichten für das Lokalradio, damals zählte er zu den Pariser Intellektuellen. In zahlreichen Erinnerungsschleifen muß sich Jean seiner Vergangenheit stellen, die er gleich einer Doppelbelichtung niemals ganz zu verdrängen vermochte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jimmy Sarano ist Autor eines endlosen Feuilletons mit dem Titel »Die Abenteuer Ludwigs XVII.«, das eine Radiostation ins Leere sendet. Er lebt in einer namenlosen Stadt am Mittelmeer, die vom Rhythmus der Muezzinrufe und dem Sprachengewirr seiner Bewohner geprägt ist. Als er eines Tages in einem Café eine junge Frau erblickt, bahnt sich eine Kindheitserinnerung einen Weg in sein Gedächtnis. Plötzlich wird er wieder von dieser Leere heimgesucht, »wie andere Leute von Malariaanfällen«, und vor ihm scheint sein früheres Leben auf; eine verdrängte Identität, aus der er sich vor langer Zeit in einem Befreiungsschlag lösen mußte. Damals hieß er noch Jean Moreno und lebte in Paris. Damals schrieb er keine Geschichten für das Lokalradio, damals zählte er zu den Pariser Intellektuellen. In zahlreichen Erinnerungsschleifen muß sich Jean seiner Vergangenheit stellen, die er gleich einer Doppelbelichtung niemals ganz zu verdrängen vermochte.
Patrick Modiano, geboren 1945 bei Paris als Sohn einer Schauspielerin und eines jüdischen Emigranten, publizierte bereits im Alter von 22 Jahren seinen ersten Roman. 1978 erhielt er für Die Gasse der dunklen Läden den Prix Goncourt. 2014 wurde Modiano der Nobelpreis verliehen.
Im Suhrkamp Verlag sind von ihm u.a. erschienen: Eine Jugend (st 4615), Villa Triste (st 4616), Die Gasse der dunklen Läden (st 4617), Pariser Trilogie (st 4618), Straferlaß (st 4619) sowie Sonntage im August (st 4620).
Patrick ModianoVorraum der Kindheit
Roman
Aus dem Französischen vonAndrea Spingler
Die Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel
Vestiaire de l'enfance
bei Gallimard.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4622
© Suhrkamp Verlag Berlin 1992
© Éditions Gallimard, 1989
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: akg-images/Paul Almasy
Umschlag: hißmann, heilmann, hamburg
FÜR ALBERT SEBAGFÜR DANIELLE
Das Leben, das ich seit einiger Zeit führe, hat mich in einen recht eigentümlichen Geisteszustand versetzt. Ich wage kaum, mein berufliches Leben zu erwähnen, das sich jetzt auf nur weniges beschränkt: das Schreiben eines endlosen Radio-Feuilletons, Die Abenteuer Ludwigs XVII. Da sich die Programme bei Radio-Mundial fast nie ändern, stelle ich mir vor, wie ich im Lauf der nächsten Jahre den Abenteuern Ludwigs XVII. immer neue Episoden hinzufüge. Soweit die Zukunft. An jenem Abend jedoch habe ich bei meiner Rückkehr vom Café Rosal das Radio eingeschaltet. Es war gerade die Zeit, als Carlos Sirvent am Mikrophon mit einem der vielfältigen Abenteuer Ludwigs XVII. begann, wie ich sie mir nach seiner Flucht aus dem Tempel ausgedacht hatte. Der Einbruch der Dunkelheit, die Stille, die Stimme Sirvents, der mein Feuilleton in spanischer Sprache las, für Hörer, die sich möglicherweise nach Tetuan, Gibraltar oder Algeciras verirrt hatten, – ein anderer Sprecher hätte es ebenso gut auf französisch, englisch oder italienisch lesen können, denn es gibt bei Radio-Mundial Sendungen in all diesen Sprachen –, die immer gedämpftere Stimme Sirvents, die von Störgeräuschen geschluckt wurde, ja, all das hat mich an jenem Abend – ganz gegen meine Gewohnheit – zum Nachdenken gebracht.
Ich werde weiter Die Abenteuer Ludwigs XVII. schreiben, so lange sie bei Radio-Mundial wollen. Sie bringen mir ein bißchen Geld ein, und ich habe auf diese Weise das Gefühl, nicht ganz untätig zu sein. Unter literarischen Gesichtspunkten ist das Ganze nichts wert, und gern würde ich zugeben, daß die spanische Übersetzung meines französischen Textes den Stil noch eintöniger macht, wäre meine gegenwärtige Sorge der Stil: hat Sirvents Sekretär, der damit beauftragt ist, diesen Ludwig XVII. nach und nach zu übersetzen, mir nicht gestanden, daß er Sätze kürzt und Wörter verändert, nicht aus Neigung zur Perfektion, sondern um so schnell wie möglich fertig zu werden? Ich weiß, daß die Hitze in den Büros von Radio-Mundial manchmal drückend ist, vor allem wenn man auf der Schreibmaschine schreibt, und ich verzeihe ihm, daß er meine Prosa nicht respektiert. Ich habe früher Bücher geschrieben, deren Machart weniger locker und von besserer Qualität war. Doch als ich an jenem Abend Carlos Sirvent zuhörte, wie er auf spanisch Die Abenteuer Ludwigs XVII. erzählte, konnte ich nicht umhin zu denken, daß dieses Thema, das ich in einem Feuilleton vertan habe, mich viel mehr berührt als irgendein anderes.
Es ist das Thema vom Überleben verschwundener Personen, die Hoffnung, eines Tages diejenigen wiederzufinden, die man in der Vergangenheit verloren hat. Das Irreparable hat nicht stattgefunden, alles wird wieder anfangen wie zuvor. »Ludwig XVII. ist nicht tot. Er ist Plantagenbesitzer in Jamaika, und wir werden Ihnen seine Geschichte erzählen.« Diesen Satz spricht Sirvent jeden Abend zu Beginn der Sendung, und man hört als Hintergrundgeräusch die Brandung des Meeres und ein paar Mundharmonikaseufzer. Er sitzt zusammengesunken vor dem Mikrophon, den Kragen seines blauen Hemds weit offen, und nützt die Intermezzi, um aus der Flasche jenes Mineralwasser zu trinken, von dem er sich nie trennt und das so schwer und unbekömmlich ist wie Quecksilber.
Man serviert es im Rosal in winzigen Karaffen. Ein Quellwasser des Hinterlands. Vorhin, am frühen Nachmittag, saß ich auf einer der Moleskinbänke des Rosal – rotes Moleskin, das mit dem dunklen Holz der Bar, der kleinen Tische und der Wände kontrastiert. Gewöhnlich ist um diese Zeit kein Gast da. Sie halten Mittagsruhe. Und die Touristen verkehren nicht im Rosal.
Als ich sie nahe dem schmiedeeisernen Gitter, das den Billardraum vom Café trennt, sitzen sah, habe ich ihre Gesichtszüge nicht gleich unterscheiden können. Das Sonnenlicht draußen ist so grell, daß man ins Dunkel eintaucht, wenn man das Rosal betritt.
Der helle Fleck ihrer Strohtasche. Und ihre nackten Arme. Ihr Gesicht hat sich aus dem Schatten gelöst. Sie war wohl nicht älter als zwanzig Jahre. Sie schenkte mir keinerlei Beachtung. Sie kramte in der neben ihr auf der Bank stehenden Tasche, und in der Stille klirrten ab und zu die Armreifen an ihren Handgelenken. Der Barmann ging auf sie zu, das Messingtablett mit einer Karaffe Wasser und einem Glas in den Händen.
Sie hat das Glas fast bis zum Rand gefüllt. Ich weiß nicht warum, ich wollte sie vor dem sehr eigentümlichen Geschmack dieses Mineralwassers warnen und vor dem unangenehmen Gefühl, das man verspürt, wenn man es zum ersten Mal schluckt, wie das Kind, das zum ersten Mal an einer Zigarette zieht. Doch sie hätte es vielleicht nicht gemocht, daß ein Unbekannter sich in etwas einmischt, was ihn nichts angeht, und ihr Ratschläge erteilt. Sie hat das Glas an die Lippen gesetzt und in einem Zug ausgetrunken, mit größter Natürlichkeit und ohne das geringste Stirnrunzeln.
Mir schien, als hätte ich ihr Gesicht schon einmal gesehen. Aber wo? Ich war im Begriff, sie anzusprechen, als eine Art Scham mich zurückhielt: ich hätte fast ihr Vater sein können. Bis zu diesem Nachmittag war mir ein solcher Gedanke noch nie in den Sinn gekommen, doch ich mußte zugeben, daß die Kinder seit einigen Jahren größer geworden sind …
Sie hat Münzen auf den Tisch gelegt, dann ist sie, ohne meine Anwesenheit bemerkt zu haben, mit geschmeidigen Schritten und klirrenden Armreifen hinausgegangen und hat mich in dem menschenleeren Café allein gelassen. Vielleicht war ich ihr schon in der Tramway begegnet, die den Hang des Vellado hinauf- oder die Küstenstraße entlangfährt? Am Strand? In der Halle von Radio-Mundial? Oder war mir dieses Gesicht unter den Touristen aufgefallen, die durch die kleinen Straßen rings um die Festung schlendern?
Ich habe die Tramway genommen, denn ich hatte nicht den Mut, in der bleiernen Sonne zu Fuß bis nach Hause zu gehen.
Auf einer Bank an der Haltestelle Vellado wartete der Chauffeur auf mich, obwohl erst früher Nachmittag war. Ich habe ihm zugewinkt, was er erwiderte, und dann ist er mir im Abstand von zehn Metern die Avenue Villadeval entlang bis zu dem Haus, in dem ich wohne, gefolgt.
So sehr ich auch meinen Schritt verlangsame, damit wir nebeneinander hergehen, er bleibt getreu den Anweisungen, die er erhalten hat, hinter mir. Er war der Chauffeur einer Amerikanerin, die ich gleich bei meiner Ankunft in dieser Stadt kennengelernt hatte und die mir zugetan war. Nach einem bewegten Liebesleben hatte sie sich in eine Villa an der Küstenstraße zurückgezogen. Sie ist inzwischen gestorben, doch sie hat in ihrem Testament verlangt, daß ihr Chauffeur als Gegenleistung für eine Rente meinen Tagesablauf überwacht und ihn jede Woche in allen Einzelheiten dem Sekretariat der Stiftung, die sie in dieser Stadt hinterlassen hat, übermittelt. Mir liegt daran, ihm die Aufgabe zu erleichtern, und ich selbst unterrichte ihn je nachdem, oft mehrere Tage im voraus, über mein Tun und Treiben. Dieser Tagesablauf ändert sich nicht: ein paar Stunden Arbeit bei Radio-Mundial, ein Nachmittag am Strand …
Er betrachtet es als seine Pflicht, mich jeden Abend an der Haltestelle der Tramway zu erwarten und mir bis zu meinem Haus zu folgen. So hat er ein ruhiges Gewissen. Manchmal trinken wir auf der Terrasse eines kleinen Cafés in der Avenue Villadeval ein Glas zusammen. Wir reden über alles und nichts.
Ich habe mich an diese Silhouette gewöhnt, die mich jeden Abend oben am Vellado erwartet. Doch das kann nicht ewig dauern. Eines Tages wird er nicht mehr da sein, um mich zu überwachen. Niemand wird mehr da sein. Ein paar Jahre werden noch vergehen, ein paar Monate noch, und das Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wird gekommen sein.
Auf einer Terrasse des gegenüberliegenden Hauses macht ein Mann seine tägliche Gymnastik. Ich kann nicht anders: auch wenn ich mein Fenster schließe oder den Kopf abwende, fällt mein Blick schließlich doch auf ihn. Fünfundzwanzig Minuten Gymnastik, zwischen halb zehn und fünf vor zehn Uhr, jeden Morgen.
Carlos Sirvent hatte diesen Mann eines Nachmittags für Radio-Mundial interviewt, und ich hatte ihrer Unterhaltung zugehört. Sie sprachen französisch – Sirvent mit spanischem Akzent und der andere mit einem fast unmerklichen Akzent, dessen Herkunft ich nicht bestimmen konnte: schweizerisch? deutsch? luxemburgisch? Er sei achtzig Jahre alt, sagte er, doch seine Stimme hinterließ einen merkwürdigen Eindruck von Zeitlosigkeit: eine Stimme ohne die geringste menschliche Schwingung; man hätte glauben können, sie funktioniere dank einer Prothese. Er hatte zahlreiche Bücher geschrieben über deutsche Musik, Colonel Lawrence, Alexander den Großen, Gärten, Mineralien und seine Reisen durch die ganze Welt. Er erklärte es Sirvent mit seiner metallischen Stimme, und dieser hatte kaum Zeit, ein Wort anzubringen oder eine Frage zu stellen.
Er ist da, auf der Terrasse. Manchmal beobachte ich ihn mit dem Fernglas. Seine Magerkeit und seine braune Haut geben ihm das Aussehen eines großen Insekts. Sein weißes Haar ist in die Stirn gekämmt und das lange knochige Gesicht aus einem matten Holz geschnitzt, gegen das eine Axt nicht ankäme.
Eines Tages lag in der Buchhandlung Edward's Stores eines seiner Werke auf dem Tisch mit den antiquarischen Büchern aus, und ich habe es für ein paar Pesos gekauft. Ein dünner Band im Schuber. Es hieß Grèce et Japon und war von 1938. Das Vorsatzblatt schmückte sein Bildnis: glattrasiertes Gesicht, schmale Lippen, braunes zurückgekämmtes Haar. Das Exemplar war mit schwarzer Tinte in gotischer Schrift einem gewissen Pedrito, »matador de toros«, gewidmet.
Ich habe in dem Buch geblättert; es war mit Fotos von griechischen Statuen und Tempeln bebildert, deren monumentaler Charakter durch die Gegenlichtaufnahmen betont wurde, und mit noch düstereren Fotos von blühenden Kirschbäumen, Soldaten und japanischen Kriegsschiffen unter einem Gewitterhimmel … Der Text war in einem heroischen und lapidaren Stil geschrieben. Später habe ich in einem verstaubten Kramladen nahe dem Hafen weitere Bücher von ihm entdeckt: La Fleur d'acier, Panthères et Scarabées, Sables africains, Engadine et Brésil, Chant funèbre pour Karl Heinz Bremer, Marbres et Cuirs, Aus dem spanischen Süden … Diese Bände waren alle dem geheimnisvollen Pedrito, »matador de toros«, gewidmet.
Er bewohnte schon vor dem Krieg seine kleine Wohnung, denn in Grèce et Japon schreibt er, daß er das Buch hier beendet habe. Ein Foto von seiner Terrasse, an deren Brüstung, mit dem Rücken zum Betrachter, ein Mann mit nacktem Oberkörper steht – vielleicht Pedrito –, schmückt Aus dem spanischen Süden.
Er führt ein zurückgezogenes Leben. Die Mahlzeiten, die ich ihn auf seiner Terrasse einnehmen sehe, sind von äußerster Kargheit. Seit einiger Zeit macht er seine Morgengymnastik in einer leuchtend roten Badehose, die mit seiner braunen Haut und seinem weißen Haar kontrastiert. Die Bewegungen der Arme und Beine werden immer langsamer, wie beim Yoga. Und die Zeit, die er damit zubringt, wird immer länger: beinahe eineinhalb Stunden inzwischen.
Es war ein Morgen, an dem ich mich fragte, ob ich nicht umziehen sollte, so lästig war mir die tägliche Gymnastik meines Nachbarn geworden. Die Tage würden einander folgen, monoton, im gleichen Rhythmus wie diese Bewegungen von Armen und Beinen.
Würde ich die Kraft haben, noch länger einige Meter von diesem Mann entfernt zu leben? Ich konnte mir noch so gut zureden und mir sagen, daß er Schriftsteller sei – »Ihr Kollege«, wie Carlos Sirvent ihn nannte … Die Lektüre seiner Werke verursachte mir ein Unbehagen, wie derjenige es empfindet, der aus Versehen die kalte Haut einer Schlange berührt. Etwas von der glattrasierten Haut, den schmalen Lippen, der Gymnastik eines alten Spartaners durchzog die Bücher, die er Pedrito gewidmet hatte.
Doch ein Wind strich sanft über die Palmen von Vellado Gardens, und meine Stimmung war plötzlich verändert. All das hatte gar keine Bedeutung. Nichts hatte Bedeutung. Ich würde bis zum Rosal hinuntergehen, um einen Kaffee zu trinken, und wenn ich mich dazu imstande fühlte, würde ich nicht die Tramway über die Küstenstraße nehmen, sondern zu Fuß bis Radio-Mundial gehen.
Ich ging auf der Schattenseite die Mesquita Street entlang. Es war elf Uhr vormittags, die Luft war ozeanisch kühl, und in meiner Tasche steckten drei Seiten, die ich Sirvent übergeben würde: eine neue Episode der Abenteuer Ludwigs XVII. Vor einiger Zeit schlug er mir vor, sie zu einem Buch zusammenzustellen und meine Arbeit einem Verleger der Stadt anzubieten. Warum nicht? Unter der Bedingung, daß das Buch in spanischer Sprache und unter dem Decknamen erscheint, den ich bei meiner Ankunft hier gewählt habe: Jimmy Sarano. So würde man nie eine Verbindung herstellen können zwischen dem, der in Paris ein paar Romane veröffentlicht hatte, und einem andalusischen Rundfunkschreiber.
Ich bin an den Schaufenstern der Cisneros Airways vorbeigekommen.
Sie war da, hinter einem Schreibtisch. Sie schrieb Schreibmaschine, und ihre Finger zögerten auf den Tasten. Zuweilen bediente sie sich nur noch der beiden Zeigefinger. Nachdem sie ein neues Blatt in die Schreibmaschine eingespannt hatte, seufzte sie müde auf und schaute hinaus auf die Straße, doch sie sah mich nicht.
Es war dasselbe Gesicht wie das, das sich im Rosal aus dem Schatten gelöst hatte.
Wenn ich vor der Scheibe stehen bliebe, würde ich ihre Aufmerksamkeit schließlich auf mich ziehen. Sie schrieb wieder auf der Maschine, doch auf noch lässigere Weise: mit einem einzigen Zeigefinger. Sie schien nur zufällig auf die Tasten zu drücken.
Um sie herum saßen noch andere Angestellte hinter kleinen Schreibtischen aus Metall. Mit aufgestützten Ellbogen warteten einige Touristen vor dem großen Schalter ganz hinten in der Halle auf ihre Flugscheine. Der Schreibtisch von ihr stand dem Fenster am nächsten.
Eine brünette Frau um die Fünfzig, das metallene Abzeichen der Cisneros Airways wie einen militärischen Orden an die Bluse geheftet, durchquerte die Halle und stellte sich hinter sie. Sie schien ihre Anwesenheit nicht bemerkt zu haben und tippte weiter mit nur einem Zeigefinger. Dann drehte sie sich jäh um. Die andere mußte ihr eine Rüge erteilt haben. Sie schlug wieder mit allen Fingern auf die Tasten, während die brünette Frau hinter ihr die Arbeit überwachte. Nach ein paar Minuten ging die Frau weg, dem Hintergrund der Halle zu. Der Angestellte, der am nächstgelegenen Schreibtisch saß, warf ihr ein ironisches Lächeln zu und beobachtete sie seinerseits. Sie spürte diesen auf sie gerichteten Blick und bemühte sich, mit zehn Fingern zu tippen.
In den folgenden Tagen sah ich ihre Gesichtszüge genau vor mir. Die Stirn und die Augen erinnerten mich wirklich an etwas.
Eines Nachmittags, als ich Carlos Sirvent wieder eine Episode der Abenteuer Ludwigs XVII. bringen mußte, bin ich erneut an den Schaufenstern der Cisneros Airways vorbeigegangen. Doch sie war nicht mehr da. Ein anderes Mädchen saß an ihrem Platz, am selben Schreibtisch. Dieses schrieb sehr schnell auf der Maschine, mit zehn Fingern. Ich habe die Stirn gegen die Scheibe gedrückt, um zu sehen, ob sie zufällig an einem anderen Schreibtisch saß oder hinter dem großen Schalter im Hintergrund der Halle stand. Nein. Ich habe die brünette Frau erkannt, die das Abzeichen der Cisneros auf der Bluse trug.
Einen Augenblick war ich versucht, mich nach ihr zu erkundigen. Das Mädchen, das ihre Nachfolge angetreten hatte, tippte immer schneller, die Finger berührten kaum die Tasten. Ja, sie war wohl entlassen worden wegen der Lässigkeit, die sie bei der Arbeit an den Tag legte. So konnte das nicht weitergehen.