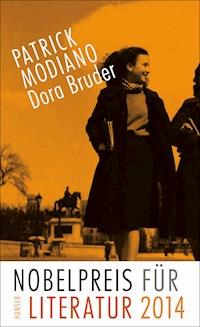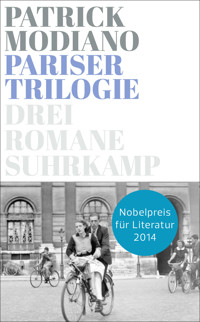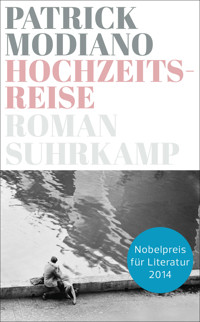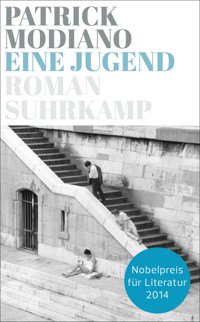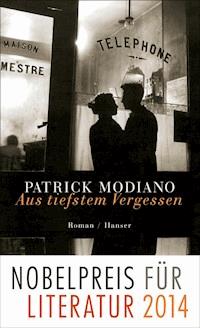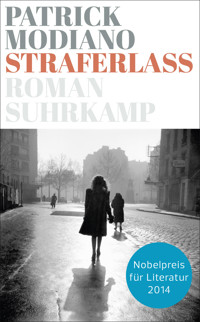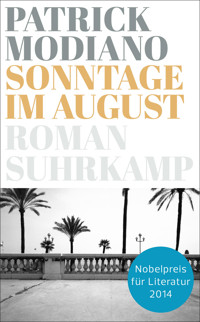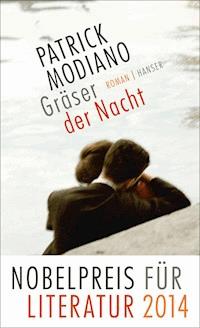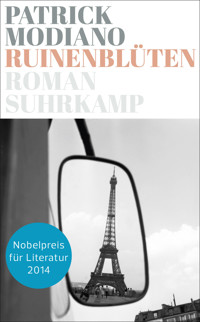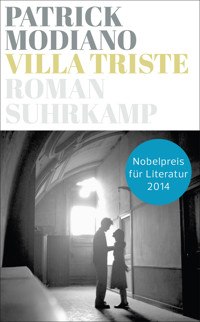
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein mondäner Badeort von sommerlichem Glanz. Ein Ort, wo die Bougainvilleen bis an die Hotelhallen vordringen, wo jedes Jahr im Sommer ein Cup für »Schönheit und Eleganz« vergeben wird, »Könige für einen Tag« gekürt werden, die Jeunesse dorée müßig von Parfüm vernebelte Tage verbringt … An diesen Ort verschlägt es den 18jährigen Victor, der in der Menge der Sommergäste auf zwei mysteriöse Personen trifft, René Meinthe und Yvonne Jacquet. Wer ist dieser Mann? Wer diese Frau, in die er sich sofort verliebt? Zwölf Jahre später, im Winter, kehrt Victor zurück. Er versucht, die Gesichter, die zarten Momente, die Stimmungen von damals wieder einzufangen. Aber die Erinnerungen sind wie ein Trugbild, und die Jugend – verloren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ein mondäner Badeort von sommerlichem Glanz. Ein Ort, wo die Bougainvilleen bis an die Hotelhallen vordringen, wo jedes Jahr im Sommer ein Cup für »Schönheit und Eleganz« vergeben wird, »Könige für einen Tag« gekürt werden, die Jeunesse dorée müßig von Parfüm vernebelte Tage verbringt … An diesen Ort verschlägt es den 18jährigen Victor, der in der Menge der Sommergäste auf zwei mysteriöse Personen trifft, René Meinthe und Yvonne Jacquet. Wer ist dieser Mann? Wer diese Frau, in die er sich sofort verliebt?
Zwölf Jahre später, im Winter, kehrt Victor zurück. Er versucht, die Gesichter, die zarten Momente, die Stimmungen von damals wieder einzufangen. Aber die Erinnerungen sind wie ein Trugbild, und die Jugend – verloren?
Patrick Modiano, geboren 1945 bei Paris als Sohn einer Schauspielerin und eines jüdischen Emigranten, publizierte bereits im Alter von 22 Jahren seinen ersten Roman. 1978 erhielt er für Die Gasse der dunklen Läden den Prix Goncourt. 2014 wurde Modiano der Nobelpreis verliehen.
Im Suhrkamp Verlag sind von ihm u. a. erschienen: Eine Jugend (st 4615), Die Gasse der dunklen Läden (st 4617), Pariser Trilogie (st 4618), Straferlaß (st 4619), Sonntage im August (st 4620) sowie Hochzeitsreise (st 4621).
Patrick ModianoVilla Triste
Roman
Aus dem Französischen vonWalter Schürenberg
Die Originalausgabe erschien 1975 unter dem TitelVilla Tristebei Gallimard.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4616
© Suhrkamp Verlag Berlin 1988
© Éditions Gallimard 1975
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: akg-images/Paul Almasy
Umschlag: hißmann, heilmann, hamburg
Wer bist du, der du nur Schatten siehst?Dylan Thomas
Für RudyFür DominiqueFür Zina
1
Das Hôtel de Verdun hat man abgerissen. Es war ein komisches Gebäude, gegenüber dem Bahnhof, mit einer Veranda ringsum, an der das Holz schon faulte. Vertreter kamen dorthin, um zwischen zwei Zügen etwas zu schlafen. Es stand im Ruf eines Absteigequartiers. Das benachbarte Café, ein Rundbau, ist ebenfalls verschwunden. Hieß es »Café des Cadrans« oder »de l'Avenir«? Zwischen dem Bahnhof und den Rasenbeeten der Place Albert-premier ist jetzt eine große Leere.
Die Rue Royale, sie hat sich nicht verändert, aber wegen des Winters und der späten Stunde hat man auf ihr den Eindruck, durch eine tote Stadt zu gehen. Schaufenster der Buchhandlung Chez Clément Marot, des Juweliers Horowitz, Deauville, Genf, Le Touquet, und der englischen Pâtisserie Fidel-Berger … Etwas weiter der Frisiersalon René Pigault. Vitrinen von Henri à la Pensée. Die meisten dieser Luxusgeschäfte sind außerhalb der Saison geschlossen. Durch die Arkaden hindurch sieht man links an ihrem Ende das rote und grüne Neonlicht vom Cintra aufstrahlen. Am Bürgersteig gegenüber, Ecke Rue Royale und Place du Pâquier, die Taverne, wo im Sommer die Jugend hinzugehen pflegte. Ob es immer noch das gleiche Stammpublikum ist?
Nichts ist mehr von dem großen Café übrig, seinen Lüstern, seinen Spiegeln und den Tischen und Sonnenschirmen bis auf die Straße hinaus. Gegen acht Uhr abends war ein Kommen und Gehen von Tisch zu Tisch. Gruppen bildeten sich. Gelächter. Blonde Haare. Gläserklingen. Strohhüte. Hier und da ein Bademantel als grellbunter Fleck. Man bereitete sich auf die Festivitäten der Nacht vor.
Unten rechts ein weißer massiger Bau: das Casino, nur von Juni bis September geöffnet. Im Winter spielen dort im Baccara-Saal die Honoratioren Bridge, und der Grillroom dient als Vereinslokal des Rotary-Clubs. Dahinter senkt sich der Park d'Albigny ganz sanft bis zum See mit seinen Trauerweiden, seinem Musikpavillon und der Landebrücke, von der man das überalterte Schiffchen nimmt, das zwischen den kleinen Ortschaften am Ufer hin und her fährt: Veyrier, Chavoire, Saint-Jorioz, Eilan-Roc, Port-Lusatz … Zuviel Aufzählung. Aber gewisse Worte muß man nun einmal immerfort leise vor sich hin singen wie ein Wiegenlied.
Man folgt der Avenue d'Albigny, die von Platanen gesäumt ist. Sie zieht sich längs des Sees hin, und wenn sie dann nach rechts abbiegt, erblickt man ein weißes Holztor: den Eingang zur Sportanlage. Zu beiden Seiten eines breiten Kiesweges mehrere Tennisplätze. Man braucht dann bloß die Augen zu schließen, um sich die lange Reihe der Badekabinen und den Sandstrand vorzustellen, der sich fast dreihundert Meter weit erstreckt. Im Hintergrund ein englischer Garten rund um die Bar und das Sportrestaurant, die in einer ehemaligen Orangerie untergebracht sind. Das alles gehörte um 1900 dem Automobilbauer Gordon-Gramme.
Auf der Höhe der Sportanlage, an der anderen Seite der Avenue d'Albigny beginnt der Boulevard Carabacel. Er steigt in Windungen bis zu den Hotels Hermitage, Windsor und Alhambra, aber man kann ebenso gut die Bergbahn nehmen. Im Sommer verkehrt sie bis Mitternacht; man wartet auf sie in einem kleinen Bahnhof, der von außen wie ein Chalet aussieht. Die Vegetation ist hier bunt gemischt, und man weiß nicht mehr, ob man sich in den Alpen oder an der Mittelmeerküste oder sogar in den Tropen befindet. Schirmpinien. Mimosen. Tannen. Palmen. Wenn man dem Boulevard weiter am Berghang folgt, entdeckt man das Panorama: den See im ganzen, die Bergkette der Aravis und auf der anderen Seite des Wassers jenes zurückweichende Land, das man die Schweiz nennt.
Das Hermitage und das Windsor bieten nur noch Unterkunft in möblierten Zimmern. Man hat jedoch versäumt, die Windfangtür des Windsor und den gläsernen Anbau an der Halle des Hermitage zu entfernen. Erinnert euch: die Bougainvilleen drangen bis in die Halle vor. Das Windsor stammte aus den Jahren um 1910, und seine weiße Fassade bot den gleichen baiserartigen Anblick wie die des Ruhl und des Negresco in Nizza. Das Hermitage mit seinem Ocker wirkte nüchterner und vornehmer, es glich dem Hôtel Royal in Deauville. Ja, wie eine Zwillingsschwester. Sind sie wirklich zu Appartements umgebaut? Kein einziges Fenster erleuchtet. Man müßte den Mut haben, die dunkle Halle zu durchschreiten und die Treppe hinaufzugehen. Dann würde man vielleicht feststellen, daß hier niemand wohnt.
Das Alhambra jedoch ist dem Erdboden gleichgemacht. Von den Gartenanlagen, die es umgaben, keine Spur. Gewiß wird man auf dem Grundstück ein modernes Hotel errichten. Noch eine kleine Gedächtnisstütze: im Sommer kamen die Gärten von Hermitage, Windsor und Alhambra dem Bild sehr nahe, das man sich vom Verlorenen Paradies oder vom Gelobten Lande macht. Aber in welchem der drei Gärten gab es dieses immense Parterre von Dahlien und diese Balustrade, wo man sich aufstützte, um den See dort unten zu betrachten? Ganz gleich. Wir werden ohnehin die letzten Zeugen einer vergangenen Welt gewesen sein.
Es ist sehr spät und Winter. Man kann kaum die verschwommenen Lichter der Schweiz am anderen Ufer des Sees ausmachen. Von der üppigen Vegetation des Carabacel sind nur ein paar abgestorbene Bäume und verkümmerte Sträucher übrig. Die Fassaden des Windsor und des Hermitage sind schwarz und wie verkohlt. Die Stadt hat ihren internationalen sommerlichen Glanz eingebüßt. Sie ist auf die Maße eines Hauptorts im Département geschrumpft. Eine kleine Stadt, die tief in der französischen Provinz versteckt liegt. Der Notar und der Unterpräfekt spielen in dem zweckentfremdeten Casino Bridge. Ebenso Madame Pigault, die Direktrice des Frisiersalons, eine blonde Vierzigerin, die sich mit »Shocking« parfümiert. Neben ihr der junge Fournier, dessen Familie drei Textilfabriken in Faverges besitzt, und Servoz vom pharmazeutischen Labor in Chambéry, ein hervorragender Golfspieler. Madame Servoz, die so brünett wie Madame Pigault blond ist, scheint unablässig am Steuer eines BMWzwischen Genf und ihrer Villa in Chavoire hin- und herzu- pendeln und hat eine große Schwäche für junge Männer. Man sieht sie häufig mit Pimpin Lavorel. Und wir könnten noch tausend andere, ebenso verblüffende Details vom Alltag dieser kleinen Stadt anführen, denn Dinge und Menschen haben sich in zwölf Jahren gewiß nicht verändert.
Die Cafés sind geschlossen. Ein rosa Licht schimmert durch die Tür vom Cintra. Sollen wir hineingehen, um festzustellen, ob die Mahagonitäfelung noch dieselbe ist, ob die Lampe mit dem schottisch gemusterten Schirm noch an ihrem Platz steht: links neben der Bar? Sie haben die Fotos von Emile Allais, aufgenommen in Engelberg, als er die Weltmeisterschaft gewann, nicht entfernt. Auch nicht die von James Couttet. Noch das Foto von Daniel Hendrickx. Sie alle sind über dem Bord mit den Apéritifs aufgereiht. Natürlich sind sie vergilbt. Und dort im Halbdunkel der einzige Gast, ein apoplektischer Mann in einem karierten Jackett, der zerstreut das Mädchen an der Bar tätschelt. Sie war zu Anfang der sechziger Jahre eine pikante Schönheit, aber seitdem ist sie fülliger geworden.
In der verlassenen Rue Sommeiller hört man seine eigenen Schritte. Zur Linken das Cinéma le Régent ist sich treu geblieben: immer noch dieser orangefarbene Verputz und die Buchstaben Le Régent in englischen Versalien, granatrot. Immerhin haben sie die hölzernen Fauteuils und die Bilder der Filmstars, die das Vestibül zierten, auswechseln müssen. Der Bahnhofsplatz ist der einzige Ort der Stadt, wo ein paar Laternen brennen und etwas Leben herrscht. Der Schnellzug nach Paris kommt um null Uhr sechs durch. Die Urlauber der Kaserne Berthollet finden sich in kleinen, übermütig lauten Gruppen ein, ihre Koffer aus Aluminium oder Pappmaché in der Hand. Einige singen Mon Beau Sapin: zweifellos wegen des bevorstehenden Weihnachtsfestes, Auf Bahnsteig 2 drängen sie sich zusammen, versetzen einander Rippenstöße. Man könnte meinen, sie gingen an die Front. Zwischen all diesen Militärmänteln ein Zivilanzug in Beige. Der Mann, der ihn trägt, scheint unter der Kälte nicht zu leiden; er hat einen grünen Seidenschal um den Hals, den er mit nervösem Griff zusammenhält. Er geht von einer Gruppe zur anderen, wendet den Kopf mit scheuem Blick von links nach rechts, als suche er inmitten dieses Haufens nach einem Gesicht. Er hat sogar einen Soldaten gefragt, aber der und seine beiden Kameraden sehen ihn nur von Kopf bis Fuß spöttisch an. Andere Urlauber haben sich umgewandt und pfeifen hinter ihm her. Er scheint das überhaupt nicht zu bemerken und kaut auf seiner Zigarettenspitze. Jetzt befindet er sich abseits, in Gesellschaft eines jungen hellblonden Gebirgsjägers. Der fühlt sich anscheinend geniert und blickt von Zeit zu Zeit verlegen zu seinen Kameraden hinüber. Der andere stützt sich auf seine Schulter und flüstert ihm irgend etwas ins Ohr. Der junge Gebirgsjäger versucht, von ihm loszukommen. Darauf schiebt ihm jener einen Umschlag in die Manteltasche, sieht ihn wortlos an und schlägt, da es zu schneien anfängt, den Kragen seiner Jacke hoch.
Dieser Mann heißt René Meinthe. Er führt plötzlich die linke Hand an die Stirn, wie um den Blick abzuschirmen, eine ihm seit zwölf Jahren eigentümliche Geste. Wie ist er doch gealtert …
Der Zug ist in den Bahnhof eingelaufen. Sie besteigen ihn im Sturm, stoßen sich in den Gängen, lassen die Fenster herunter, reichen einander Gepäck hinauf. Manche singen: Ce n'est qu'un au revoir …, aber die meisten ziehen es vor zu brüllen: Mon Beau Sapin … Es schneit jetzt stärker. Meinthe steht sehr aufrecht, reglos, mit der Hand die Augen abschirmend. Der junge Blondkopf hinter der Fensterscheibe betrachtet ihn, ein boshaftes Lächeln in den Mundwinkeln. Er faßt an seine Gebirgsjägermütze. Meinthe macht ihm ein Zeichen. Die Waggons mit ihren Trauben singender und gestikulierender Soldaten gleiten vorbei.
Er hat die Hände in die Taschen seiner Jacke gesteckt und wendet sich dem Bahnhofsbuffet zu. Die beiden Kellner haben die Tische zusammengerückt und sind mit lässigen, weit ausholenden Armbewegungen beim Ausfegen. An der Theke räumt ein Mann im Regenmantel die letzten Gläser fort. Meinthe bestellt einen Cognac. Der Mann erwidert ihm in barschem Ton, daß nichts mehr ausgeschenkt wird. Meinthe bestellt noch mal einen Cognac. »Tunten«, erwidert der Mann, »Tunten werden hier nicht bedient.«
Die beiden anderen im Hintergrund brechen in Gelächter aus. Meinthe rührt sich nicht, er blickt starr auf einen Punkt, er wirkt erschöpft. Der eine Kellner hat die Wandleuchter zur Linken ausgeknipst. Nur um die Bar bleibt noch ein gelblicher Lichtschein. Sie warten mit verschränkten Armen. Werden sie ihm die Visage einschlagen? Doch wer weiß? Vielleicht wird Meinthe mit der Faust auf die schmutzige Theke schlagen und ihnen hinschleudern: »Ich bin Königin Astrid, die Königin der Belgier!«, mit seinem Hüftschwung und seinem Lächeln von damals.
2
Was machte ich mit achtzehn Jahren am Ufer dieses Sees in diesem berühmten Badeort? Nichts. Ich wohnte in einer Familienpension, »Zu den Linden«, Boulevard Carabacel. Ich hätte ein Zimmer im Ort nehmen können, aber ich zog es vor, hier oben zu wohnen, zwei Schritt vom Windsor, vom Hermitage und Alhambra entfernt, in deren Luxus und Gärten ich mich sicherer fühlte.
Denn ich kam um vor Angst, ein Gefühl, das mich seitdem nie mehr verlassen hat: es war zu jener Zeit noch viel lebhafter und viel weniger begründet. Ich hatte mich aus Paris davongemacht, weil mir diese Stadt immer gefährlicher zu werden schien. Es herrschte dort unangenehme Polizeiatmosphäre. Viel zu viele Razzias für meinen Geschmack. Bombenexplosionen. Ich würde gern eine präzise Zeitangabe machen, und dafür sind Kriege die besten Anhaltspunkte, aber um welchen Krieg genau handelte es sich? Um den, der sich nach Algerien benannte, zu Anfang der sechziger Jahre, die Zeit, da man noch mit dem Cabriolet Floride umherfuhr und die Frauen sich schlecht anzogen. Die Männer auch. Ich jedenfalls hatte Angst, und ich hatte diesen Zufluchtsort gewählt, weil er nur fünf Kilometer von der Schweiz entfernt ist. Beim geringsten Alarmzeichen brauchte man nur den See zu überqueren. In meiner Naivität glaubte ich, je näher man der Schweiz wäre, um so mehr Chancen hätte man, sich dorthin abzusetzen. Aber ich wußte noch nicht, daß es die Schweiz gar nicht gibt.
Die »Saison« hatte am 15. Juni begonnen. Die Gala-Abende und Festveranstaltungen würden nicht abreißen. »Dîner des Ambassadeurs« im Casino, Gesangstournee von Georges Ulmer. Drei Vorstellungen von Ecoutez bien Messieurs. Feuerwerk am 14. Juli in der Bucht von Chavoire, Ballette des Marquis de Cuevas und noch anderes, das mir wieder einfallen würde, wenn ich das von der Kurverwaltung herausgegebene Programm zur Hand hätte. Ich habe es aufgehoben und bin sicher, es zwischen den Seiten eines der Bücher wiederzufinden, die ich in jenem Jahr las. In welchem? Das Wetter war »phantastisch«, und die Stammgäste rechneten mit Sonne bis in den Oktober.
Ich ging nur sehr selten zum Baden. Im allgemeinen verbrachte ich meine Tage in der Halle und in den Gärten des Windsor und bildete mir schließlich ein, daß ich dort wenigstens nichts riskierte. Wenn die Panik mich ergriff – eine allmählich sich entfaltende Blume etwas oberhalb des Nabels –, blickte ich geradeaus, auf die andere Seite des Sees. Von den Gärten des Windsor sah man drüben ein kleines Dorf. Kaum fünf Kilometer Luftlinie. Diese Strecke ließ sich leicht schwimmend zurücklegen. Bei Nacht mit einem kleinen Motorboot brauchte man dazu nur zwanzig Minuten. Aber ja. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Jede Silbe betonend, flüsterte ich vor mich hin: »Bei Nacht mit einem kleinen Motorboot …« Alles ließ sich besser an, ich nahm die Lektüre meines Romanes oder eines harmlosen Magazins wieder auf (ich hatte mir verboten, Zeitungen zu lesen oder die Nachrichten im Radio zu hören, und jedesmal wenn ich ins Kino ging, achtete ich darauf, erst nach der Wochenschau zu kommen). Nein, vor allem: nichts wissen, was in der Welt vorging. Nicht diese Angst noch verschlimmern, dieses Gefühl einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe. Sich nur für harmlose Dinge interessieren: Mode, Literatur, Film, Cabaret. Sich auf den bequemen Liegestühlen ausstrecken, die Augen schließen, sich entspannen, vor allem: sich entspannen. Vergessen. Nicht wahr?
Am späten Nachmittag ging ich hinunter in den Ort. Auf der Avenue d'Albigny setzte ich mich auf eine Bank und schaute dem Treiben am Seeufer zu, den kleinen Segelbooten und den Treträdern. Das munterte auf. Von oben schützte mich das Laubwerk der Platanen. Mit langsamen, vorsichtigen Schritten verfolgte ich meinen Weg. An der Place du Pâquier auf der Terrasse der Taverne wählte ich immer einen Tisch im Hintergrund und bestellte jedesmal einen Campari Soda. Ich betrachtete rings um mich diese Jugend, zu der ja übrigens auch ich gehörte. Es wurden immer mehr, je weiter die Stunde vorrückte. Ich höre noch ihr Gelächter, sehe noch ihr weit in die Stirn fallendes gewelltes Haar. Die Mädchen trugen Seeräuberhosen und Shorts aus Vichy-Karo. Die Jungen gefielen sich im Blazer mit aufgesticktem Wappen und offenem Hemdkragen über einem seidenen Halstuch. Sie trugen einen kurzen Haarschnitt, den man damals »Rond-Point« nannte. Sie planten ihre Surprise-Parties. Dazu erschienen die Mädchen in sehr weiten, in der Taille enggerafften Gewändern und auf Tanzschühchen. Eine brave romantische Jugend, die man alsbald nach Algerien verfrachten würde. Aber mich nicht.
Um acht Uhr kehrte ich in die »Linden« zurück. Diese Familienpension, die, von außen gesehen, an ein Jagdschlößchen erinnerte, beherbergte jeden Sommer an die zehn Dauergäste. Sie hatten alle die Sechzig überschritten, und meine Gegenwart wirkte auf sie zunächst aufreizend. Aber ich benahm mich möglichst unauffällig. Durch äußerst sparsame Gesten, einen absichtlich teilnahmslosen Blick, eine starre Miene – so wenig wie möglich mit den Lidern zucken – bemühte ich mich, eine an sich schon prekäre Situation nicht noch zu erschweren. Sie haben meinen guten Willen registriert, und ich glaube, daß sie mich am Ende doch in einem günstigeren Licht sahen.
Die Mahlzeiten nahmen wir in einem Speisesaal in savoyischem Stil ein. Ich hätte mit meinen nächsten Nachbarn, einem alten soignierten Ehepaar aus Paris, Konversation machen können, aber gewissen Anzeichen glaubte ich entnehmen zu können, daß der Mann ein ehemaliger Polizeiinspektor war. Die anderen speisten paarweise, bis auf einen Herrn mit gepflegtem Schnurrbart und dem Kopf eines Spaniels, der den Eindruck machte, als sei er hierhin abgeschoben worden. Durch das Geräusch der Unterhaltungen hindurch hörte ich in manchen Augenblicken kurze Rülpser, die wie Hundegebell klangen. Die Pensionsgäste gingen in den Salon hinüber und ließen sich seufzend auf den mit Cretonne bezogenen Sesseln nieder. Madame Buffaz, die Eigentümerin der »Linden«, brachte ihnen einen Tee oder irgendeinen Verdauungssaft. Die Frauen blieben unter sich. Die Männer begannen eine Partie Canasta. Der Herr mit dem Hundekopf, etwas abseits sitzend, verfolgte das Spiel, nachdem er sich trübselig eine Havanna angezündet hatte.
Und ich, ich wäre gern bei ihnen geblieben in dem sanften, beruhigenden Licht der mit lachsrosa Seide abgeschirmten Lampen, aber ich hätte mich unterhalten oder Canasta spielen müssen. Oder hätten sie auch akzeptiert, daß ich einfach da war, nichts sagte und sie nur betrachtete? Ich ging wiederum in den Ort hinunter. Pünktlich um neun Uhr fünfzehn – eben nach der Wochenschau – betrat ich den Kinosaal des Régent oder auch das Cinéma du Casino, das eleganter und besser ausgestattet war. Ich habe noch ein Programm des Régent aus jenem Sommer gefunden.
cinéma le régent
15. bis 23. Juni Tendre et violente Elisabeth von H. Decoin.
24. bis 30. Juni L'Année dernière à Marienbad von A. Resnais.
1. bis 8. Juli R. P. Z. appelle Berlin von R. Habib.
9. bis 16. Juli Le Testament d'Orphée von J. Cocteau.
17. bis 24. Juli Le Capitaine Fracasse von P. Gaspard-Huit.
25. Juli bis 2. August Qui êtes-vous, M. Sorge von Y. Ciampi.
3. bis 10. August La Nuit von M. Antonioni.
11. bis 18. August Le Monde de Suzie Wong.
19. bis 26. August Le Cercle vicieux von M. Pecas.
27. August bis 3. September Le Bois des Amants von C. Autant-Lara.
Ich würde gern einige Passagen aus diesen alten Filmen noch einmal sehen.
Nach dem Kino ging ich wieder auf einen Campari in die Taverne. Sie war jetzt von den jungen Leuten verlassen. Mitternacht. Wahrscheinlich tanzten sie irgendwo. Ich betrachtete all diese Stühle, diese leeren Tische und die Kellner, die die Sonnenschirme hineintrugen. Ich faßte die große Leuchtfontäne auf der anderen Seite des Platzes vor dem Eingang zum Casino ins Auge. Sie änderte ständig die Farbe. Ich amüsierte mich damit zu zählen, wievielmal sie nach Grün hinüberwechselte. Ein Zeitvertreib wie jeder andere, nicht wahr? Einmal, zweimal, dreimal. Wenn ich die Zahl 53 erreicht hatte, erhob ich mich, aber meistens machte ich mir nicht einmal die Mühe, dieses Spielchen zu spielen. Ich träumte vor mich hin, während ich mechanisch in kleinen Schlucken trank. Erinnern Sie sich an Lissabon während des Krieges? All diese gestrandeten Existenzen in den Bars und in der Halle des Hotels Aviz, mit ihrem Handgepäck und ihren Kabinenkoffern, die auf ein Schiff warteten, das nicht kommen würde? Nun, ich hier, zwanzig Jahre danach, kam mir wie einer von ihnen vor.
Die seltenen Male, da ich meinen Flanellanzug und meine einzige Krawatte trug (eine nachtblaue Krawatte mit einem Lilien-Streumuster, die mir ein Amerikaner geschenkt hatte und auf deren Unterseite die Worte »International Bar Fly« eingestickt waren. Ich erfuhr später, daß es sich dabei um einen Geheimbund von Alkoholikern handelte. An dieser Krawatte erkannten sie sich und konnten einander kleine Gefälligkeiten erweisen), dann also fiel es mir zuweilen ein, ins Casino zu gehen und für einige Minuten auf der Schwelle des Saals Brummel den Tanzenden zuzusehen. Sie waren im Alter zwischen dreißig und sechzig, und manchmal bemerkte man ein noch jüngeres Mädchen in der Gesellschaft eines guterhaltenen, schlanken Fünfzigers. Ein internationales Stammpublikum von leidlichem »Schick«, das sich zu italienischen Modeschlagern oder zu den Rhythmen des Calypso, jenes Tanzes aus Jamaika, bewegte. Danach ging ich wohl hinauf zu den Spielsälen. Dort konnte man oft sehr hohe Einsätze erleben. Die protzigsten Spieler kamen aus der nahe gelegenen Schweiz. Ich erinnere mich noch an einen besonders hartnäckigen Ägypter. Er hatte fuchsrotes glänzendes Haar, Gazellenaugen und einen Schnurrbart, der eher zu einem englischen Major gepaßt hätte und den er nachdenklich mit dem Zeigefinger streichelte. Er spielte mit Chips über fünf Millionen Francs, und es hieß, er sei ein Vetter von König Faruk.
Ich war erleichtert, wenn ich wieder an der frischen Luft war. Ich ging durch die Avenue d'Albigny langsam auf Carabacel zu. Nie wieder habe ich solche wundervollen klaren Nächte erlebt wie in jener Zeit. Von den Lichtern der Villen am See ging ein Funkeln aus, das einen fast blendete und das mir wie etwas Musikalisches vorkam, wie ein Saxophon- oder Trompetensolo. Auch nahm ich ganz leicht, ganz unkörperlich das Rauschen der Platanen an der Avenue wahr. Auf einer eisernen Bank in dem chalet-artigen Bahnhof wartete ich auf die letzte Bergbahn. Der Raum war nur noch durch eine Notlampe erleuchtet; ich ließ mich mit einem Gefühl völliger Geborgenheit in dieses veilchenblaue Halbdunkel gleiten. Um bis in diese Ferien-Oase zu dringen, müßte der Lärm der Kriege, das Getümmel der Welt eine dicke Mauer aus Watte durchbrechen. Und wer käme schon auf die Idee, mich unter diesen vornehmen Sommergästen zu suchen?
Auf der ersten Station stieg ich aus: Saint-Charles-Carabacel, und das Bähnchen fuhr weiter bergauf, leer. Es glich einem großen Leuchtwurm.
In der Lindenpension ging ich auf Zehenspitzen über den Flur, nachdem ich meine Wildlederschuhe ausgezogen hatte, denn alte Menschen haben einen leichten Schlaf.
3
Sie saß in der Halle des Hotels Hermitage auf einem der großen Sofas an der Rückwand und hielt den Blick ständig auf die Windfangtür gerichtet, als warte sie auf jemand. Ich nahm einen Sessel, zwei oder drei Meter von ihr entfernt, und sah sie so im Profil.
Rotbraune Haare. Kleid aus grüner Shatungseide und Schuhe mit Pfennigabsätzen, wie die Frauen sie damals trugen. Weiß.
Ein Hund lag zu ihren Füßen. Er gähnte und streckte sich von Zeit zu Zeit. Eine riesige deutsche Dogge, lymphatisch, schwarz und weiß gefleckt. Grün, Rot, Weiß, Schwarz. Diese Farbkombination lullte mich sozusagen ein. Wie habe ich es nur fertiggebracht, plötzlich neben ihr auf dem Sofa zu sitzen? Hat etwa der Hund als Kuppler gedient, indem er mit seinem trägen Gang herbeikam, um mich zu beschnuppern?
Ich stellte fest, daß sie grüne Augen hatte und ganz leichte Sommersprossen und daß sie ein wenig älter war als ich.
An jenem Morgen sind wir in den Gärten des Hotels promeniert. Der Hund ging vor uns her. Wir folgten einer Allee, die von einem Gewölbe aus blauen und malvenfarbenen Klematis überdacht war. Ich bog die Blätter und Blütentrauben des Goldregens auseinander; wir gingen an Rasenflächen und Ligustersträuchern vorbei. Da waren – wenn ich mich recht erinnere – Steingewächse, die wie bereift aussahen, rosa Hagedorn, eine Treppe mit leeren Wasserbecken zu beiden Seiten. Und darunter hingebreitet das Parterre der gelben, roten und weißen Dahlien. Wir haben uns über die Balustrade gebeugt und den See dort unten betrachtet.
Ich habe niemals genau in Erfahrung bringen können, was sie im Lauf dieser ersten Begegnung von mir dachte. Vielleicht hatte sie mich für den Sproß einer Milliardärsfamilie gehalten, der sich langweilte. Amüsiert hatte sie jedenfalls das Monokel, das ich zum Lesen im rechten Auge trug, nicht wie ein Dandy oder ein Angeber, sondern weil ich mit diesem Auge viel schlechter sah als mit dem anderen.
Wir reden nicht. Ich höre das Plätschern eines Rasensprengers, der auf der nächsten Rasenfläche rotiert. Jemand kommt die Treppe herunter zu uns, ein Mann, dessen blaßgelben Anzug ich schon von ferne gesehen habe. Er begrüßt uns mit einer Handbewegung. Er trägt eine Sonnenbrille und wischt sich die Stirn. Sie stellte ihn mir unter dem Namen René Meinthe vor. Er berichtigt sogleich: »Doktor Meinthe«, wobei er die beiden Silben des Worts Doktor betont. Und er setzt ein gezwungenes Lächeln auf. Auch ich muß mich nun vorstellen: Victor Chmara. Das ist der Name, den ich gewählt habe, um meine Anmeldung in der Lindenpension auszufüllen.
»Sind Sie ein Freund von Yvonne?«
Sie antwortete ihm, daß sie soeben erst in der Halle vom Hermitage meine Bekanntschaft gemacht hat und daß ich zum Lesen ein Monokel trage. Das findet er entschieden komisch. Sie bittet mich, mein Monokel aufzusetzen, um es Doktor Meinthe vorzuführen, Ich tue es. »Sehr gut«, sagt Meinthe und schüttelt dabei nachdenklich den Kopf.