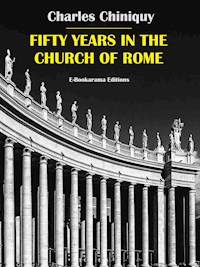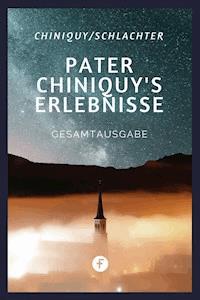
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Was Pater Chiniquy (1807-1899) aus seinem Leben und Dienst zu erzählen weiß, grenzt fast ans Unglaubliche. Ist dieses Buch nicht zeitlos unüberlebbar und für die heutigen Tendenzen aktueller denn je? Erfüllen sich darin nicht die nahezu prophetischen Worte des ehrwürdigen Präsidenten Abraham Lincoln, welche er zu Chiniquy sprach? Wann hat sich die katholische Kirche Roms jemals über ihre Intrigen und Gräueltaten der Inquisition Buße getan oder ihre gottlosen heidnischen Bräuche aufgegeben? Sprachen die Reformatoren unrecht, als die römische Kirche als antichristlich bezeichneten? Hat Rom außer dem Namen etwas mit Jesus Christus gemeinsam? Das bringt manchen zum Denken und zur Korrektur. Können Chiniquiy's Erlebnisse heute nicht unvermindert beobachtet werden in Politik, Literatur, Film, Presse, Radio, Fernsehen und im Privatleben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 713
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pater Chiniquy’s Erlebnisse – Gesamtausgabe
50 Jahre in der Kirche Roms40 Jahre in der Kirche Christi
Charles Chiniquy, nach dessen eigenen Mitteilungenzusammengestellt und übersetzt vonFranz Eugen Schlachter
Impressum
© 2. Auflage 2018 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Pater Chiniquy
Übersetzer: Franz Eugen Schlachter
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-110-7
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Folgen Verlag erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
Folgen Verlag, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen aus dem Folgen Verlag und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de/newsletter
Autor
Pater Charles Chiniquy (* 30. Juli 1809 in Kamouraska, Kanada; † 16. Januar 1899 in Montreal) war ein Gemeindeleiter, ursprünglich römisch-katholischer Priester, später überkonfessioneller Prediger.
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Autor
Band 1 50 Jahre in der Kirche Roms
Vorwort
Die Bibel und der römische Priester
Das Fegefeuer und die Kuh der armen Witwe
Der Geburtstag des Priesters
Die Vorbereitung zur ersten Kommunion
Mein Vikariat in St. Charles
Die Verbrennung des »Kanadier«
Die Theologie der Kirche Roms; ihr antisozialer und antichristlicher Charakter
Der große Kummer von Bischof Plessis
Bußübungen
Die Cholera in Quebec
Vom Messenhandel
Der »Drei-Messen-Verein«
Der Bischof von Montreal
Die Hostie in der Westentasche
Wie ich zum Temperenzapostel wurde
Ein Opfer der Trinksitten
Wie man Protestanten zur katholischen Kirche bekehrt
Die reuigen Diebe
Ein doppelt begnadigter Verbrecher
Zum Pfarrer von Beauport ernannt
Der erste Sonntag in Beauport
Gottes Hand in der Gründung der Temperenzgesellschaft von Beauport
Der Widerstand der Priester gebrochen
Der besiegte Bischof
Roms Gott, von einer Ratte gefressen
Wie ich Schulhäuser baute
Meine Versetzung nach Kamuraska
Ein doppelter Sieg
Die enttäuschten Rumhändler
Ich gehe ins Kloster
Unter den Oblaten der »Unbefleckten«
Der Temperenzapostel von Kanada
Wie mein Glaube an die Jungfrau Maria erschüttert ward
Mein Gespräch mit dem Bischof über die Marienverehrung
Das Ferkel des armen Mannes
Wie der Bischof von Detroit die Temperenz verstand
Großartige Pläne
Warum eine reiche Witwe ins Kloster gehen soll
Die Rache des Bischofs
Wie ich den Bischof zum Widerruf zwang
Gründung der Kolonie St. Anna in Illinois
Der Skandal in Bourbonnais
Die geistlichen Brandstifter
Vom Regen in die Traufe
Der Räuber im Bischofsgewand
Eine Priesterversammlung
Der Bischof gegen die Bibel
Der Bischof als Kirchenräuber
Abraham Lincoln wird mein Verteidiger
Vor dem Gerichtshof von Urbana
Versetzung oder Absetzung?
Die Exkommunikationskomödie
Als die Not am größten -
– war Gottes Hilfe am nächsten!
Abraham Lincoln, ein rechter Gottesmann und Bekenner des Evangeliums
Ich soll mich unterwerfen
Wie meine Unterwerfung verhindert ward
Papst Pius IX. und Napoleon III. entscheiden zu meinen Gunsten
Wie Gott mich aus den Banden des Papsttums erlöste
Wie Christus mir Sein Heil offenbarte
Meine Gemeinde entscheidet sich
Wie wir die Götzenbilder los wurden und dem Fegefeuer entkamen
Rom macht einen letzten Versuch
Unser Anschluss an die protestantische Kirche
Reisen und Gefahren
Welche Verfolgungen ich erfuhr - und aus allen hat mich der Herr errettet!
Getreu bis in den Tod
Band 2 40 JAHRE IN DER KIRCHE CHRISTI
Einleitung
Die Versuchung
Die Hungersnot
Manna vom Himmel
Bezahlte Schulden
Neue Arbeiter für den Weinberg des Herrn
Ein mazedonischer Ruf von Kanada
Vier Tage in Montreal
Wie der Priester von Napierville Reklame für mich macht
Den Dolch auf der Brust
Pistolenheld
Abraham Lincoln will mich zu seinem Gesandten machen
Abraham Lincoln soll ein abgefallener Katholik sein
Abraham Lincolns prophetischer Blick
Lincolns Ermordung
Abraham Lincolns Ermordung ein Werk der Römlinge
Der Aufruhr in Antigonish
Meine Taufe
Eine Kriegslist
In den Rocky Mountains
San Francisco
Die Bibel in Oregon
Auf der Reise nach Australien
Empfang in Australien
Die beiden Schwestern
Kämpfe in Ballarat
Die Überraschung zu Horsham
Mit genauer Not
Römische Bekehrungsversuche
»Maria, die einzige Hoffnung der Sünder«
Proben aus dem Breviarium
Mein letzter Besuch in Europa
Abschiedsworte
Unsere Empfehlungen
Band 150 Jahre in der Kirche Roms
Vorwort
Können Chiniquy’s Erlebnisse heute nicht unvermindert beobachtet werden in Politik, Literatur, Film, Presse, Radio, Fernsehen und im Privatleben?
Ist dieses Buch nicht zeitlos unüberlebbar und für die heutigen Tendenzen aktueller denn je?
Erfüllen sich darin nicht die nahezu prophetischen Worte des ehrwürdigen Präsidenten Abraham Lincoln, welche er zu Chiniquy sprach?
Wann hat denn die Kirche Roms jemals über ihre Intrigen und Gräueltaten der Inquisition Buße getan oder ihre gottlos-heidnischen Bräuche aufgegeben und ihre ungesetzlichen Anschläge widerrufen?
Wieviele sind immer noch Feinde der Freiheit und des Wortes Gottes? Warum wird die Heilige Schrift an vielen Orten heute noch vernichtet und werden, die daran glauben, verfolgt?
Weshalb soll ein Katholik keine anderen Schriften lesen dürfen als die der eigenen Religionsphilosophie?
Sprachen die Reformatoren Unrecht, als sie die römische Kirche als antichristlich bezeichneten? Hat Rom außer dem Namen etwas mit Christus gemeinsam?
Jesus Christus wird wiederkommen! Ihm müssen alle Feinde zu Füßen fallen. IHM allein gehört das Zepter der Weltherrschaft! – Er bleibt Sieger, weil er auferstanden ist! Gerade darin unterscheidet sich das Christentum von den Weltreligionen. Ihr Gründer Jesus lebt – und gibt allein genügsame Sühne für unsere Schuld vor Gott.
Die BIBEL ist Gottes Wort, Verheißung und Gebot!
Die biblische Gerechtigkeit steht im gleichen Verhältnis zu Belohnung und Strafe.
Aus Heiligkeit und Liebe zu Seinem offenbarten Wort wird Gott einmal abrechnen mit jedermann – entweder zur Gnade oder ewigem Gericht.
Die Bibel und der römische Priester
Mein Vater hieß Charles Chiniquy. Er war in Quebec, der Hauptstadt von Kanada, geboren und hatte im katholischen Seminar dieser Stadt Theologie studiert, in der Absicht, Priester zu werden. Da er aber nur wenige Tage vor der Weihe Zeuge einer großen Ungerechtigkeit in den hohem Regionen der Kirche wurde, so änderte er seinen Sinn, gab die Theologie auf, studierte die Rechte und etablierte sich als Notar. Nach seiner Verheiratung mit Regina Perrault ließ er sich im Jahre 1808 in Kamuraska nieder, wo ich am 30. Juli 1809 das Licht der Welt erblickte.
Ungefähr vier Jahre nach meiner Geburt siedelten meine Eltern nach Murray-Bay über, einem neugegründeten Ort, der damals noch keine Schule hatte. Meine Mutter wurde darum meine erste Lehrerin.
Das Lehrbuch, das sie benützte, bestand in einer französisch-lateinischen Bibel, welche mein Vater bei seinem Austritt aus dem Seminar von seinen Obern zum Geschenk erhalten hatte. Sobald ich das ABC gelernt hatte, ließ mich die Mutter in der Bibel buchstabieren. Sie wählte die Stellen aus, die meinem kindlichen Verständnis angemessen waren und ließ mich dieselben lesen. Manche Kapitel gefielen mir so gut, dass ich sie immer und immer wieder las, bis ich sie auswendig konnte. So z. B. die Schöpfung und den Sündenfall, die Sündflut, die Opferung Isaaks, die Geschichte Moses, Simsons, Davids; auch mehrere Psalmen; die Reden und Gleichnisse Jesu und besonders die Leidensgeschichte nach dem Johannesevangelium. Diese alle konnte ich mit neun Jahren frei aus dem Gedächtnis hersagen.
Es wurden mir noch zwei jüngere Brüder geboren. Der erste hieß Louis, der war vier Jahre jünger als ich; der zweite, Achilles, kam noch vier Jahre später zur Welt. Wenn die Kleinen schliefen oder zusammen spielten, brachte ich oft mit meiner Mutter die schönsten Stunden meines Lebens hinter der Bibel zu. Während ich vorlas, unterbrach sie mich oft, um zu sehen, ob ich auch verstehe, was ich lese. Bewiesen es ihr meine Antworten, so pflegte sie mich vor Freude zu küssen und an ihr Herz zu drücken. Als ich eines Tages die Leidensgeschichte des Heilandes las, ward mein junges Herz so bewegt, dass meine Stimme zitterte und ich fast nicht mehr weiterlesen konnte. Die Mutter bemerkte das und wollte etwas von der Liebe Jesu zu mir sagen; aber Tränen erstickten ihre Stimme; sie legte ihre Stirn an meine Wangen, und ich spürte ihre heißen Tränen der Jesusliebe! Auch ich musste weinen, und meine Tränen mischten sich mit den ihrigen. Das heilige Buch entglitt meinen Händen, und ich fiel meiner Mutter schluchzend um den Hals. Keine Menschenworte vermögen auszudrücken, was wir in jener gesegneten Stunde fühlten. Obgleich, da ich dies schreibe, mehr als 50 Jahre seitdem verflossen sind, dass Jesus mir zum ersten Mal in meinem Leben etwas von seiner Liebe offenbarte, frohlockt mein Herz immer noch, wenn ich daran denke.
Wir hatten ziemlich weit zur Kirche. Die Wege waren an regnerischen Tagen außerordentlich schlecht, so dass die benachbarten Farmer dann kaum zum Gottesdienst gehen konnten. An solchen Tagen pflegten sie sich des Abends im Hause meines Vaters zu versammeln; ich kleiner Knabe musste auf einen Tisch stehen und einige der biblischen Geschichten hersagen, die ich gelernt hatte. Die Aufmerksamkeit der Leute und ihre Freude an dem, was ich vortrug, nahm mir bald meine Schüchternheit; ward ich müde, so stimmte die Mutter mit ihrer schönen Stimme eines jener herrlichen französischen Lieder an, die sie auswendig kannte, und erfreute die Anwesenden damit.
Bei schönem Wetter, wenn mich meine Eltern mit zur Kirche nahmen, musste ich oft vor Beginn des Gottesdienstes den vor der Kirche harrenden Andächtigen vom Wagen eines Farmers herab ein Kapitel aus der Bibel hersagen. Begann es dann zu läuten, so drückten sie oft ihr Bedauern darüber aus, dass sie nicht noch länger zuhören könnten.
Eines schönen Tages im Frühling 1818, während der Vater in seinem Büro saß und die Mutter nähte, spielte ich vor der Tür mit einem zahmen Vogel, der mir überallhin folgte. Plötzlich sehe ich den Priester auf unser Haus zukommen. Ich erschrak bei seinem Anblick. Er war ein kleiner Mann von unangenehmem Äußern, dabei breitschultrig und korpulent. Sein welkes Gesicht war von langem ungekämmtem Haar eingefasst und endete in einem tief herunterhängenden Doppelkinn.
Ich sprang hinein und meldete den Besuch. Mein Vater empfing den Pfarrer mit freundlichem Händedruck.
Pfarrer Courtois, so hieß der Priester, war aus Frankreich gebürtig. Zur Zeit der Revolution unter dem Schreckensregiment eines Robespierre zur Guillotine verurteilt, war er nur mit knapper Not dem Tode entgangen, hatte wie viele seiner Kollegen in England ein Asyl gefunden und kam schließlich von dort nach Quebec hinüber, wo ihm der Bischof die Gemeinde Burray-Bay übertrug.
Der Priester unterhielt sich lebhaft mit meinen Eltern, ich hörte ihm mit Vergnügen zu. Da plötzlich stockte seine Rede und sein Angesicht verfinsterte sich. Es herrschte einige Augenblicke eine peinliche Stille in dem Gemach, wie die Windstille vor dem Sturm.
Jetzt schaute Pfarrer Courtois meinen Vater an und fragte ihn: »Ist es wahr, Herr Chiniquy, dass Sie mit Ihrem Kind in der Bibel lesen?«
»Ja«, antwortete mein Vater ohne langes Besinnen, »mein kleiner Knabe und ich, wir lesen die Bibel zusammen, und er weiß zu meiner Freude schon recht viel davon auswendig. Wenn Sie erlauben, Herr Pfarrer, so wird er Ihnen gerne etwas hersagen.«
»Dafür bin ich nicht hergekommen!« entgegnete der Priester streng, »sondern um Sie zu fragen, ob Sie nicht wissen, dass das Konzilium von Trient das Lesen der Bibel in französischer Sprache verboten hat?«
»Ach so«, entgegnete mein Vater, »darauf kommt es mir nicht an, ob ich die Bibel in französischer, griechischer oder lateinischer Sprache lese; denn ich verstehe diese drei Sprachen ungefähr alle gleich gut.«
»Aber wissen Sie nicht, dass es Ihrem Kind verboten ist, in der Bibel zu lesen?« fuhr der Priester heftiger fort.
»Meine Frau gibt dem Knaben Anleitung im Bibellesen«, antwortete mein Vater; »daran kann ich nichts Böses finden!«
»Herr Chiniquy«, sagte der Priester mit drohender Miene, »Sie haben einen ganzen theologischen Kurs durchgemacht und wissen also, was die Pflicht eines katholischen Priesters ist. Sie wissen, es ist meine unangenehme Aufgabe, Ihnen die Bibel abzuverlangen und sie zu verbrennen!«
Diese Worte des Priesters brachten das spanische Blut, das in meines Vaters Adern rollte, in Wallung. (Mein Großvater ist nämlich ein spanischer Seemann gewesen; unser Familienname war ursprünglich Etchiniquia.)
Der Vater sprang auf, schnell wie der Blitz. Ich schmiegte mich zitternd an die Mutter und spürte, dass auch sie zitterte.
Ich glaubte nichts anderes, als mein Vater würde mit dem Priester handgemein werden; denn sein Zorn war ob der Frechheit desselben sichtlich entbrannt. Noch mehr aber fürchtete ich für meine liebe Bibel, die gerade vor dem Priester auf dem Tische lag; ich hatte sie zu Weihnachten erhalten.
Zu allem Glück konnte mein Vater seinen Zorn bemeistern. Ohne ein Wort zu sagen, ging er raschen Schrittes im Zimmer auf und ab. Bleich vor Zorn und mit vor Erregung zitternden Lippen murmelte er etwas zwischen den Zähnen, was ich nicht verstehen konnte.
Auch der Priester schwieg wohlweislich. Krampfhaft umklammerte er sein spanisches Rohr und blickte unverwandt nach meinem Vater hin, sichtlich eingeschüchtert durch dessen unerwarteten Widerstand. Endlich blieb mein Vater vor ihm stehen und
fragte ihn: »Herr Courtois, ist das alles, was Sie uns zu sagen wissen?«
»Ja, mein Herr«, erwiderte zitternd der Priester.
»Nun gut, wenn das alles ist«, entgegnete mein Vater, »so haben Sie hier nichts mehr zu tun. Sie wissen, wo Sie hereingekommen sind, dort gehen Sie auch wieder hinaus!«
Das ließ sich der Gesandte Roms nicht zum zweiten Mal sagen. Er war froh, mit heiler Haut davonzukommen.
Als er verschwunden war, fiel ich meinem Vater um den Hals und küsste ihn vor Freuden, dass mir meine Bibel geblieben war. Dann sprang ich auf den Tisch und sagte ihm zu Ehren die Geschichte von David und Goliath her, wobei natürlich in meiner kindlichen Phantasie David niemand anders als mein Vater, und Goliath der römische Priester war, den er so tapfer aus dem Felde geschlagen hatte.
Du weißt, o Gott, dass ich es der Bibel verdanke, die ich auf meiner Mutter Schoss las, dass ich durch Dein unendliches Erbarmen zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen bin. Jene Lichtstrahlen, die ich damals in mein Herz aufnahm, konnten durch all die Irrtümer der römischen Kirche niemals gänzlich verdunkelt werden. Dank sei Dir dafür!
Das Fegefeuer und die Kuh der armen Witwe
Der junge Chiniquy hatte sich zwei Jahre außerhalb des väterlichen Hauses bei einem Onkel in St. Thomas aufgehalten, um dort die Schule zu besuchen. Weil aber der dortige Priester der Schuljugend schweres Ärgernis gab, so holte seine Mutter den damals zwölfjährigen Knaben auf dessen eigenes dringendes Bitten wieder ins väterliche Haus zurück; er sollte aber leider vom Regen in die Traufe kommen, wie seine folgende Erzählung zeigt:
Am 17. Juli 1821 kam ich in der Heimat an und verbrachte den Nachmittag und Abend bei meinem Vater. Wie freute er sich, als er mich schwere Probleme der Algebra und selbst der Geometrie lösen sah! Denn unter der Leitung des Herrn Jones hatte ich in diesen Fächern ausgezeichnete Fortschritte gemacht.
Der Vater prüfte mich auch in der Grammatik. »Was für ein ausgezeichneter Lehrer muss doch dieser Jones sein«, rief er aus, »in vierzehn Monaten ein Kind so weit zu bringen!«
Wie süß und doch wie kurz waren diese Stunden! Wir hielten Abendgottesdienst. Ich las das 15. Kapitel aus Lukas, vom verlorenen Sohn. Darauf sang die Mutter ein Lob- und Danklied, ich ging mit fröhlichem Herzen zu Bett und schlief so süß, wie selten in meinem Leben. Aber, o Gott, welch furchtbares Erwachen hattest Du mir bereitet!
Gegen 4 Uhr morgens hörte ich auf einmal herzzerreißendes Wehgeschrei. Es war die Stimme meiner Mutter.
»Was ist dir begegnet, liebe Mutter?« fragte ich.
»O, mein lieber Sohn, du hast keinen Vater mehr; er ist gestorben!«
Bei diesen Worten verlor sie das Bewusstsein und fiel auf den Boden. Während eine Freundin, die bei uns übernachtet hatte, sich ihrer annahm, eilte ich an das Bett des Vaters. Ich drückte ihn an mein Herz, bedeckte ihn mit Küssen und Tränen; ich bewegte ihm den Kopf, drückte ihm die Hände und versuchte ihn aufzurichten. Ich konnte es nicht glauben, dass er tot sei. Ich kniete nieder und betete zu Gott, dass er meinem Vater das Leben wiedergeben möchte. Alles vergebens! Er war und blieb tot! Er war schon eiskalt.
Zwei Tage nachher wurde er begraben. Meine Mutter war so überwältigt vom Schmerz, dass sie dem Leichenzug nicht folgen konnte. Ich blieb als ihre einzige irdische Stütze bei ihr. Arme Mutter, wie viele Tränen hast du vergossen!
Wo ist die Feder, die es zu beschreiben vermag, was in dem Herzen einer Frau vorgeht, wenn Gott ihr plötzlich in der Blüte des Lebens den Gatten nimmt und sie allein Zurückbleiben muss und noch dazu im Elend und mit drei kleinen Kindern, von denen zwei noch zu jung sind, um den Verlust zu begreifen. Wie langsam vergehen der armen Witwe, die allein, ohne Mittel, und in der Fremde leben muss, die Stunden des Tages! Wie schmerzlich sind dem Herzen, das alles verloren hat, die schlaflosen Nächte! Wie leer ist das Haus, wenn der nicht mehr da ist, der sein Herr, seine Stütze und Vater war! – Jeder Gegenstand, den sie ansieht, und jeder Schritt, den sie tut, erinnert sie an den Verlust und stößt ihr das Schwert tiefer ins Herz. O wie bitter sind die Tränen, welche sie vergießt, wenn ihr jüngstes Kind, dem das Geheimnis des Todes noch nicht bekannt ist, sich ihr in die Arme wirft und fragt: »Mama, wo ist der Vater? Warum kommt er nicht heim? Ich fühle mich so verlassen!«
Meine Mutter hat diese herzzerreißenden Prüfungen durchgemacht. Ich hörte sie weinen die langen Stunden des Tages und die längeren Stunden der Nacht. Sehr oft habe ich es gesehen, wie sie auf ihren Knien Gott bat, Erbarmen mit ihr und ihren drei unglücklichen Waisen zu haben. Ich konnte damals nichts tun, um sie zu trösten, als sie lieben, mit ihr beten und weinen.
Wenige Tage nach dem Begräbnis des Vaters kam der Pfarrer Courtois, derselbe, welcher uns unsere Bibel hatte entreißen wollen. Er galt für reich, und da wir infolge des Todes unseres Vaters arm und unglücklich waren, so dachte ich zuerst, dass er uns Trost und Hilfe bringen werde. Meine Mutter hieß ihn willkommen als einen Engel vom Himmel. Der leiseste Hoffnungsschimmer ist für die Unglücklichen ja so süß.
Aber schon seine ersten Worte zeigten uns, dass unsere Hoffnungen vergeblich waren. Er versuchte, teilnehmend zu sein, und sagte auch etwas vom Vertrauen auf Gott, sonderlich in Zeiten der Prüfung; aber seine Worte waren kalt und trocken.
»Dann wandte er sich an mich und fragte: »Liest du immer noch die Bibel, mein Kind?«
»Ja, mein Herr«, antwortete ich zitternd; denn ich fürchtete, dass er abermals versuchen würde, uns unsern Schatz zu rauben; und ich hatte keinen Vater mehr, der ihn verteidigen konnte.
Dann sprach er zu der Mutter:
»Madame, ich habe Ihnen gesagt, dass es nicht recht von Ihnen war, dieses Buch zu lesen.«
Sie schlug die Augen nieder und antwortete nur mit Tränen. Es folgte ein langes Schweigen; sodann fuhr der Priester fort:
»Madame, Sie schulden noch etwas für die Gebete, welche gesungen worden sind, und für die gottesdienstlichen Handlungen, welche Sie für die Ruhe der Seele Ihres Gatten verlangt haben. Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie die Schuld beglichen.«
»Herr Courtois«, erwiderte die Mutter, »mein Mann hinterließ mir nichts als Schulden. Ich muss mit der Hand verdienen, was ich mit meinen drei Kindern brauche. Um der armen Waisen, wenn nicht um meinetwillen, nehmen Sie uns nicht das wenige, was wir noch haben.«
»Aber, Madame, was denken Sie? Ihr Mann starb plötzlich und ohne jegliche Vorbereitung; er ist daher in den Flammen des Fegefeuers. Wenn Sie wünschen, dass er befreit werde, so müssen Sie notwendigerweise Ihre persönlichen Opfer mit den Gebeten der Kirche und den Messen, welche wir darbringen, vereinigen.«
»Wie ich Ihnen sagte, mein Mann hat mich völlig mittellos zurückgelassen, und es ist mir ganz unmöglich, Ihnen Geld zu geben.«
»Aber, Madame, Ihr Gatte war lange Zeit der einzige Notar in Murray-Bay; er muss sicherlich viel Geld verdient haben. Ich kann es nicht glauben, dass er Sie so ohne jegliche Mittel zurückgelassen habe, dass Sie ihm jetzt nicht helfen könnten, da seine Leiden viel größer sind als die Ihrigen.
»Mein Mann verdiente allerdings viel Geld, aber er gab noch mehr aus. Gott sei Dank, so lange er lebte, haben wir keinen Mangel gehabt. Aber kürzlich hat er dies Haus bauen lassen, und ich fürchte, dass die Gläubiger es mir nehmen werden. Er hat außerdem vor nicht zu langer Zeit ein Stück Land gekauft, das auch nur
halb bezahlt ist, und das ich deshalb wahrscheinlich auch nicht werde behalten können. Es ist möglich, dass ich und meine drei Waisen in kurzer Zeit alles verlieren, was er uns hinterlassen hat. leb hoffe doch, dass Sie, Herr Courtois, nicht der Mann sind, der uns das letzte Stückchen Brot aus dem Munde reißen wird.«
»Aber, Madame, die Messen, welche für die Seelenruhe Ihres Gatten dargebracht worden sind, müssen bezahlt werden«, entgegnete der Priester.
Meine Mutter bedeckte sich das Gesicht mit dem Taschentuch und weinte.
Ich konnte nicht weinen; ich empfand nur Wut und unaussprechlichen Abscheu. Ich schaute mit zornigem Blick auf diesen Menschen, der den Kummer meiner Mutter so vergrößerte und ihr heißere Tränen auspresste, als sie sonst schon weinte. Ich ballte die Fäuste und zitterte am ganzen Leibe; die Zähne knirschten mir wie bei großer Kälte. Mein größter Kummer war meine Schwäche gegenüber diesem dicken Priester, dass ich nicht imstande war, ihn aus dem Hause zu werfen und von meiner Mutter wegzujagen.
Nachdem sie lange still geweint, schlug meine Mutter die Augen wieder auf und sagte zu dem Priester:
»Mein Herr, Sie sehen diese Kuh auf der Weide neben dem Hause. Diese Milch und die Butter von dieser Kuh sind die Hauptnahrung meiner Kinder. Hoffentlich werden sie uns die nicht nehmen wollen? Wenn jedoch solch ein Opfer gebracht werden muss, um die Seele meines armen Mannes aus dem Fegefeuer zu befreien, so nehmen Sie dieselbe für die Messen, durch welche die verzehrenden Flammen ausgelöscht werden sollen.«
Sofort stand der Priester auf mit den Worten: »Recht so, Frau Chiniquy«, und ging hinaus.
Und richtig, er wandte sich nach der Wiese und trieb die Kuh weg, dem Pfarrhaus zu.
Ich schrie vor Verzweiflung: »O, liebe Mutter, er nimmt uns die Kuh! Was soll aus uns werden?«
Lord Nairn hatte uns diese Kuh geschenkt, als sie erst drei Monate alt war. Sie stammte von der besten schottischen Rasse ab. Ich hatte sie mit eigener Hand groß gefüttert und oft mein Brot mit ihr geteilt. Ich hatte sie von Herzen gern, und sie schien meine Liebe zu verstehen und mich gleichsam wieder zu lieben. Wo sie mich nur erblickte, kam sie auf mich zugelaufen, um meine Liebkosungen oder was ich ihr sonst geben mochte, zu empfangen.
Meine Mutter pflegte sie selbst zu melken; wie weinte sie vor Schmerz, als der Priester das treue Tier wegführte, das einzige, was ihr der Himmel für uns Kinder noch gelassen hatte.
»Warum hast du ihm die Kuh gegeben?« rief ich, »was sollen wir jetzt anfangen?«
»Mein liebes Kind«, erwiderte sie, »ich dachte doch nicht, dass der Priester so grausam wäre. Ach, wenn ich ihn für so unbarmherzig gehalten hätte, würde ich ihm das nicht gesagt haben. Du fragst, was aus uns werden soll? Hast du mir nicht oft aus der Bibel vorgelesen, dass Gott der Vater der Witwen und Waisen ist? Er wird unser Gebet erhören und unsere Tränen ansehen. Lass uns niederknien und ihn um Erbarmen anflehen, dass er uns wiedergebe, was der Priester uns entrissen.«
Wir knieten nieder, und sie flehte zu Gott um Erbarmen für ihre Kinder, oft vom Schluchzen unterbrochen. Aber wenn sie nicht mit der Stimme sprechen konnte, so sprach sie mit ihren feuchten Augen und mit der zum Himmel erhobenen Hand. Ich wiederholte ihre Worte unter Weinen und Schluchzen. So hatte ich noch nie beten gehört.
Nach dem Gebet war sie ganz bleich und zitterte am ganzen Leib; kalter Schweiß floss ihr von der Stirn. Ich glaubte, sie müsste sterben, und holte schnell frisches Wasser. »Liebe Mutter«, jammerte ich, »lass mich nicht allein auf Erden! Gelt, du stirbst noch nicht?«
Sie trank einige Tropfen und fing an, sich wieder besser zu fühlen. Darauf zog sie mich an ihre Brust und sagte: »Lieber Sohn, wenn du je Priester werden solltest, so bitte ich dich, sei nie so hartherzig gegen arme Witwen wie die heutigen Priester es sind.« Dabei fielen ihre heißen Tränen mir auf die Wangen.
Das Andenken an diese Tränen hat mich nie verlassen. Ich fühlte sie beständig während der 25 Jahre, in denen ich die unbegreiflichen Irrtümer der römischen Lehre verkündigt habe. Ich war natürlich nicht besser als andere römische Priester. Ich glaubte wie sie an die Lehre von dem Fegefeuer und nahm wie sie (ich bekenne es zu meiner Schande) das Geld, welches die Reichen mir für die Messen gaben, wenn ich es auch den Armen schenkte. Aber die Erinnerung an jene Worte meiner Mutter hat mich vor solcher Hartherzigkeit gegen die armen Witwen bewahrt, deren die meisten römischen Priester schuldig sind. Der Herr selbst hatte wohl meiner Mutter diese so einfachen und doch so beredten, herrlichen Worte in den Mund gelegt als eine seiner Gnadenerweisungen gegen mich. Nie haben Roms Hände jene Tränen auszuwischen vermocht; diese Worte meiner Mutter hat kein papistischer Trugschluss mich vergessen lassen.
Wie lange, o Gott im Himmel, soll diese ………………………………………. sich von den Tränen der Witwen und Waisen sättigen? Willst Du Dich nicht der zahlreichen Völker erbarmen, die noch die Opfer dieser Irrlehre sind? O nimm doch den Schleier weg, welcher den Priestern und dem Volke auf den Augen liegt, wie Du ihn mir von den Augen genommen hast! Lehre sie erkennen, dass sie nicht von diesem erfundenen Feuer Reinigung zu erhoffen haben, sondern nur von dem Blute des Lammes, das auf Golgatha zu unsrem Heile vergossen worden ist.
Der Geburtstag des Priesters
Gott erhörte die Gebete der armen Witwe. Wenige Tage, nachdem der Priester unsere Kuh weggenommen hatte, erhielt meine Mutter zwei Briefe, den einen von ihrer Schwester Genoveva, den andern von Tante Katharine.
Die erstere, die an einen Müller, namens Stephan Eschenbach, in St. Thomas, verheiratet war, riet ihr, alles zu verkaufen und samt ihren Kindern zu ihr zu ziehen. »Wir haben keine Kinder«, schrieb sie, »und Gott hat uns Überfluss gegeben. Wir wollen gerne mit dir und deinen Kindern teilen.«
Die andere Schwester war ebenfalls verheiratet und zwar in Kamuraska an Herrn Amable Dionne. Sie schrieb, da sie erst kürzlich ihren einzigen Sohn verloren hätten, wollten sie gerne mich, den zwölfjährigen Karl, an dessen Stelle erziehen. Später könne ich dann die Stütze der Mutter werden; sie möge inzwischen die Offerte ihrer Schwester Genoveva annehmen und mit den beiden andern Kindern zu ihr ziehen.
So geschah es auch. In wenigen Tagen waren alle unsere Möbel verkauft. Unglücklicherweise ging dabei meine teure Bibel verloren; wohin sie gekommen ist, konnte ich nie erfahren. Hatte vielleicht meine Mutter aus Furcht vor den Drohungen des Priesters sie beseitigt, jetzt wo der teure Vater sie nicht mehr verteidigen konnte, oder hatten meine Verwandten sie nach dem Wunsche des Feindes der Wahrheit dem Feuer überliefert? Ich weiß es nicht, nur das weiß ich, dass ich den Verlust schmerzlich empfand; er war für mich einstweilen unersetzlich.
Der Abschied von meiner geliebten Mutter und meinen jüngeren Brüdern schmerzte mich sehr; ich wurde aber in etwas getröstet durch den freundlichen Empfang, den mir Onkel und Tante Dionne bereiteten. Nachdem sie erfahren hatten, dass es mein Wunsch sei, Priester zu werden, Hessen sie mir durch den Vikar von Kamuraska, Rev. Morin, Privatunterricht im Lateinischen erteilen. Dieser Priester galt als gelehrter Mann. Er stand damals im Alter von 40-50 Jahren. Früher Priester im Distrikt von Montreal, war er wegen einer Skandalgeschichte nach seinem jetzigen Posten versetzt worden, wo man sein früheres Leben weniger genau kannte. Gegen mich war er sehr gut, und ich liebte ihn von ganzem Herzen.
Ich hatte schon einige Zeit seinen Unterricht genossen, als er mir eines Tages mitteilte, dass der Hauptpriester des Ortes, Pfarrer Varin, demnächst seinen Geburtstag mit einem großen Festessen zu feiern gedenke. »Bei dieser Gelegenheit«, sagte er mir, »wollen ihm die vornehmsten Bürger der Gemeinde ein prachtvolles Bouquet überreichen, samt einer Adresse, die ich zu schreiben beauftragt bin. Du sollst sie dann dem Herrn Pfarrer vortragen.«
»Aber ich bin ja noch so jung!«
»Umso schöner wird es sein!« meinte der Vikar.
»Nun, ich will’s versuchen«, entgegnete ich, »aber unter der Bedingung, dass die Adresse nicht zu lang wird und ich Zeit genug erhalte, sie auswendig zu lernen.«
Der Vikar versprach’s; ich lernte meine Sache und der Festtag kam. Die beste Gesellschaft von Kamuraska, bestehend aus etwa 15 Herren und ebenso vielen Damen, versammelte sich am Abend des Geburtstages in den prächtigen Räumen des katholischen Pfarrhauses, der Jubilar in ihrer Mitte. Plötzlich öffnete sich die Türe und herein trat Herr Pascal Tache, der Präsident der Pfarrei samt seiner Gemahlin. Die Herrschaften führten mich an der Hand hinein und stellten mich in die Mitte der Gesellschaft, gerade vor den Priester. Mein Haupt war mit einem Blumenkranz geschmückt; denn ich sollte den »Engel der Gemeinde« vorstellen, der im Namen derselben dem Pfarrer die Gefühle der Bewunderung und des Dankes ausdrücken sollte, die sie gegen ihn empfand. Ich trug den Inhalt der Adresse vor, und überreichte alsdann dem Priester das kunstvoll arrangierte Bouquet, das die Damen mit viel Geschmack der feierlichen Gelegenheit anzupassen verstanden hatten.
Pfarrer Varin war ein kleiner, aber wohlgebauter Mann. Seine dünnen Lippen schienen immer zu einem freundlichen Lächeln bereit. Seine auffallend weiße Haut wurde noch verschönert durch seine roten Wangen. Verstand und Güte schauten aus seinen schwarzen Augen hervor. Er unterhielt seine Gäste auf das liebenswürdigste; solche Familienfeste waren ihm eine wahre Freude. Durch die an ihn gerichtete Ansprache wurde er zu Tränen gerührt, und diese blieben auch seinen Gästen nicht erspart, als er ihnen mit bewegter Stimme für die hohe Ehre dankte, die sie ihm angetan.
Kaum hatte er geschlossen, so stimmten die Damen ein wunderschönes Lied an. Mittlerweilen öffneten sich die Flügeltüren, die aus dem Empfangszimmer in den Speisesaal führten, und wir sahen vor uns eine lange Tafel, reich besetzt mit den köstlichsten Gerichten und Weinen, welche man in Kanada auftreiben kann.
Zum ersten Mal in meinem Leben nahm ich an einem priesterlichen Diner teil. Man kann sich denken, wie ich alles mit größter Aufmerksamkeit betrachtete. Außer Pfarrer Varin und seinem Vikar waren noch drei andere Priester zugegen, die man recht geschmackvoll zwischen den schönsten Damen der Gesellschaft platzierte. Nachdem uns die Damen etwa eine Stunde lang mit ihrer Gegenwart beehrt hatten, zogen sie sich in den Salon zurück. Kaum war die letzte von ihnen verschwunden, so stand der gefeierte Priester, Herr Varin, auf und sagte:
»Meine Herren, lassen sie uns auf die Gesundheit der liebenswürdigen Damen trinken, deren Anwesenheit den ersten Teil unseres Festchens so lieblich gestaltet hat!«
Die Herren Hessen sich das nicht zweimal sagen. Jedermann füllte sein hohes Glas und leerte es in einem Zug zu Ehren der Damen.
Nicht lange darnach stand Herr Tache auf und brachte auf die Gesundheit des »hochgeehrtesten und geliebtesten Priesters von Kanada, Herrn Varin« seine Wünsche an. Wieder wurden die Gläser gefüllt und geleert, ausgenommen das meinige; denn zum Glück saß ich neben meinem Onkel, der, als er sah, wie ich mein erstes Glas leerte, mich mit strengem Blick anschaute und drohte: »Wenn du noch eins trinkst, so schicke ich dich vom Tisch! Ein kleiner Knabe wie du soll nicht trinken, sondern das Glas nur mit seinen Lippen berühren!«
Es wäre mir kaum möglich, alle die Gesundheiten aufzuzählen, die getrunken wurden, nachdem die Damen uns verlassen hatten. Nach jeder solchen »Gesundheit« musste ein Lied gesungen oder eine Geschichte erzählt werden, von welchen mehrere mit riesigem Beifall und lautem Gelächter angehört wurden.
Endlich kam die Reihe auch an mich; ich sollte auch eine »Gesundheit« ausbringen. So sehr ich mich auch weigern mochte, es half nichts. So stand ich endlich auf meine kurzen Beine und sagte, zu Pfarrer Varin gewandt: »Lasst uns trinken auf die Gesundheit des Heiligen Vaters, des Papstes!«
An unsern Heiligen Vater, den Papst, hatte wirklich noch niemand gedacht; dass sein Name unter solchen Umständen und dazu noch von einem Knaben erwähnt wurde, entflammte die Priester und ihre fröhlichen Gäste zu einer wahren Begeisterung. Sie brachen in ein schallendes Gelächter aus, stampften mit den Füßen und schrien: »Bravo! Bravo! Auf die Gesundheit des Papstes!« Alle standen auf, und nach Herrn Varins Aufforderung wurden die Gläser abermals gefüllt und ausgetrunken.
So viele »Gesundheiten« konnten nun freilich nicht getrunken werden, ohne dass man die natürlichen Folgen davon merkte. Das erste Opfer war ein Priester, welcher Noel hieß. Er war ein großer Mann und ein starker Trinker. Ich hatte mehr als einmal bemerkt, dass er, anstatt aus dem Weinglas, aus einem großen Humpen trank! Als man endlich die ersten Zeichen von Betrunkenheit an ihm wahrnahm, erregte das nicht etwa das Bedauern seiner Brüder, sondern nun fingen sie erst recht an zu lachen. Er bemühte sich, sein Glas noch einmal zu füllen; aber seine Hand war nicht mehr imstande, die Flasche zu halten; sie entglitt ihm, fiel zur Erde und brach in Stücke. Um seine gute Laune dennoch aufrecht zu erhalten, hob er einen Bacchantengesang an, konnte ihn jedoch nicht beendigen, da seine Zunge schon allzu schwer war. Jetzt ließ er seinen Kopf auf den Tisch niedersinken, versuchte aber gleich darauf wieder aufzustehen, was ihm jedoch nicht gelang; er sank schwerfällig in seinen Stuhl zurück. Schließlich machte er unter dem beständigen Gelächter der anderen Priester und Gäste eine verzweifelte Anstrengung. Er stand auf, hatte aber kaum zwei oder drei Schritte getan, als er, so lang wie er war, zur Erde fiel. Jetzt eilten seine beiden Tischnachbarn ihm zu Hilfe; aber sie hatten selbst zu wenig festen Stand hierzu. Zweimal rollten sie mit ihm unter den Tisch. Endlich erhob sich ein anderer, dem der Wein weniger getan hatte, packte Noel bei den Füßen und schleppte ihn in ein anstoßendes Zimmer, wo er ihn liegen ließ.
Diese erste Szene befremdete mich sehr; denn ich hatte nie zuvor einen betrunkenen Priester gesehen; was mich aber noch mehr verwunderte, war das Gelächter der andern Priester über den Vorfall. Es folgte aber noch eine weitere Szene, die mich sehr traurig stimmte. Mit mir nahm nämlich noch ein anderer Knabe an dieser Festlichkeit teil, Achilles Tache, der Sohn des oben genannten Präsidenten der Pfarrei. Dieser war nicht wie ich ermahnt worden, nur mit seinen Lippen das Glas zu berühren; mehr als einmal hatte er es geleert. Auch er fiel schließlich zu Boden vor den Augen seines Vaters, der selbst schon zu voll war, um ihm wieder aufhelfen zu können. Er schrie laut: »Ich muss ersticken!« Ich versuchte ihn aufzurichten, war aber zu schwach dazu. Nun lief ich nach seiner Mutter. Sie kam mit einer anderen Dame; aber inzwischen hatte der Vikar den Knaben in ein anderes Zimmer getragen, wo er einschlief, nachdem er den Wein von sich gegeben hatte.
Der arme Achilles! Im Hause seines eigenen Priesters lernte er so den ersten Schritt tun auf dem Wege der Schwelgerei und Trunkenheit, auf welchem er 15 Jahre später um all sein Hab und Gut kam, Frau, Kinder und schließlich noch sein eigenes Leben verlor.
Als die Herren endlich genug gesungen, gelacht und getrunken hatten, stand der Gastgeber auf und schlug vor, man wolle die Damen nicht länger allein lassen. Sein Vorschlag wurde angenommen und man begab sich, so gut es eben unter den obwaltenden Umständen ging, in den Salon hinüber, wo die Damen die Gesellschaft mit Musik und Gesang unterhielten. Es wollte aber doch keine recht vergnügte Stimmung mehr einkehren; die Damen, namentlich Frau Tache, schienen etwas gedrückt; denn es konnte ihnen nicht entgehen, in welchem Zustand sich ihre Männer befanden.
Der Gastgeber schien das zu bemerken, und um wieder Leben in die Gesellschaft zu bringen, schlug er vor, man wolle ein Spiel machen, z. B. »Blinde Kuh«. Dieser glückliche Einfall wurde allgemein beklatscht.
»Aber wer will sich zuerst die Augen verbinden lassen?« fragte der Priester.
»Sie selbst, Herr Varin!« schrien alle Damen, »Sie müssen uns das gute Beispiel geben, das wir dann auch befolgen werden.«
Der Priester musste gehorchen. Unverzüglich band ihm eine der Damen ihr parfümiertes Taschentuch vor die Augen. Er war zwar nicht sehr betrunken, hatte aber doch mehr als genug, obschon er viel vertragen konnte. Seine Bewegungen waren infolgedessen so komisch, dass man sich fast krank lachen musste. Nachdem er lange genug niemand erwischt hatte, gelang es ihm endlich, eine Dame, die ihm zu nahe gekommen war, am Arm zu packen. Im Bestreben, sich loszureißen, stürzte dieselbe zu Boden und riss den Priester, den der Wein so wie so unsicher gemacht hatte, mit sich hinunter. Das gab eine Szene, deren Beschreibung ich mir lieber ersparen will. Das Beste daran war, dass dieser Fall des »hochwürdigen Herrn« nicht nur der »Blinden Kuh«, sondern der ganzen Festlichkeit ein Ende machte. Die Priester aber lasen am andern Morgen ihre Messe, als ob nichts geschehen wäre.
Die Vorbereitung zur ersten Kommunion
Die römisch-katholischen Priester bereiten die ihnen anvertrauten Kinder mit größtmöglicher Sorgfalt auf den Zeitpunkt vor, wo diese zum ersten Mal die Hostie nehmen sollen. Während 2-3 Monaten im Jahr müssen die Kinder von 10-12 Jahren fast alle Tage zur Kirche gehen, um den Katechismus auswendig zu lernen und die Erklärungen des Priesters zu vernehmen.
Der Priester, der uns in Kamuraska diesen Unterricht erteilte, war der schon erwähnte Vikar Morin. Er war außerordentlich gut gegen die Kinder; wir verehrten und liebten ihn denn auch aufrichtig. Seine Unterrichtsstunden dauerten zwar etwas lang; aber wir hörten ihn gerne; denn er verstand es, immer neue und interessante Geschichten in seine Reden einzuflechten.
Der Katechismus, nach welchem unterrichtet ward, ist die Grundlage all des Götzendienstes und Aberglaubens, den die römische Kirche für die Religion Jesu Christi ausgibt. Ihm verdankt sie zu einem großen Teil die Verehrung, mit welcher die Katholiken zum Papste und dessen Stellvertretern emporschauen; durch ihn hat sie aber auch die heiligsten Wahrheiten des Evangeliums entstellt. Vermittelst dieses Katechismus wird Jesus aus den Herzen genommen, für die Er einen so teuren Preis bezahlt hat, und Maria an seine Stelle gesetzt. Aber dieser große Betrug ist so geschickt durchgeführt, dass es einem arglosen Kind nahezu unmöglich ist, der Falle zu entgehen, die ihm da unter so viel poetischen Blumen und Bildern gestellt wird.
Ich will dies beweisen, indem ich einfach den Hergang einer Unterrichtsstunde schildere.
Eines Tages sprach der Priester zu mir: »Steh auf, mein Kind, und beantworte mir die vielen wichtigen Fragen, die ich an dich richten will!«
Als ich aufgestanden war, hob er an: »Mein Kind, wenn du dich zu Hause verfehlt hast, wer hat dich da zuerst gestraft, der Vater oder die Mutter?«
Ich erwiderte zögernd: »Der Vater!«
»Du hast recht geantwortet, mein Kind«, sagte der Priester. »Der Vater verliert gewöhnlich schneller die Geduld mit den Kindern und ist auch eher bereit, sie zu strafen, als die Mutter. Sage uns nun aber auch noch, wer hat dich denn strenger bestraft, der Vater oder die Mutter?«
»Der Vater«, entgegnete ich ohne langes Besinnen.
»Und«, fragte der Priester weiter, »wenn du Züchtigung verdient hast, kam da nicht manchmal sogar die Mutter und nahm dem Vater den Stock aus der Hand, um für dich um Gnade zu bitten?«
»Doch freilich«, bestätigte ich, »Mutter hat das mehr als einmal getan und rettete mich dadurch vor harter Strafe.«
»Siehst du«, sagte der Priester, »so ist es nicht nur dir gegangen, sondern wahrscheinlich allen deinen Kameraden hier. Oder haben nicht eure Mütter euch öfters vor verdienter Strafe geschützt?«
»Doch, Herr Pfarrer!« riefen sie alle.
»Noch eine Frage: Wenn der Vater dich schlagen wollte, hast du dich dann nicht etwa in die Arme der Mutter geflüchtet?«
»O doch!« erwiderte ich, »und sie hat auch oft für mich um Verzeihung gebeten, so dass ich straflos ausging.«
»Recht so«, fuhr nun der Priester fort, indem er sich zu den übrigen Kindern wandte: »Ihr habt alle einen Vater und eine Mutter im Himmel: Euer Vater ist Jesus, eure Mutter ist Maria. Vergesst nun nicht, dass das Herz einer Mutter immer viel zarter und mehr zum Erbarmen geneigt ist als das Herz eines Vaters. Ihr beleidigt euren Vater im Himmel sehr oft durch eure Sünden. Dann macht er sich auf, um euch zu strafen. Er droht euch mit seinem Donner zu zerschmettern; er öffnet die Pforten der Hölle, um euch dort hinab zu werfen, und sicherlich hätte Er euch schon längst verdammt, hättet ihr nicht eine so gütige Mutter im Himmel, die euren zornigen und aufgebrachten Vater immer wieder entwaffnet hat. Wenn Jesus euch strafen will, wie ihr es verdient habt, so eilt die gute Jungfrau Maria zu Ihm und beschwichtigt Seinen Zorn. Sie stellt sich zwischen Ihn und euch und hindert Ihn, euch zu schlagen. Sie spricht zu euren Gunsten, bittet für euch um Vergebung und erlangt dieselbe auch. So fliehet denn zu ihr, wie euer Freund Chiniquy in die Arme seiner Mutter floh, wenn der Vater ihn strafen wollte. Werft euch in die Arme der Mutter Gottes! Vertraut auf die Macht, die sie über Jesum hat, ihr könnt sicher sein, dass ihr durch sie gerettet werdet!«
Auf so unverschämte Weise verdrehen die römischen Priester das Evangelium! In der römischen Kirche ist es nicht Jesus, sondern Maria, welche die unendliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes gegen den Sünder darstellt. Nicht Jesus, sondern sie rettet den Sünder. An sie soll er sich darum auch wenden, auf sie sein ganzes Vertrauen setzen; denn Jesus ist nach dieser Irrlehre immer darauf aus, den Sünder zu strafen, Maria aber, ihn zu begnadigen.
Auf diesem Wege ist die römische Kirche in den Götzendienst zurückgefallen. Es ist das alte Heidentum unter einem neuen Namen. Dem Geschöpf wird mehr Ehre und Dienst erwiesen als dem Schöpfer und Erlöser, der da gelobt sei in Ewigkeit, Amen! (Röm. 1,25).
*
Um nicht die Meinung zu erwecken, als sei es uns bei der Mitteilung von Pater Chiniquy’s Erlebnissen darum zu tun, die Lehren und Gebräuche der römischen Kirche anzugreifen, überschlagen wir hier eine Reihe von Kapiteln, in welchen dieser ehemalige katholische Priester über seine Studien berichtet, die er im kanadischen Priesterseminar gemacht hat. Wir sagen nur so viel, dass aller Unterricht in dieser Anstalt darauf hinauslief, aus dem Studenten ein willenloses Werkzeug der Kirche und des Papstes zu machen, das weder seiner eigenen Vernunft, noch seinem Gewissen folgen darf, noch auch der Heiligen Schrift, die übrigens diese zukünftigen Priester nicht einmal lesen dürfen, außer in dem Sinne, wie sie von der Kirche ausgelegt wird. Chiniquy, der im Priesterseminar als Bibliothekar funktionierte, fand die Bibel in der dortigen Bibliothek unter die verbotenen Bücher gestellt, so dass, als er an einem freien Nachmittag sich trotz des Verbotes darein vertieft hatte, er dies des folgenden Tages seinem Obern als eine schwere Sünde beichten musste! Als ihm dann bei seiner Weihe zum Priester die Bibel von dem amtierenden Bischof vorgehalten wurde mit dem feierlichen Befehl, dieselbe zu studieren und zu predigen, da sei es, so erzählt er uns, freilich wie ein Lichtstrahl durch seine Seele gegangen; aber auch wie ein darauffolgender Donnerschlag sei es für ihn gewesen, als er schwören musste, er wolle die Heilige Schrift nie anders auslegen als nach der übereinstimmenden Erklärung der Kirchenväter, von denen manche einander doch in fast allen Punkten widersprechen! Doch übergehen wir diese unerquicklichen Erörterungen und lassen wir Chiniquy davon erzählen, wie er sein Priesteramt antrat.
Mein Vikariat in St. Charles
Am 31. September des Jahres 1833 wurde ich in der Kathedrale von Quebec durch den Erzbischof von Kanada zum Priester der römischen Kirche geweiht. Drei Tage darauf erhielt ich durch den Sekretär des Bischofs meine Ernennung zum Vikar des Erzpriesters von St. Charles in Rivière Boyer. Diese Pfarrei ist prächtig gelegen zu beiden Seiten eines Flußs, etwa 20 englische Meilen von Quebec entfernt. Die mächtigen, weißgetünchten Bauernhäuser und Scheunen, aus denen die Ortschaft bestand, zeugten von dem Wohlstand, der hier herrschte. Noch hatte die vandalische Axt den hundertjährigen Wald nicht zerstört, der die Landschaft schmückte. Fast auf jeder Farm war ein hübsches Ahornwäldchen erhalten geblieben, als ein Zeichen von dem Geschmack der Bewohner.
Von Reverend Perras, dem Priester, dessen Vikar ich werden sollte, hatte ich schon viel Rühmliches gehört. Er sollte einer der gelehrtesten, frömmsten und geachtetsten Priester Kanadas sein. Mehrere Regierungspersonen von Quebec hatten durch ihn ihre Kinder in der französischen Sprache unterrichten lassen. Als ich m seinem Hause ankam, war er gerade auf einem Krankenbesuch abwesend; aber seine Schwester empfing mich mit ausgesuchter Höflichkeit. Trotz ihrer 55 Jahre sah sie noch recht jung und frisch aus. Sie führte mich gleich nach der Begrüßung in die für mich bestimmten Räume, die aus einem Studierzimmer und einem Schlafzimmer bestanden. Beide waren mit dem Duft von je einem großen Bouquet erfüllt, das aus den herrlichsten Blumen bestand und deren eines die Inschrift trug: »Willkommen sei der Engel, den der Herr als Seinen Boten zu uns schickt! « In den beiden Gemächern herrschte die peinlichste Sauberkeit, und sie waren mit allem nur erdenklichen Komfort ausgestattet. Ich schloss die Türe und fiel auf meine Knie, um Gott und der Heiligen Jungfrau zu danken für diese neue Heimat, die ich gefunden hatte. Darauf kehrte ich wieder in das Wohnzimmer zurück, wo Fräulein Perras mir ein Glas Wein und ein Stück Savoyerbrot auftrug, ein Leckerbissen, den man damals in jedem besseren Hause Kanadas zu servieren pflegte. Sie versicherte mir, es habe ihren Bruder und sie außerordentlich gefreut, als sie hörten, dass ich zu ihnen kommen würde; sie habe meine Mutter schon vor deren Verheiratung gekannt und habe einst glückliche Tage in ihrer Nähe verlebt. Dies interessierte mich sehr; denn meine Mutter, die leider schon seit mehreren Jahren tot war, konnte ich nie vergessen.
Bald kam auch der Priester von seinem Besuch zurück. Es ist unbeschreiblich, was ich fühlte, als ich diesen Mann zum ersten Mal sah. Die Israeliten können Moses nicht mit größerer Ehrfurcht angeschaut haben, als er vom Berge Sinai herunterkam. Pfarrer Perras war aber auch eine imponierende Gestalt, fast ein Riese. Kein Offizier, ja kein König konnte sein Haupt würdevoller tragen als er.
Dabei verliehen aber seine blauen Augen seinen Gesichtszügen einen milden Ausdruck. Trotz der 65 Winter, die schon über sein Haupt gegangen waren und die dort etliche ihrer weißen Spuren hinterlassen, hatte doch sein Haar noch seinen goldenen Glanz behalten. In seinem Angesicht spiegelten sich Frieden, Frömmigkeit und Freundlichkeit wieder, wodurch mein Herz sofort gewonnen wurde. Als er mit lachendem Munde mir seine offenen Arme entgegenstreckte, da wusste ich nicht, wie mir geschah; ich fiel zu seinen Füßen nieder und rief aus: »Gott sendet mich zu Ihnen, damit Sie mein Lehrer und Vater sein möchten. Sie sind von Ihm dazu ausersehen, mich in das heilige Amt einzuführen. Bitte, segnen Sie mich und beten Sie für mich, dass ich ein ebenso guter Priester werde, wie Sie es sind!«
Diese unerwartete Begrüßung überraschte Herrn Perras so, dass er kaum antworten konnte. Er richtete mich auf und drückte mich an seinen Busen; dann sprach er mit zitternder Stimme: »Gott segne Sie, mein lieber Freund, und Er sei dafür gepriesen, dass Er Sie zu meinem Gehilfen erwählt hat, der mir in meinen alten Tagen die Bürde des heiligen Amtes tragen helfen soll!« Hierauf hatten wir eine höchst interessante Unterredung von etwa einer halben Stunde; dann führte mich der Pfarrer in seine Bibliothek, die reichlich mit den besten Büchern ausgestattet war, welche ein katholischer Priester lesen darf. »Diese Bücher«, sagte er, »stehen Ihnen zu Diensten.«
Am andern Morgen nach dem Frühstück händigte mir mein neuer geistlicher Vater und Berater ein Papier ein, das mit einem lateinischen Spruch überschrieben war: Ordo ducit ad Deum (Ordnung führt zu Gott). »Wollen Sie so gut sein«, sagte er zu mir, »und dieses Pensum durchlesen und mir dann sagen, was Sie davon halten. Ich habe nämlich gefunden, dass eine regelmäßige Zeiteinteilung für Leib und Seele sehr nützlich ist, und es sollte mich freuen, wenn auch Sie, mein junger Gehilfe, sich mit mir vereinigen würden zu einem geordneten christlichen Leben.«
Ich las das Pensum durch und erklärte mich mit Freuden bereit, dessen Zeiteinteilung zu befolgen. Es lautete: 1. Auf stehen 5.30 Uhr morgens;
2. Gebet und Sammlung 6.00-6.30;
3. Messe, Beichtehören und Gebetablesen 6.30-8.00;
4. Frühstück 8.00 Uhr;
5. Krankenbesuche und Lektüre des Lebens der Heiligen 8.30-10.00;
6. Studium von philosophischen, historischen oder theologischen Büchern 10.00-12.00;
7. Mittagessen 12.00 Uhr;
8. Erholung und Unterhaltung 12.30-1.30.
9. Hersagen der Vesper l.30-2.00;
10. Studium der Geschichte, Theologie oder Philosophie 2.00-4.00 Uhr;
11. Besuch beim heil. Sakrament und Lesen der »Nachfolge Christi« 4.00-4.30.
12. Beichtehören, Krankenbesuch oder Studium 4.30-6.00;
13. Nachtessen 6.00-6.30;
14. Erholung 6.30-8.00;
15. Rosenkranz, Lesen der Heiligen Schrift und Gebet 8.00-9.00; zu Bette gehen 9.00 Uhr.
Innerhalb dieser Ordnung verlief unser tägliches Leben während der acht Monate, die ich bei dem verehrten Pfarrer Perras zubringen durfte. Nur an den Donnerstagen wichen wir von dieser Ordnung ab, da wir an diesem Tage regelmäßig eine der benachbarten Pfarreien zu besuchen pflegten. Die Sonntage waren selbstverständlich dem Beichtehören und den öffentlichen Gottesdiensten der Kirche geweiht.
Die Unterhaltung mit Herrn Perras war meist sehr lehrreich. Niemals hörte ich unnütze oder gar frivole Reden von ihm, wie man sie sonst von Priestern vielfach vernimmt. Er war sehr belesen in der katholischen Literatur, Geschichte, Philosophie und Theologie. Überdies konnte er mir aus seiner reichen Erfahrung vieles mitteilen; hatte er doch fast alle Priester und Bischöfe persönlich gekannt, die in den letzten 50 Jahren in Kanada gewirkt hatten. Er wusste eine Menge Anekdoten aus dem Leben dieser Kleriker. Ich will hier nur einer sehr ernsten Unterredung Erwähnung tun, die ich mit ihm hatte.
Ich war noch nicht lange in St. Charles, als ich erfuhr, dass mein Vorgänger im Vikariat daselbst sich mit einem seiner Beichtkinder, einer hübschen Tochter, auf und davon gemacht hatte. Nach drei Monaten kam die Tochter reumütig zu ihren tiefgebeugten Eltern zurück. Fast um dieselbe Zeit, wo mir dieser Fall bekannt wurde, verging sich der Priester einer benachbarten Pfarrei, auf den ich große Stücke gehalten hatte, ebenfalls auf eine schändliche, wenn auch weniger offenkundige Weise mit einem seiner Pfarrkinder. Diese beiden Skandalgeschichten betrübten mich außerordentlich; ich schämte mich so sehr, dass ich mich gar nicht mehr unter den Leuten zeigen mochte, und es reute mich fast, dass ich ein Priester geworden war. Mehrere Nächte konnte ich nicht mehr schlafen, und essen mochte ich auch nichts mehr. Die Lust zu Unterredungen mit meinem Pfarrherrn war mir gänzlich vergangen, ich hätte überhaupt am liebsten ganz geschwiegen.
Dies fiel meinem Vorgesetzten auf. »Sind Sie krank, mein junger Freund?« fragte er mich eines Tages.
»Nein, nicht krank, aber traurig«, entgegnete ich.
»Kann ich den Grund Ihrer Traurigkeit vielleicht erfahren?« forschte er. »Ich möchte Sie gerne wieder fröhlich sehen; bitte, sagen Sie mir, was Ihnen fehlt! Ich bin ein alter Mann und kenne viele Heilmittel für Leib und Seele. Öffnen Sie mir also nur getrost Ihr Herz!«
Ich sagte ihm offen, was mich so traurig gestimmt habe und bekannte, dass ich ernstlich besorgt sei um unsere heilige Kirche in Kanada, die doch auf die Dauer nicht fortbestehen könne, wenn ihre Priester so schwach seien und so wenig Gottesfurcht besäßen.
»Mein teurer Freund«, antwortete der Pfarrer, »unsere heilige Kirche ist unfehlbar; die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen, wie Jesus Christus es ihr verheißen hat. Der Bestand der Kirche hängt nicht von irgendeiner menschlichen Grundlage ab, sondern von der Verheißung ihres Herrn. Sonst wäre sie ja längst untergegangen, schon in jenen mittelalterlichen Zeiten, wo eine ganze Reihe von Päpsten lebte, die sich der ärgsten Verbrechen schuldig machten. Ein Borgia, ein Alexander VI. und andere mehr, die alle auf dem Stuhl Petri saßen, die würden heute ohne Erbarmen durch den Scharfrichter von Quebec gehängt, wenn sie in dieser Stadt nur die Hälfte von all den Mordtaten, Ehebrüchen und Ausschweifungen begingen, deren sie sich in Rom schuldig gemacht haben, in Avignon und in Neapel. Wenn unsere Kirche«, so schloss mein Pfarrer seine in viele Details eingehende geschichtliche Belehrung, »wenn die heilige römische Kirche imstande war, durch all diese Stürme unversehrt hindurch zu kommen, ist das dann nicht ein sicherer Beweis dafür, dass Christus selbst ihr Steuermann und dass sie unzerstörbar und unfehlbar ist, weil St. Petrus ihr Fundament bleibt, zu welchem der Herr gesagt hat: ,Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen’!«
Was sollte ich hierauf antworten? In meinem Herzen hieß es während all diesen Erklärungen des Priesters: »Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen – An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!« Gerne hätte ich meinem Vorgesetzten dieses Wort vorgehalten; aber ich war gelehrt worden, das Urteil meiner Obern über die Stimme meines Gewissens zu setzen, und so muss ich zu meiner Schande bekennen, dass ich es nicht wagte, meiner eigenen Überzeugung Ausdruck zu verleihen.
Die Verbrennung des »Kanadier«
Die kanadischen Patrioten Papineau, Lafontaine, Bedard, Cartier und andere, die in den Dreißiger Jahren viel von sich reden machten, sind zwar geborene Katholiken gewesen, aber sie hielten sich nur dem Namen nach zur römischen Kirche. Ich kannte sie alle persönlich und weiß, dass sie nicht zu beichten pflegten. Wiederholt forderte ich sie auf, diese religiöse Pflicht zu erfüllen, die ich damals für unerlässlich hielt zur Seligkeit. Sie beantworteten solche Aufforderungen aber jedes Mal mit spöttischen Bemerkungen, die mir zeigten, dass sie nicht an die Wirksamkeit der Ohrenbeichte glaubten. Dabei machten aber diese Männer ehrliche und ernstliche Anstrengungen, um ihre französischen Landsleute von dem bedeutend niedrigeren Niveau emporzubringen, welches dieselben im Vergleich zu der englischen Rasse einnahmen, die siegreich in Kanada eingedrungen war. Sie sahen wohl ein, dass wenn die französischen Kanadier den britischen einigermaßen ebenbürtig werden sollten, man dem Volke vor allen Dingen gute Schulen geben müsse.
In diesem Bestreben nun, dem Volke eine bessere Bildung zu verschaffen, stießen unsere Patrioten auf den entschiedenen Widerstand der Priester. Diese wussten nämlich nur zu gut, dass die Macht, die sie über das Volk hatten, wesentlich von dessen Unwissenheit abhing. Sie sahen voraus, dass ihr Einfluss in dem Masse schwinden müsste, als Aufklärung und Bildung sich unter dem Volke verbreiten würden. Volksschulen gab es damals nur in einigen wenigen hervorragenden Gemeinden, und diese standen ausschließlich unter der Kontrolle der Priester. Lehrer konnte an einer solchen Schule nur werden, wer ein ganz ergebener Knecht der Priester war. Der größte Teil dieser Lehrer konnte nicht viel mehr als das ABC lesen und etwa noch den kleinen Katechismus. Mehr wurde natürlich auch den Schülern nicht beigebracht; das wenige, was sie gelernt hatten, vergaßen sie nach ihrer ersten Kommunion bald wieder, und so konnten von 100 französischen Kanadiern kaum 95 ihren eigenen Namen schreiben! In manchen kanadischen Gemeinden waren außer dem Pfarrer, Lehrer und Notar kaum ein halbes Dutzend Leute imstande, einen Brief zu lesen oder zu schreiben, Papineau brachte als Volksvertreter diese Übelstände im Parlament zur Sprache. Die Priester widersprachen ihm heftig, sowohl von den Kanzeln herunter, als in den Zeitungen. Sie behaupteten, Kanada habe das denkbar beste Erziehungssystem, das Volk fühle sich wohl dabei, zu viel Bildung würde in Kanada dieselben bitteren Früchte zeitigen wie in Frankreich, nämlich Unglauben, Revolution, Aufruhr und Blutvergies- sen. Auch sagten sie, die Kanadier seien zu arm, umso hohe Steuern zahlen zu können, wie sie ein entwickeltes Schulwesen notwendig zur Folge haben müsste. Papineau blieb die Antwort nicht schuldig. »Das arme Volk«, sagte er in einer seiner Reden, »muss ungeheure Summen opfern zur (damals in Kanada üblichen) Vergoldung der Kirchen.« Er legte dar, welch hohe Abgaben das Volk den Priestern zu entrichten habe, wie viel die Heiligenbilder und -Statuen kosteten, die man damals massenhaft in den Kirchen aufstellte, wie viel besser es doch wäre, wenn man das auf so unnütze Dinge verwendete Geld zur Einrichtung von Schulen und zur Anstellung anständiger Lehrer gebrauchen würde.
Der »Kanadier«, das einzige französische Blatt von Quebec, druckte diese Rede ab und verbreitete sie im ganzen Lande. Das war ein harter Schlag für die kanadische Priesterschaft. Von allen Kanzeln herab wurde Papineau als ein Ungläubiger verschrien, dessen Partei gefährlicher sei als die Protestanten. Man beriet sich, wie man das Volk vom Lesen des »Kanadier« abhalten könne. In St. Charles hatte das Blatt nicht mehr als ein halbes Dutzend Abonnenten; aber diese pflegten es an Sonntagnachmittagen ihren Nachbarn vorzulesen. Wir versuchten nun zuerst im Beichtstuhl die Leute zu überreden, dass sie den »Kanadier« refüsieren möchten, indem wir ihnen sagten, es sei ein schlechtes Blatt, das gegen die Priester agitiere und die Zerstörung unserer heiligen Religion bezwecke.
Als diese Vorstellungen nicht den gewünschten Erfolg hatten, griffen die Priester zu einem andern Mittel, um den Glauben ihrer Herden zu erhalten. Der Posthalter von St. Charles war ein Mann, den Herr Perras, mein Vorgesetzter, im Seminar zu Quebec auf seine eigenen Kosten hatte ausbilden lassen. Derselbe war infolgedessen ein ganz gefügiges Werkzeug in den Händen des Priesters. Herr Perras verbot ihm einfach, er dürfe den »Kanadier« den Abonnenten nicht mehr zustellen, sobald er bemerke, dass das Blatt irgendetwas Ungünstiges gegen die Priester enthalte. Er solle, so riet ihm der Pfarrer, die Blätter in diesem Fall nur ihm übergeben, damit er sie verbrennen könne; die Reklamationen der Abonnenten könne er ja ausweichend beantworten, so dass diese meinten, die Schuld liege entweder an dem Herausgeber oder an einer andern Poststelle. Der Posthalter erfüllte getreulich den Wunsch seines Pfarrers, und dieser steckte von da an nicht selten ein Packet Zeitungen in den Ofen.
Als ich eines Tages Zeuge einer solchen Ketzerverbrennung war, erlaubte ich mir, meinem Pfarrer gegenüber folgende Bemerkung zu machen: »Verzeihen Sie«, sagte ich, »wenn ich meiner Verwunderung Ausdruck verleihe, dass Sie es wagen, den Abonnenten, die für ihre Blätter bezahlt haben, dieselben ohne ihre Einwilligung zu verbrennen. Haben wir hierzu ein Recht? Würde es nicht sehr schlimme Folgen für uns haben, wenn die Leute erführen, wo ihre Blätter hinkommen? Sie wissen, dass ich Sie sehr respektiere, meine Frage stelle ich auch nicht aus Mangel an Respekt; aber da ich ja selbst später als Pfarrer in den Fall kommen könnte, ähnlich handeln zu müssen, möchte ich doch wissen, welchen Rechtsgrund Sie für Ihre Handlungsweise geltend machen können.«
»Sind wir nicht die geistlichen Väter unserer Gemeinden?« entgegnete mir der Priester.
»Gewiss!« bestätigte ich.
»Dann«, fuhr er fort, »haben wir auch in geistlichen Dingen dasselbe Recht, welches leibliche Väter in irdischen Angelegenheiten gegen ihre Kinder beanspruchen. Sieht nun ein Vater, dass sein Kind im Begriffe ist, sich mit einem scharfen Messer, welches es irgendwo erwischt hat, zu verwunden, so hat er doch nicht nur das Recht, sondern es ist seine Pflicht, ihm dieses gefährliche Werkzeug wegzunehmen.«
»Jawohl!« erwiderte ich; »aber das ist doch was anderes! Das betreffende Messer gehört sehr wahrscheinlich dem Vater, und das Kind hat sich dasselbe widerrechtlicher Weise angeeignet; aber in unserm Fall gehören die Blätter den Abonnenten, die dafür bezahlt haben; sie gehören uns weder nach göttlichem, noch nach menschlichem Recht.«
Diese Antwort machte den guten alten Priester so nervös, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. »Man sieht, dass Sie noch jung sind!« warf er mir hin; »Sie haben offenbar noch nicht viel über die Grundsätze unserer heiligen Kirche nachgedacht. Es mag ja sein, dass mein vorhin gebrauchtes Bild von dem Kind und dem Messer nicht ganz zutreffend ist; aber dann habe ich hier etwas anderes, was jedenfalls zutrifft!« Damit zog er einen Brief hervor, den er unlängst vom Bischof erhalten hatte. »Sehen Sie«, sagte er, »in diesem Schreiben billigt der ehrwürdige Bischof Panet mein Vorgehen und rät mir nur, recht vorsichtig zu sein, damit niemand merke, dass ich die Blätter verbrenne.«
»Das glaube ich gerne«, antwortete ich. »Aber wie, wenn der ehrwürdige Bischof sich geirrt hätte, indem er Ihr Vorgehen billigte? Müssten Sie es dann nicht schließlich doch noch bereuen, so gehandelt zu haben, namentlich wenn Sie entdeckt werden sollten?
»Es bereuen, dass ich dem Rat meines Vorgesetzten gehorcht habe? Wie können Sie auch so reden? Kennen Sie denn die Pflichten der Diener unserer Kirche gegen ihre Obern so schlecht, dass Sie meinen, ein Untergebener könnte sich je versündigen, wenn er sich den Anordnungen seiner Vorgesetzten unterwirft? Das hat man Ihnen doch gewiss im Priesterseminar nicht gesagt?«
»O nein!« entgegnete ich, »dort hat man uns freilich immer gelehrt, wir müssten uns ohne irgendwelches Bedenken den Befehlen der Obern fügen.«
»Sehen Sie«, sagte er, »und ich will Ihnen überdies beweisen durch die Worte eines unserer größten Theologen, dass ich kein Unrecht vor Gott begehe, wenn ich die Zeitungen meiner Pfarrkinder verbrenne.«