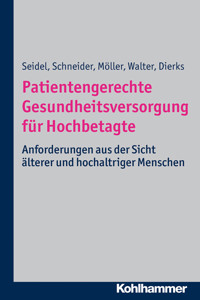
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Hochaltrige Patienten stellen eine neue, aber zunehmende Zielgruppe gesundheitlicher Versorgung in Deutschland dar. Die besonderen Bedürfnisse dieser Patienten zu verstehen ist daher sehr wichtig. Wie zufrieden sind sie mit der Versorgung? Was erwarten sie von ihren Ärzten? Welche Unterstützung brauchen sie und welche Vorstellungen haben sie selbst in Bezug auf Patientenautonomie, Information und Prävention? Das Buch greift diese Fragen auf und stellt die theoretischen Befunde sowie die Ergebnisse einer Interviewstudie mit Patienten und ihren Angehörigen praxisorientiert dar. Zahlreiche methodische Hinweise zur Durchführung von Interviews mit den Ältesten der Gesellschaft runden das Werk ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hochaltrige Patienten stellen eine neue, aber zunehmende Zielgruppe gesundheitlicher Versorgung in Deutschland dar. Die besonderen Bedürfnisse dieser Patienten zu verstehen ist daher sehr wichtig. Wie zufrieden sind sie mit der Versorgung? Was erwarten sie von ihren Ärzten? Welche Unterstützung brauchen sie und welche Vorstellungen haben sie selbst in Bezug auf Patientenautonomie, Information und Prävention? Das Buch greift diese Fragen auf und stellt die theoretischen Befunde sowie die Ergebnisse einer Interviewstudie mit Patienten und ihren Angehörigen praxisorientiert dar. Zahlreiche methodische Hinweise zur Durchführung von Interviews mit den Ältesten der Gesellschaft runden das Werk ab.
Dr. Gabriele Seidel, Susanne Möller und die Professorinnen Ulla Walter und Marie-Luise Dierks wirken am Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung an der Medizinischen Hochschule Hannover. Professor Dr. Nils Schneider leitet das Institut für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover.
Gabriele Seidel, Nils Schneider, Susanne Möller, Ulla Walter, Marie-Luise Dierks
Patientengerechte Gesundheitsversorgung für Hochbetagte
Anforderungen aus der Sicht älterer und hochaltriger Menschen
Verlag W. Kohlhammer
Wichtiger Hinweis
Pharmakologische Daten verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autor haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Gewährleistung können Verlag und Autor hierfür jedoch nicht übernehmen. Daher ist jeder Benutzer angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2013 Alle Rechte vorbehalten © 2013 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-021687-7
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-023806-0
epub:
978-3-17-027462-4
mobi:
978-3-17-027463-1
Danksagung
Wir bedanken uns beim Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung für die Förderung des Projekts im Rahmen des Programms »Niedersächsisches Vorab«. Namentlich danken wir Herrn Heinz Marciniak, Forschungsförderung im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, für die gute Zusammenarbeit und Begleitung des Projekts.
Ein besonderer Dank gilt unseren Kooperationspartnern in den geriatrischen Kliniken. Stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns dort unterstützt haben, möchten wir die Chefärzte erwähnen: Herrn Dr. Martin Stolz, MPH (Salze Klinik Bad Salzdetfurth), Herrn Prof. Dr. Klaus Hager (Henriettenstiftung) und Herrn Dr. Peter Bernhardt sowie seine Nachfolgerin Frau Dr. Cornelia Schnittger (Geriatrie Langenhagen im Klinikum Region Hannover). Weiteren Dank widmen wir den Selbsthilfekontaktstellen, Gesundheitszentren, gerontopsychiatrischen Beratungsstellen und Pflegediensten, die uns bei der Rekrutierung der Angehörigen von hochbetagten Patienten unterstützt haben.
Ganz besonders herzlich bedanken wir uns bei allen Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen, die an unseren Befragungen teilgenommen haben. Der Austausch mit ihnen war auch für uns persönlich sehr bereichernd.
Zuletzt sei hier auch allen Mitwirkenden gedankt: Dr. med. Peter Bernhardt, Dr. phil. Kurt Buser, Karsten Hagemeyer, Prof. Dr. med. Klaus Hager, Caroline Krugmann, M.A., MPH, Vivien Kurtz, MPH, Dr. med. Christiane Müller, Anke Neuber, Nikolas Pilitsis, Tanja Schmidt, Dr. med. Cornelia Schnittger, Martin Schumacher, MPH, Dr. med. Martin Stolz, MPH, Nicole Teichler, Jennifer Wrede, MPH und Olaf Wormuth.
Im Namen aller Mitwirkenden, das Projektteam Gabriele Seidel, Nils Schneider, Ulla Walter und Marie-Luise Dierks
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Hintergrund
1.1 Das Ungleichgewicht in der Geschlechterproportion im hohen Alter
1.2 Gesundheit, Altern und Krankheiten
1.3 Strukturen der ambulanten gesundheitlichen Versorgung älterer Menschen
1.3.1 Ambulante ärztliche Versorgung
1.3.2 Ambulante pflegerische Versorgung
1.3.3 Soziale, informelle Netzwerke für Hochaltrige
1.3.4 Der Stellenwert von informellen Unterstützungssystemen: Privat erbrachte Pflege- und Hilfeleistungen
1.3.5 Öffentliche gesundheitsbezogene und soziale Versorgungssysteme
1.3.6 Das Verhältnis von formeller sowie informeller Hilfe und Unterstützung
1.4 Patientenbedürfnisse, Kommunikation und die Arzt-Patienten-Beziehung
1.4.1 Shared-decision-making (SDM)
1.4.2 Kommunikationsverhalten der Ärztinnen und Ärzte
1.5 Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
2 Die Studie
2.1 Studienteil A: Befragung von hochbetagten Patienten
2.2 Studienteil B: Befragung von Angehörigen hochbetagter Patienten
3 Studienteil A – Phase 0
3.1 Phase 0 – Qualitative Vorstudie
3.1.1 Qualitative Interviews
3.1.2 Prozessbeobachtung
3.1.3 Erfassung von Patientendaten
3.1.4 Rekrutierung der Teilnehmer für die Interviews
3.1.5 Auswertung der Daten aus der qualitativen Phase I
3.2 Ergebnisse der qualitativen Interviews und Schlussfolgerungen für Phase I
3.2.1 Beschreibung der Untersuchungsgruppe
3.2.2 Inhaltsanalytische Auswertung der Interviewergebnisse
3.2.3 Lebenseinstellungen der Befragten
3.2.4 Struktur und Organisation des Lebensalltags vor und nach dem Ereignis »Erkrankung«
3.2.5 Präventives Verhalten vor dem Ereignis – Aspekte der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden
3.2.6 Bewertung der aktuellen Behandlungssituation und Erfahrungen mit der Zusammenarbeit unterschiedlicher Versorgungseinrichtungen
3.2.7 Die Arzt-Patient-Beziehung
3.2.8 Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem
3.2.9 Umgang mit Informationen
3.2.10 Patientenrechte
3.2.11 Ein guter Rat für Gesundheit und Vorsorge aus der Sicht der Befragten
4 Studienteil A – Phase I, teilstandardisierte Interviews
4.1 Entwicklung des (teil-)standardisierten Instruments
4.2 Pretest
4.3 Ergänzende Dokumentationsinstrumente
4.4 Die Interviewer
4.4.1 Schulung der Interviewer
4.5 Durchführung der Befragung zu T1
4.6 Datenauswertung in Phase I
4.7 Ergebnisse zu T1
4.7.1 Prozessprotokolle – Wahrnehmungen der Interviewer während der Durchführung der Befragungen
4.7.2 Dauer der Befragung
4.7.3 Charakteristika der Untersuchungsgruppe
4.7.4 Informelle und professionelle Unterstützungen vor dem Klinikaufenthalt und Art der Unterstützung
4.7.5 Freizeitbeschäftigung und gesellschaftliche Aktivitäten
4.7.6 Zufriedenheit mit der sozialen und hauswirtschaftlichen Versorgung
4.7.7 Einstellung zum Leben
4.7.8 Präventionsverhalten – Impfungen, Selbstmedikation und Genussmittel
4.7.9 Hochaltrige Patienten und ihre Ärzte im ambulanten Bereich
4.7.10 Patientenrechte
4.7.11 Informationsverhalten
4.7.12 Erfahrungen mit Veränderungen im Gesundheitswesen
4.7.13 Vertrauen in die Gesundheitsversorgung
4.7.14 Das Wichtigste in der Gesundheitsversorgung aus der Sicht der Befragten
5 Studienteil A – Phase II, teilstandardisierte Befragung in häuslicher Umgebung – (T2)
5.1 Entwicklung des (teil-)standardisierten Instruments zur persönlichen Folgebefragung zu T2
5.2 Durchführung der Befragung zu T2
5.2.1 Rekrutierung der Teilnehmer für die Befragung
5.2.2 Vorgehen in der Befragung
5.2.3 Prozessprotokolle – Wahrnehmungen der Interviewer während der Durchführung der Interviews zu T2
5.3 Auswertung der Folgebefragung zu T2
5.4 Ergebnisse zu T2
5.4.1 Stichprobe im Vergleich T1 zu T2
5.4.2 Stichprobencharakterisierung
5.4.3 Informelle und professionelle Unterstützungen nach dem Klinikaufenthalt
5.4.4 Gesellschaftliche Aktivitäten
5.4.5 Ernährung
5.4.6 Veränderungen des Lebens nach dem Rehabilitationsaufenthalt
5.4.7 Rechtliche Vorsorge im Alter vor und nach dem Rehabilitationsaufenthalt in der Klinik
5.4.8 Zufriedenheit mit der sozialen und hauswirtschaftlichen Versorgung
5.4.9 Ambulante Versorgung
6 Studienteil B – Befragung von Angehörigen hochaltriger Patienten
6.1 Durchführung der qualitativen Interviews
6.2 Rekrutierung der Teilnehmer für die Interviews
6.3 Auswertung der qualitativen Phase zu T3
6.4 Ergebnisse der qualitativen Erhebung zu T3
6.4.1 Beschreibung der Untersuchungsgruppe
6.4.2 Inhaltsanalytische Auswertung der Interviewergebnisse
6.4.3 Gesundheitszustand der befragten Angehörigen
6.4.4 Angaben zum Gesundheitszustand der Angehörigen der Befragten
6.4.5 Art der Unterstützung
6.4.6 Belastung der Befragten durch die Betreuung ihrer hochbetagten Angehörigen
6.4.7 Zufriedenheit mit der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung
6.4.8 Verbesserung der Versorgung von hochbetagten Menschen
6.4.9 Autonomievorstellungen der Befragten
6.4.10 Vorsorgeregelungen
6.4.11 Informationsverhalten der Befragten
6.4.12 Vorstellungen über eigene Versorgung im Alter
7 Zusammenfassendes Fazit
7.1 Die Sicht der Hochbetagten
7.2 Die Sicht der nachfolgenden Generation
7.3 Versorgung im Alter: Autonomie, Zeit, Persönlichkeit
7.4 Befragungen alter und hochaltriger Menschen – gute Machbarkeit bei hohen methodischen Anforderungen
8 Interviews mit Hochbetagten – Erfahrungen und Empfehlungen
8.1 Aufgaben von Hochbetagten während eines Interviews
8.2 Teilnahmebereitschaft von hochbetagten Probanden
8.3 Interview als Interaktion
8.4 Der Interviewer
8.5 Regeln zur Erstellung eines Befragungsinstruments
8.6 Stärkung der Validität der Ergebnisse durch weitere Datenquellen
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Mit dem vorliegenden Buch, das die Ergebnisse einer mehrjährigen Studie in Niedersachsen bündelt, sind zwei wichtige Ziele verbunden. Zum einen werden die Erfahrungen, Wünsche und Forderungen hochbetagter Patienten und ihrer Angehörigen an eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung auf der Basis diverser Befragungen vorgestellt. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten und Grenzen der Forschung mit hochbetagten Menschen erörtert.
Die Gestaltung der künftigen Gesundheitsversorgung für hochbetagte Menschen gewinnt angesichts der demografischen Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Damit einher geht ein erheblich verändertes Morbiditätsspektrum mit einer weiteren Zunahme von chronischen Erkrankungen und Multimorbidität (Kap. 1). Für die Gesundheits- und Sozialdienste (Kap. 1.3.1–1.3.2) bedeutet diese Entwicklung, die Versorgung und Betreuung älterer Menschen unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Ressourcen, Grenzen und persönlichen Wertvorstellungen zu gestalten. Dazu gehören vor allem der Ausbau präventiver und gesundheitsfördernder Ansätze, die Stärkung der Patientenautonomie (Kap. 1.4) und eine Optimierung der Versorgungsabläufe.
Wie sich die Betroffenen selbst – hochaltrige Patienten und Angehörige der nächsten Generation – eine gute Versorgung vorstellen und welche Wünsche und Erwartungen sie haben, wurde in Kooperation mit drei geriatrischen Kliniken in Niedersachsen erhoben. Die Studie umfasste unterschiedliche Phasen (Kap. 2). Zunächst wurden in einer qualitativen Vorphase leitfadengestützte, qualitative Interviews mit Hochaltrigen durchgeführt, um die Thematik aus Sicht der Betroffenen zu beleuchten und Erhebungsinstrumente für die Hauptphase zu entwickeln (Kap. 3). Zudem wurden die organisatorischen Rahmenbedingungen analysiert unter der Frage, wie die wissenschaftliche Studie bestmöglich in den Klinikalltag der beteiligten Einrichtungen integriert werden konnte.
Die Hauptphase des Projekts bestand aus drei Teilen: Im ersten Teil wurden 152 Patienten (Durchschnittsalter 85 Jahre, 74 % Frauen) während ihres stationären Aufenthaltes in einer der beteiligten geriatrischen Kliniken persönlich mit Hilfe eines standardisierten Instruments zu den Themenfeldern gesundheitliche Versorgung, Versorgungsabläufe, Lebenssituation, Prävention und Gesundheitsförderung sowie Patientenautonomie interviewt (Kap. 4). Um Veränderungen in den Lebensumständen, der Versorgungssituation und damit verbundene veränderte Anforderungen zu erfassen, wurden diese Patienten sechs Monate nach dem Klinikaufenthalt erneut, dieses Mal in ihrer häuslichen Umgebung, unter Verwendung eines modifizierten Instruments zu o. g. Themenfeldern befragt (Kap. 5).
Schließlich wurden 31 qualitative Interviews mit Angehörigen von Hochbetagten der nachfolgenden Generation (50+) durchgeführt (Kap. 6), um die Angehörigenperspektive zu Fragen der Versorgung im (hohen) Alter zu erforschen.
Im Kapitel 7 werden die Ergebnisse zusammenfassend diskutiert und Schlussfolgerungen für eine patientenorientierte zukünftige Gesundheitsversorgung formuliert.
Der Einsatz von persönlichen Befragungen bei hochaltrigen Menschen wirft zahlreiche Fragen auf, zumal diese Personengruppe bislang selten in Befragungsstudien einbezogen war. Deshalb wurden in der vorgestellten Studie Prozessbeobachtungen und Falldokumentation im Hinblick auf den Befragungsprozess selbst durchgeführt. Aus diesen Dokumenten lassen sich Empfehlungen zur Erhöhung der Teilnahmebereitschaft dieser Zielgruppe, zur Interviewdurchführung, zur Interviewerhaltung sowie zur Fragebogenerstellung ableiten (Kap. 8).
Vertiefende Ergebnisse der Studie können in einem Tabellen- und Grafikband auf der Internetseite des Instituts für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover abgerufen werden: https://www.mh-hannover.de/16208.html
Hannover, im Mai 2013
die Autoren
1 Hintergrund
Europa weist zurzeit weltweit den größten Anteil alter Menschen auf und wird diesbezüglich in den nächsten vier Jahrzehnten weiterhin Spitzenreiter bleiben (Schwartz und Walter 2003). Innerhalb der EU ist die demografische Entwicklung in Deutschland am meisten fortgeschritten: 2010 waren 20,7 % der Bevölkerung 65 Jahre und älter. Im Jahre 2030 wird dieser Anteil auf 29 % ansteigen, jeder zweite neugeborene Junge wird dann mindestens 87 Jahre, jedes zweite neugeborene Mädchen mindestens 91 Jahre alt werden (Statistisches Bundesamt 2011). Besonders erhöhen wird sich die Zahl der Hochbetagten von derzeit (2010) 4,3 Millionen (5 %) auf ein Maximum von 10 Millionen im Jahr 2050. Jeder siebte Einwohner wird dann 80 Jahre und älter sein (Bundesministerium des Innern 2011, Eisenmenger et al. 2003).
Wenn von Hochbetagten die Rede ist, finden sich in der Literatur unterschiedliche Definitionen. In den Berichten des Statistischen Bundesamtes in Deutschland umfasst Hochaltrigkeit beispielsweise die Gruppe der 80-Jährigen und Älteren (Statistisches Bundesamt 2009b). Im Vierten Bericht zur Lage der älteren Generation in Deutschland wird von Hochaltrigkeit fließend ab dem 80. bis 85. Lebensjahr gesprochen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung wird inzwischen auch diskutiert, ob es sinnvoll ist, den definitorischen Beginn der Hochaltrigkeit weiter nach oben zu verschieben (BMFSFJ 2002, BMFS-FJ 2002). Schließlich ist die Bevölkerungsgruppe der Älteren infolge ihrer langen und sehr unterschiedlich verlaufenen biographischen Entwicklung besonders heterogen. Eine allein auf dem kalendarischen Alter basierende Einteilung wird ihrer Differenzierung deshalb nicht gerecht (Tesch-Römer und Wurm 2006). Auch bedeutet ein kalendarisches Alter jenseits des 80. Lebensjahres nicht zwangsläufig Krankheit, Abhängigkeit oder Isolation. Vielmehr beeinflussen Lebensstil, psychosoziale und sozioökonomische Parameter sowie das Gesundheitsverhalten im Lebenslauf Gesundheit und Krankheit im Alter (Saß et al. 2009a, 2009b).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























