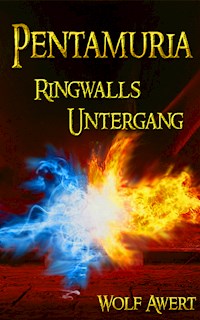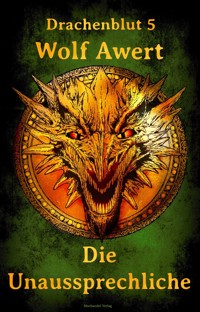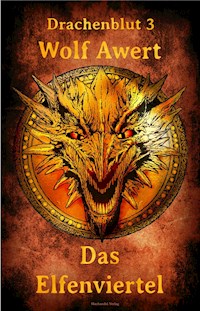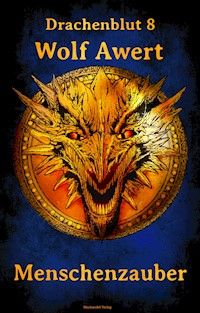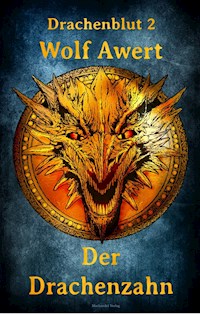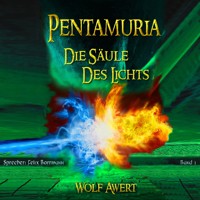9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Machandel Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Pentamuria: Eine der erfolgreichsten Fantasy Serien Deutschlands "Es wird nichts mehr so sein wie zuvor. Wo Städte waren, wird Ödland sein. Wo Ödland war, werden Früchte wachsen. Wer einmal geherrscht hat, muss dienen, und wer bisher diente, wird herrschen." Pentamuria, die Welt der fünf Königreiche, befindet sich im Wandel. Die Macht der Magier und der Adeligen wird bedroht. Krieg steht den Magiern bevor,doch wann und gegen wen, das wissen sie nicht. Darum sammeln sich die Magier in ihrer Hauptstadt, Ringwall, um sich gemeinsam auf jeden nur denkbaren Feind vorzubereiten. In diesen Tagen wird das Findelkind Nill von Druiden entdeckt. Seine magischen Fähigkeiten sind beachtlich, und so bringt man ihn nach Ringwall, wo er zusammen mit anderen Schülern zum Magier ausgebildet werden soll. Noch ahnt niemand, dass ausgerechnet in Nills Kräften der Schlüssel zum Schicksal Pentamurias liegen könnte. Hintergrund: Die Welt Pentamuria besteht aus 5 Königreichen, die auf den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft und Metall basieren und ist inspiriert von den verschiedensten fernöstlichen Philosophien. Unzählige magische Fraktionen mit ganz unterschiedlichen Zielen und Vorstellungen streiten um die Vorherrschaft. Während die Magier nach maximaler Macht streben, versuchen andere Fraktionen im Einklang mit Natur und Magie zu leben. Abgeschlossene High-Fantasy Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Pentamuria-Saga
Band 1-3
Wolf Awert
zuerst erschienen bei Zaptos Media 2016
Cover Zaptos Media
Machandel Verlag Charlotte Erpenbeck
49740 Haselünne
2020
ISBN 978-3-95959-170-6
Pentamuria-Saga Band 1
Die Macht der Magier
Kapitel I
Es waren hartgesichtige, wortkarge Männer, die sich einen Weg durch die von Alderbäumen beschatteten Pickwudd-Sträucher bahnten. Gebüschgruppen wie diese wurden hin und wieder von Hirten aufgesucht, wenn schlechtes Wetter sich zusammenbraute oder sich die Gelegenheit ergab, an einem ruhigen Tag ein paar Beeren zu sammeln. Nicht, dass man von einer Handvoll Beeren satt wurde, aber in einem Land, wo jeder Bissen hart erarbeitet werden musste, war alles, was ein wenig Süße in den Tag brachte, eine Kostbarkeit.
Es hieß später, magische Kräfte hätten die Ramsmänner an diesen Ort geführt und für viele war das sogar Gewissheit. Vielleicht war es aber auch nichts Weiteres als eine glückliche Fügung, dass sie gerade an diesem Tag in der Nähe waren. Denn die Herden wurden, war das Gras erst einmal abgeweidet, stets an einen anderen Ort getrieben und niemand außer den Ramsmännern selbst kannte die Routen und die Abfolge, in der die verschiedenen Weideplätze besucht wurden.
Ein Junge irrte zwischen den Sträuchern umher, blieb hier und dort stehen, als lausche er einer leisen Stimme und kümmerte sich nicht weiter um die Männer. Gemessen an seiner Größe konnte er kaum älter als vier Ernten sein. Seine wetterfeste Reisekleidung spannte sich über mehrere Lagen einer umfangreichen Unterkleidung, sodass er ein wenig rundlich wirkte. Die Kleidung zeigte Kratzer und merkwürdige Verfärbungen und schien einiges mitgemacht zu haben, aber sie war nur wenig zerrissen und kaum verschmutzt. Das Leder war fein und von einer Qualität, die selbst in diesem Teil des Landes, wo das Gerben von Häuten auf eine lange Tradition zurückblicken konnte, nur selten gefunden wurde. Mitten auf dem Brustleder, kaum versteckt von zwei kleinen Händen, ruhte ein mächtiges Amulett, dessen Band sich irgendwo zwischen Hals und Kragen verfangen hatte.
Roddick war der Älteste der Ramsmänner. Er war es, den die Augen der Männer suchten, wenn die Gruppe vor einer Entscheidung stand, und er sprach das erste Wort. Roddick hockte sich vor den Jungen hin und blickte auf das Amulett. Alles, was er sah, war eine einfache in der Mitte verdickte Holzscheibe, die über und über mit feinen Schnitzereien versehen war. Obwohl das Kind anscheinend eine Zeit an dem Holz herumgelutscht hatte, waren außer einigen Speichelflecken keinerlei Abnutzungsspuren zu erkennen. Was immer das für ein Holz war, es musste sehr hart sein. Und es stammte nicht aus dieser Gegend.
Ramsmänner waren Leute der Natur. Roddick, der jede Pflanze und jedes Tier in der näheren und weiteren Umgebung kannte, wog das Holz behutsam in seiner Hand. Es war zu schwer für seine Größe, die Farbe war ihm unvertraut und die Maserung fremd. Sein Blick fand nicht die vertrauten Ringe eines quer geschnittenen Holzes. Stattdessen folgte es schön geschwungenen Wirbeln, die sich um einige Augen der Ruhe schlangen. Die Schnitzarbeit war reich, wenn auch einfach, aber nicht von der Art, wie Menschen sie anfertigten, wenn sie abends nach der Arbeit am Feuer saßen. Fast jeder Ramsmann trug einen Anhänger um den Hals. Auch Roddick. Er hatte seinen aus dem Fersenbein eines Mulch geschnitten, dem ersten Stück Wild, das er selbst erlegt hatte. Er nannte es sein Amulett, glaubte sogar ein wenig an seinen Glücksbringer. Aber ein richtiges Amulett war es trotz allem nicht. Um ein Amulett zu schaffen, bedurfte es magischer Kräfte. Nur der Schultheiß des Dorfes besaß ein richtiges Amulett und trug es als Zeichen seiner Kraft offen über seinem Wams. Wer ein Amulett besaß, war von Rang und dazu ausersehen, über das einfache Volk zu herrschen. Es war stets ein Kundiger der Magie, auch wenn er seine Fähigkeiten nur selten beweisen musste. Möglicherweise nannte auch Esara, von der man wusste, dass sie über geheimnisvolle Kräfte verfügte, ein Amulett ihr Eigen. Aber wenn, dann hielt sie es, wie so vieles, verborgen.
Rätselhafter noch als die Holzscheibe war das geflochtene Band, an dem sie hing. Roddick konnte acht sorgsam gefettete Schnüre unterscheiden, die sich in einem komplizierten Muster, zu einem Strang verflochten, zusammenfanden. Vor dem Holz endeten sie in einem Sternknoten, dessen weiche Zacken wie eine schützende Hand über die obere Kante der Holzscheibe griffen. Roddick hatte gehört, dass die Männer des Wassers aus Schnüren kunstvolle Figuren knoteten. Gesehen hatte er so etwas allerdings noch nie, noch wusste er, welcher Sinn dahinter wohnte. Aber keine Kunst entwickelt sich ohne Sinn, auch wenn sich der Sinn nicht immer sofort erschließt. Der Sternknoten sah aus wie eine offene Blüte mit acht Blütenzipfeln, in deren Mitte sich ein kleiner halbkugelförmiger Hügel erhob.
Roddick hob die sternförmigen Blütenblätter des Knotens etwas an und entdeckte darunter einen einzelnen, fast durchsichtigen, dünnen Faden, der aus der Aufwölbung des Knotens in die Holzscheibe hineinführte. Roddick schüttelte den Kopf. Es sah so aus, als könne man das Holz mit einem festen Ruck vom Band losreißen. Vorsichtig zupfte er ein wenig an dem dünnen Faden, um dessen Widerstandsfähigkeit zu prüfen. Der Faden bewegte sich und schnitt in das Horn seiner Fingerkuppen ein. Roddick verstand weder das Holz noch das Band und auch eine Pflanze, aus der sich ein unzerreißbarer Faden spinnen ließ, hatte er noch nie gesehen. Hier verbarg sich etwas, das seiner Welt fremd war.
Vorsichtig wand er dem Jungen die Holzscheibe aus den Fingern und schob sie tief unter dessen innerstes Hemd. Der Fund eines Kindes in der Wildnis war schon außergewöhnlich genug und würde im Dorf für viel Aufregung sorgen. Roddick sah keinen Sinn darin, diese Aufregung durch das Geheimnis eines rätselhaften Amuletts noch weiter zu steigern. Die Ramsmänner folgten Roddick, weil er wusste, was zu tun war und weil seine klugen Worte selbst Zauderer und Zweifler überzeugen konnten. Doch dieses Mal hütete sich der Führer der Ramsmänner, auch nur ein Wort zu sagen. Manchmal geschehen die wichtigsten Dinge im Leben besser unbemerkt und unerkannt.
Die Männer, die den Jungen gefunden hatten, waren keine Männer großer Worte und nahmen das Kind mit in ihr Dorf. Es sträubte sich nicht. Nur sein Blick schien von einem unsichtbaren Punkt in der Ferne festgehalten zu werden.
Es war ein altes Sprichwort in Erdland, dass allein ein Gerücht den Wind überholen kann. Und so überraschte es die Männer nicht, dass sie daheim bereits erwartet wurden. Im Licht der tiefen Abendsonne standen die Familien in lockeren Gruppen vor ihren Hütten und blickten ihnen entgegen. Der Wind hatte sich gelegt und bereitete sich wie jeden Abend darauf vor, von den Hügeln wieder ins Tal hinabzuwehen, aus dem er während des Tages aufgestiegen war.
Roddick ließ den Jungen auf seinen Schultern reiten und schritt mit ihm den breiten, flach getrampelten Pfad hinunter, der in die Mitte des Dorfes führte und den Brunnen mit dem Dorfplatz verband. Die Menschen traten aus den Schatten ihrer Hütten und folgten Roddick und seinen Ramsmännern auf ihrem Weg zum Gerichtsbaum, wo sich bereits die andere Hälfte des Dorfvolkes unter der Führung des Schultheißen versammelt hatte. Roddick ging gemessenen Schrittes auf den großen Baum zu, dessen äußere, gewaltige Äste so schwer waren, dass sie sich auf dem Boden abstützen mussten. Das Vieh hatte hier nichts zu suchen und wurde mit Stockschlägen und Fußtritten vertrieben, wenn es sich zufällig dorthin verirrte. Denn der Dorfplatz mit dem Gerichtsbaum war ein heiliger Ort und ein öffentlicher Ort, an dem Entscheidungen getroffen wurden, die über die Zukunft des ganzen Dorfes bestimmten. Roddick ging die letzten Schritte allein. Die anderen Ramsmänner wie auch die Dorfleute hielten sich ehrfurchtsvoll zurück. Roddick wusste, dass ein Junge von vier Ernten schon zu alt war, um noch das Herz einer Frau zu rühren, die sich fast jedes Jahr um einen neuen Säugling kümmern musste, und noch zu jung, als dass er schon in irgendeiner Familie bei der Arbeit mithelfen konnte. Sie würden lange reden müssen an diesem Abend, denn es war für keine Familie einfach, ein weiteres hungriges Maul zu füttern. Vier Kindern ein fünftes hinzuzufügen, bedeutete weniger Milch, weniger Brot und weniger Käse für jedes der vier anderen. Und oft waren es nicht vier Kinder, sondern gleich acht oder gar zehn. Aber am Ende, da war sich Roddick sicher, würde das Dorf unter der Leitung ihres Schultheißen eine Lösung gefunden haben.
Der Junge hatte auf dem Weg ins Tal sein Lauschen eingestellt und blickte nun neugierig umher. Seine Augen blitzten unter dem hellen Haar und richteten sich kurz auf eine knochige Frau mittleren Alters, die nicht mit den anderen zusammen auf dem Dorfplatz stand, sondern fast unsichtbar im Schlagschatten eines Hauses zu verschwinden schien. In dem Augenblick, in dem Roddick das Kind dem Schultheiß übergab, trat sie in das braungelbe Licht der Abendsonne hinaus.
„Gebt ihn mir, ich werde mich um ihn kümmern.“
Ein Raunen ging durch die Gruppe, gleichermaßen erleichtert und missbilligend. Die Ankunft eines Kindes von fremdem Blut war keine kleine Angelegenheit, über die voreilig etwas beschlossen werden konnte. Jedermann wusste, dass Hast sich gern wie ein dunkler Schatten über wichtige Entscheidungen legte. Gebot es nicht die Sitte, zuerst einmal die Ramsmänner sprechen zu lassen und alle Einzelheiten und Umstände ihrer Entdeckung zu hören? Forderte nicht die Tradition, erst vieles zu bedenken und noch mehr zu erörtern? Die Dorfleute schauten auf die Frau, die jetzt ruhig neben dem Schultheiß stand, und mancher Blick war nicht ganz frei von Feindseligkeit. Wenn das Fremde in ein Dorf kam, wurde selbst die Alltäglichkeit zu einer öffentlichen Sache, die jeden betraf und mit allen besprochen werden musste. Hier und jetzt auf dem Dorfplatz. Und außerdem - wer hatte schon jemals davon gehört, dass eine Wahrsagerin ein Kind großzog?
Der Schultheiß hob die Hand und das Gemurmel verstummte. Seine Blicke trafen sich mit denen der Wahrsagerin, durchdrangen den Jungen, streiften Roddick, den Ramsmann, und wanderten als Letztes über das Rund der Dorfbewohner, bis sie, zum Jungen zurückgekehrt, endlich zur Ruhe kamen. Er, der Schultheiß, war dafür verantwortlich, dass jeder nach den alten Traditionen und der magischen Ordnung des Landes den Platz bekam, der ihm zustand. Für das Fremde musste ein solcher Platz erst noch gefunden werden. Eine Aufnahme in die Dorfgemeinschaft mit einem Bruch von Tradition und Sitte zu beginnen, hieße die Ordnung zu missachten und bedeutete gleichzeitig ein schlechtes Omen für die Zukunft. Und so zögerte der Schultheiß, Esaras Wunsch zu entsprechen. Aber er war auch ein kluger Mann und wusste, dass manchmal etwas erst dann erstrebenswert wurde, wenn ein anderer es haben wollte. So fragte er mit klarer Stimme in den Abend hinein:
„Erhebt jemand außer Esara, der Wahrsagerin, Anspruch auf dieses Kind?“
Bevor auch nur irgendjemand seinen Mund öffnen konnte, sagte Esara ruhig und bestimmt: „Nein, es gibt niemanden in diesem Dorf, der einen Anspruch auf den Jungen erheben wird. Das Wissen über das Jetzt, über das Morgen und über das Band, das Jetzt und Morgen verbindet, ist mein.“
Noch nie hatte jemand Esara so sprechen hören und noch nie war Esara so unübersehbar gewesen, wie hier auf dem Platz unter dem heiligen Baum. Man hatte den Eindruck, sie füllte den halben Dorfplatz aus, wo sie doch sonst eher im Halbdunkel weilte. Und wenn sie doch einmal im hellen Tageslicht stand, glitten die Augen der Dorfbewohner meist eilig über sie hinweg, denn was man nicht sieht, kann einen nicht schrecken.
Esara blickte Roddick an und sagte streng: „Setz den Jungen ab, Roddick, er ist alt genug, selbst zu stehen.“ Sie nahm den Jungen bei der Hand, durchbrach den Ring der Dorfbewohner, der sich ihr nur widerwillig öffnete, und ging mit ihm zu ihrer Hütte am Rande des Dorfes.
Was hinter ihr zurückblieb, waren nachdenkliche Gesichter. Die Sonne war schon lange untergegangen, bis endlich alle Worte gesagt waren und der Dorfplatz seine nächtliche Ruhe wiedererlangt hatte.
So kam es, dass das Findelkind bei Esara der Wahrsagerin aufwuchs. Doch die dunklen Wolken, die sein ganzes Leben überschatten sollten, ließen sich nicht mit ausreichender Nahrung und einem sicheren Schlafplatz vertreiben. „Das Fremde muss zum Fremden und es wird Fremdes nach sich ziehen“, orakelten die alten Weiber des Dorfes und wussten, dass aus der Ferne selten etwas Gutes kam. Auch Esara war eines Tages, wie der Junge, aus dem Nichts erschienen, ohne Vergangenheit und ohne Wurzeln.
Esara schälte den Jungen als Erstes aus seiner Reisekleidung und warf ihm ein lockeres Nesselhemd über, das ihm noch viel zu groß war, gab ihm etwas zu essen und legte ihn schlafen. Lange hielt sie das Amulett in der Hand und lauschte. Das Holz war so still, wie ein Mund mit zusammengepressten Lippen. Der Mond hatte schon eine beträchtliche Strecke zurückgelegt, als sie endlich sagte:
„Es wird Zeit, dass auch du jetzt Deinen Schlaf findest.“
Sie rollte das Amulett in die Kleider des Kindes ein, legte das Bündel in einer Ecke der Hütte ab und bat die Wurzeln der Wisperweiden darüber zu wachen. Noch in derselben Nacht klapperten die Runenknochen auf der fünfeckigen Steinplatte der Prophezeiungen, als Esara unter dem einzigen Licht, das die sterbende Glut der Herdasche ihr schenkte, in die Zukunft zu schauen versuchte. Sie lächelte bei dem Gedanken, dass viele Unkundige glaubten, die Zukunft läge in den Zeichen, die sich nach jedem Wurf offenbarten. Nein, so einfach war das nicht. Diese Zeichen suchten nur die Verbindung zum Himmel, so wie jene Zeichen, die sich auf dem Stein zu verstecken schienen, die Erde grüßten. Der Kundige bedachte, wo die einzelnen Knochen auf dem Stein lagen und wer zu welchem Nachbarn hinüberschaute und ob man die Zeichen erst lesen konnte, wenn man seine eigene Position veränderte.
Doch in dieser Nacht versteckten sich nicht nur die Zeichen, sondern auch das Schicksal selbst. Esaras Neugier wich einer bedrückenden Unruhe. Für sie und den Jungen, der in einer der Ecken ihrer Hütte erschöpft eingeschlafen war, schien es kein Schicksal zu geben, weder über den kurzen noch über den langen Weg.
„Der da ist nicht gut“, unterbrach eine helle Kinderstimme die Stille und eine kleine Hand nahm einen der Knochen weg. Sofort bewegten sich alle anderen Steine, die zuvor noch wie gebannt auf der Platte gehockt hatten.
„Lass das, Chigg“, sagte Esara ruhig, obwohl sich unter der Oberfläche ihres ausdruckslosen Gesichtes das Entsetzen zusammenballte. „Das ist nichts zum Spielen.“
Chigg bedeutete in Esaras Heimatdialekt einfach Kind oder Junge. Doch die Namen, die Eltern ersinnen, sind nicht weiter wichtig. Die wirklichen Namen vergibt immer das Leben selbst, manchmal mit leichter Hand und manchmal so hart und grausam, wie es eben nur das Leben selbst vermag.
Chigg warf den Runenknochen zurück auf die Platte, wo er ziellos eine Weile hin und her rollte. Esara sammelte alle Knochen wieder ein und warf sie unter den wachsamen Augen des Kindes erneut aus. Die Knochen rollten und taumelten über den Stein, ohne ihren Platz zu finden. Sie kamen erst zur Ruhe, als Chigg einen der Steine entfernte.
„Böser Stein“, sagte er.
Esara nahm ihm den Knochen aus der Hand und verstaute alle Zeichen wieder in einem kleinen Säckchen. Es war nicht immer leicht, den Willen des Schicksals zu erkennen und oft genug wurde auch sie in die Irre geführt. Aber, dass das Schicksal sich ihr völlig verweigerte, hatte sie noch nicht erlebt.
„Auch das Schicksal hat seine Herren, denen es gehorchen muss“, dachte Esara und schüttelte nachdenklich den Kopf. „Wenn es kein Schicksal mehr gibt, dann gibt es auch keine Ordnung mehr im Kosmos und keine Ordnung bedeutet das Ende der Welt. Es muss eine andere Erklärung dafür geben, dass die Zukunft sich mir entzieht.“
Esara war zu klein und unbedeutend, um dieses Rätsel zu lösen. Ihre Kenntnisse reichten gerade für die Wahrsagerei. Die Macht, die hinter dem Schicksal herrschte, war ihr nicht zugänglich.
Auch wenn Esara von vielen Leuten im Dorf gefürchtet wurde, so war sie doch keine Zauberin und gehörte folglich auch nicht zur herrschenden Klasse des Adels. Doch war sie auch keine Frau des einfachen Volkes, denn sie wusste mehr über das Gespinst, das die Welt ausmacht, als alle anderen.
„Es war einmal alles ganz anders“, versuchte sie sich zu erinnern und zerrte an dem Schleier, der über den Bildern der Vergangenheit lag. Er wollte nicht zerreißen. Er war zu fest gewoben.
In einem Dorf, in dem jeder als reich galt, an dessen Tür der Hunger vorbei ging, litt Chigg keinen Mangel, denn Esara hatte keine Kinder und keinen Mann. Es würde sich wohl auch keiner mehr finden. Als Fremde besaß sie in diesem Dorf keine Familie, deren Unterstützung man sich durch eine Ehe sichern wollte, und darüber, ob ihr zweites Gesicht Segen oder Fluch war, gingen die Meinungen weit auseinander. Eine begehrenswerte Mitgift war diese Gabe aber bestimmt nicht. Auch war ihr Liebreiz begrenzt und hatte sich selbst in ihrer Jugend kaum über ihre warmen Augen hinausgewagt. Es mochte Orte auf Pentamuria geben, wo ihr rötliches Haar als Zeichen königlicher Abstammung galt und daher hoch begehrt war. Doch hier in Erdland wie auch in der Metallwelt, die nur wenige Tagesreisen entfernt im Hügelland begann, war das Haar der Menschen dunkel. Rot war weder die Farbe des Tages noch der Nacht. Rot stand in Erdland für den Morgen und den Abend, für die kurzen Augenblicke der Unentschiedenheit zwischen dem Heute und der nahen Zukunft. Und Rot stand für das Feuerreich, über das nie etwas Gutes zu hören war.
Während die Häuser und Hütten der einflussreichen Sippen um den Dorfplatz gruppiert waren, lag Esaras Hütte an dem Rande des Dorfes, wo niemand sonst leben wollte. Die Hütten der Dorfbevölkerung bildeten ein schmales Band entlang einer unsichtbaren Linie, wo die Hänge der Hügel den Talgrund berührten. Sie lagen dort, wo die Erde noch trocken, aber das Land bereits eben war. Die etwas feuchteren Böden waren zu kostbar, um darauf zu siedeln. Dort wurden ein paar Zwiebeln angebaut und dort wuchs auch das saftige Gras, das gebraucht wurde, um die kleinen Ramsherden durch die trockene Zeit zu bringen. Die Grasrechte wurden unter dem Gerichtsbaum jedes Jahr neu ausgehandelt. Nur Esaras Haus stand, wo der Boden bereits zu feucht war, wo die Fiebergeister wohnten, die den Dorfleuten die Krankheiten brachten. Es stand dort, wo niemand sonst leben mochte.
Doch für Chigg war Esaras Haus das schönste Haus im Dorf. Die Hütten des Dorfes waren meist aus Ästen erbaut, zwischen denen Gras und Lehm die Löcher füllten, denn Holz war knapp. Nur das Haus des Schultheißen bestand zur Gänze aus Holz und ruhte sogar auf einem steinernen Fundament.
Esaras Haus hingegen war weder Hütte noch ein richtiges Haus. Sie hatte nach ihrer Ankunft im Dorf vier schnell wachsende Wisperweiden in den Boden gesetzt, die die äußeren Pfosten des Hauses bildeten und im Verlauf der Jahre immer größer und mächtiger wurden. Zwischen diesen lebenden Pfosten wuchs die silbrige Niedererle, ein dicht geduckter Strauch, nur etwas höher als Menschen mit ihren Armen reichen konnten. Zum Innenraum hin, wo weniger Licht war, starben die Zweige ab. Aber sie behielten ihre Biegsamkeit und Esara hatte es verstanden, sie kunstvoll ineinander zu verflechten. Die äußeren Zweige hingegen wuchsen immer weiter und machten aus der kleinen Behausung einen blühenden Palast um einen winzigen, wohlbehüteten Wohnraum im Innern. Esara gab ihrem Haus den Namen Haindom.
Der Fußboden war gestampfte Erde und auch an diesem feuchten Ort immer trocken, denn Wisperweide und Niedererle sorgten dafür, dass alles Wasser aus dem Boden herausgesaugt wurde.
Je mächtiger die Büsche und je größer das Haus wurde, desto mehr Vögel suchten sich dort ihren Nistplatz, sodass der Junge jeden Morgen von Vogelgezwitscher geweckt wurde. Und jeden Abend erinnerte ihn das große Geschrei der Vögel, die so lange lauthals stritten, bis jeder seinen angestammten Platz gefunden hatte, daran, dass es bald Zeit war, schlafen zu gehen.
Chigg war noch zu jung, um zu bemerken, wie sehr Esara von der Dorfbevölkerung gemieden wurde. Die Weiber zischelten hinter ihr her und spuckten dreimal aus, wenn sich ihre Wege kreuzten. Die Männer gingen ihr aus dem Weg. Wer sie besuchte, tat dies nachts und heimlich und hatte auch allen Grund dafür.
Dann wachte Chigg manchmal von heiseren Stimmen auf, die so leise waren, dass sie ihren Klang verloren hatten. Die Stimmen gehörten jungen Mädchen, die Esara um einen Liebestrank baten, Jägern, die ihre Geschicklichkeit mit dem Bogen verloren hatten, und besorgten Müttern, die für den einen oder anderen Gegenstand einen Segen benötigten oder um einen Kräutertrank baten, um das Fieber der Kinder zu besiegen.
Esara kannte nicht nur das Schicksal, sondern sie wusste auch um die Kraft der Pflanzen, des Metalls und der Erdfarben. Das Dorf an der Grenze zwischen Erdland und Metallwelt war zu klein, zu unbedeutend und zu arm, um einen eigenen Heiler unterhalten zu können. So waren Esaras Ratschläge gefragt, doch Liebe und Achtung vertragen sich nur schlecht mit Angst und Furcht.
Wenn Chigg nicht im Blütenhaus saß, rannte er umher oder spielte an jedem Ort des Dorfes, der für eine kurze Zeit seine Fantasie entzündete. Solange er klein war, blieb er unbeachtet von den Erwachsenen und unbeachtet auch von den anderen Kindern. Aber nach jeder weiteren Ernte begannen die Erwachsenen mehr und mehr zu reden, warum er denn nicht arbeite. Und auch die anderen Kinder konnten ihn nicht mehr übersehen.
Brongard war wie sein Vater. Groß, breit, dunkel und von seiner eigenen Wichtigkeit überzeugt. Als Sohn des Schultheißen führte er die Kinder des Dorfes an, bestimmte, was in der kargen freien Zeit gespielt wurde, worüber gesprochen wurde und vor allem, wie etwas zu geschehen hatte. An diesem Sommernachmittag war es geboten, den Dorfplatz von einem Ende zum anderen zu überqueren. Der unordentliche Haufen Dorfkinder lärmte hinter Brongard her, bis dieser abrupt anhielt. Da stand doch mitten auf dem Platz dieser Wahrsagerjunge.
„Geh mir aus dem Weg, Hexenjunge“, sagte Brongard ganz ruhig und in einer Weise, die er seinem Vater abgeschaut hatte.
„Warum sollte ich das?“
Brongard lachte laut auf, weil diese Frage wirklich lustig war, und die anderen Kinder lachten noch lauter, weil Brongard lachte.
„Weil wir viele sind und du allein bist. Weil ich älter bin, größer bin, stärker bin und viel klüger bin als du.“
Und nach einer sorgfältig gesetzten Pause:
„Und weil du keiner von uns bist.“
Chigg zuckte zusammen, aber verstand es, das zu verbergen.
„Was zählt es schon, ob man allein oder in der Herde lebt? Die großen Jäger jagen alle allein“, entgegnete er stolz.
Brongard fing an, die Situation zu genießen.
„Und du bist so ein großer Jäger? Dann schau dir unsere Jäger an oder wenn du es überlebst, die wilden Tiere in den Hügeln. Sie sind alle groß, stark und dunkel, so wie wir. Und du? Schau doch einmal in einen Spiegel, wenn du überhaupt weißt, was ein Spiegel ist. Wahrscheinlich kennst du dich selbst nur aus schlammigen Wasserpfützen. Du bist kein großer Jäger. Du bist klein, hell und leise. Du bist höchstens ein verirrtes Zick.“ Brongard blökte laut und die anderen Kinder fingen wieder an zu lachen.
Chigg schwieg. Was hätte er auch groß sagen können. Vielleicht hatte der Schmied einen Spiegel, weil ein Schmied Metall polieren kann. Der Schultheiß hatte bestimmt einen, weil der Schultheiß alles hatte. Und dass er anders aussah, als die Leute im Dorf, war ihm selbst schon lange aufgefallen. Seine Haare trugen die Farben der Sonne und veränderten ihren Schein während des Tages. Seine Augen standen weiter auseinander, als die der anderen Kinder. Sie waren grau und nicht braun und regierten eine kurze, gerade Nase, die eher einer Klinge, denn einer Keule, glich. Kleiner als die anderen, war er schneller und ausdauernder, aber für die bullige Kraft eines Brongard fehlten ihm die Muskeln.
Brongard nutzte das Schweigen zu seinem Vorteil und startete eine neue Attacke.
„Was ich vor mir sehe, ist schwach, dreckig und dumm. Warum verkriechst du dich nicht einfach? Du hast keinen Vater und du hast keine Mutter. Du hast noch nicht einmal eine Vergangenheit. Du hast nichts, bist nichts und wirst immer ein Nichts sein. Du bist kaum ein richtiger Mensch. Du bist … Du bist ein …“
Brongard suchte nach dem einen Wort, das alles enthielt, was ihn seine ganze kindliche Erfahrung von kaum zehn Ernten in diesem Augenblick fühlen ließ. Diese Wahrheit oder das, was er dafür hielt, formte sich in seinem Körper, verdichtete sich in seinem Kopf und brach mit letzter Wucht aus seinem triumphierend geöffneten Mund.
„Du bist ein Nill!“
Du bist ein Nill. Die Worte klangen wie ein hohles Echo in Chiggs Ohren. Einem Menschen das Menschsein abzusprechen, war das Schlimmste, was man ihm antun konnte. Mag sein, dass weder Brongard noch Chigg so genau wussten, was ein Nill ist. Aber die Worte waren gesprochen und ihre Kraft war zu stark, als dass Chigg sie nicht hätte verstehen können.
Diese vier Worte schlugen wie Hammerschläge alles, was bisher gelebt war, kurz und klein. In diesem einen Augenblick, nach kaum acht Ernten, endete Chiggs Kindheit. Durch einen Jungen, der nicht einmal böse, sondern nur älter, größer, stärker und rücksichtsloser als die anderen Kinder war.
Chigg stand wie versteinert und bewegte sich auch nicht als die Kinder puffend und knuffend an ihm vorbeigingen. Brongard war schon einige Schritte weit weg, als Chigg sich endlich umdrehte und hinter ihnen herschrie. „Ich werde aus Nill einen Namen machen, vor dem die ganze Welt den Kopf beugt!“ Aber auch dieser Schrei zerbrach bereits nach den ersten Worten in der Kehle und war am Ende so leise, dass niemand ihn mehr zu hören vermochte. Und doch war dies der erste Satz eines neuen Lebens. Chigg war das Kind, Nill hieß der Mann. Das alles geschah schneller, als ein Blitz braucht, um einen Baum zu spalten. Und vor allem geschah es leise und unbemerkt.
Nill blieb noch ein paar Augenblicke stehen und starrte aus leeren Augen hinter den anderen Kindern her, bis er aufgewühlt und voller Wut, Trauer und Trotz nach Hause lief.
„Wo warst du, Chigg?“
„Ich heiße nicht Chigg, mein Name ist Nill!“
„So heißt du nicht.“
„Doch, jetzt schon.“
Für Esara verlor ihr Junge an diesem Tag seinen Namen. Sie nannte ihn nicht mehr Chigg, weil er nicht darauf hörte, aber das Wort Nill sprach sie kein einziges Mal aus.
Die Auseinandersetzung der Kinder war den Erwachsenen nicht verborgen geblieben und manch einer sah ein weiteres böses Omen darin. Esara wusste, dass es nun an der Zeit war, ihren Jungen bei der Arbeit im Dorf mithelfen zu lassen. Einen Wahrsager wollte sie nicht aus ihm machen, denn gute Wahrsager werden nicht gemacht, sondern geboren.
Für einen Jäger war er zwar zäh genug, aber zu klein und schwach, und so fragte sie ihn einfach, was er denn werden wolle.
„Schmied!“, war die Antwort.
Esara schüttelte den Kopf.
„Ein Schmied braucht sehr viel Kraft. Die Werkzeuge sind schwer. Ich glaube nicht, dass Ambross dich dieses Handwerk lehren wird.“
„Das werden wir sehen“, antwortete Nill trotzig und ging zu Ambross dem Schmied. Nachdem er sich eine Zeit lang in der Schmiede herumgedrückt hatte und wirklich nicht mehr zu übersehen war, unterbrach Ambross unwillig seine Arbeit und fragte kurz und bündig: „Aeeh?“
„Ich möchte schmieden lernen.“
Ambross stutzte, schaute zweimal und fing dann lauthals an zu lachen. „Du Kerlchen willst schmieden lernen?“
Er wandte sich immer noch lachend wieder seinem Rohling zu und bearbeitete ihn mit wuchtigen Schlägen. Ab und zu schüttelte er den Kopf, wobei nicht zu erkennen war, ob er mit der Form des Rohlings unzufrieden war oder ob er sich immer noch über Nills merkwürdigen Wunsch wunderte.
Endlich nahm er das rot glühende Eisenstück hoch und ließ es zischend erst in einem Pflanzensud und anschließend in einem Wassertrog erkalten. „Einen guten Grabstock wird diese Eisenspitze schmücken“, dachte er und suchte nach dem nächsten Rohling.
„Du bist ja immer noch da.“
„Ja, ich möchte lernen, wie man schmiedet.“
Jetzt lachte Ambross nicht mehr, sondern schaute Nill lange und prüfend an.
„Hartnäckig bist du ja, aber du wirst kein Schmied werden können. Dazu bist du zu schwächlich.“ Die Worte kamen ruhig und sachlich aus Ambross Mund und ließen jede Spur von Verächtlichkeit vermissen. „Aber wenn du unbedingt willst, kannst du so lange hier bleiben, bis du eingesehen hast, dass es keinen Zweck hat.“ Er grinste so breit, dass sein Mund aussah, als wäre er das Werk eines gut gezielten Axthiebes. „Wird mich vermutlich das eine oder andere gute Stück Metall kosten. Ich werde dir zeigen, wie man graviert und später vielleicht, wie man ein paar Ringe oder Reifen herstellt. Wer weiß, vielleicht interessierst du dich ja mehr für Schmuck als für Werkzeuge und Waffen. Hier!“ und damit warf er Nill einen Besen zu.
Von da ab arbeitete Nill in der Schmiede von Ambross. Er lernte schnell, verstand Eisen, Bronze und Messing zu schmieden und mit dem Stichel feine Gravuren zu setzen. Er half mit dem Blasebalg, bis ihm die Arme taub wurden und säuberte die Werkstatt. Wenn nichts zu tun war, saß Nill auf einem Holzklotz im Dunkel einer Ecke wie der Felskauz im Höhleneingang und beobachtete Ambross bei der Arbeit. So verstrich die Zeit, bis Nill eines Tages seinen Meister ansprach.
„Meister Ambross, ich möchte mir eine Waffe schmieden.“
Ambross blickte auf. „So, du willst dir eine Waffe schmieden.“
Er überlegte und meinte schließlich: „Nun gut, ich schenke dir einen Rohling. Du darfst ihn dir aussuchen. Nach der Arbeit kannst du damit machen, was du willst. Aber du bekommst nur diesen einen Rohling von mir.“
Nill nickte. „Ich brauche auch nur einen Rohling“, sagte er selbstbewusst.
Ambross schaute zur Decke seiner Werkstatt, wo er die Götter des Unverstandes vermutete, und schüttelte zum wiederholten Male den Kopf. Auch wenn der Junge nie viel sprach, hatte der Schmied ihn mittlerweile doch recht gern um sich. In einem Punkt ähnelten sich die beiden, der große Schmied und der kleine Junge. Ihnen genügte meist ein einziger Satz sowie ein richtig sitzender Hammerschlag.
Die Werkstatt war nicht groß, aber dafür dunkel, verwinkelt und schmutzig. Die Rohlinge lagen sortiert nach Größe und Härte auf verschiedenen Haufen zwischen Hämmern und Zangen, zerrissenen Blasebälgen, zerbrochenen Gerätschaften und fertiggestellten Werkzeugen und über alles hatte sich eine klebrige, übel riechende Decke aus Ruß und Eisenstaub, Wasserdampf und Schweiß gelegt. Wie jemand in diesem Durcheinander etwas finden konnte, war wohl jedermann außer Ambross und Nill ein Rätsel, aber es gab eine verborgene Ordnung an diesem dunkelheißen Ort.
Aber auch eine Ordnung lässt Raum für Vergangenheit und Zukunft, für das Vergessen und für Wünsche. So hatte Nill in einer der hintersten Ecken einen Rohling gefunden, der nicht zu den anderen Eisenstücken passte. Es gehörte zu Nills Pflichten, die Rohlinge regelmäßig zu säubern. Dieses eine Metallstück hatte sich lange Zeit allen Blicken entzogen und verbarg unter einer dicken Schicht von schwarzem, klebrigem Dreck ein sonderbares Muster, das Nill von keinem anderen Rohling kannte. Das Metall wirkte nicht massiv, sondern bestand aus einzelnen Lagen, so wie Herbstblätter nach einem langen Winter zu einer einzigen feuchten Schicht verklebten. Dem Dreck nach zu urteilen, der an diesem Eisen hing, musste es schon lange in der Werkstatt liegen. Nill wusste nicht, ob dieser Rohling auch nur den geringsten Wert besaß, aber als er ihn in der Hand hielt, hatte er das Gefühl, als würde das Metall zu ihm sprechen.
Nill wartete bis zum Tag der großen öffentlichen Ratsversammlung, an dem alles vorgetragen wurde, was einer Klärung bedurfte. Niemand ließ sich dieses Schauspiel entgehen und auch Nill war bisher immer dabei gewesen. Die Kinder verstanden nicht viel von den Reden und Gegenreden der Erwachsenen, aber sie liebten das Gefühl an etwas Besonderem teilzuhaben und freuten sich über die Unterbrechung ihres eintönigen Alltags.
So hatte Nill den ganzen Tag für sich. Eine Schmiedearbeit abzubrechen und später weiter zu führen, war ohne weiteres möglich, aber nicht ohne Risiko, da das Metall neu erwärmt werden musste. Nill besaß nur diesen einen Rohling und wollte kein Risiko eingehen. Er wählte einen mittelgroßen Hammer, denn für die größeren Schmiedehämmer fehlte ihm die Kraft. Da er auch niemanden hatte, der ihm half, musste er den Blasebalg mit den Füßen treten, um das Eisen bis zur Weißglut zu bringen.
Nill hämmert aus dem spitzen Ende des Rohlings einen kurzen vierkantigen Dorn und trieb den Großteil des Metalls zum breiteren Ende, wo er es zu einer breiten Klinge abflachte. Wie ein gutes Jagdmesser auszusehen hatte, wusste Nill. Das Gewicht musste im Griff liegen, denn sonst wurde die Hand, die es führte, müde. Der Rücken der Klinge musste stark sein, damit es nicht brach, wenn der Jäger Röhrenknochen spaltete, um an das Mark zu kommen. Und die Schneide musste robust sein, weil sie sonst leicht Scharten bekam.
Dieses Messer schmiedete er gegen alle Einsicht. Der Dorn war kurz und schmal, die Klinge lang und flach und die Schneide dünn und sollte auch am Rücken bis zur halben Länge geschärft werden.
Ambross schmiedete selten Waffen und wenn er es tat, beantwortete er jede Frage zunächst nur mit einem ärgerlichen Knurren und dann nur noch mit Schweigen. Dafür murmelte er aber während der ganzen Arbeit unaufhörlich unverständliche Worte vor sich hin.
„Meister Ambross, sind das Zaubersprüche, mit der Ihr die Waffen stark macht?“, hatte Nill einmal gefragt.
„Ich bin kein Zauberer, ich bin ein Schmied“, lautete Ambross unwirsche Antwort, aber dann lächelte er doch sein stilles Lächeln und murmelte: „Wer weiß, vielleicht ist in unserer alten Schmiedetradition auch noch ein Rest Magie.“ Lauter und zu Nill gewandt sagte er: „Ich habe der Klinge Glück gewünscht und ihr erzählt, dass sie geboren wird. Wir Schmiede glauben, dass der Hammer den Waffen eine Seele gibt und sie zum Leben erweckt.“
Nill hatte versucht, es ihm gleich zu tun. Mit jedem Hammerschlag schickte er einen Gedanken in das Metall. Es war immer wieder derselbe Gedanke.
„Brenne!“
Vor Nills innerem Auge wuchs ein Bild aus lodernden Flammen, kaltem weißen Licht, grellen Blitzen und einer allumfassenden Kraft. Doch was sollte so ein Gedanke schon bewirken, der in der Breite seiner Bilder wie eine dünne Rauchfahne in der Morgenbrise zerflatterte?
Am nächsten Morgen kam Nill in die Werkstatt, kaum dass Meister Ambross sie aufgeschlossen hatte. Er deutete eine leichte Verbeugung an und bemühte sich um höflich gesetzte Worte.
„Meister, ich habe meine Lehre gestern bei Euch beendet und möchte Euch danken für all die Mühe, die ihr Euch mit mir gemacht habt.“
Ambross schaute ruhig auf den Jungen. Nichts verriet den Stolz und die Freude, die er fühlte, als er antwortete:
„Nun, Nill, du warst nie in einer richtigen Lehre bei mir. Eine Lehre, die nie richtig begonnen hat, kann deshalb auch nicht beendet werden. Aber willst du mir nicht zeigen, was du gestern geschmiedet hast?“
Nill holte seine Klinge heraus.
Ambross Gefühle erloschen wie ein Feuer, über das der Eiswind bläst.
„Was ist das?“, fragte er kalt.
„Das ist ein Kampfdolch!“
„Und was willst du mit einem Kampfdolch?“
„Ich will ein großer Held oder Krieger werden.“
Ambross` Augen blickten urplötzlich müde. Bittere Bilder aus der Vergangenheit, Erinnerungen an Leid und Verzweiflung, zu lange vergraben, kehrten an die Oberfläche zurück.
„Heldentaten, mein Junge, für Heldentaten brauchst du keine Waffen, sondern ein Herz. Aber das kannst du jetzt noch nicht verstehen. Und wenn du es verstehst, wird es zu spät für dich sein. Aber du kannst sicher sein, mein Junge: Niemand wird aus freier Wahl ein Held.“
Ambross` erfahrener Blick wanderte über die Waffe.
„Doch deine Klinge ist gut geschmiedet. Wenn ich gewusst hätte, was du vorhast, hätte ich dir nie erlaubt, den Rohling frei zu wählen. Wie konnte ich dieses Stück Metall nur vergessen?“ Ambross schaute sinnend in die Ferne. „Aber du hast gut gewählt. Die Klinge ist hart und federnd zugleich. Nur die Gewichtsverteilung deiner Waffe stimmt nicht. Deine Hand wird bei der Arbeit mit diesem Messer schnell ermüden.“
„Ja das weiß ich, Meister Ambross. Deshalb möchte ich Euch noch um einen Gefallen bitten.“
Ambross hob erstaunt die linke Braue.
„Gebt mir ein Stück Blei.“
„Was willst du mit Blei?“
„Wenn ich eine Kugel aus Blei im Griff befestige, dann sinkt der Griff und die Klinge steigt.“
„Du hast viel gelernt, mein Kleiner. Jetzt höre zu, was ich dir sage. Nimm kein Holz für den Griff, sondern Bein. Mach den Griff dünn und umwickele ihn stramm mit nassen Lederschnüren. Lederschnüre geben der Hand mehr Halt als Holz oder Knochen und sie lassen sich ersetzen, wenn sie verschlissen sind.“
Nill bedankte sich mit einer letzten förmlichen Verbeugung, und Ambross wünschte dem Jungen viel Glück. Es war alles gesagt, was zu sagen war.
Zu Hause fragte Esara nicht, was vorgefallen war, als Nill ihr mitteilte, er ginge nicht mehr zur Schmiede. Sie fragte auch nicht, als Nill immer länger fortblieb und sich in den Hügeln um das Dorf herumtrieb, wo er mit den Jägern, den Ramsmännern und manchmal auch mit den Tieren redete, anstatt einer Arbeit nachzugehen.
Nill lernte viel dort draußen in den Hügeln. Nach kaum mehr als einer Ernte verstand er, dass es nicht nur alle möglichen Blumen und Pflanzen gab, sondern dass jede Pflanze Freunde, Feinde und Verwandte hatte, dass jede Pflanze sich mit ihren Eigenschaften nach der Erde und dem Himmel, der Sonne, dem Mond, dem Licht und dem Schatten richtete. Er wusste um die richtige Zeit, Keribeeren zu pflücken und verstand, warum Trrk-Wurzeln als einzige Wurzel nur im Frühjahr ausgegraben werden durfte.
An den langen Abenden der kurzen Jahreszeit blieb Nill gern zu Haus und sah Esara dabei zu, wie sie versuchte, in die Zukunft zu blicken. Zur Prophezeiung verwendete sie nicht nur Runenknochen, kleine Hölzer oder verknotete Grashalme, sondern auch ein Gemisch aus weißer Asche und hellem Sand, das sie auf einem großen, flachen Stein in einem fünfeckigen Holzrahmen ausbreitete. Lange saß Esara vor dem Weißsand, bevor sie mit einem Orakelzweig hastig einige Zeichen durch den Staub zog.
Nill begann Esara nachzuahmen und es dauerte nicht lange, bis er ebenfalls mit einem Ast erste krakelige Bilder in den Sand malte. Er sah nicht, dass Esara gar nicht malte, sondern dass ihr Geist der Hand gebot. In diesen stillen Augenblicken der Selbstbesinnung verstand Esara nicht, was sie tat, und auch die Bedeutung der Zeichen, die sie zog, war ihr schon lange entfallen. Doch war die Kraft der Zeichen stark genug, um für Esara eine Verbindung mit den Gestirnen herzustellen.
Nill achtete sorgfältig darauf, dass Esara nicht merkte, was er tat. Obwohl ihm nichts verboten war, hatte er das Gefühl, dass sie es nicht gerne sah, wenn er ihren Aschesand benutzte. Weißer Sand war kostbar hier in Erdland, wo die Welt sich in braun und rot kleidete. Die Erde musste lange gewaschen werden, bis sie das bisschen Sand hergab, das in ihr steckte. Und dann dauerte es noch einmal eine lange Zeit bis der rote oder braune Sand seine Farbe in einer Tinktur des sauren Kamanders abgab und das Weiß zeigte, das den Runen den Halt gab.
Es kam eine Zeit, in der Nill träumte. Es waren hässliche Träume, aus denen er schreiend erwachte und es waren friedliche Träume, die ihm im Schlaf ein Lächeln auf sein Gesicht legten. Jeden Morgen, wenn Esara Haindom verlassen hatte, setzte sich Nill vor den Stein der Prophezeiungen und malte seine Träume. An einem dieser Morgen wollte ihm nichts gelingen. Er kratzte seine Spuren in den Sand, wischte sie wieder weg und begann von vorn. Immer wieder. So lange, bis er darüber die Zeit vergaß.
„Was tust du da?“
Esaras Stimme war leise und doch schlug sie wie eine Peitsche durch die Stille Haindoms. Nill erschrak derart, dass ein Teil der Asche von der Steinplatte geschleudert wurde.
„Weißt du nicht, dass es eines der schlimmsten Verbrechen ist, Bilder zu zeichnen oder Zeichen zu ritzen? Nur der Schultheiß allein hier in diesem Dorf darf das und selbst er tut es nicht und wenn, dann nur im Geheimen. Wenn du Bilder schaffen willst, schnitze Figuren in Holz, wie Kramas der Klumpfuß es tut.“
Esaras Stimme war so leise geworden, dass Nill sie kaum verstehen konnte.
„Aber du tust es, ich habe es gesehen“, flüsterte Nill mit heiserer Stimme.
„Ja, ich tue es. Oder besser gesagt, es geschieht mir. Es gab einmal eine Zeit, in der ich das durfte, und ich kann es immer noch ein wenig.“
Esara begann zu kichern. Es war ein krankes Kichern und Nill erschrak, als er sah, wie sich das Gesicht seiner Pflegemutter veränderte. Die Augen wurden klein und der Mund öffnete sich schlaff, als wolle er etwas sagen. Doch so schnell wie der Spuk erschienen war, verschwand er auch wieder und Esara sah aus wie immer.
„Ich will aber Bilder malen. Ich muss das tun. Verstehst du? Ich muss diesen Wald hier malen“, trotzte Nill.
„Du kennst keinen Wald. In ganz Erdland gibt es keinen Wald, nur Gebüsch. Woher willst du also einen Wald kennen. Niemand kann malen, was er nie gesehen hat“, sagte Esara.
„Ich kenne den Wald aus meinem Traum. Es ist der Wald aus meinem Traum, aber ich kann ihn nicht malen.“
„Warum denn nicht?“, fragte Esara.
„Der Wald soll vollständig sein.“
„Der Wald ist nie vollständig, male nur das Wichtigste.“
„Was ist das Wichtigste?“
„Das, was du in kurzer Zeit malen kannst.“
Nill wischte die Zeichen fort und kratzte einen Wald in die Sandasche, der nur aus senkrechten Strichen bestand.
„Was ist das?“, fragte Esara
„Ein Wald.“
„Den kann ich nicht erkennen.“
„Es sind auch nur die Baumstämme, alles andere habe ich weggelassen.“
„Dann fehlt dem Wald alles, was wichtig ist.“
„Mehr kann ich in kurzer Zeit nicht malen.“
„Du kannst, du hast dich nicht bemüht.“
Als nächstes kratzte Nill einen Wald, der aus drei ungleich großen, senkrechten Strichen bestand. Über den Strichen befanden sich eine Kugel und eine Spitze, zwischen ihnen ein Kreuz, zwei kleine waagerechte Striche und ein Punkt.
„Gut“, sagte Esara. „Diesen Wald kenne ich, und ich weiß sogar, wo er wächst.“
Nills Bilder wurden immer einfacher und bald machte es ihm Spaß, Botschaften aus Bildern zu schreiben, die niemand außer ihm und seiner Mutter verstand.
„Sag bei der Gefahr deines Lebens niemandem, was du hier tust. Versprich mir das und ich werde dir etwas zeigen, was noch weitaus mächtiger und gefährlicher ist als jedes Bild.“
Esara hatte hektische rote Flecken auf den Wangen und ihre Augen glänzten im Fieber. Nill hatte seine Ziehmutter noch nie so ernst gesehen und verstand auch nicht, was sie meinte. Mehr um sie zu beruhigen, als aus eigenem Wunsch, schwor er einen feierlichen Eid.
„Wenn du ein Bild immer einfacher machst, erhältst du ein Zeichen. Einige dieser Zeichen enthalten sehr viel Kraft, aber diese Zeichen kann ich dir nicht mehr zeigen und verstehe sie auch nicht mehr.“
Ein trauriger Schatten flog über Esaras Gesicht und verschwand so schnell, wie er gekommen war.
„Alle Zeichen, ob stark oder schwach, erzählen Geschichten. Sie erzählen sie in einer Art, wie es die Worte aus dem Mund nicht vermögen. Worte werden schnell gesprochen und leicht überhört. Worte verzaubern. Aber Zeichen brennen sich in einen Menschen ein. Zeichen verzaubern nicht, Zeichen verändern. Lass es also niemanden erfahren, was ich dir gesagt habe.“
„Und du kannst diese Zeichen schreiben?“, fragte Nill.
Esara nickte. „Einige. Alles haben sie mir nicht fortnehmen können.“
„Wer hat dir etwas fortgenommen?“, fragte Nill wütend, denn wer Esara etwas nahm, nahm es auch ihm und Nill fühlte sich mit seinen zehn Ernten mittlerweile alt und stark genug, um sich selbst, Esara und Haindom gegen alles Übel zu verteidigen.
Esara blickte zärtlich auf ihren Jungen, sah die schmächtigen Arme, den schlanken Körper und die dünnen blonden Haare. Sie erkannte aber auch zwei kleine Splitter Eisenstein in Nills Augen, um die herum sich ein mächtiger Wille zu formen begann.
„Es ist schon lange her. Lass es gut sein“, sagte Esara.
Nill lernte nicht nur die Bilderschrift, sondern auch die Runen und andere Schriftzeichen, die wie verknotete Halme aussahen. Er verstand nie, warum nicht eine einzige Schrift genügte, aber es bereitete ihm Freude, mit den Zeichen zu spielen und sie in immer neuen Zusammenhängen darzustellen.
„Schau“, sagte er eines Tages. „Das hier ist ein wunderschönes Graswort und es klingt auch wunderschön.“
„Ja, aber dieses Wort gibt es nicht, es hat keine Bedeutung.“
Nill runzelte die Stirn. „Dann werde ich ihm eine Bedeutung geben. Ich muss nur noch herausfinden, wozu es passt.“
Von den Runenzeichen zur Wahrsagerei war es nur ein kleiner Schritt und so fragte Nill eines Abends: „Wie kommt es, dass die Knochen die Zukunft kennen?“
„Die Knochen kennen sie nicht. Es kennt der die Zukunft, der die Knochen wirft.“
Nill nahm die Knochen und warf sie über den Stein der Prophezeiungen aus.
„So geht das nicht. Du musst dir die Orakelknochen anschauen und in dein Inneres hören.“
Nill lauschte in sich hinein und hörte nichts außer dem Rauschen des Blutes in seinen Ohren und das unruhige Klopfen seines Herzens.
„Da ist nichts“, rief er verärgert aus und der Vorwurf in seiner Stimme war nur schlecht zu überhören.
„Das liegt daran, dass die Steine und du noch keine Verbindung zueinander haben“, sagte Esara. „Auch wenn Geist und Körper die Zukunft kennen, so wissen sie das selber noch lange nicht.“
Nill schaute verständnislos.
„Die Kunst der Wahrsage besteht darin, das Wissen über die Zukunft zu berühren, das sich in dir selbst versteckt hält.“
„Aber ich kenne die Zukunft gar nicht.“
„Doch du kennst sie“, sagte Esara. „Der Zukunft eilen Boten voraus und kündigen an, was morgen sein wird. Dein Geist sieht all diese Boten und weiß daher, was geschehen wird. Doch er hütet seine Geheimnisse sorgfältig.“
Nill schwieg verärgert. Er hatte das Gefühl, dass Erwachsene ihm nie eine klare Antwort gaben, wenn er etwas wissen wollte.
„Weißt du, wie morgen das Wetter sein wird?“, fragte Esara.
„Sicher! Es wird heiß und trocken werden.“
„Siehst du, du kennst bereits einen Teil der Zukunft.“
„Aber das Wetter von morgen kennt jeder, das ist nicht wichtig.“
Nill fühlte sich verspottet und seine Empörung zeigte sich in jeder Linie seines kindlichen Gesichtes.
„Das Wetter von morgen zu kennen, ist wichtig und ich habe dir ja gesagt, dass jeder die Zukunft kennt.“
„Aber du kennst die Zukunft besser als die anderen.“
Esara lächelte leise. „Die Runensteine helfen mir, mich selbst besser zu verstehen. Schau“, fuhr sie fort, „dieser Knochen hier bedeutet groß-klein, nah-fern, bald oder später. Er ist der große Regent, die Seefahrer nennen ihn den großen Steuermann.“
„Und wie zeigt er etwas an, das klein ist, weit weg und bald wichtig wird?“
„Gar nicht.“
Nill schüttelte den Kopf.
Esara nahm eine kleine Knochenplatte hoch. „Dieser hier zeigt gut und böse, schädlich und nützlich an. Und der da ist besonders wichtig.“ Der Knochen, auf den Esara nun zeigte, besaß so viele Flächen, dass er beinahe eine Kugel war. Auf der Fläche war ein anderes dunkles Zeichen eingebrannt. „Er enthält deine Familie, deine Freunde und Feinde.“
„Das nützt mir nichts, ich habe keine Familie, ich habe nur dich.“ Nill musste schlucken.
„Natürlich hast du eine Familie. Dass du sie nicht kennst, bedeutet nicht, dass du keine hast.“
„Wenn ich sie nicht kenne und die Familie nicht weiß, dass es mich gibt, dann habe ich auch keine Familie, denn sie kümmert sich nicht um mich.“
Darauf wusste Esara nichts zu erwidern und sie fuhr deshalb einfach fort, ihrem Jungen die verschiedenen Knochen zu erklären. „Dieser Knochen steht für das Zuhause, dein Heim, deine Heimat und für alle Häuser, Gebäude und Plätze, an denen jemand wohnt und lebt. Und ganz wichtig ist nicht nur, welche Seite oben liegt, sondern vor allem, wie die Knochen zueinander liegen.“
Von diesem Abend an spielte Nill so oft mit den Orakelknochen, wie sich ihm die Gelegenheit bot, und Esara ließ ihn gewähren. Bis er sie eines Abends mit den Worten hochschreckte: „Deine Knochen sind nicht gut. Wenn ich größer bin, hole ich dir bessere. Jeder Knochen sollte von einem anderen Lebewesen und aus einer anderen Gegend sein. Gute Knochen müssen die Welt gesehen haben.“
Doch es waren nicht Nills Worte, die Esara erblassen ließen. Es war der Tanz der Runen auf dem Stein der Prophezeiungen. Einmal geworfen, kamen sie nicht mehr zur Ruhe. Einige zitterten nur, andere drehten sich um die eigene Achse und der Knochen von Haus und Hof kroch zu dem großen Regenten hin.
Esara nahm Nill die Orakelknochen weg. „Spiel nie mehr mit den Zeichen“, sagte sie hart. „Das wird zu gefährlich. Und erzähl niemandem, dass du jemals einen Orakelknochen in der Hand gehabt hast.“
„Warum nicht?“, fragte Nill mit aller Unschuld seiner nur wenige Ernten umfassenden Erfahrung.
„Orakelknochen liegen still, bis sie gerufen werden. Sie erwachen in der Hand des Wahrsagers, wenn sie geworfen werden, und finden ihre Ruhe erneut auf dem Stein der Prophezeiung um zu sagen, was zu sagen ist.“
„Das kann nicht sein“, rief Nill aus. Meine Knochen bewegen sich immer. Wenn ich den Beutel hochhebe, wenn ich sie werfe und wenn sie auf dem Stein angekommen sind. Sie hören erst dann damit auf, wenn ich es ihnen befehle.“
„Tanzende Knochen sagen dir, dass die Zukunft noch nicht bestimmt ist. Es ist nicht klug, das Schicksal immer wieder daran zu erinnern, dass es noch eine Aufgabe zu erledigen hat.“
Esaras Finger zitterten, als sie die Knochen einen nach dem anderen einsammelte und sie in das Leinensäckchen fallen ließ.
„Aber du erinnerst mich auch immer an alle Dinge, die ich noch zu tun habe.“
„Das ist etwas anderes. Glaubst du wirklich, dass du jemand bist, der über dem Schicksal steht?“
„Warum nicht? Es muss doch auch etwas geben, dem das Schicksal gehorcht.“ Nill fühlte sich sehr stark und kühn und nichts konnte ihn in diesem Augenblick erschrecken. Doch Esara funkelte ihn zornig an.
„Dummkopf. Nur ein Narr fordert heraus, was er nicht kennt, und nur ein noch größerer Narr sieht nicht, wer über sein Leben entscheidet.“
„Über mein Leben entscheide ich selbst“, dachte Nill in maßloser Überschätzung, aber wagte nicht, diese Worte auszusprechen. Zu ernst war Esaras Gesicht. So lenkte er ein und fragte:
„Gibt es das denn, dass ein Mensch keine Zukunft hat und sie erst viel später entsteht?“
Er hatte das Gefühl vor einem großen Geheimnis zu stehen.
Alles in Esaras Gesicht deutete an, dass sie diese Frage quälte, denn Zukunft und Schicksal, Zeitstrom und Bestimmung sind schon dem Seher ein Geheimnis, und sie wusste, dass ein falsches Wort ein ganzes Leben verändern kann. Mühsam zwang sie sich zu einer Antwort:
„Nein, jeder Mensch hat seine Zukunft, aber manchmal sind es auch mehrere Zukünfte oder das Schicksal hat beschlossen, sein Wissen nicht preiszugeben. Nicht immer will das Schicksal, dass man seine Absichten erkennt. Wahrsager wissen das und müssen den Lauf der Dinge so annehmen, wie sie sind.“
Aber Wahrsager wussten das nicht. Esara hatte gelogen. Es konnte sein, dass ein Wahrsager die Zeichen falsch deutete oder das Bild unklar und verschwommen war, aber Orakelknochen, die nicht zur Ruhe kamen, hatte sie noch nie gesehen. Jegliche Sicherheit war von ihr geflohen, denn eine Zukunft, die es nicht gab, glich dem Chaos vor der Entstehung der Welt. Sie versuchte mit aller Kraft, dieses schreckliche Geheimnis vor Nill zu verbergen und tat so, als wären die tanzenden Knochen nicht mehr als eine ärgerliche Sache. Doch sie konnte Nill nicht täuschen. Er sah Esaras graue Hautfarbe und den dünnen feuchten Glanz auf ihrer Stirn. Es hätte des Blickes auf ihre Hände nicht mehr bedurft, um zu erkennen, wie aufgewühlt sie war.
Es war einer jener langen Abende, an denen niemand wusste, wann die Nacht anfing. Die bereits untergegangene Sonne schob noch lange Zeit rote Finger in den dunkelblauen Abendhimmel und nur gelegentlich entkam einer der Sterne dem dünnen Schleier der sich hoch oben ausbreitenden Wolken.
Nill zog sich mit seinen Gedanken zurück und schlief darüber ein. Esara wartete noch den Mond ab, dem sie einige Fragen stellen wollte, bevor auch sie schlafen ging, aber der Mond schien sich in den Wolkenschleiern verfangen zu haben. So wurde es spät und später und Esaras letzter Blick galt dem unruhigen Schlaf ihres Jungen.
Weder Mutter noch Sohn nahmen wahr, wie die hohen Wolkenschleier endlich verschwanden und ein blassgelber Mond auf die Erde schaute. Sie hätten sich auch kaum an der Pracht der Sterne erfreuen können, denn es dauerte nicht lange und in den Niederungen der Bachauen und Sumpflöchern erwachte der Nebel, schlich dicht an den Boden gepresst in das Dorf, so wie er es schon viele Male getan hatte, und spähte in jeden Stall und jede Hütte, die ihm Einlass gewährte.
Nur zu Esaras Blütenhaus hatte er keinen Zutritt. So wie der Nebel das Licht der Sterne zurückhielt, so sperrten Haindoms Ausdünstungen in dieser Nacht den Nebel aus. Aus dem festgestampften Boden, entlang der Wurzeln von Wisperweiden und Niedererlen kroch langsam ein graugelber Rauch empor, massiger als das Gespinst des Nebels in der Kühle der Nacht und ruheloser als die Zitteräste der Weiden an der Decke. Während sich draußen noch die feuchte Luft der Dunkelheit liebkosend um die Nasen und Nüstern der Tiere legte und die Düfte des Abends sich in winzigen Wasserperlen auflösten, brach in Esaras Haus ein modriger Geruch durch die Erde mit hochwirbelnden Spitzen von Schwefel und wildem Teer. Und in den Schleiern und Wirbeln dieses Rauches, dort, wo er sich für einige, willkürliche Momente verdichtete, zeigten sich die ersten Umrisse einer Gestalt.
Nill wälzte sich unruhig auf den Ramsfellen. Die ersten Rauchschwaden legten sich über ihn und deckten ihn zu. Der Rauch zerbrach die tiefen und regelmäßigen Atemzüge des Schlafes in heisere Stücke eines hastigen Keuchens, das Nill die Lungen zerriss. Nill hustete, schrie und sprang von seinem Lager, den Dolch in der rechten Faust.
Er konnte nicht unterscheiden, ob der Rauch eine Gestalt umwehte oder selbst ein Teil dieser Gestalt war. Graugelbe Schlieren zogen über die mächtigen Hauer eines riesigen Kampfebers, dessen Schädel gewundene Hörner verzierten. Der massige Hals wie auch der muskelbepackte Rumpf waren menschlich bis auf zwei lächerlich kleine, rote Flügel, die dem Rücken aufsaßen. Die Hände endeten in scharfen Langsichelkrallen und zerteilten die Luft wie singende Schwerter. Doch was Nill den Magen zusammenkrampfen ließ, waren die Beine dieses Wesens. Mächtige Keulen mit einer üppigen Behaarung, die vom Zentrum des Körpers ausging und dem lockigen Zottelfell eines Wollbüffels ähnelte, verjüngten sich zu den Füßen eines gewaltigen Raubvogels. Die Wolle verklebte beinabwärts und ging in hornige Schuppen über, die sich unterhalb der Knie zu einem stählernen Panzer verdichteten. Die Füße trugen grobe, dunkelgelbe Krallen, von denen drei nach vorn und eine nach hinten gerichtet waren. Ein peitschender Schweif, so lang, dass er sich dem Wesen um den eigenen Kopf wickeln konnte, endete in einer mit Widerhaken versehenen Spitze. Eine fürchterliche Waffe, die die Eigenschaften von Hakenspeer und Peitsche in sich vereinigte. Kralle und Hauer, Spitze und Schneide, Kraft, Masse und Wildheit stand zum Schutze Haindoms und des eigenen Lebens nur der Dolch eines Jungen entgegen.
Nill stieß zu und sein Dolch schlitzte durch den ausgestreckten Arm des Wesens hindurch, ohne mehr als nur ein paar Wirbel zu werfen. Der Peitschenschweif kreiste mit seiner Metallspitze heulend durch die Luft, durchdrang dabei die Wände der Hütte, als wären sie nicht vorhanden, und wickelte sich um Nills Brust. Nill spürte Eiseskälte und Feuersglut zugleich. Aber der Schweif zerfloss auf der Oberfläche seines Körpers, verschwand tief im Fleisch und gewann erst hinter ihm erneut an Gestalt. Der Rauch wurde trüber und fester. Er verlor seine wirbelnde Konsistenz und tropfte ölig durch die Luft. Nill schrie erneut. Sein Kampfschrei aus Angst und Wut mit den grellen, spitzen Lauten seiner jungen Stimme ließ das Wesen den Kopf hochreißen. Es brüllte zurück. Dumpf, aus tiefster Kehle zielte dieses Röhren auf den ganzen Menschen. Es waren Urlaute des Chaos, besaßen nur Form, ohne bereits Worte zu sein. Sie markierten den Beginn aller Gefühle und töteten dabei jeden Gedanken. Das Brüllen toste durch Nills Kopf, raste das Rückgrat hinunter, überschlug sich in seinem Bauch und brach über die Haut wieder nach außen. Nill schüttelte sich unter diesem heranbrandenden Ansturm einer Sprache, die er nicht verstehen konnte.
Esara stand angstgelähmt an der Wand ihres Hauses und hatte die Finger in den verflochtenen Ästen der Niedererlen verkrallt. Bereits Nills erster Schrei hatte sie aufgeschreckt. Sie war aufgesprungen, noch bevor etwas zu erkennen war, bereit, ihren Sohn gegen jeden zu verteidigen, der den Frieden Haindoms störte. Doch jetzt vor dem Anblick dieser wirbelnden Wolke, deren Gestank sich schwer in ihrer Nase niederließ, verlor sie all ihre Kraft und Entschlossenheit. Esara war nur eine Wahrsagerin, aber aus den Resten eines alten Lebens, das längst in der Vergessenheit versunken war, stieg ein altes Wissen auf. Und mit dem Wissen kam das Verstehen.
Esaras Blick irrte durch den Raum und blieb an einem kleinen Tisch hängen, wo in einer Schale blühende Nachtkresse schwamm. Nill hatte sie ihr vor zwei Tagen von einem seiner Streifzüge mitgebracht.
„Wirf den Dolch weg und nimm die Blumen“, kreischte sie.
Doch Nill verstand nicht. Er blickte zu Esara und sah sie Worte murmeln, deren Klang in dem brunftigen Dröhnen des Ebers unterging. Nill drehte den Dolch, sodass die Spitze nun nach unten zeigte wie die Krallen einer Raubkatze. Er ließ den Unterarm fallen, streckte das Handgelenk, und der Dolch verschwand aus dem Blick seines Gegners wohl verborgen hinter Nills Körper. Das Ungeheuer ließ seinen linken Arm auf Nill herunterfallen, um die Schulter zu zerschmettern und die Langsichelkrallen tief in das weiche Fleisch zu bohren. Nill drehte sich mit dem Körper aus der Angriffslinie und warf seine Messerhand mit einem gewaltigen Schnitt schräg nach oben. Die Klinge bahnte sich den Arm entlang ihren Weg und warf eine Kaskade von braungelben Luftwirbeln durch den Raum. Der Kampfeber brüllte lauter.
Esaras Stimme ertönte plötzlich ganz klar und hell in Nills Kopf und umging die vibrierende Luft. Irgendwo in einem mystischen Zentrum zwischen seinen Ohren erklang sie ruhig, bestimmend und drängend, frei von jeglicher Furcht und Verzweiflung. „Lass den Dolch fallen, nimm die Blumen. Schau die Blumen, vergiss den Rauch. Denke daran, wie es war, als du sie gepflückt hast.“
Der nächste Schlag des Ungeheuers traf seine Schulter und die Krallen senkten sich tief in sein Fleisch. Dieses Mal war der Schmerz heftiger als bei dem Schlag mit der Peitsche, aber erneut zeigten sich keine Wunden, und auch das Blut verblieb im Körper.
„Erinnere dich daran, wie es war, als du die Blumen gepflückt hast, wie es war, als du sie nach Hause trugst, als du sie wieder in ihr natürliches Element, das ruhige Wasser, gebracht hast.“ Esaras Stimme hatte nun auch ihr Drängen verloren und das monotone Murmeln eines kleinen Baches angenommen. Sie führte Nills Gedanken weg von Krieg und Kampf, hin zu Friede, zu Schönheit und Liebe. Nill drehte sich um, nahm die Blumen behutsam aus ihrem Wasserbett und überließ das Ungeheuer sich selbst. Den heißkalten Griff der Pranken an seinem Hals spürte er nicht mehr und auch das spitze Horn der Raubvogelkrallen nicht. Von dem Wasser in seinen Handflächen breitete sich eine wohlige Wärme aus, die den ganzen Körper durchströmte. Der Schmerz aus Feuer und Eis löste sich auf und die unheimliche Gestalt wurde in dem schwindenden Rauch immer durchsichtiger. Das letzte, was Nill sah, war die weit geöffnete Schnauze des Kampfeberkopfes, des gewaltigen, weit in den Nacken geworfenen Schädels. Es sah aus, als wolle sie noch etwas rufen. Dann war der Rauch verschwunden und von dem Dröhnen und Heulen verblieb nur noch ein tauber Nachhall in den Ohren.
Esara nahm Nill in den Arm und flüsterte: „Komm und schlaf weiter, jetzt. Es waren nur Illusionen, Bilder ohne Kraft.“ Fast willenlos ließ Nill sich führen. Er war wie betäubt und schlief sofort wieder ein. Doch in seinem Inneren ging der Kampf weiter. Den Rest der Nacht warf er sich hin und her, schrie auf und fuhr mit leeren Augen hoch, die auf unsichtbare Bilder starrten. Esara saß die ganze Nacht an seinem Bett. Um den leichten Anflug des Fiebers zu unterdrücken, ließ sie immer wieder ein paar Tropfen von dem Wasser in der Schale der Nachtkresse auf seine Stirn tropfen. Als Nill sich endlich beruhigte, ging schon die Sonne auf.
„Ich hatte einen schrecklichen Traum“, sagte Nill, der blinzelnd auf seinem Bett saß. „Ich habe von einem unheimlichen Wesen geträumt, gegen das ich gekämpft habe.“