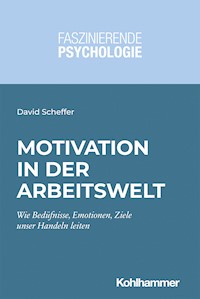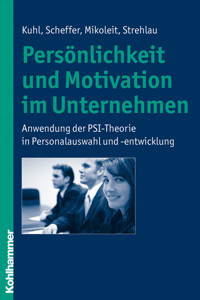
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch gibt einen Einblick in Modelle der Mitarbeitermotivation. Es überwindet die Schwächen bisheriger Modelle dadurch, dass Motivationsformen unterschieden werden, die für jeweils andere Aufgaben und Arbeitskontexte sinnvoll sind. Die Beschreibung der Funktionsprofile jeder Motivationsform auf der Grundlage einer fundierten Persönlichkeitstheorie (PSI-Theorie) eröffnet neue Perspektiven für die Förderung der Mitarbeitermotivation. Fallbeispiele verdeutlichen, welchen Nutzen eine komplexere Betrachtung der Persönlichkeit bei der Frage nach der Person-Job-Passung schaffen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch gibt einen Einblick in Modelle der Mitarbeitermotivation. Es überwindet die Schwächen bisheriger Modelle dadurch, dass Motivationsformen unterschieden werden, die für jeweils andere Aufgaben und Arbeitskontexte sinnvoll sind. Die Beschreibung der Funktionsprofile jeder Motivationsform auf der Grundlage einer fundierten Persönlichkeitstheorie (PSI-Theorie) eröffnet neue Perspektiven für die Förderung der Mitarbeitermotivation. Fallbeispiele verdeutlichen, welchen Nutzen eine komplexere Betrachtung der Persönlichkeit bei der Frage nach der Person-Job-Passung schaffen kann.
Professor Dr. Julius Kuhl lehrt Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung an der Universität Osnabrück. Dr. David Scheffer lehrt Eignungsdiagnostik und Wirtschaftspsychologie an der Nordakademie - Hochschule der Wirtschaft in Elmshorn. Bernhard Mikoleit ist Berater mit den Schwerpunkten Eignungsdiagnostik und Mitarbeiterzufriedenheit für Unternehmen in Hamburg und Effretikon/Schweiz. Alexandra Strehlau ist Doktorandin bei Professor Dr. Kuhl sowie Beraterin und Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung in Osnabrück.
Julius Kuhl, David Scheffer, Bernhard Mikoleit und Alexandra Strehlau
Persönlichkeit und Motivation im Unternehmen
Anwendung der PSI-Theorie in Personalauswahl
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrofilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2010 Alle Rechte vorbehalten © 2010 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-021470-5
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028186-8
mobi:
978-3-17-028187-5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Motivation und Persönlichkeit: Basiskonzepte
1.1 Flow: Die Passung zwischen Anforderungen und Fähigkeiten
1.2 Die Korrelationsfalle: Hängt Verhalten von der Situation oder der Person ab?
1.2.1 Zur Bedeutung von Persönlichkeitsunterschieden in der Wirtschaftswelt
1.2.2 Gibt es einen konsistenten Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf das Verhalten?
1.2.3 Der Aggregationsansatz: Korrelation und Faktorenanalyse
1.2.4 Synthese: Situatives Modell und Trait-Modell
1.2.5 Wann sind Persönlichkeitstests keine guten Prädiktoren für Arbeitsverhalten?
1.3 Vom Aggregationsansatz zur Funktionsanalyse persönlicher Kompetenzen
1.3.1 Starke und schwache Situationen
1.3.2 Gründe für die Wiederentdeckung der Persönlichkeit
1.3.3 Forschung zur Persönlichkeit
1.3.4 Funktionsanalyse persönlicher Kompetenzen
2 Vom Flow zur Interaktion psychischer Systeme
2.1 Funktionsanalyse des Flow-Erlebens
2.2 Job-Charakteristika
2.2.1 Das Entwicklungsquadrat
2.2.2 Verstand versus Gefühl
2.3 Die PSI-Theorie: Vier motivationale Erkenntnissysteme und deren Verschaltung
2.3.1 Die resultatorientierte Motivationsform (R)
2.3.2 Die entwicklungsorientierte Motivationsform (E)
2.3.3 Die integrative Motivationsform (I)
2.3.4 Die wirkungsorientierte Motivationsform (W)
3 Anwendungsbeispiele: Die vier Motivationstypen in Aktion
3.1 Zusammenfassung der Motivationstypen
3.1.1 Welche Aufgaben motivieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am meisten?
3.1.2 Was sind die Stärken der verschiedenen Motivationstypen?
3.1.3 Welche Managementmethode passt am besten?
3.1.4 Motivation und Führung
3.2 Die praktische Anwendung auf eine Berufsgruppe – Eine Verkäufertypologie
3.2.1 Allgemeine Beschreibung des resultatorientierten Verkäuferprofils (R-Typ)
3.2.2 Allgemeine Beschreibung des entwicklungsorientierten Verkäuferprofils (E-Typ)
3.2.3 Allgemeine Beschreibung des integrativen Verkäuferprofils (I-Typ)
3.2.4 Allgemeine Beschreibung des wirkungsorientierten Verkäuferprofils (W-Typ)
4 Vertiefung der PSI-Theorie: Erkenntnissysteme, Affekte und Bedürfnisse
4.1 Die vier handlungsrelevanten Erkenntnissysteme
4.1.1 Intentionsgedächtnis (IG)
4.1.2 Intuitive Verhaltenssteuerung (IVS)
4.1.3 Extensionsgedächtnis (EG)
4.1.4 Objekterkennungssystem (OES)
4.2 Die Modulationsannahmen
4.2.1 Erste Modulationsannahme
4.2.2 Zweite Modulationsannahme
4.3 Bedürfnisse: Stimulation und Sicherheit
4.3.1 Das Bedürfnis nach Stimulation
4.3.2 Das Bedürfnis nach Sicherheit
4.4 Systemkonfigurationen im Berufsleben
4.4.1 Sensibilität und Interesse für Mitarbeiter-/Kundenbelange
4.4.2 Interesse an Kommunikation und Mitarbeiter-/Kundenkontakten
4.4.3 Zwischenmenschliche Anpassungsfähigkeit
4.4.4 Entscheidungsfreude
4.4.5 Interesse an der Kontrolle von Vorgaben
4.4.6 Interesse an Führungsverantwortung
4.4.7 Interesse an strategischer Planung
4.4.8 Interesse am Umsetzen von Projekten
4.4.9 Interesse an Struktur und Ordnung
4.4.10 Risikobereitschaft
4.4.11 Unternehmerische Orientierung und Übersicht über das Branchenumfeld
4.5 Die Wirkung von impliziten Motiven
4.5.1 Der Gestalter im Hintergrund (Resultatorientierter Stil)
4.5.2 Der personalisierende Gestalter (Integrativer Stil)
5 Entwicklungsorientierte Systemdiagnostik
5.1 Entwicklungsorientierte Systemdiagnostik (EOS): Die Suche nach dem Angelpunkt
5.1.1 Der Motiv-Umsetzungs-Test (MUT)
5.1.2 Der Operante Motiv-Test (OMT)
5.1.3 Skalen für die explizite und implizite Befindlichkeit (BEF und IPANAT)
5.1.4 Das Persönlichkeits-Stil-und-Störungs-Inventar (PSSI) und die Skalen für emotionale und kognitive Stile (SEKS)
5.1.5 Das Selbststeuerungs-Inventar (SSI)
5.2 Ausführliche Fallbeispiele
5.2.1 Fallbeispiel 1: Herr A., 65, Geschäftsführer im Ingenieurbereich (resultatorientierter Stil)
5.2.2 Fallbeispiel 2: Herr M., 24, Student (entwicklungsorientierter Stil)
5.2.3 Fallbeispiel 3: Frau B., 41, Unternehmensberaterin (integrativer Stil)
5.3 EMOSCAN®: Ein objektives Verfahren
5.3.1 Leistungsmotivation
5.3.2 Machtmotivation
5.3.3 Beziehungsmotivation
5.3.4 Fallbeispiel 4: Herr S., 52, Unternehmer (wirkungsorientierter Stil)
6 Zusammenfassung: Motivation und Persönlichkeit in der Personalauswahl und -entwicklung
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Die Mitarbeitermotivation ist in modernen Wissensgesellschaften das wichtigste Kapital von Unternehmen. Ohne Motivation gibt es keine Leistung und Zufriedenheit – auch nicht bei ausgesprochen qualifizierten Mitarbeitern. Ganz besonders gilt dies in allen kreativen und stark wissensbasierten Berufen. Die Motivation ist hier für den Erfolg entscheidend (wie auch immer man diesen definiert).
Mit den immer flacher werdenden Strukturen in den Unternehmen und der Ausweitung der Aufgabenbereiche aufgrund einer schrumpfenden Personaldecke verändert und erweitert sich das Aufgabenprofil von Fach- und Führungskräften. Die für einen Arbeitsplatz bisher zentrale Aufgabe wird ergänzt um neue, vielfältige Management- und Steuerungsaufgaben. Dabei spielt beispielsweise die konzeptorientierte Leitung von Teams und die Koordination eines interdisziplinären Netzwerkes eine zentrale Rolle. Zunehmend wichtiger wird die Kompetenz, Abteilungen oder ganze Unternehmen in kurzer Zeit auf ein neues Ziel, eine neue Aufgabe auszurichten.
In diesem Buch möchten wir eine Vorgehensweise aufzeigen, mit der sich die Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachhaltig steigern lässt. Unser Beitrag versteht sich als Fortführung und Erweiterung unserer Gedanken, die wir in dem Buch „Erfolgreich Motivieren“ formuliert haben (Scheffer & Kuhl, 2006). Wir möchten dabei unsere zahlreichen Erfahrungen und Rückmeldungen zu unserer Vorgehensweise, die wir aus der Unternehmenspraxis erhalten haben, einfließen lassen. Insbesondere wollen wir den Wunsch vieler Praktiker aufgreifen, die Modelle und Theorien zur Persönlichkeit und Motivation von Menschen aus einer ganzheitlichen Perspektive zu integrieren und damit anwendbarer zu machen. Wie schon in unserem letzten gemeinsamen Werk lassen wir uns dabei von dem Ausspruch Kurt Lewins, dem Begründer der modernen Psychologie, inspirieren: „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“.
Während wir bei unserer Arbeit mit der hier beschriebenen Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (Kuhl, 2001) und den auf dieser Theorie basierenden Instrumenten normalerweise auf sehr differenzierte Weise individuelle Entwicklungspotentiale suchen, ist es in diesem Buch nun unser Ziel, ganz bewusst eine für die Personalentwicklung praktikable Vereinfachung in Form einer Typologie darzustellen. Der Unterschied zu den üblichen typologischen Ansätzen liegt darin, dass sich die hier beschriebene Typologie nicht an Strukturparametern orientiert (wie zum Beispiel Extraversion/Introversion), sondern Interaktionen zwischen den für persönliche Kompetenzen relevanten psychischen Systemen berücksichtigt. Auf diese Weise entsteht ein dynamisiertes typologisches Konzept, das Praktikern der Personalentwicklung die Anwendung einer integrativen Persönlichkeitstheorie auf ökonomische Weise ermöglicht und wertvolle Hinweise zur Passung zwischen Jobmerkmalen und Persönlichkeit gibt.
In der Persönlichkeitspsychologie finden Typenansätze seit einem halben Jahrhundert wenig Zuspruch. Das liegt daran, dass man Typenansätze für unvereinbar hält mit den wissenschaftlich attraktiveren „dimensionalen“ Ansätzen, die Menschen nicht in „Schubladen“ stecken (Kategorien oder Typen), sondern davon ausgehen, dass Persönlichkeitsmerkmale auf kontinuierlichen Dimensionen abbildbar sind (d. h. jemand ist z.B. nicht entweder extra- oder introvertiert, sondern hat eine bestimmte Ausprägung der Extraversion, die irgendwo zwischen den Polen „hohe Extraversion“ vs. „hohe Introversion“ liegt).
Heute können wir davon ausgehen, dass sich Typen und Dimensionen nicht ausschließen. Mit der Theorie nichtlinearer Systeme lässt sich zeigen: Veränderungen einer Variablen in einer kontinuierlichen (oft nicht beobachtbaren) Dimension („Genotyp“) können ab einer kritischen Intensität zu qualitativen Sprüngen im beobachtbaren Erscheinungsbild („Phänotyp“) führen (Haken & Schiepek, 2006). Aus diesem Grund wenden wir in diesem Buch die Bezeichnungen „Stil“ und „Typ“ für dieselben Persönlichkeitsmerkmale an. Das Wort Stil verweist dann auf die latente(n) Dimension(en), die gemäß der hier angewendeten Persönlichkeitstheorie (PSI-Theorie) zu den phänotypischen Eigenschaften eines bestimmten Persönlichkeitstyps führen. So bildet sich z.B. ab einer Mindeststärke an Selbstberuhigungskompetenz (latente Dimension) der Typus des Handlungsorientierten heraus. Auch wenn man einen „Typus“ nicht als chronisch auf ein bestimmtes Verhaltensmuster festgelegt auffassen muss, so lässt sich doch gut begründen, dass ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale auf der phänotypischen Ebene (d.h. in ihrem Erscheinungsbild) eine sich selbst stabilisierende Dynamik entwickeln und dadurch ihre Konturen schärfen. Dies entspricht dem bekannten Phänomen, wenn eine Figur sich von ihrem Hintergrund herauszulösen scheint und die Konturen verstärkt werden, sodass die Figur stärker hervortritt, als es den objektiven Verhältnissen entspricht. Die erwähnten nichtlinearen Modelle (z.B. Selbstorganisations-Theorie) erklären, wie diese Trennung von Phänotyp und Genotyp geschehen kann: Die Typenbildung kann im Erscheinungsbild stattfinden, ohne dass sich die Ausprägung des entsprechenden Persönlichkeitsmerkmals auf der latenten Dimension verändert.
Die Anwendung dieses typologischen Konzepts im Bereich der Person-Job-Passung veranschaulichen wir anhand von Fallbeispielen. Bei deren Beschreibung zeigen wir außerdem, welchen zusätzlichen Nutzen eine komplexere, über das Typenkonzept hinausgehende Betrachtung der Persönlichkeit bei der Frage nach der Person-Job-Passung schaffen kann.
1 Motivation und Persönlichkeit: Basiskonzepte
Unternehmen brauchen für ihren Erfolg motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist allgemein bekannt. Die Frage ist nur: Wie bekommt man sie? Ist es möglich, schon im Prozess der Personalauswahl die motiviertesten Bewerber herauszufiltern? Kann man unmotivierte Mitarbeiter, die sich bereits im Unternehmen befinden, zu motivierteren machen? Die Antwort ist: Ja, man kann die Personalauswahl und die Personalentwicklung so gestalten, dass die Motivation der Mitarbeiter und Führungskräfte maximiert wird. Allerdings ist es dafür notwendig, die Fragen zu präzisieren. Soll der motivierteste Bewerber ausgesucht werden, ist zu hinterfragen: Für welchen Job suchen wir jemanden, und welche Person wird durch die Merkmale dieses Jobs zu Höchstleistungen angetrieben? Gilt es, eine Führungskraft zu motivieren, sollte die Frage lauten: Welche Aufgaben oder Bedingungen vermögen genau diese Führungskraft zu beflügeln?
Um die Motivation im Unternehmen nachhaltig zu steigern, müssen die Persönlichkeitsunterschiede beachtet werden. Denn Motivation entsteht dort, wo die richtige Person am richtigen Platz ist. Hierfür ist es essenziell, die Motivation und Persönlichkeit der Bewerber, Mitarbeiter und Führungskräfte genau zu beleuchten. Nur, wenn die Persönlichkeitsunterschiede berücksichtigt werden, kann eine Person im Unternehmen so platziert werden, dass sie dauerhaft motiviert ist.
In diesem Kapitel beschreiben wir diese wesentliche Determinante der Job-Motivation: die Passung zwischen den Anforderungen des Jobs und den relevanten persönlichen Fähigkeiten.
1.1 Flow: Die Passung zwischen Anforderungen und Fähigkeiten
Mit einer guten und umfassenden Theorie der Persönlichkeit und Motivation können Human-Resources-Abteilungen auch ohne teure Seminare, in denen selbst ernannte Motivationsexperten einer staunenden Gemeinde Zauberwörter und Wunderstrategien anpreisen, die Motivation und Leistung von Fach- und Führungskräften stärken. Ein wissenschaftlich fundierter Ansatz, um Menschen dauerhaft zu motivieren, ist, sie in ein Arbeitsumfeld zu bringen, das optimal zu ihnen passt. Oder anders ausgedrückt, eine Passung zu ermöglichen (Holland, 1997; Scheffer & Kuhl, 2006). In der Persönlichkeits- und Motivationspsychologie wurden in den letzten Jahren wichtige Erkenntnisse darüber gewonnen, was diese Passung fördert. Für ein Unternehmen lohnt es sich, diese Erkenntnisse zu berücksichtigen, weil es an allen Stellen mit Menschen zusammenarbeitet, die von Passung profitieren: Kunden, Fachkräfte, Führungskräfte und Kooperationspartner.
Bei einer guten Passung entsteht Flow – der wohl wichtigste Anreiz des Menschen, um zu arbeiten (Csikszentmihalyi, 1997; v. Cube, 2003; Rheinberg, 2006). Werden Menschen optimal beansprucht, also weder über- noch unterfordert, dann geraten sie in einen Zustand des Glücks und der Leistungsfähigkeit. Flow kann als der Goldstandard der Motivationspsychologie in Organisationen gelten, denn nichts scheint Menschen nachhaltiger zur Arbeit zu bewegen. Diesen Zustand zumindest phasenweise zu erreichen, ist eines der wichtigsten Ziele auf individueller wie auf Team-Ebene. Das Flow-Konzept integriert auf einzigartige Weise die idealistischen Visionen einer humanistischen Psychologie und das auf Profit ausgerichtete betriebswirtschaftliche Denken.
Zwei Hauptmerkmale zeichnen Menschen im Flow aus:
Sie fühlen sich mit ihrer Arbeit eins und haben große Freude an ihr; sie glauben, die Arbeit unter Kontrolle zu haben und fühlen sich durch sie gleichzeitig angeregt und sicher.Unabhängig von der Berufsrolle scheinen Menschen im Zustand des „Flow“ ihre Arbeit mit höchstem nachhaltigem Erfolg zu erledigen.Abb. 1.1: Modell der Person-Job-Passung
Abbildung 1.1 verdeutlicht das Gesagte. Bei guter Übereinstimmung zwischen den Merkmalen der Person und den Anforderungen des Jobs bzw. der Arbeit entsteht Flow, und zwar umso mehr, je stärker die Person-Job-Merkmale ausgeprägt sind, d. h. je stärker die Anforderungen des Jobs und die dazu passenden („relevanten“) Fähigkeiten sind. Haben sowohl Job- als auch Personenmerkmale eine starke Ausprägung (beispielsweise den Wert 4), so besteht die Möglichkeit, in den stark ausgeprägten Flow-Kanal zu gelangen (s. Abb. 1.1). Die Person erlebt damit längere Phasen, in denen konzentriertes, interessantes und als erfüllend empfundenes Arbeiten möglich ist. Haben beide Merkmale dagegen nur eine schwache Ausprägung (beispielsweise den Wert 1), dann entsteht bei hinreichender Passung zwar auch Flow, jedoch nur in begrenztem Ausmaß. Die ganze Bandbreite an Verhaltensweisen, die mit Flow einhergehen, kann man nur bei starken Ausprägungen sowohl auf der Job- als auch auf der Personenachse erwarten (d.h., wenn die Anforderungen hoch und die relevanten Fähigkeiten entsprechend gut ausgeprägt sind). (Die Skalierungen der Achsen von 0 bis 5 sind natürlich nur Beispiele. Man hätte genauso gut auch Werte von 0 bis 100 nehmen können. Die Skalierungen variieren, je nachdem, welches Instrument man für die Messung der beiden Achsen verwendet.)
Bei mangelnder Passung impliziert dieses Modell Über- bzw. Unterforderung, die im Extremfall schließlich in das Gegenteil von Motivation, in Stagnation, übergeht. Wer aus den Abweichungen vom optimalen Flow-Korridor nicht mehr „herauskommt“, verfällt in Stagnation – gerät in einen Teufelskreis, aus dem er allein nur noch schwer zurück zum Flow-Kanal findet. Ein Beispiel für eine ungenügende Passung ist eine sehr analytische und sachliche Person mit einem starken Bedürfnis nach konkreten Zielvorgaben, die in einem Call-Center ständig mit zum Teil ganz unvorhersagbaren und emotionalen Kundenbeschwerden konfrontiert ist. Die Fähigkeiten dieser Person passen nicht zu den Anforderungen des Jobs, die Person ist überfordert. Ähnlich ist die Situation für einen emotionalempathisch orientierten Controller, der langsam, aber sicher in ein Burn-out-Syndrom gerät, wenn er den ganzen Tag seine ganze Emotionalität an zu kontrollierenden Zahlenkolonnen auszuleben versucht. Auch hier passen die Fähigkeiten des Controllers nicht zu dem, was in seinem Job gefragt ist. Im Gegensatz dazu läge eine Passung vor, wenn die sehr analytische und sachliche Person mit einem starken Bedürfnis nach konkreten Zielvorgaben aus dem ersten Beispiel in einem Job arbeiten würde, der klare Strukturen bietet, und wenn eine emotional-empathisch orientierte Person ihre Fähigkeiten in einer Aufgabe ausleben könnte, die genau diese Orientierung fordert. Unter solchen Bedingungen ist Flow durch Person-Job-Passung möglich.
Eine allgemeine Definition von Motivation bei der Arbeit
Die Motivation, die Menschen aus ihrer Arbeit schöpfen, ist darauf ausgerichtet, Flow zu erleben. Dieses Ziel gibt dem Verhalten nachhaltig Energie, Richtung und Ausdauer.
Unsere Erfahrungen und die Rückmeldungen aus der Praxis zeigen deutlich: Alle Menschen in den Unternehmen wollen Flow erleben. Selbst diejenigen, die vordergründig nur auf Geld verdienen und Macht aus sind, genießen durchaus die Phasen, in denen ihr zielgerichtetes Handeln wie von selbst und mit höchster Effizienz abläuft. Sie spüren, dass dieser Zustand umso stärker erlebt wird, je stärker ihre Motive und Eigenschaften aktiviert sind und je stärker die Herausforderungen vonseiten der Umwelt ausfallen. Passt beides auch nur kurzzeitig perfekt zusammen, dann will man dieses Flow-Gefühl immer wieder erleben und schöpft daraus Kraft für den Alltag. Aus Abbildung 1.1 lassen sich die zwei folgenden, wichtigen Motivationskonzepte ableiten.
Wie kann Flow erreicht werden?
Motivation (Flow) braucht nicht durch wundersame Techniken mühsam induziert zu werden. Ganz im Gegenteil: Die Menschen sind von selbst motiviert, Flow zu erleben, d.h. eine Passung zwischen der eigenen Persönlichkeit und den Anforderungen des Jobs herzustellen. Motivieren heißt daher, Menschen dabei zu helfen, für sich und die Team-Mitglieder eine optimale Passung zu den Anforderungen des Jobs zu finden.Eine optimale Person-Job-Passung und damit Flow herzustellen, setzt notwendigerweise die Diagnostik der Persönlichkeitsmerkmale und der Jobmerkmale voraus. Personen zu motivieren bedeutet demnach zuallererst, Motivationsdiagnostik zu betreiben, d.h. herauszufinden, was eine Person motiviert, um dann auf dieser Basis zu erarbeiten, was sie in ihrem Job konkret zur Motivierung benötigt.Zur Diagnostik persönlicher Motivationsquellen werden Tests, Methoden und Instrumente eingesetzt. Wer diese sicher anwendet, kann ein wirksamer Motivator werden. Zusammen mit einer guten Diagnostik können „Zauberwörter“ und „Wunderstrategien“ sogar regelrecht von falschen Versprechungen hin zu unterstützenden Maßnahmen mutieren. So kann der Hinweis auf die Allmacht des „positiven Denkens“ oder der „Selbstwirksamkeitsüberzeugungen“ („Just believe in yourself“) zwar einerseits die fehlenden Kompetenzen nicht ersetzen (Kuhl, 1981; Martens & Kuhl, 2008). Andererseits kann jedoch schon die Suggestionskraft solcher Schlüsselkonzepte die Wirkung neu gewonnener Kompetenzen verstärken, wenn diese zusammen mit einer umfassenden Diagnostik eingesetzt werden, die die entwicklungsfähigen Kompetenzen identifiziert und den Arbeitsschwerpunkt einer darauf aufbauenden Intervention festlegt (Beratung, Coaching, Training oder Therapie). Analoge Erfahrungen gibt es auch in anderen Berufen: Der gute Ruf einer Heilpflanze, eines Medikaments oder einer Behandlungsmethode kann durchaus deren Wirkung verstärken, wenn er mit einer sicheren Diagnostik und den darauf aufbauenden Maßnahmen zusammentrifft. Entscheidend ist, dass unterstützende Maßnahmen zur Motivierung einer Person auf deren individuelle Persönlichkeit zugeschnitten sind. Menschen benötigen unterschiedliche berufliche Rahmenbedingungen und Anforderungen, um motiviert zu sein – Motivationsmaßnahmen, die nach dem Gießkannenprinzip auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezogen werden, sind daher wenig sinnvoll.
Ohne eine Diagnostik der relevanten Person- und Jobmerkmale besteht die Gefahr, dass es zwischen den Merkmalen einer Person und ihrem Job zur Nicht-Passung kommt. Ein eher analytischer und rationaler Mitarbeiter kann beispielsweise in einem Job mit klaren Strukturen und konkreten Zielvorgaben sehr motiviert und erfolgreich sein. Wird dieser Mitarbeiter jedoch in ein völlig unstrukturiertes Umfeld versetzt, in dem es keine klaren Arbeitsaufträge, kein eindeutiges Feedback und auch keine Zielvereinbarungen gibt, ist keine Passung mehr zwischen Person- und Jobmerkmalen gegeben. Auch wenn diese Person noch so gut für ihre Aufgabe qualifiziert ist, wird Demotivation die Folge sein. Entsprechend wird es einem Mitarbeiter ergehen, der es gewohnt ist, objektiv und logisch zu entscheiden, von dem aber im Job subjektive Gefühlsarbeit abverlangt wird. Es gibt im Alltag viele solcher Beispiele, von denen wir einige in diesem Buch anhand konkreter Fallbeschreibungen diskutieren werden.
Das Erkennen und Beseitigen von Demotivation kann sich schwierig gestalten, da deren Bedingungen oft unbewusst sind. So mag eine Person davon überzeugt sein, in ihrem Arbeitsumfeld subjektive Gefühlsarbeit zu verrichten und mit ihrer Persönlichkeit auch zu diesem Job zu passen. Zuweilen kann dies jedoch durchaus ein Irrtum sein: Es gibt heute klare Hinweise darauf, dass Menschen nicht selten dazu neigen, sich hinsichtlich bestimmter Persönlichkeitseigenschaften falsch einzuschätzen. Dies liegt letztlich daran, dass das bewusste Selbstkonzept eines Menschen nur eines von mehreren Erkenntnissystemen im „Universum“ des menschlichen Geistes ist. Neben den bewussten Konzepten, die Menschen über sich und die Welt bilden, gibt es andere Systeme im Gehirn, die überwiegend „nicht bewusst“ arbeiten. Immer wenn die Erkenntnisse eines Systems nicht expliziert werden können (d. h. nicht sprachlich oder nonverbal ausgedrückt werden können), dann sprechen wir heute von impliziten Prozessen. Hierzu gehören vor allem Motive, und überhaupt viele Prozesse, von denen die Art und Weise abhängt, wie wir Informationen wahrnehmen, beurteilen und Handlungen initiieren (Kuhl, 2001; McClelland, 1985; Scheffer, 2005). Wir werden uns später noch eingehend mit der Diagnostik von Motiven befassen. Motive sind besonders wichtig für das Coaching und die Beratung, da sie unbewusste Kraftquellen der Motivation darstellen (Cox & Klinger, 2004; Schultheiss & Brunstein, 2005). Eine Person, der ihr hohes implizites Machtmotiv bislang nicht bewusst war, kann, indem sie sich ihrer unbewussten Machtmotivation bewusst wird und die positiven Seiten ihrer Machtmotivation entdeckt, lernen, sich Möglichkeiten zu schaffen, um zu führen und zu entscheiden und somit ihre Machtmotivation als unbewusste Kraftquelle viel besser nutzen. Als vorläufige Begriffsbestimmung können wir festhalten: Motive entstehen als Reaktion auf Sozialisationsbedingungen, die immer im Rahmen der Persönlichkeitsdispositionen von Individuen variiert, d.h. die Ausprägung persönlicher Motive ist zum Teil angeboren, aber zum Teil auch Ausdruck der individuellen frühkindlichen Erfahrung mit der Art und Weise, wie Bedürfnisse (zum Beispiel nach Beziehung, Leistung und Macht) befriedigt oder frustriert wurden. Sie sind in einer vorbegrifflichen, bildhaften Sprache gespeichert und wirken sich besonders auf die spontane Wahrnehmung der Möglichkeiten aus, in einer konkreten Situation ein vorherrschendes Bedürfnis zu befriedigen.
1.2 Die Korrelationsfalle: Hängt Verhalten von der Situation oder der Person ab?
Bevor wir die theoretischen und diagnostischen Grundlagen im Einzelnen besprechen, ist es sinnvoll, einige Missverständnisse zu klären, die auch heute noch viele Praktiker davon abhalten, die Fortschritte der modernen Persönlichkeits- und Motivationspsychologie zu nutzen. Wo steht die Diagnostik von Persönlichkeit und Motivation heute und warum steht sie dort?
Wenn wir diese Frage ehrlich beantworten wollen, dann kommen wir nicht umhin zu konstatieren, dass die Diagnostik von Persönlichkeit und die daran gekoppelten Anwendungen in der Praxis häufig einen erstaunlich geringen Stellenwert haben. Das ist in anderen Lebensbereichen anders: Wer meint, von einer Ernährungsberatung zu profitieren, wer zum Arzt geht oder sein Auto in die Werkstatt bringt, erwartet eine fundierte Diagnose und nicht blindes Herumprobieren. Warum ist dies anders, wenn es um die eigene Persönlichkeit geht? Wie kommt es, dass das, was in anderen Bereichen selbstverständlich ist, nicht genutzt wird, wenn es um die Motivation und andere persönliche Kompetenzen geht, deren Bedeutung für den beruflichen Erfolg nicht angezweifelt wird? Es lohnt sich, einige Gründe für diese Situation etwas näher zu betrachten.
Bei unseren Diskussionen in den Unternehmen sind uns drei Sorgen besonders oft begegnet: Eindringen in den Privatbereich der Person (Grenzüberschreitung), Reduktion der Person auf einige starre Kategorien (Schubladendenken) und Aufdecken der eigenen Schwächen (Defizitorientierung). Diese drei Sorgen mögen auf manche Tests (oder den Umgang damit) zutreffen, passen aber nicht auf die hier gemeinten neuen Methoden einer entwicklungsorientierten Diagnostik (Entwicklungsorientierte Systemdiagnostik: EOS und Visual Questionnaire: ViQ). Nehmen wir die Sorge um die Grenzüberschreitung: Viele Menschen verbinden Persönlichkeitsdiagnostik mit einem Eindringen in die zu schützende Privatsphäre. Als die Entwicklungsorientierte Systemdiagnostik (EOS) zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, titelte eine Münchner Boulevardzeitung mit „Der gläserne Mensch“ und traf damit eine Grundangst vieler Menschen vor einer Durchleuchtung des Seelenlebens. Diese Sorge beruht jedoch auf einem Missverständnis: Die Systemdiagnostik untersucht – im Unterschied zu manchen klassischen Persönlichkeitstests – nicht persönliche Überzeugungen, sondern Kompetenzen, die man zur Umsetzung der eigenen Fähigkeiten in erfolgreiches Handeln braucht. Dabei ist weder EOS noch ViQ auf die Feststellung statischer Strukturmerkmale der Person ausgerichtet, sondern auf die Ermittlung entwicklungsfähiger Kompetenzen. Damit ist auch die Gefahr der Defizitorientierung gebannt. Die Diagnostik ist in dem Sinne ressourcenorientiert, dass gezielt nach den latenten Kompetenzbereichen gesucht wird, bei denen das größte Entwicklungspotential der Person zu vermuten ist.
Die Tatsache, dass das Denken in Persönlichkeitskategorien historisch noch sehr jung ist, mag zum Teil auch mit den genannten drei Gründen zusammenhängen. Sicherlich gibt es weitere Gründe, die in der Unternehmenskultur und in gesellschaftlichen Grundüberzeugungen verwurzelt sind. Die Persönlichkeitsdiagnostik hat zwar im Personalbereich seit den 1980er Jahren durchaus eine zunehmende Verbreitung gefunden, insgesamt aber in der Wirtschaftswelt einen nach wie vor marginalen Einfluss. In der Marktforschung und im Marketing, aber auch in der Produktentwicklung werden so gut wie nie Persönlichkeitsvariablen berücksichtigt. Dabei läge es nahe, die unterschiedliche Wahrnehmung und Motivation verschiedener Zielgruppen in diese Entscheidungsprozesse einzubeziehen. So achten manche Menschen bei Produkten mehr auf Details und spezifische Informationen, während andere Menschen sie mehr intuitiv und ganzheitlich wahrnehmen und durch Details eher irritiert oder sogar abgestoßen werden.
Das zuletzt genannte Beispiel konnten wir auch auf unsere eigene Arbeit anwenden. Eine der wichtigsten Rückmeldungen, die wir beim praktischen Einsatz unserer Theorie in den Unternehmen erhielten, war der Hinweis, dass manche Praktiker zwar die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) hervorragend verstanden, ihre Relevanz ganz klar erkannt hatten und auch mit den Instrumenten der PSI-Theorie bestens umgehen konnten, die erhoffte Wirkung in ihrem Unternehmen aber dennoch nicht erzielten (während andere Praktiker rasche Anwendungserfolge berichteten). Wir fragten uns, woran dieses Transferproblem liegen könnte und kamen zu dem Schluss: Oft argumentierten wir zu sehr aus dem Detail heraus, und zwar aus einer sehr spezifischen persönlichkeitspsychologischen Perspektive, die vieles voraussetzt, was bei den Mitgliedern von Wirtschaftsorganisationen nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann.
Eine solche Grundvoraussetzung, über die wir gar nicht gesprochen hatten, weil sie uns selbstverständlich erschien, ist die Annahme, dass individuelle Unterschiede und damit Persönlichkeit wirklich wichtig ist im Arbeitsleben. Zwar wird dieser Aussage prinzipiell niemand direkt widersprechen, aber gelebte Wirklichkeit ist die Beachtung von Persönlichkeitsunterschieden deswegen noch lange nicht – weder in Unternehmen noch in der Gesellschaft als Ganzes.
Zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir daher folgende Frage ausführlich untersuchen: „Ist die Beachtung von Persönlichkeitsunterschieden eigentlich wichtig?“ Erst wenn diese Frage nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern aus voller Überzeugung positiv beantwortet wird, kann damit gerechnet werden, dass Entscheider in den Unternehmen die Fortschritte der Motivations- und Persönlichkeitsforschung nutzen und die Job-Person-Passung optimieren. Auf diese Unterstützung durch die Unternehmensführung kommt es natürlich an, damit der hier beschriebene Ansatz wirklich gelebt und nachhaltig wirksam werden kann.
1.2.1 Zur Bedeutung von Persönlichkeitsunterschieden in der Wirtschaftswelt
Warum sind interindividuelle Unterschiede und Persönlichkeitsmerkmale heute für Unternehmen so eminent wichtig? Darauf gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort ist nach außen gerichtet und nimmt den Kunden in den Blick, der immer individueller angesprochen werden will. Die Individualisierung von Produkten und Dienstleistungen bezeichnete der russische Ökonom Nikolai Kondratieff (1892–1938) als den Mega-Trend des 21. Jahrhunderts. Tatsächlich wird es immer wichtiger, Kundengruppen nicht nur nach soziodemographischen, sondern zusätzlich nach Persönlichkeitsmerkmalen zu segmentieren. Marketingexperten fordern eindringlich, dass Firmen eine lernende Beziehung zum Kunden aufbauen – ihn besser und persönlicher kennenlernen. Hierfür braucht eine Organisation Experten, die sich mit den Persönlichkeitsmerkmalen ihrer Kunden auskennen und diese Erkenntnisse in die Geschäftsprozesse implementieren.
Allerdings spielen Persönlichkeitsmerkmale des Kunden immer noch eine geringe Rolle. Die Marktforschung verlässt sich heute vor allem auf Variablen wie Geschlecht und Alter, einige soziodemographische Kennwerte wie Einkommen und höchstens noch auf eng an soziale Milieus gekoppelte Werthaltungen. Persönlichkeitsmerkmale im differentiellen Sinn spielen in der Praxis keine Rolle. Das hat weitreichende Folgen: Dort, wo es im Unternehmen um Geld geht, ist die Persönlichkeit des Menschen eine unbekannte Dimension. Sie fristet in den Personalabteilungen ein Schattendasein, aus dem sie aufgrund mangelnder Relevanz nicht heraustreten kann, um im Unternehmen zu wirken.
Eine auf Persönlichkeitsmerkmalen beruhende Kundenzentrierung kann eine erheblich verbesserte Kommunikation und damit einhergehend einen signifikant höheren Umsatz bewirken, vor allem, wenn Vertriebskräfte sowie andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt geschult werden, sensibler auf die Persönlichkeitsunterschiede von Kunden zu achten, um besser auf die charakteristischen Persönlichkeitsmerkmale ihrer Kernzielgruppe eingehen zu können.
Die zweite Antwort auf die Frage, warum interindividuelle Unterschiede und Persönlichkeitsmerkmale heute für Unternehmen so eminent wichtig sind, fokussiert die Mitarbeiterführung. So werden natürlich auch die Mitarbeiter stärker motiviert, wenn Führungskräfte individuell führen – durch die Beachtung von Persönlichkeitsmerkmalen wird eine optimale Person-Job-Passung und eine zum Persönlichkeitstyp passende Zielsetzung erreicht. Diese Zusammenhänge lassen sich in Unternehmen oft wirksamer darstellen, wenn man den Umweg über die Marktforschung bzw. das Marketing nimmt. Für ein Unternehmen erwächst daraus die Chance, die Aktivitäten dieser Abteilungen mit denen der Personalabteilung zu koordinieren. Es kann dann durchaus passieren, dass auch weitere Abteilungen plötzlich an dem Thema Persönlichkeit interessiert sind, wenn etwa die Abteilung Forschung & Entwicklung ihre Produkte auf die Persönlichkeit der Zielgruppe abstimmen will.
Persönlichkeitsmerkmale („Traits“) werden nach Allport (1937) als dauerhafte, neuropsychische Strukturen der Person definiert, die in einer Vielzahl von Situationen in konsistenter Weise deutlich erkennbar werden. Die Art und Weise, wie Menschen handeln und denken, reflektiert jedoch nicht nur ihre „Persönlichkeit“ im engeren Sinne. Auch andere Faktoren, wie die soziale Herkunft und damit verbundene Einstellungen, beeinflussen das Verhalten. Die Abgrenzung dieser und anderer Einflüsse ist nicht einfach. Meistens ist das Verhalten eine Funktion verschiedener Einflüsse, bei der die Persönlichkeitsmerkmale fast immer eine zentrale Rolle spielen. Die Organisations- und Personalpsychologie beschäftigt sich mit Persönlichkeitsmerkmalen mit dem Ziel, Vorhersagen zu arbeitsrelevanten Fragen wie Arbeitsleistung, Motivation oder Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern sowie den Erwartungen und Bedürfnissen von Kunden treffen zu können.
Besonders in sogenannten „schwachen“, mehrdeutigen und unsicheren Situationen kommt verschiedenen Persönlichkeitsvariablen eine Schlüsselrolle zu, also dann, wenn das individuelle Verhalten weniger stark durch die Umwelt determiniert ist. Die zunehmende Globalisierung und Individualisierung sowie der rasante technologische Wandel machen viele Alltagssituationen immer häufiger zu „schwachen“ Einflussgrößen, d.h., sie lassen viel Spielraum für individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung und Beurteilung handlungsrelevanter Informationen. Konsumenten in Deutschland müssen beispielsweise aus mehr als 50 000 aktiv beworbenen Marken auswählen, und das tun sie auch aufgrund unbewusster Filter, die durch ihre Persönlichkeit gesteuert werden. Mitarbeiter motivieren und führen bedeutet daher zunehmend, sie auf die differenzierenden Persönlichkeitsmerkmale von verschiedenen Kundengruppen auszurichten.
Persönlichkeitsmerkmale bieten also eine Struktur, die in Zeiten, in denen andere Strukturen zunehmend verfallen, immer wichtiger wird. Wenn Servicemitarbeiter wissen, dass eine bestimmte Kundengruppe sich durch einen emotionalen Entscheidungsstil signifikant von anderen Gruppen unterscheidet, kann dies sehr hilfreich sein, da es die Art und Weise der Kommunikation erleichtert (eine emotionale, persönliche Ansprache der Kunden ist wichtig).
Natürlich hat jeder Mensch eine einzigartige Ausprägung von verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen. Trotzdem kann es sinnvoll sein, diese Einzigartigkeit durch die Bildung von Typen oder Gruppenprofilen handhabbarer zu machen. Bestimmte Marken werden tatsächlich auch aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale gekauft (Scheier & Held, 2007), sodass es durchaus Sinn macht, bestimmte Käufergruppen beispielsweise als „einflussmotiviert“ oder „emotional“ zu charakterisieren.
1.2.2 Gibt es einen konsistenten Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf das Verhalten?
Die Idee, dass dauerhafte charakteristische Merkmale („Traits“) der Person das Verhalten erklären, war im Verlauf der Geschichte der Psychologie keineswegs immer gleichermaßen einflussreich. Ganz im Gegenteil: Ein alternativer Erklärungsansatz, der besagt, dass Verhalten unter der direkten, unmittelbaren Kontrolle von Situationen bzw. soziodemographischen Einflüssen steht und Traits höchstens marginal eingreifen, war zumindest die letzten 100 Jahre wesentlich einflussreicher – sowohl in der Psychologie als Wissenschaft als auch in der Gesellschaft als Ganzes. Abbildung 1.2 zeigt das „Auf und Ab“ dieser beiden komplementären Erklärungsansätze, wobei der Verlauf der Variablen „Einfluss“ über die Zeit (1900–2010) bei beiden Kurven natürlich eine grobe Annäherung ist und keine exakte Quantifizierung. Im Prinzip stellt sich der Verlauf so dar, dass die Bedeutung des Trait-Ansatzes zu Anfang des letzten Jahrhunderts allmählich anstieg, ab den 1950er Jahren dann aber so erheblich an Einfluss verlor, dass man von einer großen Krise der Persönlichkeitsforschung sprechen kann. Der Einfluss des eher situativen bzw. soziodemographischen Erklärungsansatzes war immer höher, ganz besonders in der Marktforschung.
Abb. 1.2: Soziodemographischer und traitbezogener Erklärungsansatz im Wandel der Zeit
Der Tiefpunkt der Erklärungsmacht des Trait-Ansatzes liegt wohl irgendwann Anfang der 1980er Jahre. Erst Mitte der 1980er Jahre erholte sich diese Sichtweise wieder, besonders weil Experten im Human-Resources-Bereich (HR) merkten, dass es ohne Persönlichkeitsdiagnostik kaum gelingt, valide Prognosen über den Berufserfolg von Individuen zu erstellen. Das geflügelte Wort damals – wie heute – war in diesem Zusammenhang: „We hire for facts but fire for personality.“
Die Rivalität der beiden komplementären Erklärungsansätze wurde im Laufe der Zeit mit unterschiedlichen Schlagwörtern umschrieben: „Situation versus Person“, „nature versus nurture“ (Anlage oder Umwelt) oder „state versus trait“ (kurzlebiger Zustand oder überdauernde Eigenschaft). Allen diesen Schlagwörtern ist gemeinsam, dass sie die komplizierte Wirklichkeit hinter der Komplementarität nicht vollständig erfassen. So verkennt der Gegensatz „Situation versus Person“, dass situative Einflüsse natürlich auch intern repräsentiert sein können, beispielsweise in Form von Einstellungen und Werthaltungen, die eine Person im Laufe ihrer Sozialisation angenommen hat. Auch das Gegensatzpaar „state versus trait“ (Zustand versus Eigenschaft) ist missverständlich, da es nahelegt, Eigenschaften seien unveränderbar. Eigenschaften (traits) sind aber, trotz ihrer definitionsgemäßen Stabilität, nicht statisch. Sie lassen sich, innerhalb eines gewissen festgelegten Rahmens, durchaus verändern (zum Beispiel durch einschneidende Erfahrungen, durch Coaching, durch Therapie).
Oft meint man, aus ideologischen Gründen Eigenschaften und andere Persönlichkeitseinflüsse ablehnen zu müssen, da das Hervorheben von Persönlichkeitsmerkmalen weniger Raum für politische und gesellschaftliche Veränderungen lasse als das Fokussieren auf situative Einflüsse, die man verändern könne. Situative Bedingungen sind allerdings nicht immer leicht zu verändern: Dass ein Kind kranke Eltern hat, dass es in einer Bibliothek relativ ruhig ist und in einer Disco oft laut, lässt sich nicht ohne Weiteres ändern. Manche Situationen werden relativ stabil, indem sie zu internen Repräsentationen werden. Ein Beispiel sind frühe Bindungserfahrungen, die sich als „sichere“ oder „unsichere“ Bindungsrepräsentationen das ganze Leben über auswirken (Ainsworth et al., 1978). Natürlich kann man mit gewissem Recht einwenden, dass verinnerlichte Situationen Teil der Persönlichkeit sind. Letztlich wird man die beiden Kurven in Abbildung 1.2 deshalb nicht wirklich als strenge Gegensätze ansehen, sondern sie in einer dialektischen Beziehung zueinander verstehen müssen.
Am besten beschreibt noch das Schlagwort „nature versus nurture“ das von uns Gemeinte (Anlage versus Umwelt). Traits sind in erheblichem Maße genetisch determiniert. Sie werden nach heutigem Wissen so gut wie gar nicht durch Faktoren beeinflusst, die für alle Geschwister gleich sind, wie zum Beispiel der Schicht, dem Erziehungsstil und den gelebten Normen und Werten der Eltern, der Kultur usw. Tatsächlich verweisen Befunde aus der Verhaltensgenetik darauf, dass ca. 50 Prozent der Varianz innerhalb stabiler Persönlichkeitsmerkmale genetisch bedingt ist und die restlichen Anteile der Varianz offenbar auf das Konto noch wenig verstandener Umwelteinflüsse gehen, die den Geschwistern nicht gemeinsam sind (Loehlin, 1982, 1989). Auch ist die empirische Evidenz gegen den Einfluss der Erziehung durch die Eltern durchaus fundiert – Kinder sind viel resistenter gegenüber den Erziehungsversuchen ihrer Eltern, was deren charakteristische Merkmale und Vorlieben angeht, als gedacht (Plomin, 1986). Manche Forscher gehen sogar so weit zu sagen, dass eher die Eltern auf das „Temperament“ des Kindes reagieren, als dass sie dessen Temperament beeinflussen (Harris, 1995).
Letztlich ist das Erleben und Verhalten immer eine Interaktion zwischen Situation und Person. Auch Gene können selbstverständlich ohne Umwelt keine Wirkung erzielen, denn sie brauchen dazu Proteine, die ihnen über die Außenwelt (zum Beispiel Nahrung) zugeführt werden. Trotzdem gibt es aber sog. „starke Situationen“, die das Erleben und Verhalten von Menschen nahezu vollständig kontrollieren. Diese Auffassung wird paradigmatisch von der Marx’schen Grundidee verdeutlicht, dass das „Sein das Bewusstsein bestimmt“.
Andere mächtige Bewegungen haben diesen Erklärungsansatz immer einflussreich gehalten. Man denke nur an die Philosophie des Behaviorismus, die besagt, dass das Verhalten vollständig eine Funktion von externen Belohnungs- und Bestrafungserfahrungen ist und intrapsychische Vorgänge als „Blackbox“ ausgeklammert werden müssen. Wie extrem dieser Ansatz gemeint war, verdeutlich ein Zitat, das Watson zugeschrieben wird, und sinngemäß besagt, dass man drei zufällig ausgewählte, gesunde Jungen nach Belieben zu einem Genie, einem Verbrecher oder einem Bettler machen kann. Der Behaviorismus war nicht einfach eine für sich isolierte Denkschule, sondern hat in breiten Teilen der Psychologie lange Zeit als Denkbasis gedient: Individuelles Handeln wird bestimmt von sozialen Umständen.
Vorbereitet wurde diese Denkschule durch die berühmten Hawthorne-Studien, welche die Macht des Umfeldes in Arbeitssituationen belegten. Die Experimente von Milgram (1974) und Zimbardo (1969) zeigten den enormen Einfluss von Konformität erzeugenden Situationen in schockierender Weise auf. Abhängig davon, welches Verhalten belohnt bzw. bestraft wird, kann offenbar so gut wie jeder Mensch zu einem Folterknecht gemacht werden! Die individuelle Persönlichkeit erscheint in allen diesen Studien als zu vernachlässigende Einflussgröße.
Die komplementäre Auffassung, dass Kräfte innerhalb des Individuums das Verhalten steuern, ging zu Anfang des 20. Jahrhunderts zunächst vor allem auf C. G. Jung zurück, war aber natürlich von anderen auch schon vorher vertreten worden. Jung erklärte das Erleben und Verhalten als eine Funktion von stabilen intrapsychischen Strukturen. Später formulierten Allport und Cattell die amerikanische Sichtweise und trugen dazu bei, weite Bevölkerungskreise vom Einfluss verschiedener Persönlichkeitseigenschaften zu überzeugen.
Auslöser der großen Krise der Persönlichkeitsforschung war das Konsistenzparadox. Der intuitive Beobachter menschlichen Verhaltens ist davon überzeugt, dass er selbst und andere Personen sich über verschiedene Situationen und Zeitpunkte hinweg in hohem Maße konsistent verhalten. Diese sogenannte „transsituative Konsistenz“ ist ein zentrales Bestimmungsstück der Definition von Persönlichkeit. Sobald man jedoch diese Erwartung empirisch zu bestätigen suchte, fand man eine enttäuschend geringe Konsistenz des Verhaltens (zusammenfassend Scheffer & Heckhausen, 2005). Mischel (1968) meinte daher, dem „gesunden Menschenverstand“ widersprechen zu müssen, und behauptete, die Vorstellung von einer stabilen „Persönlichkeit“ sei eine Einbildung.
Persönlichkeitsvariablen wurden aufgrund des „Konsistenzparadox“ in der Psychologie spätestens seit einem epochalen Beitrag von Guion und Gottier (1965) bis in die 1990er Jahre – also fast 30 Jahre lang – als nicht mehr akzeptabel angesehen. In dieser Zeit war es eine „Weltanschauung“, dass die Situation – und nicht die Persönlichkeit – das Verhalten determiniert. Und diese war oft verbunden mit der optimistischen Auffassung, man müsse nur die Umstände verändern, um im Nu den „neuen Menschen“ in einer humaneren Arbeitswelt zu schaffen. Erst später wurde in der Organisations- und Personalpsychologie zunehmend erkannt, dass die differentielle Psychologie mit ihren Persönlichkeitstheorien einen wichtigen Beitrag zur Lösung organisationspsychologischer Probleme leisten kann. Dieser gedanklichen Neuorientierung gingen allerdings Diskussionen über viele Jahre voraus.
Es gab auch weitere Auslöser der „Krise des Persönlichkeitsansatzes“. Viele Kritiker warfen diesem traitbezogenen Ansatz – insbesondere in Europa – einen pathologisierenden Bias (Verzerrung) vor. Tatsächlich beschäftigten sich viele Persönlichkeitsforscher mit krankhaften Merkmalen der Persönlichkeit oder benannten Persönlichkeitsdimensionen mit pathologisierenden Begriffen wie Neurotizismus. Dies kann durchaus dazu beigetragen haben, dass Persönlichkeitstests in Richtung sozialer Erwünschtheit verfälscht werden. Niemand möchte gerne als neurotisch oder unverträglich dastehen, erst recht nicht, wenn der Test im Rahmen von Auswahlverfahren angewendet wird. Schließlich wurde dem Trait-Ansatz auch die unübersichtliche Vielfalt verschiedener Skalen und theoretischer Ansätze zum Verhängnis, die in dessen Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg wie Pilze aus dem Boden geschossen waren. Als man versuchte, mithilfe einer in der Intelligenztestforschung entwickelten Methode (Faktorenanalyse) aus dem Dilemma einer immer unübersichtlicheren Vielfalt von Persönlichkeitsmerkmalen durch das Zusammenfassen korrelierender Merkmale herauszufinden, geriet die Persönlichkeitsforschung in eine noch tiefere Sackgasse.
1.2.3 Der Aggregationsansatz: Korrelation und Faktorenanalyse
Da die meisten der heute verwendeten Persönlichkeitstests mithilfe der Faktorenanalyse entwickelt wurden, wollen wir kurz erklären, wo sich die EOS-Methodik von der Logik der Faktorenanalyse abgrenzt. Das Prinzip der Faktorenanalyse ist recht einfach: Persönlichkeitsmerkmale, die korrelieren, werden zu Faktoren zusammengefasst, die man im Sinne von Persönlichkeitsdimensionen oder Eigenschaften interpretiert. Wenn Menschen, die sich selbst als sehr gesellig beschreiben, oft auch ihre Tatkraft und Unternehmungslust hoch einschätzen, vermutet man, dass Geselligkeit, Tatkraft und Unternehmungslust zu einem gemeinsamen Faktor gehören, der als Persönlichkeitsdisposition oder -eigenschaft interpretiert wird (in diesem Beispiel: Extraversion). Korrelationen zwischen zusammenhängenden Merkmalen können durchaus auf Gemeinsamkeiten aufmerksam machen, insbesondere wenn man die Faktorenanalyse theoriegeleitet einsetzt. Ohne Theorie ist jedoch das Risiko erhöht, korrelierende Merkmale zusammenzufassen, die gar nicht auf einer gemeinsamen Dimension beruhen. So ist beispielsweise die Korrelation zwischen Körpergröße und -gewicht viel höher als die Korrelation zwischen Merkmalen, die zu Persönlichkeitsfaktoren zusammengefasst werden. Dennoch wird man mit diesem Befund keinen Physiker davon überzeugen, dass Körpergröße und -gewicht dieselbe physikalische Dimension darstellen.