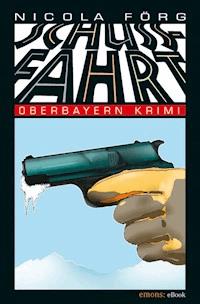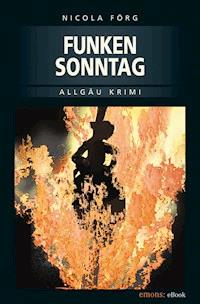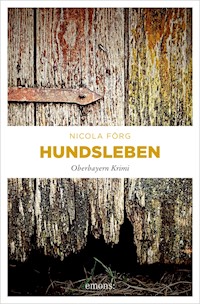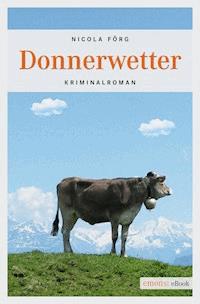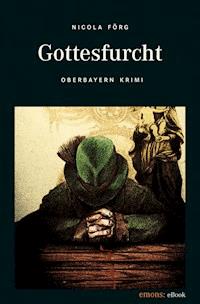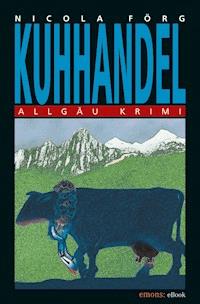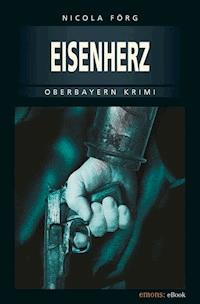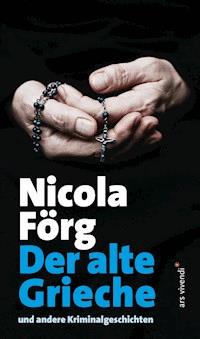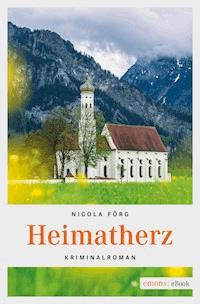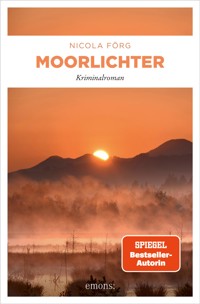8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein altes feudales Jagdhaus inmitten saftiger Weiden und dunkel wogender Tannen, die ihre nadelbehangenen Finger wie grüne Gespenster nach Irmi ausstrecken – märchenhafter könnte der Anblick kaum sein, wäre das Schneewittchen, das so friedlich im Schuppen liegt, doch nur eine schlafende Prinzessin und nicht die ermordete Gutsbesitzerin: Regina von Braun, bekannte Biologin, Jägerin und Forstwirtin, hatte sich mit ihrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ihrer großen Klappe nicht nur Freunde in der Region gemacht. Von der Auseinandersetzung mit ihrem Exfreund, einem Forstwirt und Großgrundbesitzer mit völlig anderen Ansichten, zeugt sogar eine Fernsehdebatte. Aber sind Abschusszahlen und fiese Wildereiwirklich Grund genug für einen Mord? Und was zum Geier hat das mit einem Tagebuch zu tun, das sich auf Reginas lange gut verstecktem Laptop befindet?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Gerhard Walter
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96194-3
© 2013 Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München
Liedtext von James Brown, It’s a man’s man’s world:
© 1966 (renewed) Dynatone Publishing Company (BMI)/Unichappell MusicInc. and Warner-Tamerlane Publishing Corp. (BMI); SVL:Neue Welt Musikverlag GmbH & Co. KG/Warner Chappell Music
Umschlaggestaltung: Mediabureau Di Stefano, Berlin, unter Verwendung der Fotos von s-cphoto, Renee Keith und
Shirley Kaiser/iStockphoto, D. Maehrmann/blickwinkel, Michal Krakowiak/Getty Images
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
This is a man’s world, this is a man’s world
But it would be nothing, nothing without a woman or a girl
You see man made the car to take us over the road
Man made the train to carry the heavy load
Man made the electric light to take us out of the dark
Man made the boat for the water like Noah made the ark
This is a man’s, man’s, man’s world
But it would be nothing, nothing without a woman or a girl
Man thinks about the little bitty baby girls and the baby boys
Man makes them happy ’cause man made them toys
And after man made everything, everything he can
You know that man makes money to buy from other men
This is a man’s world but it would be nothing,
nothing not one little thing without a woman or a girl
He’s lost in the wilderness, he’s lost in bitterness
He’s lost, lost somewhere in loneliness.
James Brown, This is a man’s world
Prolog
Es herrschte jene Stille, die nur der Morgen herbeizaubert. Ein paar Vögel irgendwo in den Bäumen begrüßten den Tag, die Wiesen atmeten Feuchte, und die flache Sonne stand noch hinter den Fichten.
Früher war Irmi ein Morgenmuffel gewesen – sie hatte es gehasst, in einer Landwirtsfamilie aufzuwachsen, denn dort hatte man stets zu unchristlichen Zeiten aufstehen müssen. Mittlerweile liebte sie den Morgen, er war die einzige unschuldige Zeit des Tages. Die Zeit des klaren Blicks. Auch Irmis Abende waren häufig still, aber sie hatten meist etwas Bleiernes an sich. Ihnen war ein Tag vorhergegangen, der Körper und Geist strapaziert hatte. Nur der Morgen war unschuldig und rein, bevor die Menschen dem Tag mit ihrer Unzulänglichkeit, ihrem Hass und ihren Verzweiflungstaten die Unschuld raubten.
Aus dem Wald traten vier Rehe, eins davon war der kleine Rehbock, den Irmi insgeheim Hansi getauft hatte. Er hob den Kopf und sah herüber. Lange. Dann senkte er die glänzende schwarze Nase und begann zu fressen. Die so eleganten und filigranen Tiere zogen langsam über die meerglatten Weiten am Rande des großen Moors. Sie waren grau, denn sie trugen noch ihr Winterkleid. Bald schon würden sie fürchterlich zerrupft aussehen und ins Braune wechseln. Im Wald würden ganze Fellbüschel liegen, und die Rehe würden ihre Hälse verdrehen, um sich das juckende Fell vom Rücken zu knabbern.
Anfang März war es schon einmal ungewöhnlich warm gewesen, doch es war die typische oberbayerische Rache gefolgt: Es hatte wieder geschneit, und zwar zuhauf. Der kurze Versuch mit aufgekrempelten Jeans war ganz schnell wieder den gefütterten Gummistiefeln und den Fleecejacken gewichen. Heute Morgen hatte es auch nur zwei Grad plus, aber der Frühling schien irgendwo zu kauern und nur darauf zu warten, dem Weiß den Kampf ansagen zu dürfen. Diese ganze Jahreszeit war so unschuldig und optimistisch.
Die Rehe mussten etwas gehört haben, denn sie standen auf einmal starr wie Statuen da. Bernhard kam drüben aus dem Stall und ging über den gekiesten Vorplatz zum Haus hinüber. Hansi senkte als Erster wieder den Kopf – von diesem trampeligen Menschen drohte ihm keine Gefahr. Irmi fröstelte, aber sie konnte sich so schwer vom Anblick der Tiere lösen. Plötzlich ruckten sie wieder mit den Köpfen. Rannten eine kurze Strecke, hielten inne.
Der kleine rabenschwarze Kater kam wie ein Gummiball über die Wiesen gehüpft – in himmelhohen Sprüngen. Hansi schüttelte den Kopf, als wolle er den Kater für diese Energieverschwendung rügen. Schließlich hatte er Irmi erreicht, strich um ihre Beine und schüttelte vorwurfsvoll und angewidert die nassen Pfoten. Irmi lächelte und schenkte den Rehen einen letzten, fast wehmütigen Blick. Den Kater im Gefolge ging sie hinein.
Der Frieden eines Morgens war so kurzlebig. Auch der Friede des Frühlings wurde viel zu schnell von den donnernden Sommergewittern abgelöst, und die Rehe würden schon bald unter den Beschuss derer geraten, die um ihre Bäume fürchteten. Viele der Kitze würden die Mähmassaker nicht überleben. Der Friede für Tiere war so fragil. Jeder Friede war so anfällig für Störungen …
Es dröhnte, als würde jemand eine Lawine absprengen, und Sophia rief lachend: »Du klingst wie Dumbo, wenn du so trötest!«
»Sehr witzig!«, maulte Kathi wütend und nieste erneut. Das wiederum trieb das Soferl zu einem wahren Lachkrampf, sie wollte sich ausschütten vor Lachen, doch was sie dann tatsächlich verschüttete, war der Kakao, der den alten Holztisch flutete. Sophia sprang zwar sofort auf, um Küchenkrepp zu holen, aber die Flutwelle hatte schon die Tischkante erreicht und stürzte als brauner Wasserfall auf Kathis Jeans.
»Du blöde Nuss!«, brüllte Kathi und rannte unter Niesen die Treppe hinauf. Dort schälte sie sich aus der engen Jeans, feuerte sie neben das Bett und fingerte ein Papiertaschentuch aus der Packung am Nachttisch. Da lag draußen noch meterhoch Schnee, da zogen die Tourengeher in Karawanen zu Berge – und sie hatte Heuschnupfen. Jedes Jahr kam er wie ein plötzliches Gewitter ohne Ankündigung. Dabei war es so klar wie das Amen in der Kirche, dass die fiese Hasel und die bösartige Erle wieder blühen würden. Die gemeine Birke würde sich auch noch dazugesellen. Aber der Winter verdrängte dieses Wissen. Und eines Morgens wachte Kathi dann auf und fühlte sich, als habe sie die ganz Nacht durchgesoffen. Die Augen tränten, die Nase lief. Heißa! Der Frühling war da.
Kathi hasste das Frühjahr. Und sie hasste den Morgen. Um diese Tageszeit hatte sie gar keinen Nerv für ihre putzmuntere Tochter. Ebenso wenig wie für ihre Mutter, die immer gegen halb sechs aufstand und ihr jeden Morgen etwas zum Essen aufdrängte. Frühstück wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendbrot wie ein Bettler – diesen Spruch hatte sie schon in Soferls Alter gehasst. Bis heute hasste sie Frühstücken. Ein schwarzer Kaffee war doch völlig ausreichend. Warum ließen diese beiden lästigen Stehaufmännchen sie nicht einfach in Ruhe morgenmuffeln?
1
März1936
Es geht auf Josephi. Leider. Es hat tagelang geschneit, heut hat es aufgerissen. Irgendwo singt schon ein Vogel. Er singt hinein in diese Welt aus Weiß, die uns blendet. Ich zwinkere schon den ganzen Tag gegen die Sonne. Ach, würde sie doch nur wieder verschwinden. Aber ich werde es nicht mehr lange hinauszögern können. Der Herr Vater ist im Lechtal unten gewesen, er hat telefonieren lassen. Mir ist das unheimlich. Man spricht in ein Rohr, und so viele Tagreisen entfernt hören die etwas? Ganz so, als stünde einer neben einem? Der Herr Pfarrer hat auch gesagt, das ist Teufelswerk.
Aber der Herr Vater hat kein Einsehen. Er hat gesagt, dass ich gehen muss, auch wenn ich schon sechzehn bin. Solange dich keiner heiratet, musst du gehen. Er hat gesagt, ich sei selber schuld, dass ich noch keinen Burschen hätt. Wo soll ich denn einen Burschen hernehmen? Wir kommen den ganzen Winter doch nicht raus.
Die Flausen hierzubleiben, die wolle er mir schon austreiben, hat der Herr Vater gesagt. Und dass ich a gschnablige Fechl bin. Das ist nicht schön von ihm. Und das ist auch gar nicht wahr. Aber ich bin ein Mädchen, und der Herr Vater mag keine Mädchen. Die Zwillingsbrüder sind vor sechs Jahren am Joch gestorben, die Lawine hat sie beide mitgerissen.
Nur gut, dass die Johanna mit von der Partie ist und der Jakob. Mir wird jedes Jahr banger. Das erste Jahr war es am leichtesten, obwohl ich mir zwei Zehen erfroren habe. Aber das geschieht allen. Wir sind neun gewesen und eine Frau, die uns führen sollte. Von Elbigenalp waren sie auch heraufgestiegen, weswegen wir vier Hinterhornbacher immer am Hornbach entlang bis zur Hermann-von-Barth-Hütte hatten gehen müssen. Dort trafen wir uns, es gab eine Marend, sogar Muggafugg. Wir aßen und tranken, denn um den Krottenkopf herum und auf zum Mädelejoch, das war keine feine Strecke. Vereist war es gewesen, das Mädelejoch hatte kaum Schnee, der Wind hatte ihn verblasen. Aber dann kamen die Kitzabolla. Und kalt war es gewesen. So kalt.
Aber ich wusste damals noch nicht, was geschehen würde. Die Großen waren schon oft außi zu den Fritzle, der Konrad war sogar auf dem Kindermarkt in Ravensburg gewesen. Was er berichtet hat, war nicht schön. Später hatte auch der Konrad feste Herrschaften, und nun ist er längst als Stuckateur dussa. Ab dem dritten Jahr wurden wir in Kempten immer schon erwartet, sogar mit einem Fuhrwerk abgeholt. »Was für ein Glück«, hat die Mama immer gesagt. »Was ihr für ein Glück habt.« Und dann hat sie mich jedes Jahr so komisch angesehen, und bekreuzigt hat sie sich. Jedes Jahr mehr. Ich hatte ja Glück, zwei erfrorene Zehen sind nichts. Dem Oswald fehlen sogar drei Finger. Ganz schwarz sind die gewesen.
Mir wird es dennoch jedes Jahr schwerer ums Herz. Wir sind die Letzten. Aus Elbigenalp kommen sie nicht mehr, zwei der Mädchen, die Hermine und die Maria, sind tot. Warum, weiß ich nicht genau. Seit wir die Letzten sind, gehen wir den kürzeren Weg übers Hornbachjoch. Ich fürchte mich immer unter den Höllhörnern. Der Herr Pfarrer hat gesagt, der Teufel hause in den Zacken. Und dass wir beten müssten am Joch und uns bekreuzigen und einen Rosenkranz sprechen. Der Herr Pfarrer ist ein Knatterle, hat die Johanna gesagt, so was darf man aber doch nicht über einen Kirchenmann sagen. Wenn der Herr Pfarrer wüsste, dass wir uns immer nur ganz kurz bekreuzigt und nie einen Rosenkranz gebetet haben … Aber der Herr Pfarrer weiß ja nicht, wie eisig kalt es ist im Sturm droben am Joch.
Die Johanna hat gesagt, dass sie dieses Jahr nicht mehr heimkommen will, so wie die Gertrud. Diese Johanna. Solche Pläne hat die Johanna! Sie ist ein Wildfang, die Johanna! Ich habe viel lesen können im Winter. Der junge Herr Kaplan hat mir Bücher zugesteckt und Lesen mit mir geübt. Wir sind ja immer nur im Winter in der Schule, und oft fiel der Unterricht aus. Der junge Herr Kaplan musste aber bald nach der Christnacht gehen, ein Sozialist sei er, wurde geraunt. Was ist ein Sozialist? Ist ein Mann Gottes ein Sozialist?
»Schneewittchen ist schon tot«, sagte Benedikt. Dabei klang er altklug wie immer, und Julia atmete auf.
Sie selbst war schon wieder tausend Tode gestorben, weil Bene sich einmal mehr von der Gruppe abgesetzt hatte. Der Junge war eine Katastrophe, er schien osmotisch durch Wände diffundieren zu können. Man hatte ihn gerade noch im Blick, und eine Sekunde später war er verschwunden. Fand man ihn dann doch irgendwann, sagte er gerne: »I hob mi verzupft.« Das hatte er vom Allgäuer Opa, »der, wo in Trauchgau residiert«. Bene sagte wirklich »residiert«, der Opa schien ein relativ großes Haus zu haben. Julia beneidete weder Benes Eltern noch seine zukünftigen Lehrer. Bene beneidete sie auch nicht. Das war ein Kind, das anecken würde, ein allzu wacher Geist und ein Übermaß an Phantasie verunsicherten den Rest der dumpfen Welt.
»Benedikt, wo warst du schon wieder?« Julia versuchte streng zu klingen.
»Julia«, er ahmte die Stimme der Erzieherin nach, »ich habe doch gesagt, dass ich das tote Schneewittchen besuchen muss.«
In diesem Moment kam ihre Kollegin Lea zurück. Sie wirkte immer etwas überfordert und hatte offenbar das Elend der ganzen Welt auf ihre schmalen Schultern geladen.
»Diese Regina von Braun ist nirgendwo«, jammerte sie. »Die Haushälterin weiß auch nicht, wo sie steckt.«
»Oh, du liabs Herrgöttle«, kam es von Benedikt, und er schlug sich theatralisch die Hand auf die Stirn.
Das hatte er bestimmt auch vom Trauchgauer Opa. Julia unterdrückte das Grinsen, wies Bene zurecht und wandte sich an die Kollegin: »Vielleicht ist sie schon zu den Gehegen gegangen und füttert die Tiere. Wir gehen einfach mal runter.«
Gehen war allemal eine gute Idee, denn es hatte höchstens null Grad an diesem Morgen. Die Zwergentruppe war nur deshalb vergleichsweise ruhig, weil sie Kakao und Kekse bekommen hatte. Julia begann die Becher einzusammeln, überprüfte, dass jedes Kind seinen Rucksack hatte, und erklärte den Kleinen, dass sie nun ganz leise sein müssten, um die Tiere nicht zu erschrecken. »Pst«, machte sie, was augenblicklich eine ganze Woge von »Pst«-Geräuschen hervorrief – in der Lautstärke eines Düsenjets. Unter abflauenden »Psts« marschierten die Kinder in Zweierreihen hinter Julia her, hinein in den Wald, vorbei an einem Schild, das in Richtung Wildgehege deutete.
Julias Kindergartengruppe hatte am Morgen eigentlich einen Termin bei Dr. Regina von Braun. Die Biologin besaß ein Gut, das sie – wie man sich erzählte – mehr als Bürde denn als Würde ererbt hatte. Um es am Leben zu erhalten, hatte sie ein Walderlebniszentrum initiiert. Julia war die Eigentümerin nicht ganz unbekannt, weil Regina von Braun gern in Kindergärten vom Wald und seinen Bewohnern erzählte und dabei auch mal eine Eule mitbrachte oder einen Greifvogel. Sie war nämlich nicht nur Biologin, sondern auch Jägerin und Falknerin, und das wenige, was Julia von ihr wusste, war, dass ihre Tage offenbar mehr als vierundzwanzig Stunden hatten. Heute sollten die Kinder zwei zahme Elche und einige Rentiere besuchen. Das war natürlich eine Sensation im Oberland, ein echter Elch!
Nach fünf Minuten erreichten sie eine Lichtung. Die Sonne stand schon höher am Himmel und beleuchtete eine große Erklärungstafel und eine Sitzgruppe aus dickem Holz. Das Gehege lag dahinter, rechts davon stand ein großer Schuppen mit einer Schubkarre davor, die ein wenig vereinsamt wirkte. Bevor Julia ihn noch am Kapuzenzipfel erwischen konnte, sauste Benedikt davon, am Zaun entlang, hinüber zum Schuppen und hinein durch ein hohes Stahltor, das er öffnete, als habe er nie was anderes getan. Lea brüllte ihm ein verzweifeltes »Benedikt!« hinterher, Julia stöhnte. Es hätte so nette Jobs im Büro gegeben, bei Krankenkassen oder Behörden – warum nur hatte sie sich als Zwergenbezwingerin verdingt?
»Ihr bleibt hier und schaut euch schon mal mit Lea die Bilder auf der Tafel an. Ich hole den Bene, vielleicht ist Frau von Braun ja auch noch in dem Schuppen.«
Julia eilte zu dem Tor, das überraschend leichtgängig war. Der Schuppen entpuppte sich als Unterstand mit einem gewaltigen Vordach. Frische Hackschnitzel waren ausgebreitet, es duftete nach Holz. Benedikt stand da und betrachtete interessiert den Boden.
Dort lag Regina von Braun. Ihre ausgesprochen blauen Augen schienen verwundert ins Leere zu starren. Sie war blass, und ihr langes dunkles Haar war auf den Holzschnitzeln ausgebreitet. Aus einer Schusswunde an der Stirn trat Blut aus. Das kalkweiße Gesicht, die Haare wie Ebenholz, das rote Blut – eine tote Märchenfrau.
»Siehst du, Julia? Schneewittchen ist schon tot«, sagte Benedikt völlig ungerührt.
Julia war wie paralysiert und wachte erst auf, als hinter ihr das Chaos ausbrach. Natürlich war es Lea nicht gelungen, die Kinder auf den Holzbänken zu halten. Nun standen sie hier, und als eines zu weinen begann, brach ein kollektives Heulkonzert aus. Julia schaffte es irgendwie, die Kleinen wegzuscheuchen und sie zurück zum Haupthaus zu bringen, wo es in einem Nebengebäude einen Seminarraum mit Küche gab. Es glückte ihr sogar noch, Lea zum Kakaokochen abzukommandieren, die Polizei und die Haushälterin zu alarmieren.
Als die sich völlig erschüttert in Richtung des Geheges aufmachen wollte, stellte sich ihr Benedikt in den Weg. »Das darfst du nicht, das verwischt die Spuren. Wie im Fernsehen.«
Du lieber Himmel, was fand man im Hause Haggenmüller denn passend als TV-Kost für einen Fünfjährigen? Nun ja, bei den beiden Rechtsanwaltseltern konnte man ja nie wissen, dachte Julia und wunderte sich über sich selbst. Da draußen lag eine tote Frau, und sie dachte über Kindererziehung nach.
Die Haushälterin war leise weinend auf einen Stuhl gesunken. Benedikt ging zu ihr hin und reichte ihr einen Becher Kakao. »Abwarta und Kakau trinka«, sagte er. Oh, du segensreicher Opa aus dem schönen Halblechtal …
Irmi war beschwingt ins Büro gekommen. Dort traf sie auf eine Kathi, die wie die Inkarnation von »I don’t like Mondays« aussah. Die Augen verquollen, fummelte Kathi ein Taschentuch nach dem anderen heraus und verfluchte ihre Allergiemedikamente, die alle nichts halfen.
»Versuch’s doch mal mit Sulfur-Globuli«, schlug Irmi vor, was ihr einen Blick einbrachte, der vernichtend war.
»Zuckerkügelchen mit nix drin. Du glaubst auch an jeden Hokuspokus, Irmi, oder? So ein Placeboscheiß.«
Bevor Irmi in eine Diskussion einsteigen konnte, dass die homöopathischen Globuli sogar bei ihren Kühen wirkten und die Rinder ja kaum im Verdacht standen, auf ein Placebo hereingefallen zu sein, kam Sailer.
»Morgen, die Damen. Des wird heit nix mit Kaffeetrinken. Im Waldgut Braun is wer tot geworden.«
Tot geworden – der gute Sailer.
»Weiß man auch, wer tot geworden ist, Sailer?«
»Ja, die Frau Regina von Braun höchstselber. Derschussen. Sauber derschussen. Ned derhängt oder so was Unguats.«
Sauber derschussen – auch eine schöne Formulierung. Abgesehen davon war es für Irmi mehr als überraschend, dass der sonst so kryptische Sailer die komplette Information von sich gab, ohne dass sie ihm alles aus der Nase ziehen musste. Der Mann schien Montage zu mögen.
»Wer hat uns informiert?«, fragte Kathi unter Niesen.
»A Madl, das wo Kindergärtnerin ist. De Kinder ham de Frau g’funden.«
Auch das noch! Ein verschreckter Haufen Kinder, die überall herumgetrampelt waren, dachte Irmi.
»Na merci, Mausi«, kam es von Kathi.
Irmi sparte sich eine Zurechtweisung, informierte stattdessen das Team von der Kriminaltechnischen Untersuchung und forderte die Polizeipsychologin an – wegen der Kinder und weil sie ein ungutes Gefühl hatte, das sie momentan schwer zu deuten wusste. Dann nickte sie Kathi zu und wies Sailer an, den Kollegen Sepp im Streifenwagen mitzunehmen. Seit Irmi und ihr altes Cabrio vom TÜV geschieden worden waren, fuhr sie einen japanischen SUV, und der hatte dank Blechdach natürlich den Vorteil, dass man ein Blaulicht draufsetzen konnte. Außerdem besaß er eine gewisse Bodenfreiheit, was bei den alpinen Einsätzen nicht von Nachteil war.
Die Bodenfreiheit erwies sich heute als recht sinnvoll.
Zwei Kilometer hinter Grainau war das Waldgut durch ein verwittertes Holzschild ausgewiesen. Die Teerdecke der Zufahrtsstraße war von Löchern durchsetzt, die gut und gern als Ententümpel hätten herhalten können. Auf den Tümpeln lag eine dünne Eisschicht, die unter den Autoreifen brach.
Das Sträßchen mäandrierte durch den Wald. Es lagen noch immer Schneehaufen am Wegesrand, und Irmi vermutete, dass das Gut im Winter bisweilen von der übrigen Welt abgeschnitten war. Sie fand den Gedanken gar nicht so uncharmant, während Kathi böse nach vorne starrte und maulte: »Das ist voll am Arsch der Welt hier.« Und nieste.
Zu ihrer Linken lag ein kleiner Moorsee, alles sehr idyllisch und doch auch düster in seiner schweren Farbigkeit. Sie kamen aus dem Wald, ein Feld lag vor ihnen und mittendrin das Gut. Rechts thronte das Haupthaus auf einem kleinen Hügel, ein stolzer Bau oder besser ein ehemals stolzer Bau im Stil eines kleinen Jagdschlösschens. Links stand ein Wirtschaftsgebäude mit einem anschließenden Stadl. Vor ihnen schlängelte sich das Sträßchen weiter, vorbei an einem Tipidorf, und danach schon wieder der Wald, der hier alles umschloss. Sogar Irmi empfand das als etwas bedrückend, so als könnte der Wald auf sie zukommen und alles überwuchern wie in einem Dornröschenschloss.
Sie parkten vor dem Wirtschaftsgebäude, und ein bärtiger kräftiger Mann, der sicher schon in den Siebzigern war, kam auf sie zu.
»Veit Bartholomä«, stellte er sich vor. »Meine Frau und ich stehen der Regina ein wenig bei und helfen ihr …« Er schluckte. Es war schon auf den ersten Blick klar, dass er eigentlich ein tatkräftiger Mann war, der momentan jedoch am Limit seiner Beherrschung angelangt war. Ein Dackel saß neben ihm und begutachtete die Neuankömmlinge. Er hatte den Kopf schräg gelegt und blickte Irmi so an, wie das nur Dackel können. Dann begann er zu bellen.
»Lohengrin! Aus! Ruhe jetzt!«, kam es von Herrn Bartholomä, und der Hund war tatsächlich still.
»Mein Beileid«, sagte Irmi – ein Satz, den sie immer schon verabscheut hatte und heute ganz besonders. Beim Verlust eines lieben Menschen verlor so vieles im Leben an Kontur, manchmal heilte die Zeit zwar Wunden, aber der Verlust selbst blieb. Und so fahl, wie der Mann aussah, war ihm Regina wahrscheinlich wie eine Tochter gewesen.
»Mein Name ist Irmgard Mangold, das ist meine Kollegin Katharina Reindl. Wo sind denn die Kinder? Und wo ist die Erzieherin, die Regina von Braun gefunden hat?«, fragte Irmi und wunderte sich über sich selbst, dass sie die vollen Vornamen genannt hatte. Das tat sie sonst nie, zumal sie ihren eigenen vollen Namen furchtbar fand. Aber zu solchen Gutshöfen mit ihrer besonderen Aura von Adel und früherem Glanz schienen die Kurzformen Irmi und Kathi nicht zu passen.
»Die sind alle im Seminarraum«, sagte der Mann. »Darf ich vorgehen?«
Irmi signalisierte Sailer und Sepp, die soeben vorgefahren waren, dass sie draußen Position beziehen sollten. Dann folgten sie dem Mann.
Das von außen eher unscheinbare Wirtschaftsgebäude war im Inneren frisch renoviert. Sie gingen einen Gang entlang, der gesäumt war von Vitrinen – gefüllt mit ausgestopften Tieren.
»Puh«, machte Kathi.
Am Ende des Ganges lag der Seminarraum, wo die Kinder saßen und gar nicht sonderlich verstört wirkten. Eine ältere Frau war aufgestanden und sagte mechanisch: »Helga Bartholomä, kann ich was anbieten?«
»Danke, momentan nicht.« Irmis Blicke durchmaßen den Raum. Die fünfzehn Kinder saßen vor Kakaotassen, Kekstüten lagen auf den Tischen. Essen war immer schon eine gute Sache gewesen, um die Nerven zu beruhigen. Eine auffällig dünne junge Frau mit langen schwarz gefärbten Haaren saß daneben und wirkte weit verstörter als die Kleinen. Eine zweite Frau betrat gerade mit einem kleinen Mädchen an der Hand den Raum, vermutlich kamen sie von der Toilette zurück. Sie flüsterte dem Mädchen etwas in Ohr, woraufhin es sich artig hinsetzte, und kam auf Irmi und Kathi zu.
Irmi lächelte aufmunternd. »Sie haben die Tote gefunden, Frau …?«
»Opitz. Julia Opitz, na ja, also eigentlich hat Benedikt die Frau gefunden. Ich …«
Bevor sie noch weitersprechen konnte, hatte sich ein kleiner Junge mit kecker Stupsnase vor Irmi aufgebaut und meinte: »Bist du die Polizei?«
»Genau – und du?«
»Ich bin der Bene, also Benedikt Haggenmüller.« Es klang durchaus weltmännisch. »Is die da auch von der Polizei?«, fragte er und deutete auf Kathi.
»Ja, is die da.« Kathis Ton war nicht direkt freundlich.
»Bist du nicht zu jung? Außerdem hast du schlechte Schuhe an«, sagte Benedikt ungerührt. »A guats Schuawerk isch alls im Leba.«
Irmi unterdrückte eine Lachsalve, die mehr als unpassend gewesen wäre, aber Kathi war nun mal seit Jahren diejenige, die niemals vernünftige und der Jahreszeit angemessene Schuhe trug.
»Diese Weisheiten hat er vom Opa«, erklärte Julia Opitz.
»Und vom Fernsehen!«, rief Bene. »Drum weiß ich auch, dass man am Tatort nicht rumlaufen darf.« Allein wie er das Wort Tatort betonte, war schon göttlich.
»Stimmt«, meinte Irmi, »danke erst mal für deine Hilfe, ich brauch dich später bestimmt wieder. Kannst du so lange hier warten?«
Irmi nickte Julia unmerklich zu. Sie verließen gemeinsam den Raum und gingen in die Küche jenseits des Gangs.
»Kommen Sie mal zu mir in den Kindergarten, um Benedikt zu bändigen?« Julia Opitz lächelte angestrengt. »Sie haben da Talent.«
Zu eigenen Kindern hatte es Irmi nie gebracht. Es hatte in ihrem Leben falsche Männer gegeben, gar keine Männer oder die richtigen Männer zum falschen Zeitpunkt. Vieles zu früh gewollt, das meiste zu spät erledigt. Später hatte sie den absolut falschen Mann geheiratet, einen erklärten Kinderhasser. Nach der Scheidung hatte sie erst mal ums Überleben gerungen und über Kinder nicht mehr nachgedacht. Irgendwann war es zu spät gewesen, und sie hatte den davongaloppierenden Jahren verblüfft hinterhergesehen. Sie hatte nie beweisen müssen, ob sie ein Talent für Kindererziehung hatte.
»Frau Opitz, was ist denn nun passiert?«, fragte Kathi in die Stille.
Julia Opitz zuckte regelrecht zusammen und begann leise zu erzählen.
Am Ende sah Irmi sie nachdenklich an: »Das heißt, dass Benedikt die Tote offenbar schon bei seinem ersten Verschwinden gesehen hat? Das tote Schneewittchen?«
»Ja, das befürchte ich.« Julia Opitz zitterte. »Vielleicht hätten wir ihr da noch helfen können.« Sie begann zu weinen.
»Wann sie wirklich gestorben ist, wissen wir später«, sagte Kathi rüde, und wieder einmal hatte Irmi den Eindruck, dass Kathi immer besonders harsch war, wenn ihr Gegenüber hübsch war. Und das war diese Julia Opitz zweifellos. Sie trug einen langen brünetten Pferdeschwanz und hatte ein absolut ebenmäßiges Gesicht mit sehr großen ungeschminkten braunen Augen. Sie war schlank, knapp eins achtzig groß und hatte wohlgeformte Brüste in ihrem engen geringelten Rolli. Und eins hatte Kathi definitiv nicht: Busen. Darunter litt sie, auch wenn sie das nicht zugab.
Irmi versuchte noch zu retten, was zu retten war: »Frau Opitz, beruhigen Sie sich, Spekulationen nutzen uns gerade gar nichts. Bleiben Sie hier bei den Kindern, während wir uns ein wenig umschauen?«
Dann packte sie Kathi am Ärmel und schob sie den Gang entlang. »Was bist du denn so pampig, Kathi?«, zischte sie.
»Ach, hab du mal seit Tagen Heuschnupfen! Mein ganzes Hirn ist zu. Die Augen triefen. Ich bekomm da sogar Fieber. Mein gesamtes Immunsystem ist aus der Bahn, oder.«
Nicht bloß dein Immunsystem, dachte Irmi.
Sie kamen gleichzeitig wie die KTU zum Fundort der Leiche. Kollege Hase war knurrig wie immer. Die Sonne war hinter ein paar Wolken verschwunden, und schlagartig war es wieder kälter geworden.
Hasibärchen maulte vor sich hin, dass die Kälte, das wäre ja für die KTU wichtig, den genauen Todeszeitpunkt verschleiern werde, zudem verfluchte er die Hackschnitzel und auch gleich noch Gott, die Welt und Irmi dazu, die ihm immer solche Aufträge einbrachte.
Irmi betrachtete die Tote. Der Schütze hatte sie genau zwischen den Augen getroffen. Eliminiert hatte er sie.
»Kaliber? Habt ihr da schon eine Idee?«, fragte Kathi.
»Lassen Sie mich meine Arbeit machen, Frau Reindl! Auf den Arzt warten!«, stieß er aus und blieb sprachlich genauso knapp wie Kathi. Sie maßen sich mit Blicken, die Heuschnupfengenervte und der Dauerdepressive. Dann ging er hinter die Absperrung, um irgendwas zu holen. Kathi folgte ihm niesend.
Irmi kniete sich neben das tote Schneewittchen. Regina von Braun mochte Anfang oder höchstens Mitte vierzig gewesen sein. Sie war eine zarte Frau, apart, ein wenig herb, aber vielleicht machte der Tod sie auch herber.
Als Irmi ein Rascheln vernahm, hob sie den Kopf und sah als Erstes eine Nase. Eine ziemlich große Nase und ein gewaltiges Geweih. Und dann ein Tier dazu, das auf sie herabsah. Irmi war einem Elch noch nie in ihrem Leben so nahe getreten, sie hätte das eventuell auch vermieden, aber der hier war ja auch eher ihr sehr nahegetreten. Sie erhob sich langsam und konnte die Formulierung ›Ich glaub, mich knutscht ein Elch‹ endlich mit Bedeutung füllen, weil das Tier sie nun anstupste. Irmi streichelte seine Nase, der Elch sah Irmi lange an, dann senkte er seinen gewaltigen Schädel und schnupperte an der Toten. Wenn der Hase das sähe, bekäme er bestimmt einen Herzklabaster. Ein Elch trampelte über einen Tatort.
»Arthur, du Lapp!« Veit Bartholmä scheuchte den Elch weg, der sich trollte und in etwa drei Metern Entfernung anhielt, wo noch so ein Nasentier stand, deutlich kleiner und ohne Geweih.
»Die Kleine ist Wilma. Der Lästige ist Arthur. Sie heißen nach zwei schwedischen Elchwaisen. Regina war mal dort. Unsere sind allerdings aus der Uckermark.«
»Wo kommt denn das Viech auf einmal her?«, fragte Irmi, die immer noch völlig verblüfft war. Hatte sie nicht Weihnachten, die Zeit der Elche, gerade erst hinter sich gebracht? In Plüsch, als Weihnachtsbaumschmuck, auf Tassen und Tischdecken gab es sie zuhauf – und ja, sie hatte sich sogar Elchbettwäsche gekauft. Ihr Bruder hatte ihr den Vogel gezeigt und was von »infantil« gemurmelt. Ihre Nachbarin Lissi besaß sogar zwei Plüschelche, die ein Weihnachtslied schmettern konnten. Der eine sang ›I wish you a merry christmas‹, der andere konnte zu ›Jingle Bells‹ sogar die Hüften schwingen. Ein echter Elch war ihr allerdings noch nie begegnet.
»Zum Gut gehört ein eingezäuntes Areal von vier Hektar, das direkt hinter der Hütte anschließt. Hier auf dem Paddock ist die Fütterung, und man kann dieses Gehege schließen, wenn Regina ihre Elchführungen macht. Gemacht hat.« Er schluckte schwer. »Normalerweise stehen die beiden längst Gewehr bei Fuß …«
Er brach ab, und Irmi wusste, was er dachte. Die Elche hatten wahrscheinlich den Schuss gehört und waren geflüchtet. Der Hunger und die Neugier hatten sie zurückgetrieben. Ach, Arthur, wenn du nur reden könntest! Wahrscheinlich hätte er ihr den Schützen beschreiben können. Leider war sie keine Frau Dr. Doolittle.
»Können Sie die beiden mit etwas Futter weglocken? Wegen der KTU.« Irmi war sich klar, dass hier die Spurenlage sowieso katastrophal war, aber sie wollte dem Hasen den knutschenden Elch gerne ersparen.
Inzwischen war der Arzt eingetroffen. Er schätzte den Todeszeitpunkt auf zweiundzwanzig Uhr, wollte sich aber angesichts des Nachtfrosts nicht genau festlegen. Aber das würden sie von der Gerichtsmedizin allemal erfahren.
Auf jeden Fall war es stockdunkel gewesen, überlegte Irmi. Wie hatte einer da geschossen? Und dann so präzise? Sie sah sich um, es gab am Schuppen einen Bewegungsmelder, der eine relativ helle Beleuchtung auslöste. Eventuell hatte der Schütze auch ein Nachtzielgerät verwendet.
Sie kehrte zu den Gebäuden zurück. Wieder schienen die Bäume ein Eigenleben zu führen. Als hätten sie moosige Arme, die nach ihr greifen konnten. Als könnten sie plötzlich losmarschieren, wie eine Armee von vielfingrigen grünen Gespenstern. Dornröschen und Schneewittchen. Sie hatte hier in dieser abgelegenen Waldwelt sofort an Dornröschen gedacht, Bene hatte Schneewittchen vor Augen gehabt. Das alles hier war so weit weg von der realen Welt, dabei war Regina von Brauns Tod wahrlich nicht märchenhaft.
Benedikt hatte sich währenddessen trefflich beschäftigt. Es war ihm gelungen, eine der Vitrinen zu öffnen und die ausgestopften Vögel der Größe nach zu sortieren. Er folgte Irmi gern in einen Nebenraum und erzählte ihr, dass Regina von Braun schon da gelegen habe, als er gekommen sei. Sie habe ausgesehen wie Schneewittchen, mehr noch: Sie sei das Schneewittchen gewesen. Er hatte niemand und nichts gesehen, keine Elche, keine Menschen. Und er hatte Julia informiert. »Aber die hat’s ja nicht interessiert, die Julia.«
Im Seminarraum versuchten die beiden Kindergärtnerinnen die Kleinen mit einem Wildtiermalbogen, den es hier im Erlebniszentrum gab, bei Laune zu halten. Sailer und Sepp hatten die Eltern informiert, das war ihre Pflicht. Eine Polizeipsychologin war gekommen und stellte so komische Fragen, dass Irmi stark am Sinn eines Psychologiestudiums zweifelte. Aus der Küche war Schluchzen zu hören. Helga Bartholomä versuchte vergeblich einen jungen Mann zu beruhigen. Sein Alter war schwer zu schätzen, wie häufig bei Menschen mit einer geistigen Behinderung.
»Robbie, Robbielein, alles wird wieder gut. Robbie, mein liebes Robbielein.« Aber der Mann ließ sich nicht beruhigen. Er wimmerte nur immer »Gina, Gina«, unterbrochen von Weinkrämpfen, die Irmi das Herz zerrissen.
Veit Bartholomä schob Kathi, die hilflos im Türrahmen stand, zur Seite und hielt dem jungen Mann ein Taschentuch hin. Dann nickte er seiner Frau zu, machte eine leise Kopfbewegung zum Kühlschrank hin. Helga sah unendlich traurig zu ihm auf, und als seien ihre Hände aus Blei, öffnete sie den Kühlschrank im Zeitlupentempo und holte eine große Packung Schokopudding heraus, die sie dem jungen Mann zusammen mit einem Löffel reichte, dessen Stiel aus einem Bärenkopf bestand. Der junge Mann begann zu löffeln, lächelte und sagte in Irmis Richtung: »Bärenbrüder.« Irmi versuchte ebenfalls ein Lächeln und glaubte, sich noch nie im Leben so überfordert gefühlt zu haben wie in diesen Sekunden. Sie schaffte es gerade noch, Veit Bartholomä mit einer Kopfbewegung aus dem Raum zu lenken.
Draußen auf dem Gang erklärte er ihr: »Robbie ist Reginas Bruder. Eigentlich heißt er Robert René. Seine Mutter ist bei der Geburt gestorben, da war Regina sechs Jahre alt. Sie war Robbies ein und alles, und umgekehrt. Das Mädchen hat sich immer verantwortlich gefühlt. Eine Bürde für so ein Kind. Hieronymus, also ihr Vater, hatte keinen rechten Draht zu Robbie …«
In diesem Satz lag so viel. Keinen rechten Draht. Irmi vermutete, dass der Herr Gutsbesitzer sich geschämt hatte, das Kind abgelehnt hatte, sich oder die verstorbene Frau verantwortlich gemacht hatte.
Irmi sah den Mann mitfühlend an, und er fuhr fort: »Wir haben uns gekümmert, so gut es eben ging. Er arbeitet in einer betreuten Werkstatt, und normalerweise holt ihn ein Bus ab, die Werkstatt hat nur ausgerechnet heute wegen einer Besprechung der Betreuer geschlossen. Drum muss er das hier alles miterleben. Das dürfte gar nicht sein.«
Nein, das dürfte nicht sein. Überhaupt dürfte niemand das Leben eines anderen beenden. »Wie alt ist Robbie denn?«, erkundigte sich Irmi.
»Achtunddreißig, die Ärzte haben damals bei seiner Geburt gemeint, er werde keine achtzehn. Man hatte fast das Gefühl, als wollten sie ihn loswerden. Fast so, als sei das ein Trost, dass er sterben würde. Als würde das seine Eltern befreien und alle um ihn herum. Aber Robbie ist ein Engel. Er hat vielleicht eine andere Wahrnehmung der Welt, aber wer sagt uns denn, welche die richtige ist?« Bartholomä sah eher grimmig drein als gebrochen. Das war eine normale Reaktion für einen Mann. Verdrängen, die Contenance wahren. Nur war der Preis für diese Beherrschung oft hoch.
Irmi schluckte. Kürzlich hatte sie irgendwo den Satz gelesen: Man wirft ein Leben nicht weg, nur weil es ein wenig beschädigt ist. Sie lebten in einer Welt der Jungen und Schönen und Faltenfreien. In einer Welt, wo skrupellose Männer mit Milliardensummen jonglieren und Millionen anderer Menschen damit in ihrer Existenz gefährdeten. Wer hatte denn überhaupt das Recht, Normen aufzustellen? Diejenigen, die sich das Recht einfach nahmen? Mörder nahmen sich auch das Recht, über Leben und Tod zu bestimmen.
»Kann Robbie denn etwas gesehen haben?«, fragte Irmi. »Es wäre auch hilfreich, wenn wir die Abläufe im Haus kennen würden.«
Veit Bartholomä nickte. »Regina ist immer um fünf aufgestanden und war dann zwei Stunden im Büro. Anschließend weckt sie Robbie, Helga macht Frühstück, Robbie wird kurz vor acht abgeholt. Regina ist dann immer rausgegangen zum Tierefüttern und hatte häufig Besuch von Schulklassen oder Kindergartengruppen. Sie ist auch mit einer Eule und einem Falken in Schulen gegangen. Regina hat immer gesagt: Ich kann nur schützen, was ich kenne. Die Tiere bekommen dann gegen vier ihr Abendessen, die Ställe werden gepflegt. Wir essen um sechs Uhr zu Abend. Das war ein Ritual. Die Familie muss zusammen essen.«
Sie aß fast immer allein. Irmi schluckte. »War das auch gestern so?«
»Ja, Regina hat hinterher noch ein bisschen mit Robbie gepuzzelt, das liebt er. Wir haben massenweise große Puzzlebilder von Tieren. Es müssen Tierpuzzle sein, andere macht Robbie nicht.« Er lächelte wehmütig. »Robbie geht gegen acht ins Bett. Helga und ich ziehen uns auch zurück, Regina geht oft noch in ihr Büro.«
»Ein ganz schönes Pensum«, sagte Irmi. »Da bleibt wenig Zeit für Privatleben. Hatte sie einen Freund? Sie war eine sehr attraktive Frau.«
»Der letzte liegt ein halbes Jahr zurück. War ein Forstwirt. Berater bei den Staatsforsten. Ein arroganter Schönling, wenn Sie mich fragen. Er hat Regina nach Strich und Faden betrogen. Außerdem hatten sie sehr konträre Ansichten darüber, wie man so einen Besitz zu führen hätte.« Der alte Mann knurrte auf einmal wie ein Kettenhund. »Der is guad weiter!«
»Der hat ihnen das Kraut ausgeschüttet, oder?«, fragte Irmi in möglichst neutralem Ton.
»Ich mag es nicht, wenn Menschen, die ich liebe, gequält werden.«
Wer mochte das schon? Irmi versuchte ihre neutrale Gesprächsposition aufrechtzuerhalten und war doch abgelenkt. Was hieß eigentlich Pensum? Diese Regina war ihr ähnlich gewesen. Sie half doch auch beim Bruder im Stall mit, ging ins Holz, hatte unmögliche Arbeitszeiten und chronisch zu wenig Schlaf. Privatleben? Sie musste doch schon nachschlagen, wie man das Wort überhaupt schrieb. Es gab sicher Berufe, in denen man morgens um zehn in Deutschland sein Frühstückchen einnahm, um zwölf Mahlzeit wünschte, um vier Schluss machte, den PC herunterfuhr, die Tastatur zurechtrückte und dann einfach wegdenken konnte. Es gab Tätigkeiten, bei denen man bis zum nächsten Morgen keine Millisekunde mehr über das, was man gemeinhin Arbeit nannte, nachdenken musste. Doch bei ihr verwischte sich alles, ihre Gedanken waren nie frei.
Inzwischen tauchten erste Eltern auf, die ihre Kinder abholen wollten. Eine Mutter kreischte: »Wie können Sie das meinem Kind antun?«, worauf die Psychologin ganz ruhig erwiderte: »Ihr Kind lebt aber und ist putzmunter.« Sie nickte dem Mädchen zu. »Auf Wiedersehen, Valerie, und ich glaube, deine Mama brüllt in Zukunft nicht immer gleich so rum, wie du mir gesagt hast.« Dann schenkte sie der Frau noch ein freundliches Lächeln und ging in die Küche.
Kathi entfuhr ein Glucksen, und Irmi musste sich das Grinsen verbergen. So ohne war diese Seelenklempnerin ja gar nicht. Irmi folgte ihr in die Küche des Seminarhauses, wo Robbie auf einem alten Holzstuhl zusammengesackt war. Leise wandte sie sich an die Psychologin und bat sie, Robbie zu befragen.
Robbie sprach sehr unartikuliert, er weinte immer wieder, es musste neuer Pudding herangeschafft werden. Am Ende war klar, dass Gina ihn ins Bett gebracht hatte und gesagt hatte, sie wolle noch einmal rausgehen, um nach den Tieren zu sehen. Dass er aber beruhigt schlafen könne, da sie gleich wieder zurückkomme und nebenan im Büro sei, wo sie immer alles aufgeschrieben habe. »Gina hat doch immer alles aufgeschrieben«, wiederholte er unentwegt.
»Weißt was, Robbie, jetzt gehen wir mal zu Arthur. Der hat ja immer noch nichts zu essen bekommen«, sagte Veit Bartholomä in die Stille und sah Irmi fragend an. Sie nickte unmerklich, es war sicher gut, Robbie jetzt abzulenken. Auch die Psychologin nickte, und als die beiden weg waren, sagte sie: »Wenn Sie mich brauchen, Frau Mangold, gerne! Frau Bartholomä, Sie können sich auch gerne melden, ich lass Ihnen meine Karte da. Aber Ihr Mann macht das ganz richtig, ablenken, die üblichen Rituale einhalten, Halt geben und Struktur.« Sie hob die Hand zum Gruß und ging davon.
Irmi folgte ihr hinaus ins Freie, wo die Sonne wieder aufgetaucht war. Lohengrin kam ihr entgegen. Mit dem Schwanz wedelte der halbe Hund, und sein Dackelblick war noch dackliger. Es versetzte ihr einen Stich. Seit ihre Hündin Wally tot war, lebte sie allein unter Katern. Wie wäre es mit so einem Hund …?
Von Lohengrin verfolgt, ging Irmi wieder zurück in die Küche, wo sich der Hund augenblicklich in einem Körbchen verkroch. Helga Bartholomä sah unendlich müde aus. Ihre Falten hatten sich tief eingegraben, ihre Gesichtsfarbe war fahl.
»Frau Bartholomä, jetzt setzen Sie sich aber auch mal!« Irmi drückte die Frau regelrecht auf den Stuhl, auf dem Robbie gesessen hatte, schenkte an der Spüle ein Glas Wasser ein und drückte es der Frau in die Hand. Sie wartete, bis die Haushälterin ein paar Schlucke getrunken hatte. »Wie lange arbeiten Sie beide denn schon bei den von Brauns?«
Ein seltsam wehmütiges Lächeln umspielte die Lippen von Helga Bartholomä. »Lange, viel länger, als man denkt.«
Irmi war ein wenig irritiert von dieser kryptischen Antwort. »Geht das etwas genauer?«
»Ich seit siebenundfünfzig Jahren. Veit seit fünfundfünfzig. Ich war achtzehn, als ich bei Hieronymus von Braun in den Dienst eintrat. Zwei Jahre später kam Veit als Forstwirt, während ich als Mädchen für alles da war. Ich habe auch lange die Buchhaltung gemacht. Eigentlich immer. Ich liebe Zahlen. Die letzten Jahre nicht mehr, Regina hat einen Steuerberater, der das übernommen hat. 1974 ist die arme Margarethe gestorben, der Gutsherr erst 2010. Regina wollte, dass wir bleiben. Also sind wir geblieben, vor allem wegen Robbie.«
»Nicht wegen Regina?«, fragte Irmi etwas überrascht.
»Sie ist gesund. Und stark. Und dickköpfig. Sie braucht zwei alte Zausel wie uns eigentlich nicht. Wir hätten leicht in ein Altersheim gehen können. Auf ein Abstellgleis, wo solche wie wir auch hingehören.«
Irmi betrachtete die Frau mit den abgearbeiteten Händen, die das Glas umklammert hielten, und horchte ihren Worten hinterher, die sie mit einem ganz leichten Dialekt vortrug, ein schöner Dialekt war das.
»Frau Bartholomä, war es denn schwierig, mit Regina zusammenzuleben? Ich höre da so was raus …«
»Ich hatte Regina sehr lieb, falls das falsch bei Ihnen angekommen ist. Sie ist mir wie eine Tochter gewesen. Sie war eben dickköpfig!«
Ja, Töchter waren selten so, wie die Mütter sie gerne hätten, dachte Irmi. »Inwiefern?«, hakte sie nach.
»Sie legte sich mit allen an. Sie gab nie nach, denn sie hatte einen Gerechtigkeitstick. Sie war so zart anzusehen und hatte doch einen so eisernen Willen. Sie hatte keinen Respekt. So was schickt sich als Frau eben nicht.«
Irmis Blick fiel auf den Nebenraum der Küche, wo ein kleines Waschbecken hing und darüber ein Allibert. Das war auch so ein Fossil. Hatte früher nicht jeder einen Allibert gehabt? Passend zu den Fliesen in Kotzgrün oder Bleichrosa oder in Weiß, abgestimmt auf die zu eierschalengelben Fliesen. Wo waren nur all die Alliberts hingekommen? Ruhten sie alle auf einem großen Allibert-Friedhof?
»Mit wem hat sie sich denn angelegt?«, fragte Irmi.
»Mit den Staatsforsten. Mit anderen Jagdpächtern. Sie hatte andere und eigene Ansichten.«
»Und wie sahen die aus?«
»Ach, das weiß ich auch nicht so genau. Es ging um Abschusszahlen. Ich finde es einfach nicht passend, wenn eine Frau mit einem Gewehr herumläuft, und es ist auch nicht schicklich, sich überall einzumischen. Regina hatte genug zu tun mit ihrem Zentrum. Sie hätte weiter ihre Führungen machen sollen. Allein diese Idee, Rentiere zu halten und zwei Elche. Den Floh hat ihr der Vater ins Ohr gesetzt.«
Irmi ließ die jagdlichen Fragen mal dahingestellt. Sie merkte auch, dass sie bei Helga Bartholomä nicht weiterkam. Diese Frau gab Antworten, aber nur weil sie Respekt vor der Polizei hatte. Dabei kam Irmi die Frau eigentlich nicht so vor, als sei sie ein Weibchen oder ein Häschen. Eher im Gegenteil. In ihren Augen lag etwas Entschlossenes. Aber vielleicht war sie einfach müde und alt. Irmi fand keinen rechten Zugang zu der Frau und versuchte es auf einem anderen Weg.
»Die Elche haben mich aber auch überrascht. Elche im Werdenfels? Also wirklich!« Irmi schüttelte den Kopf.
»Da sagen Sie es auch! Bloß wegen des alten Bildes. Weil Hieronymus das am Speicher gefunden hatte und wieder aufgehängt hat.«
»Ein Bild?«
»Kommen Sie mit!«, sagte Frau Bartholomä und erhob sich mühsam.
Ende der Leseprobe