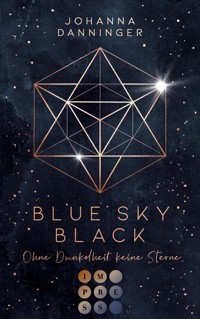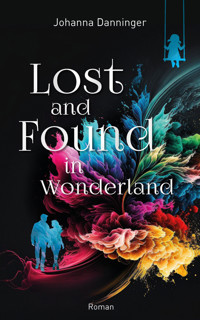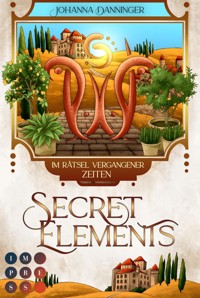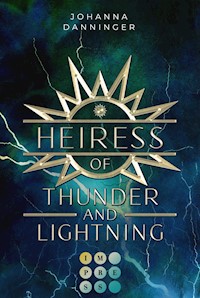2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Plötzlich Undercover
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Tina ist gelangweilt. Die bekennende Actionfilm-Fanatikerin wünscht sich sehnlichst ein wenig Aufregung und Spannung in ihrem unspektakulären Alltag als Assistentin der Assistentin in einer Münchner Softwarefirma. Ihr Wunsch wird wahr, denn eines Tages erscheint doch tatsächlich ein smarter Brite namens Jayden Scott und bittet Tina im Namen des MI6 um Hilfe. Die internationale Sicherheit sei in Gefahr, behauptet der charmante Spion mit den himmelblauen Augen und der Statur einer nordischen Gottheit. Da lässt sich Tina natürlich nicht zweimal bitten. Dummerweise entpuppt sich der harmlose Job allerdings als doch nicht so harmlos und der sexy Agent plötzlich als gar nicht mehr so charmant. Eines ist klar – im Film sah´s irgendwie leichter aus ... *** "Ein Agent zum Verlieben" ist der erste Band der Plötzlich Undercover-Dilogie. Überarbeitete Fassung der Erstauflage von 2020.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Ähnliche
Impressum neobooks
Plötzlich Undercover
Ein Agent zum Verlieben
Johanna Danninger
Kapitel 1
Montag, 14. September 2020, 7:50 Uhr
München, Wohnblock, Apartment 6c
Ich war gelangweilt.
Nicht nur von dem frühen Montagmorgen, den ich mit einer Kaffeetasse in der Hand am Küchentisch verbrachte, sondern generell. Ich war gelangweilt vom Alltag, von meiner winzigen Wohnung, vom Leben ... und auch von mir selbst. Alles an mir, in mir und um mich herum, war dermaßen durchschnittlich, dass es quasi in der Mitte der Mittellinie der Skala verschwand. Schon mein Name - Christina Müller. Ein Klassiker in Deutschland, sozusagen. Keine Ahnung, wie viele Christina Müllers es hierzulande gab. So einige, grob geschätzt.
Mein durchschnittliches Leben begann bereits bei meiner Geburt. Nach einer durchschnittlichen Wehendauer von etwa 10 Stunden gebar meine Mutter ein durchschnittlich großes Mädchen mit 50 Zentimetern Körperlänge und einem Durchschnittsgewicht von 3.500 Gramm, das sie nach den durchschnittlichen drei Tagen Krankenhausaufenthalt mit nach Hause in das durchschnittliche Eigenheim einer durchschnittlichen 1,3-Kind-Familie in einer durchschnittlichen süddeutschen Kleinstadt nahm.
Das war vor knapp achtundzwanzig Jahren.
Und vor ungefähr sechsundzwanzig Jahren brachte meine Mutter die anderen 0,65 Prozent der 1,3 Kinder auf die Welt: meinen Bruder, der den bisherigen Durchschnitt unserer Familie sogleich damit durchbrach, dass er sich nicht an den Geburtstermin hielt, sondern zwei Wochen zu früh und innerhalb einer halben Stunde das Licht der Welt erblickte. Er bekam den Namen Joseph zugeteilt, doch das hielt ihn auch nicht davon ab, sich weiterhin gegen den Durchschnitt zu wehren und zum absoluten Überflieger zu werden.
Joe war so etwas wie ein Wunderkind. Zumindest gemessen an dem vorherrschenden Standard unserer eher ländlichen Heimat. Wie er im bundesweiten Vergleich abschnitt, konnte ich nicht sagen. Im Vergleich zu mir war er aber in allem besser. Er konnte schneller laufen, früher sprechen, hatte perfekte Noten, war ein Sportass ... Na ja, eben alles, was man sich unter einem Wunderkind vorstellt.
Inzwischen arbeitete er als Hedgefonds-Manager in einer deutschen Börsenfirma. Wir hatten also nicht den blassesten Schimmer, womit er sein Geld verdiente, aber es klang nach einem äußerst wichtigen Beruf, und meine Eltern waren ungemein stolz auf ihn.
Zudem war er sogar ein wirklich toller Bruder. Ja, echt! Durch seinen Job war er leider sehr viel im Ausland. Aktuell befand er sich auf unbestimmte Zeit in Bulgarien, und obwohl wir regelmäßig telefonierten, vermisste ich ihn wahnsinnig.
Joe war auch heute noch mein bester Freund, der mich oft besser verstand als ich mich selbst. Früher wäre es mir manchmal lieber gewesen, ich hätte ihn nicht leiden können, aber im Gegensatz zu allen anderen, war er ironischerweise der Einzige, der mir nie das Gefühl gab, eine Versagerin zu sein.
Meine Eltern taten das dafür umso mehr. Nicht unbedingt offensiv, aber ihre subtilen Hinweise auf die Erfolge meines Bruders begleiteten mich schon mein Leben lang. Alles, was ich hingegen leistete, wurde allenfalls mit einem müden Lächeln belohnt.
Ja gut, besondere Leistungen konnte ich bisher auch keine verzeichnen. Daran hatte sich auch nichts geändert, seit ich vor knapp einem Jahr meine Sachen gepackt und nach München gezogen war, um meine Karriere voranzutreiben. Meine Karriere als Bürokauffrau, wohlgemerkt, denn zu Abitur und Studium hatte es bei mir nicht gereicht. Was ich aber gar nicht so schlimm fand, denn immerhin arbeitete ich inzwischen als persönliche Assistentin des Geschäftsführers von SysCom, einem stetig wachsenden Softwareunternehmen. Und das hatte ich ganz ohne eine wichtig klingende, englische Berufsbezeichnung geschafft!
Okay, strenggenommen war ich die Assistentin der eigentlichen Assistentin. Man könnte mich auch als Mädchen für alles bezeichnen. Oder als Depp vom Dienst. Je nach Tagesverlauf. Aber – und darauf kam es schließlich an – ich war Teil der modernen Unternehmenswelt. Irgendwie. Außerdem klang es ganz cool. »Ich arbeite bei SysCom« stand ja wohl wirklich in keinem Vergleich zu früher, als ich sagen musste: »Ich arbeite bei Maler Stöckel«. Dass es mir bei Maler Stöckel deutlich besser gefiel, sei mal dahingestellt.
Das Problem an meinem derzeitigen Job war, dass ich irgendwie von niemandem ernst genommen wurde. Vielleicht lag es an der fehlenden, englischen Berufsbezeichnung, aber mir kam es so vor, als wäre ich für die meisten meiner Kollegen nur die Frau, die für die Kaffeemaschine zuständig war. Als wären meine Bemühungen, den Espressoautomaten am Laufen zu halten, kein ausreichender Grund, meine Anwesenheit entsprechend zu würdigen. Immerhin war ausnahmslos jeder in unserer Etage koffeinabhängig.
Apropos Kaffee – die Tasse in meiner Hand war mal wieder eiskalt, weil ich lieber selbstmitleidig Löcher in die Luft gestarrt hatte, anstatt zu trinken. Tja, wenn ich etwas gut konnte, dann war es, Kaffee kalt werden zu lassen.
Ich nahm trotzdem einen Schluck, in der Hoffnung, dass an dieser alten Volksweisheit doch etwas dran war und er mich vielleicht schöner machen würde. Gleichzeitig brummte mein Handywecker, der mich darauf hinwies, dass es Zeit wurde, sich auf den Weg zu machen. Ohne diesen Alarm würde ich vermutlich nie pünktlich zur Arbeit erscheinen, denn ich war ausgesprochen gut darin, mich in Grübeleien zu verlieren.
Lustlos erhob ich mich von meinem Stuhl, stellte die halbvolle Tasse neben die Spüle und schlurfte zur Garderobe im Flur. Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, das Licht anzuschalten. Ich wusste ja, dass mich kein spektakulärer Anblick im Spiegel erwartete. Daher reichte der dämmrige Schein, der durch die offene Küchentür hereinfiel, allemal aus.
Erst als ich in meinen Blazer schlüpfte, warf ich einen flüchtigen Kontrollblick auf mich. Man wusste ja nie, ob man sich vielleicht irgendeinen Fleck im Gesicht geholt hatte, während man reglos am Küchentisch saß.
Hatte ich nicht. Mein Gesicht sah genauso normal aus wie der Rest von mir: absolut durchschnittlich. Nussbraunes, schulterlanges Haar mit einem Stufenschnitt, der versuchte, die Frisur ein bisschen peppiger wirken zu lassen, aktuell hochgezwirbelt zu einem lockeren Dutt. Klassische braune Augen, unspektakuläre Gesichtsform. Durchschnittlicher BMI mit Körbchengröße B. Wobei mein Dekolletee in der neuen Bluse durchaus nett anzusehen war. Die gemusterte Seide passte perfekt zu dem Retro-Tellerrock, der sich wie eine Glocke ausbreitete, wenn ich mich schnell um die eigene Achse drehte. Nicht, dass ich das ständig machen würde, aber wenn man so einen Rock anzog, probierte man das Pirouettenverhalten eben aus.
Mode war meine persönliche Rettung aus dem Durchschnittdrama. Ich liebte stylische Klamotten und dekorierte mich gerne mit bunten Stoffen. Vielleicht war es ein Hilfeschrei meines Unterbewusstseins, aber ich fühlte mich eben am wohlsten, wenn ich als wandelnder Farbklecks unterwegs war. Da ich grundsätzlich in der Masse unterging, relativierte sich mein flippiger Kleidungsstil sowieso wieder.
Ich seufzte schwer. Bevor ich mich erneut in Selbstmitleid verlieren konnte, schnappte ich mir lieber Handtasche und Autoschlüssel und verließ mein Apartment. Weil ich im sechsten Stock eines Siebzigerjahre-Wohnblocks hauste und generell eher faul veranlagt war, stieg ich in den klapprigen Fahrstuhl, anstatt die Treppe zur Tiefgarage zu nehmen. In der winzigen Kabine stank es wie immer nach Zwiebeln. Warum das so war, hatte ich noch nicht herausgefunden. Der Zwiebelverbrauch in diesem Haus musste ungewöhnlich hoch sein.
Nachdem mich die muffige Kabine in der düsteren Tiefgarage ausgespuckt hatte, stieg ich in meinen klapprigen, roten Kadett und warf meine Handtasche auf den Beifahrersitz. Der Motor erwachte nach einer Reihe mysteriöser Geräusche zum Leben und brachte die Wände der Tiefgarage zum Erzittern. Wahrscheinlich war der Auspuff nun endgültig durchgerostet, darum das Gebrüll und der spürbare Leistungsverlust.
Ich kannte mich ein bisschen mit Autos aus, da meine erste große Liebe kein geringerer als der Vorsitzende des hiesigen Opelclubs war. Darum musste mein erstes Auto natürlich auch ein Opel sein und noch dazu ein Klassiker, den Schatzi selbstverständlich für mich restaurieren würde.
Tja, mit Schatzi ging es nicht so lange gut wie gedacht. Daher war der Kadett nie vollständig in Schuss gebracht worden. Im Grunde befand er sich jetzt wieder in dem gleichen Zustand wie vor zehn Jahren, als ich ihn von Papa erbettelt hatte – schrottreif. Mit dem nächsten TÜV würde sein letztes Stündchen schlagen. Das wussten wir beide, und wir nahmen bereits im Stillen Abschied voneinander. Da ich noch nicht genügend Geld für ein neues Auto zusammengespart hatte, musste der Kadett aber noch bis zum bitteren Ende durchhalten.
Theoretisch könnte ich in München freilich auch ohne Auto überleben. Aber ich hatte ja schon erwähnt, dass ich faul war. Außerdem war ich es nun mal gewohnt, ein eigenes Auto zu besitzen. Dort, wo ich herkam, war man ohne Auto nämlich aufgeschmissen, sofern man außerhalb des Busfahrplans, der maximal vier Linien umfasste, irgendwohin wollte. Vielleicht war ich davon traumatisiert, oder was weiß ich.
Knatternd und röhrend trug mich der Kadett also aus der Düsternis der Tiefgarage ins zarte Sonnenlicht eines lauen Septembermorgens. Nach einer spektakulären Fehlzündung sortierte ich mich in den Verkehr ein und rollte einem weiteren Arbeitstag entgegen, während das Radio mich mit Popsongs beschallte.
08:25 Uhr
München, SysCom Firmenzentrale, Parkplatz
Das verhältnismäßig kleine Gebäude von SysCom befand sich in der Nähe des Olympiaparks, eingebettet zwischen riesigen Firmenkomplexen. Wo man auch hinsah, überall blitzte und blinkte es durch die verspiegelten Fassaden der stylischen Businessanlagen. Umringt von all den hohen Türmen ging SysCom ein bisschen unter, obwohl es an sich ein recht repräsentatives Gebäude war, das auf den ersten Blick einzig aus Glas zu bestehen schien.
Tatsächlich hatte man von außen den Eindruck, einem überdimensionierten Gewächshaus gegenüberzustehen. Sollte im Hochsommer die Klimaanlage ausfallen, würden die Mitarbeiter da drin vermutlich innerhalb von zehn Minuten verdunsten.
Ich lenkte den brüllenden Kadett auf den Firmenparkplatz und suchte mir brav eine Lücke in den hinteren, nicht nummerierten Reihen. Für eine eigene Parkplatznummer würde ich wahrscheinlich nie wichtig genug sein, aber das störte mich eigentlich nur in den Wintermonaten.
Während ich zum Haupteingang marschierte, kämpfte ich genervt gegen intermittierende Windböen, die es auf meinen sorgfältig drapierten Dutt abgesehen hatten. Ich presste mir beide Hände auf den Kopf, was es insgesamt vermutlich nicht besser machte, und rannte die letzten Meter über den kleinen Vorplatz, als würde es in Strömen regnen. Dementsprechend verwundert sah mich die Nikotinfraktion der Mitarbeiter, die in kleinen Grüppchen einen Morgenplausch hielten, auch an. Ich wünschte ihnen einen guten Morgen und huschte durch eine der Drehtüren in das rettende Gebäude. Auf dem Weg zur Sicherheitsschleuse zupfte ich verstohlen an meinem Haupt herum, während ich mit der anderen Hand in meiner Tasche nach meinem Mitarbeiterausweis suchte. Bis ich an einer der automatischen Schleusen angekommen war, hatte ich ihn noch nicht gefunden.
Notgedrungen wühlte ich mit beiden Händen in den mysteriösen Tiefen meiner eigentlich gar nicht so großen Tasche. Es dauerte nicht lange, da hörte ich hinter mir auch schon das erste verhaltene Hüsteln, was ja auf internationaler Ebene das nonverbale Synonym für »Jetzt mach schon!« war. Aus dem Augenwinkel heraus erkannte ich, dass der Wachmann schräg vor mir zunehmend nervös wurde. Wirklich interessant, was 30 Sekunden Handtaschengekrame für Auswirkungen auf sein Umfeld haben konnte.
Als ich die Chipkarte schließlich mit triumphaler Geste hervorzog, erhielt ich keinen Applaus. Die Frau hinter mir zog nur leicht eine Braue hoch, aber wenigstens entspannte der Wachmann sich wieder, sobald ich meinen Ausweis auf den Scanner legte und die Schranke vor mir aufschwang. Dass ich seit einem Jahr jeden Tag an ihm vorbeiging, schien der Kerl vergessen zu haben.
Im vollverspiegelten Fahrstuhl richtete ich mir unter gefühlt dreihundert Augenpaaren die Frisur. Warum man Aufzüge nach allen Seiten mit Spiegeln ausstattete, würde ich wahrscheinlich nie verstehen. Schließlich versuchte doch jeder möglichst den Blicken des anderen zu entgehen, was durch die Vollverspiegelung letztlich zu einem wahren Gemetzel aus unruhig umherfliegenden, von den Spiegeln reflektierten Blicken wurde. Der reinste Stress war das.
Nach der üblichen Stopp-and-go-Fahrt erreichte ich schließlich die Chefetage, die sich natürlich im obersten Stockwerk befand. Das war wahrscheinlich so ein Autoritätsding, dass der Boss ganz oben thronen musste. Jedenfalls waren hier oben nicht nur die Außenwände aus Glas, sondern auch der größte Teil der Decke. Im Verdunstungsszenario wären wir eindeutig als Erste dran.
Die komplette Etage war weitestgehend offen gestaltet, um ein modernes, gemeinschaftliches Arbeiten zu ermöglichen. Die wenigen abgetrennten Räume bestanden aus ... Glas. Woraus sonst?
Eine voyeuristische Neigung des Architekten war sehr wahrscheinlich. Ich war froh, dass wenigstens die Toiletten von blickdichten Wänden umgeben waren, denn irgendwo hörte der Schauspaß ja dann doch auf.
Verwinkelte Raumteiler brachten ein wenig System in das Chaos aus Schreibtischansammlungen. Nur wenige Mitarbeiter hatten an diesem Morgen bereits ihren Platz gefunden und starteten träge ihre Computer.
Ich folgte dem schnurgeraden Hauptgang zum Glaskasten meines Bosses. An der Tür kündigten silberne Lettern seinen Namen an: »Albert Stetten - Geschäftsführung«. Die Lamellenvorhänge waren zurückgezogen und das Büro dahinter noch im Schlummermodus, wodurch es nur noch mehr wie der Showroom eines Innenausstatters anmutete. Den Design-Award hätte die Einrichtung durchaus verdient. Ob es eine gemütliche Arbeitsatmosphäre schuf, stand auf einem anderen Blatt.
Da fühlte ich mich an meinem schlichten Arbeitsplatz vor dem Glaskasten schon deutlich wohler. Mein Schreibtisch und der meiner direkten Vorgesetzten, der Chef-Assistentin, standen sich gegenüber und flankierten den Eingang zu Stettens Büro. Wer da rein wollte, musste also erst einmal an uns vorbei. Beziehungsweise an meiner Vorgesetzten, denn obwohl unsere Schreibtische exakt gleich groß waren, schien jeder instinktiv zu wissen, dass nur der ihre von Bedeutung war.
Ich warf meine Tasche unter den Schreibtisch und startete meinen PC. Während er surrend zum Leben erwachte, wanderte ich zum Mittelpunkt der gesamten Etage – die Personalküche. Die bestand im Grunde nur aus einer Küchenzeile vor einer freistehenden Wand, bildete aber dennoch das Herzstück der Abteilung. Der große Kaffeevollautomat, die Lebensquelle schlechthin, begrüßte mich mit einer netten Nachricht auf dem Display.
»Schale leeren«, befahl sie mir. Wie beinahe jedes Mal, wenn ich bei ihr ankam. Da war Zufall schon echt ausgeschlossen. Wahrscheinlicher war, dass meine werten Kollegen sofort auf dem Absatz kehrtmachten, sobald die Maschine nach Aufmerksamkeit verlangte. Dann lauerten sie so lange in der näheren Umgebung, bis ich auftauchte und die Sache regelte.
Artig leerte ich also den Tresterbehälter, füllte den Wasserbehälter auf und holte vorsorglich eine Packung Kaffeebohnen aus dem Hängeschrank.
Kaum hatte ich die Bedürfnisse der Maschine zufriedengestellt und sämtliche Behälter und Deckel wieder an ihren Platz gerückt, erschien auch schon meine Kollegin Jule wie aus dem Nichts. Die Mittvierzigerin strich sich ihr dunkles Haar hinters Ohr und stellte ihre Tasse unter die Ausgabe, ungeachtet dessen, dass ich gerade das Gleiche tun wollte.
Schönen Dank auch, dachte ich grimmig.
»Morgen, Tina!«, begrüßte sie mich unbekümmert und drückte den Startknopf. »Alles klar bei dir?«
Ich trommelte mit den Fingerspitzen gegen die leere Tasse in meinen Händen, was durch das Gebrumm des Mahlwerks ziemlich an Effekt verlor. Da Jule weiterhin unschuldig dreinschaute, ließ ich es schließlich gut sein und antwortete freundlich, wie gute Kollegen es eben taten: »Alles klar. Bei dir hoffentlich auch?«
»Aber sicher.« Sie schnupperte genüsslich den aufsteigenden, frischen Kaffeeduft. »Hm, der erste Kaffee im Büro ist immer der Beste, oder?«
»Stimmt«, meinte ich und fing nun doch wieder an zu trommeln, bis sie endlich den Weg freimachte.
Ich wollte gerade den Platz in Beschlag nehmen, da sog Jule neben mir geräuschvoll die Luft ein und stieß mich in die Seite. »Achtung, sie kommt!«
Neugierig drehte ich den Kopf, und sofort wurde mein Blick wie magisch von ihr angezogen. Sie war der Inbegriff von Schönheit. Jene Art von Frau, deren Auftritt stets in Zeitlupe dargestellt wurde, um das wallende, blonde Haar und die wogenden Kurven zu würdigen. Sie war eine Göttin, der die Welt nach einem simplen Augenaufschlag zu Füßen lag.
Ach, ja, und sie war außerdem meine Vorgesetzte, Valerie König.
»Guck dir diesen Fummel an«, wisperte Jule abschätzig. »Sind wir hier auf einer Preisverleihung, oder was?«
Valerie trug ein schlichtes, blaues Etuikleid und war damit nicht unbedingt overdressed. Allerdings könnte sie auch in einem Kartoffelsack erscheinen und die weibliche Kollegschaft würde trotzdem vor Neid erzittern. Offengestanden nahm ich mich da nicht mit aus, doch gegen den missgünstigen Teil wehrte ich mich. Valerie konnte schließlich nichts dafür, dass sie von Venus persönlich gesegnet war. Außerdem mochte ich sie. Wenn man mal gegen den ersten Schein ihrer Schönheit angeblinzelt hatte, stellte man nämlich schnell fest, dass sie äußerst charmant, witzig und freundlich war.
Gott, ich wünschte, ich könnte sie hassen ...
Während Valerie den Gang entlang schwebte, schreckte mich das Gebrumm der Kaffeemaschine auf. Eine weitere Kollegin hatte sich meine Ablenkung zunutze gemacht und sich vorgedrängelt.
Genervt rückte ich näher an die Maschine heran, ignorierte den verstörten Gesichtsausdruck meiner Kollegin und eroberte sofort das Feld, nachdem sie die Flucht ergriffen hatte.
Als ich endlich mit einer vollen Kaffeetasse zurück an meinen Schreibtisch kehrte, tippte Valerie bereits geschäftig auf ihrem Computer herum.
»Guten Morgen«, wünschte ich ihr und ließ mich erschöpft auf meinen Stuhl fallen.
»Guten Morgen.« Sie ließ einen Blick über mich gleiten. »Die Bluse ist neu, oder? Sieht toll aus!«
Ja, Valerie wusste stets das Richtige zu sagen. Sie war einfach in allem perfekt.
Sie warf einen prüfenden Blick zur Seite und beugte sich verschwörerisch vor. »Hast du ihn gestern noch gefragt?«
»Nein«, antwortete ich und schnitt eine Grimasse.
»Tina ...« Valerie seufzte schwer. »Von selber wird Herr Stetten nicht an deine Bonuszahlung denken. Du kennst ihn doch! Er hat bestimmt längst vergessen, dass er sie dir zugesichert hat.«
Das war ziemlich wahrscheinlich, denn wenn man meinen Boss mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es »zerstreut«. Es grenzte an ein Wunder, dass er diese Firma trotzdem im Griff hatte. Oder die Zerstreutheit rührte von dieser immensen Aufgabe. Eine Huhn-Ei-Frage, vielleicht.
Fakt war, dass er mir vor zwei Monaten einen Bonus versprochen hatte, der bis heute nicht bei mir angekommen war und ebenfalls Fakt war, dass ich immer noch nicht den Mut aufgebracht hatte, bei ihm nachzuhaken.
»Du hast recht«, sagte ich zu Valerie. »Heute frag ich ihn. Ganz bestimmt!«
17:55 Uhr
München, SysCom Firmenzentrale, Chefetage
Bis kurz vor Feierabend hatte ich meinen Boss noch nicht gefragt.
Vor einer knappen halben Stunde hatte Valerie begonnen, mit eindringlichem Blick immer wieder in Richtung Bürotür zu nicken. Das brachte mich schließlich tatsächlich dazu, entschlossen aufzustehen, denn die Arme sollte wegen mir keine Nackenschmerzen bekommen.
Ich trat also vor die Glastür und spähte hinein. Herr Stetten saß hinter seinem Schreibtisch und war in ein Dokument vertieft. In all dem Design um ihn herum wirkte er mit seinem buschigen Vollbart und den noch buschigeren Augenbrauen völlig deplatziert. Dass sein runder Bauch im Sitzen an die Kante des Edelmetallschreibtisches stieß, sei nur am Rande am erwähnt. Insgesamt sah er überhaupt nicht wie jemand aus, der eine moderne Softwarefirma leitete, sondern eher wie ein Mann, der regelmäßig zum Altherrenstammtisch ging und im Wirtshaus einen eigenen Krug mit seinem eingravierten Namen besaß.
Valerie hüstelte vernehmlich. Sie war aufgestanden und streifte sich gerade den Riemen ihrer Handtasche über die Schulter. »Viel Erfolg. Wir sehen uns morgen.«
Nach einem ermutigenden Augenzwinkern schwebte sie von dannen. Und ich glotzte wieder in den Schaukasten rein, ohne mich von der Stelle zu rühren.
Jetzt stell dich nicht so an, du Memme!, schalt ich mich selbst. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
Stimmte schon. Mehr als abweisen konnte er mich ja nicht. Er könnte mich höchstens zusätzlich noch auslachen. Aber in Lebensgefahr sollte ich nicht unbedingt sein.
Beherzt klopfte ich an die Scheibe. Stetten hielt den Kopf gesenkt, wedelte mich aber mit einer Hand zu sich herein.
Ich näherte mich vorsichtig dem Schreibtisch und wartete höflich, dass er von seinem Dokument abließ. Als er nach einer Weile gedankenversunken umblätterte, schwante mir, dass er meine Anwesenheit bereits wieder vergessen hatte.
Ich fing an mich bemerkbar zu machen, indem ich erst möglichst geräuschvoll an meinem Blazer herumzupfte und mit den Fingerknöcheln knackste. Weil der gewünschte Effekt ausblieb, steigerte ich das Ganze zu einem respektvollen Räuspern.
Da Stetten nicht mehr der Jüngste war, schien die Geräuschkulisse völlig an ihm vorbeizugehen. Sobald er ein weiteres Mal umblätterte, sah ich mich zu einer drastischeren Maßnahme gezwungen.
»Äh«, begann ich. »Herr Stetten?«
Er blickte auf und musterte mich wie eine merkwürdige Lichtspiegelung. »Fräulein Meier?«
»Müller.«
»Natürlich«, erwiderte er geistesabwesend und runzelte die Stirn. »Nun, was kann ich für Sie tun?«
Nervös knibbelte ich an meinen Fingerspitzen herum. »Ja, also, wenn Sie mich schon so fragen ... Also, vor ein paar Wochen haben Sie da was zu mir gesagt, was mich sehr gefreut hat. Ja, eigentlich habe ich mich sogar geschmeichelt gefühlt, und nun würde ich gerne wissen, wie wir in dieser gewissen Sache weiter vorgehen sollen.«
Stetten schaute mich verwirrt an. Vielleicht auch ein wenig erschrocken, was ich ihm bei meiner eloquenten Ansprache kaum verübeln konnte. Hastig gab ich mir einen Ruck, um jegliche Missverständnisse auszumerzen.
»Bonuszahlung!«, stieß ich hervor. Knapp und präzise, wie ich eben nun mal war.
Die Augen meines Chefs weiteten sich ein wenig. Ihm dämmerte wohl, dass er etwas übersehen hatte. Er richtete sich auf und lupfte erkennend die buschigen Brauen. »Ja, richtig!«
Er begann in den Schreibtischschubladen herumzuwühlen und zog schließlich einen zusammengeklappten Flyer hervor, den er mir feierlich überreichte. »Bitte schön. Ein kleiner Dank für Ihre hervorragenden Leistungen, Fräulein Meier.«
»Müller«, korrigierte ich und betrachtete verwundert den Flyer. »Eine Kunstgala?«
Herr Stetten hob gewichtig einen Zeigefinger. »Nicht irgendeine Kunstgala, sondern die Veranstaltung schlechthin! Die Gala ist schon seit Monaten ausverkauft. Es gibt unzählige Leute, die sich für ein Ticket die Hand abhacken würden.«
Ich drehte ernüchtert das Prospekt herum. »Aber das ist nur ein Flyer.«
»Ja, sicher. Bei solchen Veranstaltungen gibt es keine Eintrittskarten. Da steht man auf der Gästeliste, Fräulein Meier.«
»Müller.«
»Genau. Jedenfalls habe ich Sie bereits auf die Liste setzen lassen. Ich gehe davon aus, dass Sie sich diese außergewöhnliche Chance nicht entgehen lassen wollen. Genießen Sie den Abend auf Kosten der Firma. Meine Wertschätzung an Sie, Fräulein Müller.«
»Müller. Äh. Okay.« Ich riss mich zusammen und mühte mich, mir meine Enttäuschung nicht allzu sehr anmerken zu lassen. »Vielen Dank, Herr Stetten. Einen schönen Abend noch.«
Dann trug ich meinen Flyer nach draußen.
So ein Mist. Unter einer Bonuszahlung hatte ich mir wirklich etwas anderes vorgestellt.
20:25 Uhr
München, Wohnblock, Apartment 6c
Mein Tag endete wie meistens auf der Couch, während eine Tiefkühlpizza im Ofen brutzelte. Ich hatte mich in meinen geliebten Schlabberlook gehüllt, die Haare hoch auf dem Kopf verknotet und hockte nun im Schneidersitz auf dem Sofa, den Kunstgala-Flyer in den Händen ausgebreitet.
Die Veranstaltung fand bereits morgen Abend im Haus der Kunst statt. Wann Herr Stetten mir die freudige Nachricht hatte überbringen wollen, war fraglich. Der Gute wirkte echt mit jedem Tag zerstreuter und langsam machte ich mir schon ein wenig Sorgen, ob er vielleicht mit einer anfänglichen Demenz zu kämpfen hatte. Je länger ich bei ihm arbeitete, umso schlechter schien er sich meinen Namen merken zu können. Ziemlich eigenartig, das Ganze.
Warum plante man eigentlich einen Galaabend an einem Dienstag? Musste das übliche Klientel einer solchen Veranstaltung mittwochs nicht arbeiten?
Wenn es um Schlaf ging, verstand ich keinen Spaß. Hatte ich selbst in jungen Jahren nicht, und je älter ich wurde, desto mehr bestand ich auf meine acht Stunden, auch wenn Studien behaupteten, sieben Stunden würden vollkommen reichen. Gegen diesen Durchschnitt wehrte ich mich entschlossen.
Zudem stand auch noch die Frage im Raum, was um Himmels Willen ich zu dieser Gala anziehen sollte. Meine einzige festliche Abendgarderobe hing in Form meines Abschlussballkleides im Schrank. Und das eher aus nostalgischen Gründen, denn hinein passte ich schon lange nicht mehr.
Da meine finanzielle Situation derzeit auf ein neues Auto ausgerichtet war, gab mein Spesenkonto auch nicht wirklich eine Neuanschaffung her. Und zu guter Letzt hatte ich absolut keinen Schimmer wie so eine Kunstgala überhaupt ablief.
Ich hatte freilich dieses Bild im Kopf von herumstehenden, Sekt schlürfenden Leuten, die mit kennerischen Blicken Kunstwerke würdigten und rote Punkte neben Gemälde klebten.
Ach, nein, das war ja eine Vernissage ... aber, was zur Hölle war dann eine Kunstgala? Gab es da überhaupt einen Unterschied?
Eines stand jedenfalls fest: Ich war nicht vorbereitet auf eine solche Art von Veranstaltung und sollte wohl besser zu Hause bleiben.
Die Eieruhr in der Küche schrillte, darum warf ich den Flyer auf den Couchtisch und widmete mich lieber Dingen, von denen ich Ahnung hatte. Tiefkühlpizza, zum Beispiel. Absolut professionell holte ich sie aus dem Ofen und rollte mit geübten Bewegungen den Pizzaschneider drüber. Dazu schenkte ich mir ein Glas Chianti ein und servierte mir selbst das exquisite Dinner auf dem Couchtisch.
Hätte man mir gesagt, dass mein Alltag in München so aussehen würde, wäre ich vermutlich nicht hergezogen. Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, mir längst einen gut situierten Großstädter geangelt zu haben, mit dem ich in einem schicken Loft mit Dachterrasse wohnte. Ich wollte eine tolle Clique um mich haben, mit denen ich jeden Abend in einem anderen stylischen Restaurant den Tag ausklingen ließ. An den Wochenenden würden wir von einer Großveranstaltung zur nächsten ziehen und einfach alles mitnehmen, was die Stadt zu bieten hatte ...
Tja, und da war ich nun. Single, in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon. Mein einziger bester Freund war mein Bruder, der tausende Kilometer von mir entfernt war, und keinerlei andere soziale Kontakte in Sicht, mit denen ich die Stadt unsicher machen könnte.
Während die Pizza noch dampfte und Netflix auf dem Fernseher startete, warf ich einen Blick auf mein Handy, das tatsächlich eine Nachricht anzeigte.
Von Valerie?
Erstaunt las ich den Text. »hallo ich bin krank und kann nicht arbeit.«
Das war merkwürdig. Erstens hatte Valerie mir noch nie eine Textnachricht geschickt. Zweitens war sie noch kein einziges Mal krank gewesen. Und drittens hätte ich sie nicht für jemanden gehalten, der bei einer SMS plötzlich sämtliche Regeln der Rechtschreibung vergaß.
Unschlüssig kreiste mein Daumen über die Tastatur. Ich überlegte, ob ich sie anrufen sollte. Allerdings hätte sie das wohl selbst getan, wenn sie mit mir hätte reden wollen, darum tippte ich ein: »O je! Was fehlt dir denn? Gute Besserung und ich sag´s dem Chef.«
Ich kaute auf meiner Unterlippe herum und löschte die Eingangsfrage aus meiner Nachricht. Es ging mich ja schließlich nichts an. Neugierig war ich freilich, denn noch vor zwei Stunden hatte Valerie nicht gerade so gewirkt, als würde sich bei ihr eine Erkältung ankündigen oder sowas. Dennoch berief ich mich auf meine guten Manieren und schickte nur ab: »O je! Gute Besserung und ich sag´s dem Chef.«
Dann tauschte ich Handy gegen Fernbedienung und scrollte durch das Filmangebot.
Kenn ich, kenn ich, kenn ich ...
Ja, na ja, ich war eben ein Filmjunkie. Ich war quasi der Typ Mensch für den Netflix und Co. erfunden wurden. Ich war die Nachfrage des Angebots. Ich schuf Arbeitsplätze!
Und ich kompensierte mein eigenes langweiliges Leben damit. Das war mir klar, aber irgendwie musste ich mich ja davon ablenken. Am liebsten in Form eines rasanten Actionfilms, mit viel Geballer, knallharten Helden und mindestens einer spektakulären Explosion. Das war schön. So konnte ich mich am besten entspannen.
Bevor meine Pizza kalt wurde, entschied ich mich schließlich für meinen Lieblings-James-Bond-Streifen, den ich zwar längst auswendig kannte, aber wer könnte einem smarten, englischen Agenten schon überdrüssig werden?
Entspannt stellte ich mir den Teller auf den Schoß und tauchte ein in die aufregende Welt des MI-6.
Kapitel 2
Dienstag, 15. September 2020, 19:13 Uhr
München, Wohnblock, Apartment 6c
Scheiß drauf, dachte ich am nächsten Tag und holte mir nach Feierabend einen schicken Fummel aus einer Damenboutique in der Innenstadt.
Vielleicht färbte Bonds Selbstbewusstsein noch auf mich ab, aber ich war wild entschlossen, zu dieser Kunstgala zu gehen. Ich würde elegant eine geschwungene Treppe hinunterschreiten und alle Anwesenden würden vor Bewunderung meiner Grazie den Atem anhalten. Heute Abend würde ich Valerie König sein. Genau!
Der erste Schritt der Verwandlung bestand aus einer Ganzkörperepiliertortur, weil man schließlich nie wusste, was sich auf einer Kunstgala so ergab. Ein Ergeben wäre jedenfalls echt mal wieder an der Zeit.
Aktuell durchlebte ich eine regelrechte Dürreperiode, was Männer betraf. Nachdem mich meine letzte vage Liebschaft via Facebook abserviert hatte, war ich doch ziemlich beleidigt gewesen und hatte mich von den Herren der Schöpfung distanziert.
Inzwischen hatte sich mein Stolz allerdings wieder so weit gefangen, dass ich vor kurzem sogar mal Tinder ausprobierte. Rund fünfzig Dick-Pics später meldete ich mich zwar ohne einziges Date wieder ab, aber immerhin hatte ich an anatomischen Kenntnissen dazugewonnen. Auf die Frage, ob sich nach einer Kontaktaufnahme mittels Penisfoto jemals ein Treffen ergeben hätte, bekam ich leider nie eine Antwort. Meistens folgte darauf nur eine andere Perspektive.
Nach zwei Stunden intensiver Zuwendung für Frisur und Make-up bewunderte ich meinen Kopf von allen Seiten im Badspiegel und gab mir im Geiste selbst ein High-Five. Ich sah fabelhaft aus, und das konnte ich wirklich nicht oft von mir behaupten. Vielleicht sollte ich doch regelmäßig falsche Wimpern aufkleben, denn mein Augenaufschlag war phänomenal. Genau wie meine rotgeschminkten Lippen, die exakt den gleichen Farbton wie mein Kleid hatten. Mein Haar war zu einer eleganten Hochsteckfrisur drapiert, die ich abschließend mit einer kleinen Schmuckbrosche vollendete.
Ich verließ den Haarspraydunst des Badezimmers und schlüpfte in das bodenlange, karmesinrote Kleid, das einfach nur der reinste Wahnsinn war. Das taillierte Oberteil schmeichelte meinen etwas zu breiten Hüften und quetschte gleichzeitig meinen etwas zu kleinen Busen effektvoll nach oben.
Vorausgesetzt, ich bekam den Reißverschluss am Rücken zu, was sich schwieriger gestaltete als gedacht. Solche Kleider wurden definitiv für Frauen entworfen, die sich in einer Beziehung befanden. Oder für Schlangenmenschen.
Während meiner Verrenkungen klopfte es plötzlich an meiner Wohnungstür. Zwei Mal lang, drei Mal kurz. Das Klopfzeichen meines Nachbarn Tobbs, der eigentlich Tobias hieß, das Kürzel Tobi aber hasste und deshalb Tobbs genannt werden wollte.
Tobbs war eine Art klischeehaftes Unikat. Er war Anfang zwanzig, ein Computergenie und arbeitete als freiberuflicher Programmierer von zuhause aus. Dabei erfüllte er sämtliche Vorstellungen, die man gemeinhin von einem verschrobenen Hacker hatte. Angefangen von der abgedunkelten, vermüllten Bude, über einen fraglichen Hygienestandard, bis hin zu fundamentalem Wissen bezüglich globaler Verschwörungstheorien. Daher auch das Klopfzeichen.
Ich mochte Tobbs, gerade wegen all seiner Merkwürdigkeiten. Einen authentischeren Menschen wie ihn hatte ich noch nie kennengelernt und diese unverfälschte Art machte ihn für mich zu etwas ganz Besonderem.
Das Kleid am Ausschnitt gerafft, öffnete ich ihm die Tür. »Hi, Tobbs! Du kommst gerade richtig!«
Ich erhaschte nur einen kurzen Blick auf sein zerstrubbeltes Haar, bevor ich ihm auch gleich auffordernd den Rücken zudrehte.
»Hast du ein Date mit den Royals?«, fragte er staunend.
Geschmeichelt lächelte ich in mich hinein, während er den Reißverschluss hochzog und schließlich sagte: »Hey, das Preisschild ist noch dran. Soll ich es ...?«
»NEIN! Nein, nein, nein. Schieb es einfach unter den Stoff, okay?«
Er gluckste. »Verstehe. Aber pass besser mit dem Rotwein auf.«
Mit überlegener Miene drehte ich mich wieder zu ihm. »Ich gehe auf eine Kunstgala.«
Tobbs kratzte sich mit anerkennendem Nicken am Bauch. Sein Shirt war mit diversen Flecken übersät, die sich vermutlich hauptsächlich aus Energydrinks und Salsa Dip zusammensetzten. Der Länge seines Barts nach zu urteilen, war er gerade erst wieder ins echte Leben zurückgekehrt. Normalerweise trug er nämlich gar keinen Bart.
»Anstrengender Auftrag?«, schlussfolgerte ich mitfühlend.
»Ja, war eine harte Nuss. Du ... kann ich mir ein bisschen Waschpulver ausborgen? Das ist mein letztes sauberes Shirt ...«
»Es ist dein letztes Shirt«, korrigierte ich. »Und klar kannst du mein Waschpulver benutzen.«
Ich holte den Karton aus meinem Waschbeckenunterschrank. Tobbs klemmte ihn sich unter den Arm und druckste herum, bis ich ihn freundlich fragte, ob er vielleicht noch was brauchte. Das tat er. Und zwar eine Zitrone, zwei Batterien und vier Eier. Da ich in Eile war, wollte ich gar nicht erst wissen, ob er diese Zutaten in einem Zug verwenden würde.
Als Tobbs mit seinen Errungenschaften davongeschlurft war, gönnte ich mir noch einen ausgiebigen Blick in den Garderobenspiegel. In diesem Fall war ich es eindeutig wert, das Licht einzuschalten.
Ich drehte mich hin und her. Der Saum des Kleides umspielte sanft meine Knöchel. Meine silbernen Pumps passten hervorragend zu den Glitzerapplikationen am Ausschnitt. Fast eine Schande, dass ich das Kleid morgen wieder zurückgeben würde, um mein Kontolimit zu schützen.
Da ich an diesem Abend eine Prinzessin war, stopfte ich in ausgeklügeltem Schichtsystem mein wichtigstes Zeug in eine Clutch und gönnte mir zur Feier des Tages sogar ein Uber.
19:54 Uhr
München, Haus der Kunst, Haupteingang
Die Uber-Fahrerin hatte kein Auge für meine Schönheit übrig und chauffierte mich durch die Stadt, ohne ein einziges Mal ihr Telefonat mit ihrer Schwester zu unterbrechen. Verständlich, denn die Schwester hatte ihren Ehegatten beim Fremdgehen erwischt. Da gehörte es sich nun wirklich nicht, das Gespräch über die Freisprechanlage zu beenden, bloß weil ein Fahrgast mithörte. Ich wünschte der Schwester im Geiste von Herzen alles Gute.
Das Haus der Kunst befand sich am südlichen Ende des Englischen Gartens. Im Grunde war es ein länglicher Betonklotz aus Zeiten des Nationalsozialismus, an dessen Front riesige Säulen einen opulenten Eindruck vermittelten. Große Banner von Kunstwerken schmückten die Fassade und wurden effektvoll angestrahlt.
Ich stieg am Straßenrand aus und sortierte mein erlesenes Gewand, während mich die Passanten vor dem Gebäude interessiert musterten. Flache Stufen führten vom Gehweg in den Säulengang hinauf. Eigentlich hatte ich ja eine Treppe hinunterschreiten wollen, aber so musste ich eben würdevoll hinaufschreiten.
Als ich durch die hohe Eingangstür trat, hielt niemand den Atem an. Es lag vermutlich an der falschen Treppenrichtung.
Der Eingangsbereich war leer und mutete wenig festlich an. Es gab einen Infotresen, mehrere Flyerständer und einen Souvenirshop, der gerade seine Pforten schloss.
Erleichtert entdeckte ich schließlich ein paar Menschen in eleganter Kleidung im hinteren Teil der Eingangshalle. Sie versammelten sich vor einer doppelflügeligen Tür, über der ein Banner mit der Aufschrift »12te Münchner Kunstgala« angebracht war.
Mit erhaben vorgerecktem Kinn stöckelte ich darauf zu und beobachtete dabei unauffällig das Verhalten der anderen Gäste. Sie wandten sich gezielt einem Tisch vor der Tür zu, neben dem reglos eine junge Frau verharrte, als wäre sie eine Statue. Vielleicht war sie das ja. Immerhin war das hier das Haus der Kunst. Nein, sie atmete.
Ich erreichte den Tisch und erkannte, dass darauf unzählige Namensschildchen in alphabetischer Reihenfolge bereitlagen. Das Paar vor mir beugte sich kurz über das Angebot, nahm sich ihre Schilder und verschwand anschließend zielstrebig in der Tür unter dem Banner.
Na, gut. Dieses System hatte ich schon mal durchschaut. Dummerweise befand sich aber keine Christina Müller in der M-Abteilung. Und auch keine Christina Meier.
Stirnrunzelnd überflog ich nochmals die kleinen Schildchen. Ich stutzte, als ich auf »Valerie König« stieß. Stetten hätte ruhig erwähnen können, dass Valerie auch eine Eintrittskarte bekommen hatte.
Moment mal! Oder hatte letztlich ich ihre Karte bekommen?
Missmutig suchte ich weiter die Reihen ab, bis schließlich das erste internationale Hüstelzeichen hinter mir erklang. Da geriet auch die Statue in Bewegung und sie neigte sich in meine Richtung.
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragte sie in einem näselnden Ton, aus dem die Arroganz nur so tropfte.
Ihr Blick ließ keinen Zweifel daran offen, dass ich ihrer Meinung nach nicht hierher gehörte. Ganz so unrecht hatte sie zwar nicht, aber dafür, dass sie nur die Tischfrau war, fand ich ihre Überheblichkeit dann doch ziemlich überzogen. Auf gar keinen Fall würde ich mir die Blöße geben und dieser Schrulle erklären, dass mein Chef mich wohl doch nicht auf die Gästeliste hatte setzen lassen.
»Nein«, sagte ich und griff hastig nach Valeries Namensschild. »Ich hab´s gefunden.«
Sie schaute mich überaus skeptisch an, aber Ausweiskontrolle schien nicht in ihren Aufgabenbereich zu fallen.
Ich schenkte ihr ein möglichst blasiertes Lächeln, bevor ich an ihr vorbeistolzierte. Mein Vorhaben, heute Valerie König zu sein, setzte sich somit mehr in die Realität um als gedacht. Da meine Kollegin aber ohnehin krank zu Hause war, hielt sich mein schlechtes Gewissen in Grenzen. Valerie würde nie erfahren, dass ich mir ihre Identität kurz ausgeborgt hatte.
Ich trat durch die Tür und landete in einem Saal, der meiner Vorstellung einer Galaveranstaltung endlich gerecht wurde. Die hohen Wände waren mit Marmor verziert. Der Mittelteil der Decke bestand aus einer riesigen Sprossenglaskuppel. Ein Meer aus Lichterketten überspannte eine ganze Armada aus hussenüberzogenen Stehtischen, die sich um eine große Bar tummelten. Überall huschten Kellner mit sektbeladenen Tabletts herum.
An einer Seite war ein riesiges Buffet aufgebaut, gegenüber davon gab es mehrere Sitzgelegenheiten. Und am anderen Ende des Saals bezog gerade eine Jazzband Stellung auf einer Bühne.
»Champagner, die Dame?«, fragte mich ein Kellner, während ich noch staunte, und hielt mir ein Tablett hin.
Aha, der vermeintliche Sekt war also gar keiner. Ich pflückte mir dankend ein Gläschen vom Tablett des Kellners, der sofort wieder davoneilte. Neugierig betrachtete ich das perlende Getränk, das in meinem ungeübten Auge immer noch wie Sekt aussah, sich aber natürlich gleich viel gewichtiger anfühlte. Genüsslich nippte ich an dem erlesenen Tropfen und ...
... verzog angewidert das Gesicht.
Bäh! Auf dieses Gesöff waren die Reichen immer so wild? Mir klebte nach nur einem Schlückchen die Zunge am Gaumen, so trocken war das Zeug. Vielleicht fehlte mir ja der entsprechende Speichelfluss der Reichen und Schönen, um Champagner als gut zu empfinden.
Unauffällig stellte ich das volle Glas auf dem nächstbesten Stehtisch ab und wanderte zur Bar. Der Saal war erst halbvoll. Offenbar gehörte es in erlesenen Kreisen zum guten Ton, nicht pünktlich zu Veranstaltungsbeginn zu kommen. Darum schien es wohl auch die Band nicht sehr eilig zu haben.
Ich fragte mich, was das wohl für Leute waren, die in kleinen Grüppchen herumstanden und fröhlich plauderten, während sie Champagner schlürften. Auf den ersten Blick schien sich die Menge ausschließlich aus Paaren zusammenzusetzen. Irgendwie war ich die Einzige, die sich ganz alleine in Richtung Bar bewegte und anscheinend auch die Erste, die sich an diesem Abend überhaupt dorthin wagte. Zumindest sah mich der Barkeeper ziemlich schräg an, als würde er nicht verstehen, was ich denn jetzt überhaupt wollte.
»Ich hoffe, hier gibt´s auch was Anständiges zu trinken«, scherzte ich, um gleich mal das Eis zu brechen. Mit dem Barkeeper sollte man sich ja bekanntlich gut stellen.
Der junge Mann schien nicht viel Interesse an einem netten Tresenverhältnis zu haben und reagierte auf meinen Spruch nur mit einem müden Lächeln. Wenigstens legte er mir eine Getränkekarte hin, bevor er so tat, als müsse er Gläser sortieren.
Gleich nach dem ersten Blick auf die Karte blieb mir auch noch der Rest an Spucke weg. Ich hatte nicht erwartet, Preise hinter den Angeboten stehen zu sehen. In der Eintrittskarte war wohl keine Flat-Rate enthalten und der günstigste Posten war mit acht Euro eine kleine Flasche Wasser. Das billigste Achterl Wein kostete knapp das Doppelte. Das war an sich schon eine Frechheit, und da ich davon ausgegangen war, heute gar nichts bezahlen zu müssen, war ich erst recht angepisst.
So viel also zum Thema: Ein schöner Abend auf Kosten der Firma.
Vielen Dank, Herr Stetten, für dieses großzügige Geschenk!
Ach so, nein, die Einladung war ja eh nie für mich gewesen, sondern für Valerie. Zumindest war ich inzwischen überzeugt, dass ich gar nicht für die Gästeliste vorgesehen gewesen war und Stetten mir den Flyer aus reinem schlechten Gewissen und allgemeiner Zerstreutheit in die Hand gedrückt hatte.
Was für ein Scheiß!
Der Barkeeper kehrte zurück in mein Sichtfeld. Aus purem Trotz bestellte ich einen doppelten Whiskey auf Eis, der freilich mein Budget sprengte, aber irgendwie musste ich ja das Beste aus diesem blödsinnigen Abend machen.
Wenigstens war der Whiskey gut. Durfte er aber auch sein, wenn er schon mein Taxibudget auffraß. Dass in diese bescheuerte Clutch nicht mal mein Geldbeutel reinpasste, musste ich nun büßen. Hauptsache, ich hatte diverse Make-up-Artikel hineingequetscht. An meine Kreditkarte hatte ich nicht gedacht, doch mit den übrigen Münzen würde ich zumindest via Straßenbahn nach Hause kommen.
Ich lehnte an der Bar, nippte verdrossen an meinem Drink und ließ meinen Blick durch den Saal schweifen. Die Band hatte sich nun auch endlich aufgerafft und beehrte die Gäste mit recht zurückhaltenden Klängen, die es nicht weit über die Gesprächskulisse hinausschafften. Da mir von meinem Posten aus schnell langweilig wurde, schlenderte ich schließlich mit meinem Drink an der Wand entlang und betrachtete die dort ausgestellten Kunstwerke.
Kunst würde ich wahrscheinlich nie verstehen. Vor allem nicht solche, die anmutete, als wäre der Künstler mit diversen Farbtöpfen auf seiner Leinwand Amok gelaufen. Gerade stand ich vor einem Objekt, das im Grunde ein einziges Durcheinander in Orange und Grün auf drei Quadratmetern zeigte. Der Titel: »Gestern«.
Aha. Na ja, meine Interpretation dazu lautete, dass der Künstler gestern die falschen Pilze auf seine Pizza gestreut hatte. Wäre also durchaus interessant, wie sich sein »Heute« darstellte. Vielleicht als schwarzes Loch?
Ich fand es nicht heraus, denn die Leinwand daneben war von jemand anderem massakriert worden, der die »Gefahr« ausdrückte in ...
Ich trat einen Schritt zurück. Ich neigte den Kopf nach links. Ich neigte den Kopf nach rechts. Ich trank einen Schluck.
Alles klar. Das da vor mir war zweifelsfrei die gnadenlose Frontansicht einer ein Meter großen Vagina in diversen Blautönen und ... waren das Zähne?
Grundgütiger! Der Künstler sollte sich dringend mit seinem Frauenkomplex auseinandersetzen und mit einem Profi über seine Mutter reden.
»Interessante Darstellung, nicht wahr?«, sagte eine männliche Stimme hinter mir.
Da ich nicht damit rechnete, dass diese Aussage mir gegolten hatte, reagierte ich nicht darauf und nippte an meinem Whiskey. Das Glas hatte kaum meine Lippen berührt, als der Sprecher neben mich trat und sich mir leicht zuwandte.
Ich versteinerte augenblicklich inmitten der Bewegung, denn der Anblick des Mannes schockierte mich weit mehr als die zähnefletschende Vagina vor mir.
Er war der mit Abstand schönste Mann, den ich je im realen Leben gesehen hatte. Groß und unter dem Smoking zweifelsohne perfekt gebaut, dunkelblondes Haar, himmelblaue Augen in einem glattrasierten, markanten Gesicht, mit einem vagen Lächeln auf den Lippen und insgesamt einer maskulinen Ausstrahlung, die meine Weiblichkeit bis in die Grundfeste erschütterte.
Ich merkte erst, dass ich ja noch im Begriff war zu trinken, als mein Mund randvoll mit Whiskey war. Irgendwie würgte ich den viel zu großen Schluck hinunter, ohne daran zu ersticken, und wischte mir wenig elegant mit dem Handrücken über die Mundwinkel. Der schöne Mann sah das zum Glück nicht, denn er hatte sich dem Gemälde zugewandt und betrachtete es eingehend.
»Sehr prägnant«, sagte er.
»Ich finde es eher besorgniserregend«, kommentierte ich ehrlich.
Er schmunzelte und drehte sich wieder zu mir.
Ich grinste unbeholfen. Der Kerl machte mich nervös. Mit einer solch geballten sexy Ausstrahlung konnte ich nicht umgehen. Testosteronüberdosis, quasi.
»Darf ich mich vorstellen?«, fragte er elegant und streckte mir eine Hand hin.
Aber sicher durfte er das, darum reichte ich ihm eilig meine Hand und bemerkte den leichten Whiskeyschimmer auf meinem Handrücken erst, als sich bereits seine Finger darum schlossen. Beinahe hoffte ich, er würde daran kleben bleiben, denn die an sich unschuldige Berührung stellte Unglaubliches in meinen unteren Bauchregionen an. Nicht auszudenken, was seine Hand anstellen könnte, wenn sie ...
»Mein Name ist Jayden Scott«, sagte er da, was mich kurz verwirrte. Dann fügte er noch an: »Es freut mich sehr, dass wir uns endlich persönlich kennen lernen, Valerie«, was mich erst recht verwirrte.
Einen Teil konnte ich recht schnell entwirren, indem ich mich des geklauten Namensschilds an meiner Brust entsinnte.
Vermutlich hätte ich an dieser Stelle klarstellen sollen, dass ich nicht Valerie König war. Mein östrogenschwangeres Gehirn entschied sich allerdings für ein weitaus interessanteres Thema.
»Jayden Scott«, hörte ich mich raunen. »Woher genau kommen Sie denn, Mister Scott?«
»Nennen Sie mich Jayden«, bot er an, blieb leider nicht an mir kleben und zog seine Hand zurück. »Ich stamme aus Birmingham.«
»Großbritannien? Ich hätte eher auf USA getippt.«
Er schmunzelte. »Warum? Weil ich nicht so charmant bin wie James Bond?«
»Nein, daran lag es bestimmt nicht«, antwortete ich und spürte ganz genau, wie meine Ohren unter seinem Lächeln zu glühen begannen.
»Dann bin ich ja beruhigt«, meinte er augenzwinkernd.
Großer Gott!
Ich konnte wirklich nicht fassen, dass ich einem waschechten, smarten Engländer gegenüberstand, von denen man ja immer wieder hörte. Und ich musste schon sagen, dass er allen Vorstellungen entsprach, die man so als Frau von einem eleganten Briten hatte. Bestimmt war er auch noch aus reichem Hause, wie es sich halt für einen Mister Darcy gehörte. Mit einem bezaubernden Landsitz, dessen Name auf Manor endete.
Jayden ließ einen langen Blick über mich gleiten. »Ich war sehr beeindruckt von Ihrem Engagement bei SysCom, doch ich muss schon sagen, dass mir Ihre Schönheit fast noch mehr imponiert.«
Eigentlich wäre jetzt endgültig der Zeitpunkt gekommen, die Verwechslung aufzuklären, aber dummerweise schmolz ich einfach nur dahin und brachte gerade einmal ein verlegendes »Ach« zustande. Als er daraufhin einen Schritt näher trat und sich so nahe an mein Ohr beugte, dass ich die Wärme seiner Wange an der meinen spürte, befand ich mich schließlich vollends in einem Zustand der geistigen Umnachtung. Sein herbes Aftershave vernebelte mir die Sinne und das Gefühl seines Atems auf meiner nackten Schulter jagte mir aufregende Schauer über den Rücken.
»Wir sind Ihnen zu Dank verpflichtet, Valerie«, raunte er und nahm meine Hand. »Haben Sie noch einen schönen Abend.«
Dann hauchte er mir einen Kuss auf die Wange, wandte sich von mir ab und ging davon, während ich noch mit den Auswirkungen seiner Nähe zu kämpfen hatte.
Verdattert blickte ich auf meine Hand, die eigenartigerweise ein Münzgroßes, ovales Objekt umklammert hielt. Es war schwarz und aus Plastik, und ich brauchte ziemlich lange, um zu verstehen, dass es a) ein kleiner USB-Stick mit Schutzkappe war und b) wie dieser in meine Hand gekommen war.
Blinzelnd erwachte ich aus meiner Vernebelung und sah mich hektisch nach Jayden um. Der smarte Brite war nirgends zu entdecken. Nervös drehte ich den Stick zwischen meinen Fingern und überlegte, was ich nun tun sollte. Das Ding war zweifelsohne für Valerie bestimmt gewesen und hatte wohl etwas mit der Arbeit zu tun.
Vielleicht sollte sie es Stetten geben? Aber warum dieses inoffizielle Treffen auf einer Kunstgala? Das mutete ja geradezu wie die versteckte Übergabe geheimer Dokumente an.
Quatsch! Ich befand mich ja nicht in irgendeinem Spionagestreifen. Für diese Sache gab es bestimmt eine ganz harmlose Erklärung. Am besten rief ich Valerie morgen kurz an. Oder sollte ich gleich noch? Nein, wenn sie krank war, schlief sie wahrscheinlich schon.
Ich packte also den USB-Stick in meine Clutch und leerte mein Glas in einem Zug. Dabei fiel mein Blick auf die zähnefletschende Vagina an der Wand. Aber nicht einmal sie schaffte es, den wehmütigen Nachhall der viel zu kurzen Begegnung mit Jayden aus meinen Zellen zu vertreiben.