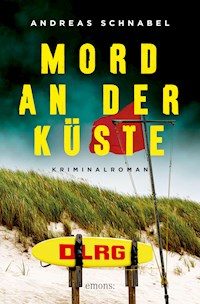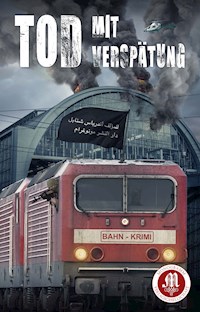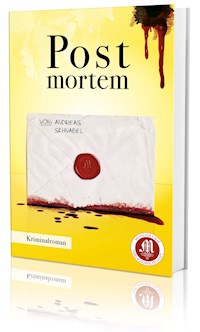Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mallorca Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei Mordfälle erschüttern das Inselparadies Mallorca: eine männliche Leiche mit schweren Kampfverletzungen und ein spanischer Nationalist, der tot im Pool liegt. Michael Berger und Comisario Cristobal García Vidal müssen sich ebenso wie ihre junge Kollegin Carmen Lucas durch ein Gespinst aus Lügen, Korruption und Gewalt kämpfen, bis sie die wahren Täter endlich stellen können. Sie ahnen nicht, in welches Wespennest sie damit stechen . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Schnabel, geboren 1953 in Hamburg, ist ausgebildeter Rettungsassistent, arbeitete als Hauptbrandmeister, Taxifahrer, Rundfunkreporter, RTL-Sportredakteur, TV-Producer, Filmproduzent, Event- und TV-Regisseur und Theater-Autor. Er lebt als Autor in Pulheim bei Köln.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: iStockphoto.com/katjawickert Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-625-6 Mallorca Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Silke und Christian Volgmann,
die immer für mich da waren.
Danke!
EINS
In Norbert Kleinen kamen deutliche Zweifel auf. Er hatte noch nie eine derart tobende Menschenmenge erlebt. Lauter hätte es in einem Fußballstadion auch nicht sein können, nur saßen die Fans da nicht so nahe am Spielfeld. Was heißt hier Fans?, dachte Kleinen irritiert, das ist der blanke Mob, Hooligans in Ballkleid und Smoking, die sich rund um den Boxring gebärden wie Wilde.
Vor den drei Stufen, die auf das Podest hinaufführten, blieb er zögernd stehen. Zwei junge Damen in knappen Bikinis und High Heels, deren Absätze bis zu den drallen Hinterteilen ihrer Trägerinnen zu reichen schienen, waren damit beschäftigt, eine Ecke der Matte von etwas zu säubern. Das, was sie da über den Putzeimern aus den Wischlappen drückten, sah aus wie Blut.
Angst stieg in Kleinen auf. Sollte er das wirklich über sich ergehen lassen? Er brauchte einfach nur nicht diese dusselige Treppe hinaufzusteigen, und schon wäre er aus dem Schneider. Andererseits brauchte er das Geld.
Egal. Einfach laut Nein sagen und wieder in die Umkleidekabine gehen, das war das Gebot der Stunde.
Seine beiden riesigen Begleiter schienen diesen Gedanken jedoch zu erahnen, denn bevor er sich dazu entschließen konnte, seine Überlegung in die Tat umzusetzen, spürte er, wie seine Oberarme von jeweils einem Schraubstock umspannt wurden und er unter dem hämischen Gelächter der Menge annähernd wehrlos die Treppen hochgetragen und zwischen den von einem dritten Bodyguard auseinandergezogenen Ringseilen hindurch in das Kampfareal geschubst wurde.
Ein Häuflein Elend klatschte auf die Matte, ein ängstliches Bündel Mensch, das sichtlich Mühe hatte, sich im gleißenden Rampenlicht zu orientieren. Mühsam rappelte Kleinen sich hoch und schaute sich um. In einer Ringecke stand ein Mann in einem Trainingsanzug, der ihn zu sich winkte. Mit einem grimmigen Kopfnicken wies er ihn an, sich auf den Holzhocker zu setzen, der gerade von einem Assistenten unter den Ringseilen hindurchgeschoben und aufgestellt wurde.
»Wo ist mein Gegner?«
»Mach dir keine Sorgen, mein Junge, der kommt noch früh genug.« Der Betreuer überprüfte mit ein paar Handgriffen, ob die Bandagen an seinen Fuß- und Handgelenken richtig saßen. Dröhnende Musik setzte ein. Zu den Klängen von »Conquest Of Paradise«, der ehemaligen Auftrittsmusik von Henry Maske, und begleitet vom geradezu frenetischen Jubel der Massen, schob sich eine dichte Menschentraube durch die schmalen Gänge zwischen den Sitzreihen in Richtung Ring. Kleinen hatte Mühe, durch die gleißende Lichtwand der Scheinwerfer hindurch etwas zu erkennen. Da teilten sich die Seile, und mit federnden Schritten hüpfte ein junger, am ganzen Körper tätowierter und völlig haarloser Mann in den Ring. Ihm folgte eine weitere, in schwarz gekleidete Person, offensichtlich der Ringrichter der Veranstaltung.
Kleinen schöpfte neue Hoffnung. Sein Gegner war zwar drahtig, zudem hatte die Körperbemalung etwas Martialisches, doch der Mann war fast einen Kopf kleiner als er und, wie Kleinen fand, weniger muskulös. Er erhob sich von seinem Sitz und begann ebenfalls zu tänzeln – ein zaghafter Versuch, seinen Kontrahenten zu beeindrucken. Der schien ihn aber gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. Seine leeren Augen starrten bei der Gegenüberstellung glatt durch ihn hindurch.
Kleinen musste nach Luft schnappen. Ihm war, als würde sein Herz in einen Bottich eiskalten Wassers getaucht werden.
Um die grölende Menschenmenge zu übertönen, brüllte der Ringrichter die beiden Kontrahenten an. Kleinen verstand trotzdem kein Wort, nickte aber, als der Mann mit seiner Rede geendet hatte. Das gesamte Ringpodest begann zu vibrieren, und ein infernalisches Sirenengeheul setzte ein. Unter einer Kaskade bunten Saalfeuerwerks wurden die Ringseile in den Boden hinabgelassen, während von oben gleichzeitig ein Stahlkäfig heruntergefahren kam. Es war nun keine Flucht mehr möglich. Kleinen fühlte sich wie ein Stück Pflaumenkuchen, das, vor Wespen geschützt, unter einer Netzkuppel darauf wartete, verzehrt zu werden. Vielleicht war dieser Vergleich mit dem Pflaumenkuchen gar nicht so falsch, denn nach dem Kampf könnte sein Gesicht der Kuchenauflage durchaus ähneln.
Ein lauter Gong dröhnte, und ehe Kleinen reagieren konnte, durchzuckte sein Gesicht ein so furchtbarer Schmerz, wie er ihn sich nicht hätte vorstellen können. Der erste Faustschlag seines Gegners hatte ihn bereits getroffen, bevor der Ringrichter »Go« gerufen hatte, aber das schien ungeahndet zu bleiben. Kleinen fühlte direkt den nächsten Schmerz, als er zu Boden ging und mit dem Hinterkopf auf die harte Matte krachte. Mühsam richtete er sich wieder auf. Seine Nase und sein Mund fühlten sich an wie ein blutiger Brei, aus dem er seine Schneidezähne auszuspucken versuchte. Da seine Oberlippe bis zur Nase hin aufgerissen war, war das aber kein Spucken, sondern nur noch ein blutiges Schnauben und Zischen.
Gut, dachte Kleinen, jetzt werde ich ausgezählt, und dann hat der Spuk ein Ende. Schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Doch er hörte niemanden zählen. Ein wuchtiger, für ihn völlig unerwarteter Tritt in den Unterleib ließ ihn wie ein Tier aufbrüllen. Fast irrsinnig vor Schmerzen versuchte er, sich wie eine Kugel zusammenzurollen, doch der Gegner ließ nicht von ihm ab, im Gegenteil. In Panik schlug er mit der flachen Hand auf den Ringboden. Das war in der Welt des Kampfsportes das Zeichen zum Aufgeben und sollte ihn vor weiteren Angriffen schützen.
Stattdessen fühlte Kleinen, wie seine Handgelenke gegriffen und seine Arme gestreckt nach hinten gebogen wurden. Er spürte, wie die Bänder der Rotatorenmanschetten eines nach dem anderen rissen. Den darauffolgenden gewaltigen Tritt mit der Fußsohle zwischen seine Schulterblätter empfand er nicht mehr als besonders schmerzhaft. Das knirschende Schmatzen, mit dem die Gelenkkugeln beider Oberarme aus ihren Knochenpfannen gerissen wurden, befremdete ihn nur noch.
Es wurde immer leiser um ihn herum. Am Boden liegend öffnete er seine Augen und erblickte zwischen den in der ersten Reihe vor Begeisterung schier ausflippenden Zuschauern die schönste Frau, die er jemals in seinem Leben gesehen hatte. Aufregender konnte ein rotes hautenges Kleid gar nicht sein, und ihr unglaubliches Dekolleté würde selbst durch den teuersten Schmuck dieser Welt nur verschandelt werden. Sie war die Einzige, die es noch auf ihrem Sitz hielt. Reglos sah sie ihn an und lächelte. Kein aufreizendes Lächeln, eher ein mitleidiges. Ihre Blicke trafen sich, und Kleinen war von ihren Augen und ihrem Wesen so fasziniert, dass ihn die Brutalität, mit der sein Gegner seinen Hals in den Mattenboden hineintrat, nicht weiter tangierte.
In diesem Moment war sie die einzige Liebe, die er in seinem Leben je gehabt zu haben schien, und er schwor sich, nie wieder eine andere zu lieben. Er fühlte sich in ihrem Blick gefangen, war in ihm geborgen, zutiefst erfüllt und völlig schmerzfrei. Ein ungeahntes Glücksgefühl durchströmte ihn, denn diese Göttin nahm ihn zur Kenntnis. Sie hob ihren rechten Arm, streckte die Faust aus und spreizte den Daumen ab. Dann nickte sie ihm seltsam spöttisch zu und drehte, begleitet vom hysterischen Kreischen ihrer Sitznachbarinnen, den Daumen in Richtung Boden.
Ob Kleinen das Knacken seiner Schädelbasis noch hörte, ist ungewiss. Er wusste nun aber, wie sich pures, unendliches Glück anfühlte, und starb mit einem grotesken Lächeln in seinem zerschlagenen Gesicht.
***
Es drohte wieder einmal ein brütend heißer Tag zu werden. Die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen, doch das Quecksilber des Terrassenthermometers zeigte schon jetzt vierundzwanzig Grad an. Michael Berger legte das Telefon zur Seite und drehte sich zu Rosa um, die eben hereinkam. Er hatte sich zwar große Mühe gegeben, seine Gräfin nicht zu wecken, als er sich aus dem Bett gewälzt hatte, aber vermutlich war sie bereits beim Handyklingeln wach geworden.
»War das Cristobal?«, fragte sie.
»Wer sonst?«, brummte er verschlafen. »Jeder andere würde auch von mir erschossen werden.«
Gräfin Rosa hantierte an der Espressomaschine, während Berger seine Morgentabletten sortierte. Er war im Prinzip zwar gesund, aber hatte, wie fast jeder Mensch seines Alters, so seine Zipperlein. Mit Mitte fünfzig war man eben kein Jungspund mehr. »Was soll ich nur alles nehmen«, schimpfte er, »wenn ich wirklich alt bin?«
»Die Kugel, mein Schatz, dann hört wenigstens das Gejammer auf. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Tante Auguste. Die ist hoch in den Achtzigern und verzweifelt auch nicht daran.«
»Die ist kein Maßstab. Auguste hält das Altwerden für das letzte große Abenteuer, das ein Mensch auf unserem Planeten noch erleben kann, und genießt es in vollen Zügen.«
»Dennoch beißt sie in mancherlei Hinsicht ganz schön die Zähne zusammen.«
»Wenn man noch seine eigenen hat, wird davon explizit abgeraten.«
Durch die Küche zog bereits ein verlockender Kaffeeduft, als Rosa die Milch mit Hilfe der Wasserdampfdüse in einer Stahlkanne erhitzte. »Weswegen müssten Sie denn schon wieder ran?«
Berger rieb sich den Schlaf aus den Augen. »Auf der Bundesstraße zwischen Llucmajor und Campos haben sie eine Leiche gefunden.«
Sie goss die heiße Milch in den Kaffee. »Ist sie denn mehr als nur tot?«
»Der Kleidung nach zu urteilen, hat es einen jungen Mann beim Sport erwischt, aber der Rest passt irgendwie nicht zur Leiche. Mehr kann ich Ihnen dann nachher erzählen.«
Obwohl die Beziehung der beiden inniger nicht hätte sein können und sie einander am Ende des Jahres das Jawort geben wollten, am »Sie« zwischen ihnen würde auch das nichts ändern. Für beide war es schon die zweite Ehe, und nachdem Bergers erste durch den gewaltsamen Unfalltod seiner Frau und seiner zwei Kinder furchtbar geendet hatte, versuchte er mit diesem »Sie«, seine Rosa vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.
Kennengelernt hatten sich die beiden, als Rosa nach Mallorca gekommen war, um den Nachlass ihres kürzlich verstorbenen Mannes, des Grafen Ernst von Zastrow, zu regeln. Zum ersten Mal auf der Insel und des Mallorquinischen nicht mächtig, hatte sie die Hilfe des »Residente«, wie Michael Berger von den Einheimischen genannt wurde, in Anspruch genommen. Dass dieser ein emigrierter Ex-Kriminalkommissar aus Bonn und zudem ein enger Freund von Comisario Cristobal García Vidal war, hatte sich als glückliche Fügung erwiesen, denn wie sich bald herausstellte, plante ein Verbrechersyndikat, ganz groß ins mallorquinische Immobiliengeschäft einzusteigen. Als Filetstück wollte man sich die dreihunderttausend Quadratmeter große gräfliche Finca unter den Nagel reißen und hatte kurzerhand den Grafen umgebracht. Der Plan der Schurken war es, der Witwe das Grundstück für wenig Geld abzukaufen. Sie gingen davon aus, dass es kein Problem sein würde, die Gräfin angemessen einzuschüchtern, hatten aber nicht mit der Wehrhaftigkeit dieser zierlichen Mittvierzigerin gerechnet. Nachdem die »feindliche Übernahme« erfolgreich vereitelt werden konnte, hatte Gräfin Rosa entschieden, der Insel nicht wieder den Rücken zu kehren. Inzwischen war sie die Inhaberin einer kleinen Detektei, deren einziger Angestellter Michael Berger war. Und dadurch, dass Comisario García Vidal bei kniffligen Fällen immer wieder um dessen Mithilfe bat, rechnete sich das Ganze auch.
García Vidal, der Berger vom Auto aus alarmiert hatte, und seine Assistentin Carmen Lucas, die mit Tomeu, ihrem Lebensgefährten und Verwalter des gräflichen Anwesens, ebenfalls auf der Finca wohnte, betraten fast gleichzeitig die Küche.
»Buenos días, Señora Condesa.« García Vidal inhalierte gierig den frischen Kaffeeduft. »Da unsere Leiche schon tot ist, dürfte gegen einen kurzen Cortado nichts einzuwenden sein, denke ich«, sagte er auf den fragenden Blick der Gräfin.
Rosa füllte frisches Kaffeepulver in das Sieb. »Carmen, du auch?«
Die junge Frau nickte verschlafen. »Gern, aber meinen bitte mit etwas mehr Milch.«
»Wissen Sie schon Genaueres über unseren Toten, Cristobal?«, fragte Berger, während er Zucker in seinen Cortado rührte.
»Leider nein. Ich weiß nur, dass dem Doc am Unfallort einige Dinge seltsam vorgekommen sind, deshalb haben sie uns alarmiert.«
***
Juan Valdo, der wachhabende Beamte im Foyer des Rathauses, schreckte hoch und sah sich nach der Quelle des Geräusches um, das ihn geweckt hatte. Sichtlich aufgeregt klopfte draußen im Morgengrauen eine junge Frau an die gläserne Rathaustür. Nur spärlich bekleidet, machte sie den Eindruck, als sei sie aus dem Bett geflüchtet, um Hilfe zu holen. Der Beamte der Policía Local erhob sich von seinem Stuhl. Nachdem er sich auf dem Kontrollmonitor davon überzeugt hatte, dass niemand anderes neben dem Eingang und auf dem Vorplatz lauerte, öffnete er und ließ den Besuch ein.
»Señora, kann ich Ihnen behilflich sein?«
Sie nickte verstört. »Sí Señor«, erwiderte sie in schlechtem Spanisch, »bitte rufen Sie jemanden von der Kriminalpolizei, der Deutsch versteht.«
»Was ist denn passiert?«
»Ich befürchte, dass ich meinen Verlobten umbringen werde. Heute noch.«
Er glaubte, falsch verstanden zu haben. »Ihn umbringen werden?«
»Sí.« Sie wischte sich mit einer fahrigen Bewegung eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Und wie kommen Sie darauf?«
»Ich träume es, immer und immer wieder.«
»Und da wenden Sie sich an die Polizei?«
»Sí. Ich weiß mir keinen anderen Rat.«
»Wenn Sie etwas träumen, was Ihnen offensichtlich Angst macht, sollten Sie zum Therapeuten gehen oder zum Hausarzt. Bei uns sind Sie da völlig falsch.«
»Ich habe keinen Hausarzt auf Mallorca und schon gar keinen Therapeuten.«
»Tja, junge Frau, ich weiß ja auch nicht.« Juan Valdo grinste. »Also … immer wenn ich Lust habe, meine Alte umzubringen, gehe ich in die Bar und geb mir die Kante.« Er lachte. »Wenn ich jedes Mal zur Polizei rennen würde, hätte ich gar keinen freien Tag mehr.«
Sie blieb stur. »Ich vertrage keinen Alkohol, und ich will ihn ja auch gar nicht umbringen.«
»Und warum träumen Sie es dann?«
Tränen der Verzweiflung schossen ihr in die Augen. »Woher soll ich das wissen? Rufen Sie nun jemanden, oder zwingen Sie mich zu einem Mord, den ich gar nicht begehen will?«
»Die von der Policía Nacional würden sowieso erst dann kommen, wenn Sie Ihren Mann wirklich umgebracht haben. Vorher rühren die keinen Finger.« Er zuckte ratlos mit den Achseln. »Wie heißen Sie eigentlich? Ich habe Sie doch schon mal gesehen, hier auf der Fiesta, mit Miguel zusammen.«
»Sí. Ich bin seine Verlobte. Mein Name ist Vanessa Riesche.«
»Und Sie wollen Miguel also wirklich umbringen?«
»Dios mío, eben das will ich ja gerade nicht. Deswegen bin ich hier. Ich träume nur davon.«
Valdo schüttelte entnervt den Kopf. »Das wird mir hier zu blöd. Ich rufe Hilfe für Sie.«
Er griff zum Telefon, und die Frau nickte erleichtert. »Na endlich. Mehr will ich doch gar nicht.«
***
Als sie am Unfallort auf der C-717 eintrafen, hatte die Guardia Civil die Fahrbahn bereits komplett geräumt und wieder freigegeben, was der Comisario fluchend zur Kenntnis nahm.
»Wozu rufen uns diese Deppen dann noch?« Er öffnete die Wagentür. »Es ist doch immer das Gleiche.« Wütend stieg er aus.
Berger und Carmen folgten ihm.
García Vidal verbreitete seine schlechte Laune auf der Einsatzstelle, indem er umgehend einen älteren Guardista anschnauzte, der sich gerade mit der Besatzung des Rettungswagens unterhielt. »Hättet ihr die Straße nicht auch gleich feucht wischen können? Was sollen wir hier, wenn es nichts mehr zu sehen gibt?«
»Erstens heißt es ›Guten Morgen, Kollegen‹, wenn man um diese Zeit einen Einsatzort betritt, und zweitens gab es nichts aufzuwischen. Alles, was zu sehen war und ist, liegt jenseits der Mauer. Begeben Sie sich also auf die Wiese und verpesten Sie dort die Stimmung.«
Bevor García Vidal explodieren konnte, zogen ihn Berger und Carmen zur Seite.
»Was wollt ihr von mir?«
»Wir wollen verhindern«, raunte Berger, »dass Sie sich vollends zum Deppen machen.«
»Wieso mache ich mich zum Deppen?«
»Weil Sie sich wie ein …« Er zögerte.
»Weil Sie sich wie ein Arsch aufführen«, komplettierte Carmen Bergers Satz. »Auch für die Kollegen ist es jetzt sechs Uhr morgens, und statt hier einen auf Rambo zu machen, wäre es schön, wenn Sie erst einmal die Fakten auf sich wirken lassen würden.«
García Vidal sah beide kurz an. »Ich denke, ihr habt recht.« Er ging zu dem Beamten und entschuldigte sich bei ihm.
»Dafür könnte ich ihn nun wieder küssen«, murmelte Berger.
Als der Comisario zu ihnen zurückgekehrt war und alle drei die flache Steinmauer überwunden hatten, standen sie vor einem ausgebrannten Trümmerhaufen, der einmal ein Motorrad gewesen war. Etwa zwanzig Meter weiter feldeinwärts lag die abgedeckte Leiche des Fahrers.
»Herrje«, brummte Berger. »Den hat es ja völlig zerbröselt.«
Ein paar Kollegen der Guardia Civil Tráfico waren dabei, die Fundorte der einzelnen Teile von Mensch und Maschine genau auszumessen, zu fotografieren und auf einem Lageplan zu markieren. Einer der Beamten kam auf García Vidal zu, um Meldung zu machen. »Guten Morgen, Señor Comisario.«
»Guten Morgen, Kollege. Was gibt es denn so Besonderes, dass man uns gerufen hat? Sieht aus, als hätte sich ein Chaot mit seiner ›Rennsemmel‹ selbst abgeschossen.«
»Im Prinzip schon, aber da sind einige Sachen, die nicht zusammenpassen.«
»Die da wären?«
»Dem Unfallbild zufolge muss die Maschine ein gutes Stück in diese Richtung«, er zeigte in Richtung Campos, »ungebremst abgehoben haben. Sie ist zunächst gegen die Mauerkrone geknallt, um dann im hohen Bogen hier zu landen und geradezu zu explodieren.«
»Bei dem Unfallhergang«, gab der noch immer etwas gereizte Comisario zurück, »ist es kein Wunder, dass es das Motorrad in Einzelteile zerlegt hat, oder?«
»Sí, Comisario, aber dass der Fahrer die Mauer erst zehn Meter weiter gestreift hat, um dann runde zehn Meter hinter ihr zum Liegen zu kommen, passt einfach nicht dazu. Wir haben an der entsprechenden Stelle Gewebereste gefunden. Das würde aber bedeuten, dass der Fahrer ein ganzes Stück ohne Motorrad weiter geradeaus gefahren ist, um dann ebenfalls abzuheben und die Mauer zu streifen.«
García Vidals schlechte Laune war schlagartig verschwunden. Er wirkte jetzt aufmerksam und wach. »Und was meinen Sie, was der so auf dem Tacho hatte?«
»Das ist der zweite Punkt, der mich stutzig macht. Von der Flugkurve her schätze ich die Geschwindigkeit auf gute einhundertzwanzig Kilometer pro Stunde. Für eine 1100er Suzuki, wenn sie auch gute fünfzehn Jahre alt ist, ein leicht zu erreichendes Tempo. Zu der Zeit, als dieses Modell rauskam, wurden die Tachos aber noch über eine Welle angetrieben. Dadurch blieben sie bei einem so kapitalen Unfall meist stehen und zeigten weiter die Geschwindigkeit an, bei der sich der Unfall ereignet hatte. Wie man hier an den verschmorten Resten aber deutlich sehen kann, steht der Zeiger auf null.«
»Was bedeutet«, bemerkte der Comisario, »dass der Tacho entweder noch funktionsfähig ist oder der Aufprall im Stehen erfolgte.«
»Sí, exakt.«
Carmen schrieb die ganze Zeit mit. »Und auf der Straße ist wirklich nichts zu sehen? Keinerlei Bremsspuren?«
»Absolut nichts. Erst der Einschlag der Maschine hat Spuren hinterlassen und dann zehn Meter weiter der Körper an der Stelle, an der er die Mauer gestreift hat. Aber gehen Sie doch mal zum Doc. Der ist noch bei der Leiche und hat auch ein paar Ungereimtheiten für Sie.«
Sie fanden den Arzt neben der Leiche eines jungen Mannes, dessen Körper und Gesicht völlig zerschlagen waren. Ein Bein fehlte.
»Hola, Señor Médico«, begrüßte García Vidal den Rechtsmediziner. »Was haben Sie dem Toten bisher entlocken können?«
»Hola, ihr drei. Nichts Definitives, aber das, was er mir sagt, ist überaus interessant. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an: Der Mann war mit Sicherheit schon eine ganze Weile tot, als er seinen finalen Flug angetreten hat. Sein Bein liegt da hinten diesseits der Mauer. An der Fundstelle ist aber kein Blut zu finden, und so ein Bein blutet aus, wenn es einem Lebenden abgerissen wird. Auch an der Mauer fand ich zwar jede Menge Gewebereste, aber nur minimal Blut. Die Lebertemperatur ist mit der der Umluft identisch. Das heißt, dass der Mann bereits mehr als zwölf Stunden lang tot ist. Die Verwesungsspuren am Bein deuten auf eine noch längere Liegezeit post mortem. Die Maschine hat bis vor einer Stunde aber noch gebrannt. So lange brennt kein Motorradwrack.«
»Sie wollen uns also weismachen, dass hier vor einer guten Stunde ein Mensch, der bereits seit einem Tag tot ist, mit hundertzwanzig Sachen über die Mauer geflogen ist?«
»Sí, und während des Fluges hat er noch den Helm abgenommen und ihn weggeworfen. Der liegt nämlich ganz weit da hinten auf dem Campo.«
Carmen schlug mit einem resignierenden Seufzer ihre Aluminiumkladde zu. »Und ich habe dann angeblich wieder ›irgend so ein Zeug geraucht‹, wenn ich den Bericht abliefere.«
»Mach dir nichts draus«, erwiderte Berger ungerührt, »es weiß ja jeder, wer dein Dealer ist.«
***
Vanessa Riesche atmete erleichtert auf, als sie durch die Glasscheibe, die das Revier vom Rathausfoyer trennte, einen Mann auf die Tür der Polizeistation zuhalten sah. Es schien ihr aber kein Kriminalpolizist, sondern eher ein Arzt zu sein. Ärzte hatten doch immer so eine ganz typische Tasche dabei, wenn sie auf Hausbesuch waren. Eine Tasche wie diese hier.
Nachdem der Mann auf Spanisch ein paar Worte mit dem Wachhabenden gewechselt hatte, kam er auf sie zu.
»Frau Riesche?«
Sie nickte. »Sie sind kein Kriminalpolizist.«
»Nein. Mein Name ist Dr. Ohrem. Ich bin hier in Santanyí Allgemeinmediziner.«
»Ich wollte aber mit einem Polizisten sprechen.«
»Ich weiß. Er sollte auch Deutsch sprechen können. Zumindest diese Voraussetzung erfülle ich. Wenn Sie mir sagen, was Sie so in Sorge bringt, kann ich Ihnen vielleicht helfen.«
Vanessa Riesche dachte kurz nach. »Ich habe das Gefühl, dass ich von dem Polizisten nicht ernst genommen werde.«
»Zu Unrecht, Frau Riesche. Aber der Wachtmeister glaubt, verstanden zu haben, dass Sie Ihren Mann umbringen wollen und dass es sich bei Ihrem Problem um eine psychische Krise handelt.«
Sie beugte sich vor und vergrub ihr Gesicht in den Händen. »Ich drehe wirklich langsam durch, wenn das so weitergeht.«
Dr. Ohrem setzte sich neben sie auf einen freien Stuhl und stellte seine Tasche ab. »Was, wenn ich fragen darf?«
»Dass ich Nacht für Nacht träume, meinen Mann umgebracht zu haben.«
»Wie?«
»Ich ersteche ihn mit einer Hutnadel, die ich vor langer Zeit von meiner Großmutter geerbt habe.«
Der Arzt schaute sie verwundert an. »Ausgerechnet mit einer Hutnadel? So etwas trägt man heute doch gar nicht mehr.«
»Ich habe doch auch keine Ahnung, wieso. Im Traum muss ich nachts aufstehen, weil ich aufs Klo muss. Danach gehe ich auf den Hof, eine rauchen. Und da schwimmt Miguel tot im Pool.«
»Und woher wissen Sie das mit der Hutnadel?«
»Weil ich sie in der Hand halte, völlig blutverschmiert.«
»Ist das Wasser in Ihrem Traum auch voller Blut?«
»Natürlich nicht. So eine Hutnadel ist doch schließlich kein Zaunpfahl.«
Dr. Ohrem zögerte. »Hat Ihr Mann Ihnen Gewalt angetan?«
»Er ist nicht mein Mann. Er ist mein Verlobter.«
»Aha. Wenn er tot im Pool schwimmt, sind Sie aber mit ihm verheiratet?«
Sie stutzte. »Ist das denn wichtig?«
»Ich weiß es nicht.«
»Warum fragen Sie dann danach?«
»Weil es vielleicht sein kann, dass Sie Angst vor der Ehe haben und das in Ihren Träumen verarbeiten.«
Sie begann zu weinen. »Seit heute ist es leider kein Traum mehr.«
Dr. Ohrem war entsetzt. »Schwamm Ihr Mann denn heute Nacht wirklich tot im Pool?«
»Nein, er lag friedlich im Bett und schnarchte. Aber ich hatte eine blutverschmierte Hutnadel in der Hand.«
»Oh. Verstehe. Haben Sie die mitgebracht?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Na, wegen der Fingerabdrücke. Man soll nichts anfassen, was irgendwie mit einem Mord zu tun hat.«
Dr. Ohrem hatte Mühe, geduldig zu bleiben. »Aber wenn Sie die Nadel doch bereits in der Hand hielten, waren Ihre Fingerabdrücke ja schon darauf, dann hätten Sie sie auch gleich mitbringen können.«
»Da haben Sie eigentlich recht.«
»Außerdem sagten Sie«, der Doktor zeigte auf ihre Hände, »die Nadel sei blutig gewesen. Ich sehe aber nichts.«
Vanessa Riesche zog abrupt die Hände zurück und versteckte sie hinter ihrem Rücken. »Ich bin doch nicht verrückt, mit blutverschmierten Händen zur Polizei zu gehen. Nachher denken die doch, ich sei eine Mörderin«, entrüstete sie sich. Dann dämmerte ihr langsam, was für einen Unsinn sie redete, und sie sah ihn mit verzweifeltem Blick an. »Sagen Sie, Herr Doktor: Bin ich verrückt geworden? Meine Großmutter war manisch depressiv. Habe ich mich eventuell bei ihr angesteckt?«
Dr. Ohrem bemühte sich, wenigstens so zu wirken, als würde er diese Frau ernst nehmen. »An so einer Krankheit kann man sich nicht anstecken.«
»Ist sie vererbbar?«
»Ich fürchte, ja, Frau Riesche.«
»Mein Gott, dann bin ich ja eine Gefahr für meine Umwelt.«
»Nun mal langsam, junge Frau. Eine Anlage dazu kann vererbt werden, muss aber nicht. Und eine Gefahr für andere wird man dadurch auch nicht automatisch.«
Sie schwiegen eine Weile.
»Was soll ich denn nun machen? Nach Hause gehen, so tun, als ob nichts gewesen wäre, und warten, bis ich meinen Verlobten getötet habe?«
Der Doktor schüttelte den Kopf. »Nach Hause gehen, ja. Dort sollten Sie aber nicht warten, sondern Ihre psychischen Probleme, wenn es denn wirklich welche sind, offensiv angehen.«
»Was heißt, wenn es denn welche sind? Sie haben doch gerade gesagt, dass ich verrückt bin?«
»Das habe ich keineswegs. Das sind Ihre Befürchtungen. Außerdem bin ich kein Facharzt für Psychiatrie. Ich kann Ihnen Tabletten geben, damit Sie sich erst einmal traumlos ausschlafen können, und Sie bei einem deutschsprachigen Kollegen in Palma anmelden, den Sie heute Nachmittag anrufen sollten, wenn Sie wieder wach sind.«
Sie griff nach seinen Händen. »Herr Doktor, sagen Sie mir bitte: Bin ich nun verrückt oder nicht?«
»Einen Teufel werde ich tun und darüber ein Urteil fällen. Dazu fehlt mir die fachliche Kompetenz. Aber glauben Sie mir, wenn Sie jetzt nichts für sich tun, werden Sie langsam, aber sicher wirklich meschugge – und das wäre weder in Ihrem Interesse noch im Sinne Ihres Zukünftigen.«
***
Nachdem sämtliche Ungereimtheiten an der vermeintlichen Unfallstelle peinlich genau dokumentiert worden waren, saßen Berger und der Comisario gemeinsam mit einem Verkehrspolizisten in einem Wagen der Guardia Civil Tráfico über einen Tisch gebeugt, auf dem ein auf Millimeterpapier gezeichneter Plan lag, und versuchten, das Puzzle der Fakten zusammenzusetzen. Carmen war schon ins Büro vorgefahren, um die wenigen Informationen, die sie hatten, ins System einzupflegen.
García Vidal zeigte mit dem Finger auf die Stelle, an der das Motorrad die Mauerkrone gestreift haben musste. »Wenn wir eine Linie vom Fundort der Maschine zu dieser Stelle ziehen und sie über die Mauer hinweg zur Straße verlängern, dann haben wir den Punkt des Ereignisses, das die Maschine von der Straße gefegt haben muss. Also hier.« Er tippte mit dem Finger auf den angegebenen Punkt.
»Aber weder dort noch woanders«, kam es von dem erfahrenen Ermittler der Verkehrspolizei, »haben wir irgendwelche Spuren gefunden. Nicht einmal das kleinste Kratzerchen auf dem Asphalt, geschweige denn eine Bremsspur oder Ähnliches.«
»Okay.« García Vidal wirkte genervt. »Dann nehmen wir einfach an, dass die Maschine aus Lust und Laune abgehoben hat. Wenn man jetzt eine Linie vom Fundort der Leiche zu der Stelle an der Mauer zieht, an der Gewebereste gefunden wurden, ist der Fahrer ohne Maschine rund zehn Meter weiter auf der Straße geradeaus geflogen, um dann nach einer scharfen Rechtskurve gegen die Mauerkrone zu stoßen und zwanzig Meter querfeldein zu landen.«
»Erschwerend kommt hinzu, dass der Kerl bereits tot war, als er den Unfall gebaut hat«, meinte Berger. »Das verstößt doch sicher auch gegen irgendein Gesetz.«
García Vidal seufzte. »Kommt vielleicht auch noch irgendetwas von Ihnen, was zur Klärung dieses Phänomens beiträgt?«
»Nein.«
»Na dann. Gut, dass wir drüber gesprochen haben.«
»Wir hätten da außerdem noch die tote Natter«, nahm der Kollege von der Guardia Civil Tráfico den Faden wieder auf.
»War sie die Beifahrerin?«, fragte Berger frech.
»Nein, sie war – oder besser ist – ein toter Zeuge. Sie wurde, das zeigen die Spuren deutlich, von einem Wagen mit Zwillingsreifen überfahren. Da muss sie bereits tot gewesen sein, denn sie ist an Ort und Stelle liegen geblieben und hätte sich mit diesen Verletzungen sonst noch ein paar Meter weiterschlängeln können, um dann erst zu verenden.«
»Das könnte bedeuten, dass ein Wagen mit Zwillingsreifen in den Unfall involviert war«, schlussfolgerte García Vidal. »Ebenso gut könnte der Wagen die Natter aber auch schon Stunden zuvor überfahren haben. Zumal es sonst keine Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs am Unfall gibt.«
Bergers Gesicht hatte ernste Züge angenommen. »Und was ist, wenn die Natter nicht von Zwillingsreifen, sondern vom gleichen Auto zweimal überfahren wurde? Nur dass der Fahrer beim zweiten Mal das Tier nicht exakt wieder so getroffen hat wie beim ersten Mal?«
Der Verkehrspolizist sah Berger zweifelnd an. »Und warum sollte man zweimal eine tote Schlange überfahren?«
»Weil man beim ersten Mal ein Motorrad über eine Mauer schmeißt und sich des vermeintlichen Fahrers erst bei der zweiten Tour entledigt.« Berger setzte einen triumphierenden Blick auf.
Der Guardista konnte seinem Gedankengang zwar folgen, war aber noch immer nicht zufrieden. »Und warum schmeißt man, wenn man auf diese Weise einen Motorradunfall vortäuscht, nicht Motorrad und Fahrer gleichzeitig vom Wagen?«
»Weil so eine Maschine allein schon rund zweihundert Kilo wiegt. Das stemmt man nicht mal eben kurz von der Pritsche.«
Der Polizist nickte. »Stimmt, macht Sinn.«
»Miguel«, kam es flehentlich vom Comisario. »Erläutern Sie mir doch bitte noch mal langsam und für einen Motorradidioten zum Mitschreiben Ihre Lösung unseres Problems.«
»Aber gern. Also: Nehmen wir mal an, dass irgendjemand, warum auch immer, eine Leiche zu viel im Keller hat. Die muss weg, weil sie auf verdächtige Weise ramponiert ist. Ein so junger Mensch wie unser Opfer stirbt ja nicht an Altersschwäche. Man kommt also auf die Idee, es wie einen Motorradunfall aussehen zu lassen. Maschine und Leiche werden auf einen kleinen Lkw geladen, der hundertzwanzig Sachen fahren kann. Ein Sprinter mit Ladepritsche kriegt das locker hin. Man fährt mit Vollgas so dicht an die Mauer, dass das Motorrad von mehreren Männern von der Ladefläche geschubst werden kann. Das titscht dann auf die Mauer, fliegt im hohen Bogen in die Pampa und fängt an zu brennen. Dann wird mit der Leiche ebenso verfahren, nur wird der Abwurfpunkt nicht hundertprozentig wieder getroffen. Der Helm wird der Leiche dabei einfach hinterhergeschmissen.«
García Vidal ging das Szenario im Geiste durch. »Und warum ist der Helm dann ganz woanders gelandet?«
»Weil man ihn viel weiter schleudern kann. Außerdem sieht man im Dunkeln nicht, wo er landet.«
Die drei Männer schwiegen.
Der Guardista war der Erste, der wieder Worte fand. »Tja, selbst die wundersamsten Mysterien können eine ganz simple Erklärung haben.«
»Wenn Ihnen das nicht passt«, konterte Berger grinsend, »dürfen Sie keine Atheisten zur Unterstützung anfordern.«
ZWEI
Dr. Michael Ohrem glaubte, seinen Augen nicht zu trauen, als er bei seinem Gang von einem Sprechzimmer zum anderen im Vorbeigehen die Silhouette von Frau Riesche erkannte. Er machte auf dem Absatz kehrt und sprach sie an.
»Frau Riesche, ich denke, Sie sind im Bett und schlafen. Hat das Tavor denn nicht gewirkt?«
»Ich denke schon«, erwiderte sie lallend, was von dem starken Beruhigungsmittel herrühren konnte, das er ihr gegeben hatte. »Geträumt habe ich nichts, aber ich wurde von den Stimmen geweckt.«
Er forderte sie auf, ihn in eins der Sprechzimmer zu begleiten. Mit unsicheren Schritten folgte sie ihm. Im Behandlungszimmer setzte sie sich in einen großen Stuhl neben seinem Schreibtisch.
»Was waren das für Stimmen, von denen Sie geweckt wurden?«
»Ich habe keine Ahnung. Es waren Stimmen.«
»Haben sie Deutsch mit Ihnen gesprochen oder Spanisch?«
Die Frau sah ihn mit großen Augen ratlos an. »Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber ich weiß es nicht. Eine Frau sagte mir, dass ich das mit der Hutnadel gut gemacht hätte, dass es wichtig für mich war, meinen Mann zu ermorden.«
»Für die Stimme waren Sie also verheiratet?«
Sie dachte kurz nach. »Scheint so, sonst hätte sie doch nicht von meinem Mann, sondern von meinem Verlobten gesprochen. Der Mann hat dann zu mir gesagt, dass ich jetzt zur Polizei müsste.«
»Ein Mann hat auch zu Ihnen gesprochen?«
»Ja. Aber den kannte ich ja schon, von den Nächten davor. Die Frau war neu für mich.«
Dr. Ohrem runzelte die Stirn. »Frau Riesche, bisher haben Sie nichts von Stimmen gesagt, nur von Träumen.«
Man sah ihr deutlich an, dass sie immer mehr an sich selbst zweifelte. »Bisher hat die Stimme ja auch nur in meinem Traum zu mir geredet. Heute war ich aber ganz bestimmt wach. Ich lag auf meinem Bett, und da hat erst die Frau etwas zu mir gesagt, danach der Mann.«
»Aha, und was hat der Mann genau gesagt?«
Sie versuchte, sich zu erinnern. »›Vanessa‹, hat er gesagt, ›du hast es vollbracht, jetzt bring die Nadel zur Polizei.‹«
»Die Hutnadel?«
»Ja, die lag neben dem Pool, obwohl ich sie nicht dorthin gelegt hatte.«
»Heute Morgen erzählten Sie mir, dass Sie mit der Nadel in der Hand aufgewacht seien.«
Sie schloss die Augen, als würde sie die Bilder des Geschehenen an sich vorbeiziehen lassen. »Das kann gut sein. Vorhin lag sie aber neben dem Pool.«
»Und war sie wieder blutverschmiert?«
»Ja. Hier ist sie.« Frau Riesche griff in eine Plastiktüte, die sie bei sich trug, holte die Nadel heraus und legte sie vor den Doktor auf den Schreibtisch. Die Hutnadel war aus einer Art Vierkantstahl fein geschmiedet, zur Spitze hin immer schmaler werdend. Ihr Griff bestand aus fein geschnitztem Elfenbein, wie es den Anschein hatte. »Sie haben ja gesagt, dass ich sie ruhig anfassen könne, ich meine, wegen der Fingerabdrücke.«
Der Doktor betrachtete das Corpus Delicti eingehend. Es gab nur wenig Zweifel: Das Rote an der Nadel schien geronnenes Blut zu sein. »Und Ihr Verlobter? Lag er auch diesmal wieder schlafend im Bett?«
Sie verneinte mit schwerer Zunge. Das Reden fiel ihr augenscheinlich immer schwerer. »Diesmal schwamm er … im Pool. Mit dem Rücken nach oben, die Beine abgesackt, nur der Oberkörper dicht unter der … Wasseroberfläche.«
Dr. Ohrem dachte nach. Der Fall interessierte ihn nun doch so sehr, dass er die Frau nicht einfach nach Hause schicken und zur Tagesordnung übergehen konnte. Bei ihr lag Realität und Wahnsinn viel zu dicht beieinander. »Wissen Sie was, ich werde Sie jetzt nach Hause begleiten und mir das alles einmal mit eigenen Augen ansehen. Was halten Sie davon?«
Frau Riesche antwortete nicht. Sie saß zusammengesunken auf dem Patientenstuhl und sackte in eine immer tiefer werdende Bewusstlosigkeit. Speichel floss aus ihrem Mundwinkel. Er versuchte, sie zu wecken, indem er ihren Namen rief, sie schüttelte, sie kniff, doch alles erfolglos.
»Mein Gott«, murmelte Dr. Ohrem besorgt. »Die wird doch wohl nicht das ganze Tavor geschluckt haben?« Er überprüfte hastig ihren Blutdruck. Neunzig zu vierzig bei einem Puls von achtunddreißig Schlägen pro Minute. Hastig griff er zum Telefon und wählte die 112.
***
Comisario García Vidal und der Residente hatten in ihren Laufbahnen schon viele Leichen gesehen. Bei dem jungen Mann, der im gleißenden Licht auf dem Edelstahltisch vor ihnen lag, schluckten sie dennoch.
»Was hat dieser arme Mensch nur alles erleiden müssen«, murmelte García Vidal. An den Pathologen gewandt, ergänzte er: »Diese vielen Hämatome im Gesicht und an den Schultern müssen ihm doch zu Lebzeiten zugefügt worden sein, oder nicht?«
»Sie haben bei meinen Seminaren gut aufgepasst, Comisario. Aber die Schläge gegen Kopf und Oberkörper sind noch längst nicht alles. Seine beiden Hoden wurden förmlich zu Brei getreten. Zumindest ist anzunehmen, dass Tritte und kein Werkzeug ursächlich dafür waren, denn auf der Haut des Scrotums sind Abdrücke von einem groben Leinenstoff zu erkennen. Das könnten Fußbandagen gewesen sein, wie sie Kickboxer tragen. Außerdem hat man dem Mann bei lebendigem Leib beide Arme ausgekugelt und den Schädel eingeschlagen. In welcher Reihenfolge das alles passiert ist, vermag ich nicht zu sagen. Die übrigen Blessuren wurden dem Körper post mortem zugefügt.«
Berger betrachtete die Statur des Toten. »Wie ein Kampfsportler sieht der doch nun wirklich nicht aus.«
»Nein«, erwiderte der Rechtsmediziner bestimmt. »Der Mann war mit Sicherheit kein Kampfsportler, sonst wären diverse Muskelpartien viel besser ausgebildet. Ich fürchte, der Arme ist als eine Art lebender Punchingball zu Tode malträtiert worden. Folgt man dem Kampfsportszenario, könnte er durchaus der Sparringspartner einer völlig entfesselten Kampfmaschine gewesen sein. Was da aber nicht hineinpasst, ist die eigentliche Todesursache, nämlich ein Tritt ins Genick, der die gesamte Schädelbasis eingedrückt hat. Das ist in keinem Kampfsport zulässig.«
»Doch«, bemerkte Berger böse. »Es gibt Veranstaltungen, bei denen es erst dann einen Gewinner gibt, wenn der Tod des Gegners festgestellt wurde.«
»Aber doch nicht hier auf Mallorca«, widersprach García Vidal entrüstet. »Außerdem: Wenn dem Tod dieses Mannes eine derartige Kampfveranstaltung vorausgegangen wäre, hätte es an dem Abend mehrere Kämpfe und somit mehrere Leichen gegeben. Warum saß dann nur ein Toter auf dem Motorrad?«
Berger zuckte mit den Achseln. »Das Argument sticht.« Er dachte nach. »Wissen wir schon, ob es eine Vermisstenmeldung gibt, die auf den armen Teufel hier passen könnte?«
»Carmen kümmert sich drum. Es werden derzeit einige junge Männer vermisst. Bei diesem hier bedarf es aber noch einiger digitaler Rekonstruktionsarbeiten, bevor wir sein Gesicht durch die Datenbanken jagen können. Mit den von Carmen auf dem Campo gemachten Bildern ist angesichts der Verletzungen nichts anzufangen.«
»Mit Bestimmtheit kann ich Ihnen nur sagen, dass er einen Meter dreiundsiebzig groß und männlich war«, ergänzte der Arzt. »Aber schon beim Alter fängt das Schätzen an. Ich würde sagen, so um die dreiundzwanzig.«
Berger machte sich Notizen. »Ich wäre Ihnen dankbar, Doc, wenn Sie den Körper noch einmal nach Abdrücken absuchen könnten, die von Gittern oder Maschendraht stammen könnten.«
»Warum das denn?«, fragte García Vidal verwundert.
»Weil solche illegalen Kämpfe in der Regel in Käfigen stattfinden, aus denen keine Flucht mehr möglich ist. Werden die Kämpfer dagegen gedrückt, hinterlässt das oftmals Abdrücke auf der Haut.«
Der Arzt bedeckte den Leichnam mit einem Tuch. »Da muss ich Sie enttäuschen. Ich habe die Haut bereits nach Abdrücken abgesucht. Abgesehen von den mutmaßlichen Bandagen ist das Ergebnis absolut negativ.«
»Schade«, murmelte der Comisario. »Das wäre doch mal ein brauchbarer Anhaltspunkt gewesen.«
***
Nachdem Frau Riesche vom Notarzt ins Krankenhaus von Manacor gebracht worden war, bat Dr. Ohrem seine Sprechstundenhilfe, die Adresse ihres Verlobten herauszufinden. Wie sich nach einem Telefonat mit der Policía Local herausstellte, kannte er den Mann von einigen Stadtverordnetensitzungen her, an denen er als Vertreter der Residenten teilnahm.
Miguel Fluxá vertrat die Konservativen. Er war ein schwerreicher Mallorquiner, der im Laufe der vergangenen Jahre das gesamte Areal, das einmal zu seiner Finca gehört hatte, und fünf seiner sechs Stadthäuser an zahlungskräftige Deutsche verkauft hatte, zu denen auch Ohrems Schwiegereltern gehört hatten. Dabei dachte und handelte er nach dem unter Einheimischen verbreiteten Motto: Ihr Deutschen könnt die Insel ruhig kaufen, aber gehören tut sie nach wie vor uns Mallorquinern. Dementsprechend feindlich stand er Ohrem und allen anderen Residenten gegenüber, die sich für gleiche Rechte als Europäer auf europäischem Boden starkmachten.
Nach kaum zehn Minuten Fahrt erreichte Dr. Ohrem Fluxás Finca über die Verlängerung der Carrer d’es Rafalet, stieg aus seinem Auto und klingelte am großen Tor. Früher, so wusste er, waren derart gesicherte Grundstücke nicht üblich auf Mallorca. Noch vor zwanzig Jahren hatte man sich jedem Herrenhaus problemlos nähern können. Doch seitdem Einbrecher wussten, dass in den Landsitzen der vermögenden Deutschen viel zu holen war, konnte keine Einfriedung mehr hoch genug sein, gab es kaum einen laufenden Meter Zaun oder Mauer, der nicht videoüberwacht war. So auch hier. Doch was nutzte der ganze technische Schnickschnack, wenn niemand zu Hause war?
Nachdem er mehrfach erfolglos geklingelt hatte, suchte Ohrem den Zaun des Anwesens nach Stellen ab, an denen er vielleicht einen Blick auf den Pool erhaschen könnte. Vanessa Riesche hatte das Szenario so exakt beschrieben, dass ihr Verlobter jetzt eigentlich mit dem Rücken nach oben darin schwimmen müsste. So beschäftigt war er damit, ein geeignetes Sichtfenster zu suchen, dass er den sich von der Straße her nähernden Mann gar nicht bemerkte – und auch nicht den Dobermann, der sich schweigend, aber mit drohend gefletschten Zähnen neben ihn setzte und ihn nicht aus den Augen ließ.
»Hola, Señor Médico. Wenn ich meinen Hund jetzt nicht auf Sie hetze, habe ich bei der nächsten Abstimmung einen gut, meinen Sie nicht?«
Dem Arzt gefror kurzzeitig das Blut in den Adern. Beschämt drehte er sich um und sah Fluxá, der seinen Dobermann zu sich rief. Über seiner Schulter hing eine aufgeklappte Schrotflinte.
»Señor Fluxá, wie schön, dass ich Sie lebend antreffe«, sagte er.
»Das finde ich auch sehr angenehm«, kam es trocken zurück.
»Sagen Sie mal, ist Ihr Hund immer so schweigsam?«
»Ja, aber nur, wenn ich dabei bin. Ohne mein Beisein hätte er Sie gestellt und beim geringsten Fluchtversuch zerfleischt. Dabei ist er dann schon geräuschvoller.« Er tätschelte seinen Hund liebevoll am Hals. »Was treibt Sie hierher, Señor Médico, ausgerechnet in die Höhle ihres Todfeindes?«
»Ich komme wegen Ihrer Frau.«
»Soso. Nicht wegen Ihrer? Haben Sie etwa damit aufgehört, überall herumzuposaunen, dass ich sie in den Selbstmord getrieben hätte?«
»Fluxá, das ist doch Schnee von gestern. Sie wissen selbst, was man in seiner Trauer und Verzweiflung manchmal für einen Mist behauptet. Nein, ich komme wegen Ihrer Frau.«
»Da kommen Sie drei Jahre zu spät. Ihre Kollegen haben Maria längst auf den Friedhof gebracht.«
Ohrem lächelte milde. »Wie ich sehe, sind auch Sie noch nicht über den Tod Ihrer Frau hinweggekommen. Nein, ich meine Ihre zukünftige Frau, Ihre Verlobte, Frau Riesche.«
Fluxá öffnete das Tor. »Dann kommen Sie doch herein, Señor. Dank der Tabletten, die Sie ihr gegeben haben, wird sie allerdings noch wie ein Murmeltier schlafen.«
Sie betraten das Haus.
»Wann haben Sie Ihre Verlobte zuletzt gesehen?«
»Heute Morgen, nachdem sie bei Ihnen war. Ich habe noch gewartet, bis sie wieder eingeschlafen war, und bin los. Ich war den ganzen Vormittag über auf der Jagd.«
»Dann haben Sie es noch nicht bemerkt. Ihre Verlobte konnte leider nicht schlafen, weil sie Stimmen gehört hat, wie sie mir sagte. Sie wurde wach, als die Stimmen sie lobten, dass sie das mit dem Mord an Ihnen gut gemacht habe. Sie stand auf und hat Sie tot im Pool schwimmen sehen. Daraufhin ist sie zu mir in die Praxis gekommen.«
»Um Gottes willen. Ich hatte so gehofft, dass das mit den Tabletten nun ein Ende hat. Wo ist sie jetzt?«
»Ich musste sie ins Krankenhaus einweisen. Ihrem Zustand nach muss sie alle Tabletten auf einmal genommen haben. Ich bin hergekommen, um Sie zu informieren.«
»Seien Sie ehrlich zu mir, Señor Médico. Habe ich mich mit einer Irren eingelassen?«
Dr. Ohrem zuckte mit den Achseln. »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin kein Facharzt für Psychiatrie.«
»Aber das ist doch alles nicht mehr normal!«
»Wer vorübergehend verwirrt ist, muss noch lange nicht nachhaltig irre sein. So seltsam es sich anhört, aber für all das, was Frau Riesche zurzeit umtreibt, könnte es eine völlig logische Erklärung geben.«
»Und welche, wenn ich fragen darf?«
»Zum Beispiel könnten sich reale Kindheitserlebnisse, die sie latent belasten, durch bestimmte, völlig nebensächlich erscheinende Auslöser so in den Vordergrund schieben, dass sie für sie, wie damals auch, real erscheinen.«
Fluxá seufzte entmutigt. Dann sah er sich in seiner Küche um. »Darf ich Ihnen einen Palo anbieten?«
Obwohl Ohrem dieses Zeug hasste, tat er erfreut. Wann ergab sich schon mal die Möglichkeit, mit seinem Intimfeind einen Schnaps zu trinken und dadurch vielleicht ein altes Kriegsbeil zu begraben?
»Gern, wenn es bei einem bleibt. Ich muss danach wieder in die Praxis.«
Fluxá goss in zwei Wassergläser jeweils zwei Zentimeter Palo, füllte die Gläser mit Soda aus einer Sprühflasche auf und schob dem Doktor eines davon hin. Die beiden prosteten sich zu und tranken schweigend.
»Sie müssen nämlich wissen«, kam Fluxá aufs Thema zurück, »dass meine Kinder mir damit in den Ohren liegen, ich solle Vanessa wieder nach Deutschland schicken und mir eine einheimische Frau nehmen.«
»Aber wenn Sie sie nun mal lieben, müssen Ihre Kinder das akzeptieren, selbst wenn sie im Augenblick etwas instabil ist.«
Fluxá nahm einen großen Schluck. »Ich will auch gar keine Mallorquinerin, die sind mir zu anstrengend. Seit Maria tot ist, habe ich wieder das Sagen in meinem Haus, und so soll es auch bleiben. Eine Deutsche akzeptiert das, eine Mallorquinerin nie.«
»Ausgerechnet Sie, Señor Fluxá, vertreten die Ansicht, dass Mallorca eine Amazoneninsel ist?«
Fluxá lachte hämisch. »Nein. Die Männer haben hier eindeutig das Sagen. Aber eben nur so lange, wie es sich mit dem deckt, was ihre Frauen bereits entschieden haben.«
Das stimmte mit den Beobachtungen des Doktors überein. »Und wo holen sich die Frauen Rat?«
»Bei ihren Müttern, ihren Schwestern oder weiß der Kuckuck, wo.«
»Señor, Sie haben Kinder. Die müssten Ihnen doch bei der Wahl Ihrer neuen Partnerin beratend zur Seite stehen.«
»Was die Partnerwahl betrifft, verzichte ich lieber auf ihren Rat. Mein Sohn hat sich für das andere Ufer entschieden, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es gab in seinem ganzen Leben nur eine einzige Frau für ihn, und das war seine Mutter. Seit Maria tot ist, vergöttert er sie wie eine Heilige. Jede andere Frau an meiner Seite besudelt seiner Meinung nach das Andenken an sie. Er kann also nur ein schlechter Ratgeber sein.«
»Und Ihre Tochter?«
»Die hat sich mir gegenüber zwar nie geoutet, aber ich könnte wetten, dass die auch nicht normal ist«, erwiderte Fluxá gehässig.
»Trifft Sie das?«
»Was heißt treffen? Ich hätte gern einmal Enkel gehabt. Das kann ich mir unter diesen Voraussetzungen ja wohl abschminken.«
Dr. Ohrem sah auf seine Uhr. »Ihre Verlobte müsste bei geeigneter Medikamentierung mittlerweile wieder ansprechbar sein. Sicher möchten Sie zu ihr fahren. Sie wurde ins Krankenhaus nach Manacor gebracht.«
Fluxá stellte sein Glas ab. »Gut. Denken Sie, dass ich sie heute schon wieder mit nach Hause nehmen kann?«
»Das hat der behandelnde Arzt zu entscheiden. Wenn sie sich das Leben nehmen wollte und sich dementsprechend äußert, dann sicher nicht. Wenn sich die Überdosis als ein Unfall herausstellt, dürfte aus medizinischer Sicht nichts dagegensprechen.«
***
Auf der Rückfahrt von Palma nach Santanyí waren weder Berger noch der Comisario sehr gesprächig gewesen, denn beide hatten nun eine Ahnung von dem, was in den nächsten Tagen auf sie zukommen würde. Inzwischen saßen sie in ihrer Stammbar, der Bar Sa Plaça an der Plaça Mayor, und schwiegen über ihren Getränken.
»Was ist, Miguel? Immer wenn Sie minutenlang in Ihrem Cortado herumrühren, ohne etwas davon zu trinken, brodelt es in Ihnen.«
»Und immer wenn Sie anderen vorwerfen, es würde in ihnen brodeln, wollen Sie nur von Ihren eigenen dunklen Gedanken ablenken.«
»Stimmt. Mir geht der junge Mann aus der Pathologie auch nicht aus dem Kopf. Sollten wir hier auch so einen völlig verpeilten Millionärssohn als Killer haben wie den, der vor ein paar Jahren durch die amerikanische Presse ging?«
Berger wurde hellhörig. »Was war denn mit dem?«
»Er war ein begeisterter, aber sauschlechter Kampfsportler, dessen reiche Mama dafür sorgte, dass er ab und zu mal ein Erfolgserlebnis hatte, indem er einen ihm unterlegenen Gegner tötete, den sie ihm mit ihrem vielen Geld kaufen konnte.«
»Aber wer gibt sich denn für so was freiwillig her?«