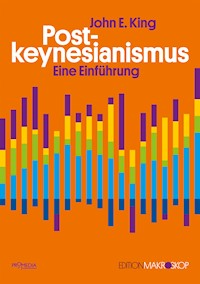
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Pandemiemaßnahmen und der Krieg in der Ukraine befeuern eine schwelende Wirtschaftskrise. Die euphemistisch "Klimakrise" genannte Umweltzerstörung bleibt als klaffende Wunde in unserer auf Kapitalverwertung basierenden Gesellschaft bestehen. Klimaziele zu beschwören und ansonsten auf marktkonforme Problemlösungen zu setzen, wird der Tatsache nicht gerecht, dass ein radikaler Umbau unseres gesamten ökonomischen Systems ansteht. Der erste Band der "Edition Makroskop", die vom Promedia Verlag gemeinsam mit dem gleichnamigen Wirtschaftsmagazin herausgegeben wird, widmet sich daher einer Wirtschaftstheorie, die eine Alternative zur unregulierten Marktwirtschaft aufzeigt. John E. King erläutert die besonderen Merkmale der postkeynesianischen Wirtschaftslehre, einer Schule, die in der Nachfolge des britischen Ökonomen John Maynard Keynes für eine sozial gerechtere Wirtschaftsordnung eintritt. Er beginnt mit einem Überblick über die Kernelemente der Theorie und erklärt, wie sie sich von anderen Schulen unterscheidet. Im Weiteren befasst er sich mit wichtigen methodischen Fragen, die die Postkeynesianer von den Mainstream-Ökonomen trennen, mit ihrer Behandlung von Unternehmen, ArbeiterInnen und Haushalten und ihrer Analyse von Wirtschaftswachstum und Entwicklung. Den postkeynesianischen Ansatz erläutert King insbesondere in Bezug auf Geld- und Steuerpolitik, Einkommen und Umwelt, wobei er den Kontroversen über Sparmaßnahmen und Austeritätspolitik und der Reform des Finanzsektors und des internationalen Währungssystems große Aufmerksamkeit widmet. Diese Einführung ist für ein breites Publikum geschrieben, das nach Alternativen zu sogenannten "Strukturreformen" und zur makroökonomischen Idealisierung des Konzepts der "schwäbischen Hausfrau" sucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
John E. KingPostkeynesianismus
Übersetzt von Ulrike Simon und Paul Steinhardt
Diese Publikation wurde durch die Georg-Friedrich-Knapp-Gesellschaft für Politische Ökonomie e. V. ermöglicht.
© für die Originalausgabe: J. E. King 2015 First published by Edgar Elgar Publishing
© 2022 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
ISBN: 978-3-85371-902-2(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-506-2)
Covergestaltung: Stefan Fuhrer
Der Promedia Verlag im Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Über den Autor
John E. King, geboren 1947, studierte Philosophie, Politik und Volkswirtschaft in Oxford. Er lehrte an der Universität Lancaster und der School of Economics der La Trobe-Universität in Melbourne. Seit 2013 ist er emeritierter Professor. Er forscht und publiziert zur Geschichte ökonomischer Denkschulen und zu ökonomischem Pluralismus.
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Postkeynesianer haben sich schon immer für die wirtschaftlichen und sozialen Institutionen Deutschlands und die damit zusammenhängenden politischen Fragen interessiert. Sie haben ihre Bedeutung für ein Verständnis ökonomischer Zusammenhänge viel ernster genommen und aus einer politökonomischen Perspektive heraus viel positiver bewertet als die große Mehrheit der Mainstream-Ökonomen.
In der englischen Ausgabe dieses Ende 2014 geschriebenen Buches beziehe ich mich mehrfach auf Deutschland. Hervorgehoben habe ich die gesamtwirtschaftlichen Vorzüge des deutschen Modells eines »Stakeholder-Kapitalismus«. Seine Verdrängung durch eine neoliberal inspirierte Wirtschaftspolitik hat zu einer Stagnation der Reallöhne und einer zunehmenden sozialen Ungleichheit geführt. Der »neue Merkantilismus« Deutschlands wird, wie auch das chinesische Wirtschaftsmodell, im Rahmen des Postkeynesianismus als ein »exportgetriebenes Wachstumsmodell« beschrieben und äußerst kritisch bewertet. Es beruht nämlich auf einer Politik der Lohnzurückhaltung und einer damit verbundenen verbesserten internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die notwendig zu einem »Export« von Arbeitslosigkeit führt.
Seit der Veröffentlichung der englischen Ausgabe dieses Buches sind einige interessante Bücher zu der postkeynesianischen Ökonomik erschienen (z.B. Blecker und Setterfield (2019) und Lavoie (2014)). Das Ihnen vorliegende Buch fasst aber weiterhin den Stand der postkeynesianischen Forschung zusammen. Viel Beachtung hat die Modern Monetary Theory gefunden, die aber weniger eine Theorie in einem engeren Sinne ist, sondern sich vor allem auf Fragen der makroökonomischen Steuerung fokussiert. Ihr Vorschlag, höhere Staatsausgaben durch staatliche Geldschöpfung statt durch Steuererhöhungen zu finanzieren, wird aber auch unter postkeynesianischen Ökonomen aus verschiedenen Gründen kontrovers diskutiert (Fullbrook und Morgan 2020 sowie Palley 2020).
Im Mittelpunkt der postkeynesianischen Debatte stehen gegenwärtig die folgenden drei Themenkomplexe:
Erstens: Die Voraussetzungen und Folgen lohngetriebener Wachstumsmodelle.
In diesem Zusammenhang spielen die Arbeiten Michał Kaleckis eine zentrale Rolle. Seine Modelle belegen auf Basis realistischer Annahmen, dass eine stetige Erhöhung von Reallöhnen eine höhere effektive Nachfrage bewirkt. Steigende Löhne erweisen sich daher nicht etwa als wachstumshemmend, wie von der Neoklassik behauptet, sondern im Gegenteil als wachstumsfördernd. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass mit steigenden Löhnen ein Anreiz für die Einführung produktivitätsfördernder Technologien geschaffen wird. Diese Ergebnisse legen eine Wirtschaftspolitik nahe, die auf eine Stärkung der Verhandlungsmacht von Gewerkschaften und eine Entflexibilisierung von Arbeitsmärkten abzielt. Wie oben schon erwähnt, ist das eine Frage, die gerade für Deutschland besonders relevant ist (King 2019).
Daraus lässt sich auch eine forschungsstrategische Lehre ziehen: Die postkeynesianische Volkswirtschaftslehre lässt sich zwar nicht auf die Mikroökonomik und schon gar nicht auf die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit oder gar Personalmanagement reduzieren, aber einige mikroökonomische Sachverhalte sind für makroökonomische Fragestellungen unmittelbar relevant.
Zweitens: Im Zusammenhang mit der in der EU verfolgten Austeritätspolitik haben sich die Diskussionen über die jeweilige Rolle und Bedeutung der Fiskal- und Geldpolitik intensiviert.
Im Rahmen des Postkeynesianismus wurde mit Bezug auf das dominante »endogene Kreditgeld« die Wirksamkeit der Geldpolitik, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld, schon immer bezweifelt. Stattdessen wurde die außerordentliche Bedeutung der Fiskalpolitik für die Steuerung der Konjunktur hervorgehoben. Es häufen sich die Anzeichen, dass auch unter Politikern aller Couleur, unter vielen Mainstream-Ökonomen und sogar bei vielen desillusionierten Zentralbankern die Fiskalpolitik eine Renaissance feiert.
Drittens: Die Umweltpolitik, der langfristig die wohl größte Bedeutung zukommt.
Wie dem Klimawandel zu begegnen ist, hat inzwischen in der postkeynesianischen Literatur eine wesentlich größere Bedeutung als noch im Jahr 2014. Mittlerweile liegen ausführliche Analysen der gesamtwirtschaftlichen Effekte eines Wachstumsrückgangs (Victor 2019) und mehr und mehr Konzepte für einen »Green New Deal« vor. Dabei wird immer wieder deutlich, dass eine erfolgversprechende ökologische Wende ohne eine Politik der Vollbeschäftigung und die Reduktion der Einkommens- und Vermögensungleichheit nicht gelingen kann (Dafermos und Nikolaides 2019). An dieser Stelle kommt der Staat ins Spiel. Während der Emissionshandel ein notwendiges Element der Energiewende sein mag, kann er keineswegs das einzige Instrument der Umweltpolitik bleiben. Regulatorische Maßnahmen und umfangreiche öffentliche Investitionen sind unabdingbar.
Womit wir bei einer »großen« Frage angelangt wären: Geht die neoliberale Phase des Kapitalismus ihrem Ende entgegen? Mike Howard und ich haben vor einigen Jahren darüber spekuliert (Howard und King 2008, Kap. 8); und während ich dieses Vorwort schrieb, veröffentlichte der englische Journalist Larry Elliott einen provokanten Zeitungsartikel, in dem er argumentierte, dass mit der Covid-Krise eine neue Phase des Kapitalismus eingeläutet wurde: ein Ende der Austeritätspolitik, ein zunehmendes Vertrauen in die Macht der Fiskalpolitik und vor allem eine zunehmende wirtschaftliche Rolle des Staates. Man darf gespannt sein.
Seit der Erstveröffentlichung dieses Buches haben sich die institutionellen Gegebenheiten verändert, die Postkeynesianern zum Gedankenaustausch zur Verfügung stehen. Leider scheint die so vielversprechendgestartete International Student Initiative for Pluralism in Economics nicht mehr zu existieren; auf ihrer Website beziehen sich die »neuesten« Informationen auf eine Konferenz im Jahr 2016. Positiv zu vermerken ist, dass die Review of Keynesian Economics, von der bis 2014 nur zwei Ausgaben erschienen waren, inzwischen immer stärker geworden ist und nun dem Journal of Post Keynesian Economics als erster Adresse für theoretische, empirische und politikorientierte Artikel in der postkeynesianischen Tradition Konkurrenz macht. Eine unschätzbare Quelle für Informationen über die postkeynesianische und andere heterodoxe Denkschulen bleibt weiterhin der seit 2013 von dem österreichischen Ökonomen Jakob Kapeller herausgegebene Heterodox Economics Newsletter – mit Hinweisen auf Zeitschriften, Bücher, Kurse für Studierende und Graduierte sowie Stellenangebote. Kapeller arbeitet jetzt an der Universität Duisburg/Essen, so dass der Newsletter nun auch (elektronisch) in Deutschland erscheint.
Melbourne, im Juli 2022, John E. King
1. Einleitung
Unter Postkeynesianismus versteht man eine auf John Maynard Keynes’ Hauptwerk »Die Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes« aufbauende makroökonomische Denkrichtung, die dessen Inhalte in spezifischer Weise interpretiert. Bei einigen Postkeynesianern sind auch die zeitgleich erschienenen Arbeiten des polnischen Ökonomen Michał Kalecki ein wichtiger Bezugspunkt.
Postkeynesianer haben außerdem umfangreiche Arbeiten zu mikroökonomischen Themen von wirtschaftspolitischer Relevanz vorgelegt. Ziel des vorliegenden Buches ist es, darzustellen, was den Postkeynesianismus inhaltlich ausmacht und worin er sich von anderen makroökonomischen Schulen unterscheidet.
Anhand der sechs von A.P. Thirlwall vor 20 Jahren dazu formulierten Thesen gebe ich im zweiten Kapitel einen Überblick über die grundlegenden Inhalte der postkeynesianischen Theorie und erkläre, wo die Trennungslinien zu anderen Denkschulen verlaufen. Auch wenn diesen Thesen vermutlich alle Postkeynesianer zustimmen würden, kann man daraus nicht schließen, dass es eine postkeynesianische Ökonomik gebe.
Es sind zumindest drei Strömungen innerhalb dieses Rahmens zu unterscheiden: der fundamentalistische keynesianische Ansatz von Paul Davidson, die von Malcolm Sawyer und Eckhard Hein vertretene kaleckianische Variante und die an Hyman Minsky anschließenden Denker, wie etwa L. Randell Wray. Nach der Erläuterung ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede werde ich begründen, warum ich eine Kalecki-Minsky-Synthese für erfolgversprechend erachte.
Der Postkeynesianismus ist aus der Kritik an anderen makroökonomischen Schulen hervorgegangen und unterscheidet sich von diesen auch heute noch fundamental. In Kapitel 3 arbeite ich die Kernpunkte dieser Kritik an der »altkeynesianischen« und »neukeynesianischen« Theorie, am Monetarismus, an der Neoklassik sowie an der Neuen Neoklassischen Synthese (der Synthese aus Monetarismus und Neoklassik) heraus.
Es folgt ein Überblick über die Geschichte der postkeynesianischen Schule, die in den 1950er- und 1960er-Jahren in den beiden Cambridges in Großbritannien und den Vereinigten Staaten begann und sich von da aus in den 1970er- und 1980er-Jahren international verbreitete. Abschließend beschreibe ich die lockeren institutionellen und organisatorischen Zusammenhänge, in denen die Postkeynesianer heutzutage arbeiten und sich untereinander austauschen.
Auch aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive unterscheidet sich der Postkeynesianismus wesentlich vom Mainstream, wie ich im Kapitel 4 darlege. Das beginnt mit der grundlegenden ontologischen Frage nach der Natur des »Wirtschaftsuniversums«, setzt sich fort mit dem Denken in »offenen Systemen« und endet mit den sich daraus ergebenden Implikationen für den Einsatz mathematischer Modellierung und ökonometrischer Forschung.
Ich erkläre in diesem Kapitel auch, warum Postkeynesianer Pluralismus in den Wirtschaftswissenschaften für unabdingbar halten und warum sie die Forderung ablehnen, dass Makroökonomik auf strenge »Mikrofundamente« aufbauen muss.
Beginnend mit der Analyse der Preisbildung und der Investitionsentscheidungen von Unternehmen wende ich mich in Kapitel 5 der postkeynesianischen Mikroökonomik zu. Von der anschließenden Darstellung des postkeynesianischen Arbeitsmarktkonzepts gehe ich zur Analyse des Verhaltens privater Haushalte über und erläutere dann einen Theorieansatz, der die Faktoren Verbrauchernachfrage, Gender und Arbeitskräfteangebot verbindet und sich stark vom Mainstream unterscheidet. Das Kapitel schließt mit einem kurzen Abriss der postkeynesianischen Wohlfahrtsökonomik und der Erörterung der Frage, inwiefern der kapitalistische Marktmechanismus einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten vermag.
Gegenstand des sechsten Kapitels sind die globalen Zukunftsthemen von Wachstum, Entwicklung und Weltwirtschaft. Bei dem Versuch, die »Allgemeine Theorie« für den Langzeitbereich zur Anwendung zu bringen, verwendeten die Cambridge-Postkeynesianer zunächst das Harrod-Wachstumsmodell; später ergänzten und bereicherten sie ihre einfachen nachfragebasierten Wachstumsmodelle, vor allem durch die Faktoren »endogener technischer Wandel« und »Zahlungsbilanzschranken«.
Das Kapitel schließt mit den postkeynesianischen Vorstellungen zur Weltwirtschaft; dabei gehe ich besonders auf die Themen Außenhandel, Zahlungsbilanzregulierung und globale Kapitalströme ein.
In Kapitel 7 geht es um die praktische Relevanz der postkeynesianischen Ökonomik, dabei stehen die wirtschaftspolitischen Vorschläge der Postkeynesianer im Mittelpunkt. Ich konzentriere mich besonders auf die Themen Geld- und Haushaltspolitik, Preis- und Einkommensregulierungen und Reform des internationalen Währungssystems.
Mit dieser Darstellung geht eine substanzielle Kritik an der Geld- und Steuerpolitik des Mainstreams einher, die die Notwendigkeit fiskalischer Sparmaßnahmen behauptet. Ich werde stattdessen darlegen, dass zur Vermeidung von Inflation und Deflation die Lohnpolitik in den Mittelpunkt rücken muss.
Zum Schluss skizziere ich postkeynesianische Vorschläge zur Reform des internationalen Währungssystems und zu einigen bisher vernachlässigten makroökonomischen Aspekten der Umweltpolitik.
In Kapitel 8 verwende ich die globale Finanzkrise von 2007−2008 als Fallstudie, um viele der im Buch aufgeworfenen wichtigen theoretischen und politischen Fragen zu veranschaulichen. Ich beginne mit der Finanzialisierung der Weltwirtschaft nach 1970 und ihren Folgen und fahre fort mit der Analyse der vom neoliberalen Denken inspirierten Deregulierungsprozesse. Die Darstellung der Ereignisse von 2007/8 mündet in die Frage, ob diese Krise tatsächlich ein »Minsky-Moment« war.
Das Kapitel schließt mit der Erörterung der Frage, was wir aus der Krise lernen können. Dabei stütze ich mich auf die umfangreiche postkeynesianische Literatur zu den politischen Veränderungen auf nationaler und internationaler Ebene, die nötig sind, um ähnliche Krisen in Zukunft weniger wahrscheinlich zu machen.
Das Verhältnis des Postkeynesianismus zu neun anderen heterodoxen Schulen ist Thema des neunten Kapitels. Ich diskutiere die Marx’sche Politische Ökonomik, die Sraffianische Ökonomik, den Institutionalismus, die Evolutionäre Ökonomik, die Feministische Ökonomik, die Ökologische Ökonomik, die Verhaltensökonomik, die Komplexitätstheorie und die von Hayek und von Mises geprägte liberale Richtung der österreichischen Schule.
Im zehnten Kapitel schließe ich mein Buch mit Gedanken zur Zukunft des Postkeynesianismus ab, der sich in einem in organisatorischer und intellektueller Hinsicht zunehmend feindseligen Klima behaupten muss.
2. Grundzüge der postkeynesianischen Wirtschaftslehre
Sechs Kernaussagen
A.P. Thirlwall (1993) fasste die postkeynesianische Wirtschaftslehre in sechs Kernaussagen zusammen.
Erstens: Das Niveau von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit wird auf dem Gütermarkt und nicht auf dem Arbeitsmarkt bestimmt. Bei diesem für die Wirtschaftstheorie zentralen Thema kann man nicht nur auf Arbeitsmärkte fokussieren, sondern muss immer den gesamtwirtschaftlichen Kontext berücksichtigen.
Als Keynes Mitte der 1930er-Jahre die »Allgemeine Theorie« schrieb, war die Bedeutung dieser Themen nicht zu übersehen, und das ist in vielen Teilen der Eurozone heutzutage nicht viel anders. In dem 2008 bei Princeton University Press neu aufgelegten Lehrbuch der Ökonomik für HochschulabsolventInnen spielen die Themen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit aber keine nennenswerte Rolle. Da »die Einbeziehung des Faktors Arbeit nur geringfügige Änderungen der bisherigen Ergebnisse zur Folge hatte«, schreibt Michael Wickens, »werden wir ihn überall dort, wo es angemessen und machbar ist, davon absehen« (Wickens 2008, S. 83). Wie sich bei der Lektüre herausstellt, ist das fast immer der Fall, und im Index findet man noch nicht einmal den Eintrag »Arbeitslosigkeit« (diese erstaunliche Auslassung wurde in der zweiten Auflage korrigiert).
Dass es sich bei der Arbeitslosigkeit um ein makroökonomisches Problem handelt, wurde in der altkeynesianischen Literatur der 1950er- und 1960er-Jahre durchgängig als selbstverständlich vorausgesetzt. Dort unterschied man noch zwischen Nachfrage-induzierter Arbeitslosigkeit und der nicht mit der Nachfrage zusammenhängenden friktionellen und strukturellen Arbeitslosigkeit (siehe z.B. Perlman 1969, Teil 3). In den heute verbreiteten Lehrbüchern findet man dazu jedoch fast nichts. Postkeynesianer hingegen betonen den Unterschied zwischen mikroökonomischen und makroökonomischen Ursachen von Arbeitslosigkeit und halten letztere für entscheidend.
Thirlwalls Verweis auf den »Gütermarkt« in diesem Zusammenhang ist selbstverständlich nicht wörtlich zu nehmen, einen solchen Ort (oder eine solche Institution) gibt es nicht, sondern nur eine Vielzahl von Märkten für einzelne Waren und Dienstleistungen. Die Bezeichnung Gütermarkt ist eine Metapher – eine von sehr vielen, die in den Wirtschaftswissenschaften verwendet werden – für die Gesamtsumme der Ausgaben für Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft, von der die Erwerbs- und die Arbeitslosenquote abhängt. Basis der postkeynesianischen Theorie von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit ist ein Einkommen-Ausgaben-Modell, welches manchmal abschätzig als »hydraulischer Keynesianismus« bezeichnet wird (Schneider 2010, S. 337−41). Natürlich kann ein »Einkommen-Ausgaben-Kreislaufmodell« nur ein erster Schritt auf dem Weg der Entwicklung eines komplizierteren und damit zufriedenstellenden makroökonomischen Modells sein (Davidson 2011, S. 49−53). Ein solches Modell ist aber erforderlich, um theoretische Konzepte wie das des keynesianischen Multiplikators zu verstehen. Ohne dieses Modell sind auch die Folgen von Veränderungen von Investitionen, Staatsausgaben und Nettoexporten auf das Nationaleinkommen und damit zusammenhängend das Niveau der Beschäftigung nicht bestimmbar.
Zweitens: Unfreiwillige Arbeitslosigkeit ist eine Realität, die auf eine unzureichende effektive Nachfrage und nicht auf Unzulänglichkeiten des Arbeitsmarktes zurückzuführen ist. Es gäbe also Arbeitslosigkeit auch dann noch, wenn die behaupteten Unzulänglichkeiten beseitigt werden könnten und beseitigt würden. Dies folgt direkt aus Thirlwalls erster These, die, wie wir gesehen haben, von der Unterscheidung zwischen Arbeitslosigkeit aufgrund von Nachfragemangel und Arbeitslosigkeit aus anderen Gründen ausgeht. Das ist eine sehr wichtige Implikation. Postkeynesianer leugnen keineswegs die Existenz von friktioneller und struktureller Arbeitslosigkeit (wie wir in Kapitel 5 sehen werden). Es ist also keineswegs uninteressant, sich mit »Arbeitsmärkten« und deren »Unvollkommenheiten« zu beschäftigen. Dabei stellt sich heraus, dass neoklassische Arbeitsmarktmodelle Annahmen machen, die in der Realität nicht herstellbar sind.
»Arbeitsmärkte« sind für Postkeynesianer also durchaus ein Thema. Dennoch werden sie darauf insistieren, dass die primäre Ursache von Arbeitslosigkeit eine unzureichende effektive Nachfrage ist. In Zeiten von Vollbeschäftigung ist die auf mangelnder Nachfrage beruhende Arbeitslosigkeit (per Definition) gleich Null. Seit den frühen 1970er-Jahren, mit dem Ende des sogenannten »goldenen Zeitalters« des Kapitalismus, ist Vollbeschäftigung aber eher die Ausnahme als die Regel. Diese Tatsache wird heutzutage meist bestritten oder doch zumindest ignoriert und vor allem nicht mehr als gesamtwirtschaftliches Problem anerkannt.
Vor einiger Zeit besuchte ich den Vortrag eines angesehenen Ökonometrikers, der kürzlich in den Vorstand der Reserve Bank of Australia berufen wurde. Als ein Kollege ihn nach dem Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Arbeitslosigkeit fragte, schien er verwirrt. »Nicht unsere Abteilung«, antwortete er. »Das ist das Problem der Arbeitsmarktpolitiker.« So zeigte er nicht nur, dass er das australische Zentralbank-Gesetz von 1959 nicht kannte (welches diese dazu verpflichtet, nicht nur auf die Inflation, sondern auch auf Beschäftigung und Wachstum zu achten), sondern er lehnte damit auch implizit Thirlwalls zweite These ab.
Drittens: Eine empirisch adäquate makroökonomische Theorie stellt den Zusammenhang von Gesamtinvestitionen und -ersparnissen in ihren Mittelpunkt. Die Kausalkette verläuft dabei von den Investitionen zum Sparen und nicht umgekehrt. Wie James Meade es einmal formulierte, änderte sich mit der »Keynesianischen Revolution« unsere Vorstellung: Nun wedelt nicht mehr ein Hund namens »Sparen« mit dem Schwanz »Investition«, sondern die Verhältnisse werden umgekehrt, und der Hund »Investition« wedelt mit dem Schwanz »Sparen« (Meade 1975, S. 82). Wir haben es mit einer kapitalistischen Wirtschaft zu tun, in der die wirklich wichtigen Entscheidungen von Unternehmen getroffen werden, nicht von Haushalten oder einzelnen Verbrauchern. Es sind die Investitionsausgaben von Unternehmen, die das BIP bestimmen – wenn wir aus Gründen der Vereinfachung zunächst die Rolle von Staatsausgaben und Nettoexporten unberücksichtigt lassen.
Die Investitionsausgaben sind somit die unabhängige Variable, die die Gesamtbeschäftigung, die Produktion und das Einkommen einer Volkswirtschaft bestimmt. Die Konsumausgaben (und damit auch die Ersparnisse als Differenz zwischen Einkommen und Ausgaben der Haushalte) sind die davon abhängige Variable. Sie steigen oder fallen mit den gesamtwirtschaftlichen Einkommen.
Das soll nicht heißen, dass das aktuelle Haushaltseinkommen die einzige Determinante für die Konsumausgaben ist, oder dass die Verbraucher lediglich passiv auf Veränderungen der makroökonomischen Parameter reagieren. Aber es sind die Investitionen, die eine kapitalistische Wirtschaft antreiben, sodass die theoretische Analyse einer solchen Wirtschaft mit den Determinanten der Investitionen beginnen muss und nicht (wie Wickens es tut) mit dem Nutzen-maximierenden Verhalten der einzelnen Verbraucher. Investitionen werden getätigt, wenn sie Gewinne erwarten lassen. Jede realistische makroökonomische Theorie muss daher mit den Rentabilitätserwartungen der Unternehmen beginnen.
Viertens: Eine Geldwirtschaft unterscheidet sich deutlich von einer Tauschwirtschaft. Das sollte sich eigentlich von selbst verstehen, wenn man bedenkt, dass Gewinne als die Differenz zwischen zwei Geldbeträgen (Einnahmen und Kosten) definiert sind. Dieses Faktum kommt aber in den gängigen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen der Mainstream-Ökonomen oft nicht vor. Die Bedeutung dieses Punktes kann gar nicht hoch genug bewertet werden.
In einem frühen Entwurf der »Allgemeinen Theorie« verwendete Keynes Karl Marx’ berühmte Formel zur Darstellung des kapitalistischen Zirkulationsprozesses G – W – W´ – G´, um zu erklären, warum Geld wichtig ist (Rotheim 1981); leider nahm er diese Darstellung nicht in die endgültige Fassung des Buches mit auf. Der Kapitalist, so Marx, beginnt mit einer Geldsumme G; er verwendet sie, um Waren (Arbeitskraft und Produktionsmittel) von gleichem Wert W zu kaufen; diese Waren setzt er in einem Produktionsprozess ein, um neue hochwertigere Waren, W´, herzustellen; in der Erwartung, dass er diese Waren für die Geldsumme G’ verkaufen kann, die diesem höheren Wert entspricht. Das Ziel des Kapitalisten ist die Realisierung eines Profits (d.h. der Geldsumme G´ minus G, die dem Wert W´ minus W entspricht). Ohne diese Gewinnerwartung, würde er den ganzen Produktionsprozess nicht in Gang setzen und stattdessen die ursprüngliche Geldsumme G behalten. Etwas altmodisch, aber anschaulich ausgedrückt: Geld kann »gehortet« werden. Keynes prägte für dieses Phänomen den Begriff »Liquiditätspräferenz«.
Damit unterscheidet sich eine kapitalistische Wirtschaft fundamental von einer Tauschwirtschaft, in der es gar kein Geld gibt, und Produkte direkt gegen andere Produkte getauscht werden (Brot gegen Schuhe, Schuhe gegen Brot). Sie funktioniert auch grundlegend anders als eine »einfache« Warenproduktion oder »Kleinproduktion«, wie Marx sich ausdrückte. Er meinte damit klassenlose Wirtschaftsformen, in denen Kleinproduzenten nicht für Profit arbeiten, sondern Geld aus dem Verkauf der von ihnen produzierten Waren erwerben, um damit andere Waren von gleichem Wert zu kaufen; die Marx’sche Formel hierzu wäre also W – G – W. Diese Formel (wie Keynes in einem etwas anderen Kontext schreibt) entspricht jedoch nicht »der Wirtschaftsordnung, in der wir tatsächlich leben« (Keynes 1936, S. 3). In einer Tauschwirtschaft gibt es (außer Schuhen und Brot) nichts zu horten, und normalerweise gäbe es auch keinen Grund dafür; in einer einfachen Warenproduktion könnte zwar Geld gehortet werden, es würde aber wenig Sinn machen. Völlig anders ist die Lage in einer kapitalistischen Wirtschaft. Dort zahlt es sich aus, Geld zu horten, um die Risiken von Ertragsausfällen abzusichern.
Aus dem Gesagten ergeben sich drei wichtige Schlussfolgerungen. Geld ist nicht »neutral«, und deswegen kann eine empirisch adäquate Makroökonomik nicht auf der Annahme aufgebaut sein, es gebe zwischen dem »realen« und dem »monetären« Sektor einen »eisernen Vorhang«. Die »Finanzierung« ist ein essenzielles Merkmal einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Denn die Finanzierung von Investitionsausgaben ist die Voraussetzung für die Realisierung zukünftiger Gewinne. Man muss sich daher dem Thema der »Schulden« zuwenden und dabei die Asymmetrie zwischen Schuldnern, die man zur Senkung ihrer Ausgaben zwingen kann, und Gläubigern, die man nicht zur Erhöhung ihrer Ausgaben zwingen kann, als von größter Bedeutung erachten. Kurzum, die Funktionsweise einer Geldwirtschaft kann man nicht verstehen, wenn man sie als Tauschwirtschaft konzipiert und dann, so wie man den Käsegang bei einem Bankett nach dem Hauptgang serviert, die Analyse einer Tauschwirtschaft zum Abschluss mit Geld verfeinert.
Fünftens: Die Quantitätstheorie des Geldes ist falsch. Nach ihr gilt, dass Geld lediglich das Preisniveau bestimmt, aber keinen Einfluss auf das BIP und auf die Beschäftigungslage eines Landes hat. Diese »klassische Dichotomie« wurde schon vor zwei Jahrhunderten von Jean-Baptiste Say und David Ricardo behauptet.
Betrachten wir dazu die sogenannte Quantitätstheorie des Geldes: M x V = P x T, wobei M für die Geldmenge, V für die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, P für das Preisniveau und T für das Handelsvolumen (als Indikator für die reale Produktionsmenge) steht.
Nehmen wir an, dass T durch »reale« (d.h. nicht-monetäre) Faktoren bestimmt wird, vor allem durch individuelle gegenwärtige und zukünftige Konsumpräferenzen. Die Quantitätstheorie besagt dann, dass bei konstantem V Veränderungen von M direkt zu Veränderungen von P führen, und zwar nur zu Veränderungen von P. Die Höhe der Geldmenge beeinflusst also nur die Preise, aber nicht die Ausbringungsmenge und auch nicht das Beschäftigungsniveau. Das ist der Kern der Aussage, nach der man den realen und den monetären Sektor als voneinander getrennt erachten kann.
Keynes lehnte die klassische Dichotomie ab, und widersprach damit sowohl der Annahme von der Neutralität des Geldes als auch der Quantitätstheorie. Nach Ansicht der Postkeynesianer hätte er noch einen Schritt weiter gehen müssen und erkennen sollen, dass es streng genommen kein außerhalb der Produktionssphäre befindliches Geldangebot gibt, sondern das Geldangebot »endogen« bestimmt wird. Anders gesagt, die Quantitätsgleichung ist kausal von rechts nach links (von PT nach MV) und nicht umgekehrt (von MV nach PT) zu interpretieren. In der Welt des Kreditgeldes, in der die Banken über Kredite Geld schöpfen, richtet sich also die »angebotene« Geldmenge nach seiner Nachfrage. Somit »bestimmt das Auf und Ab der Wirtschaft das Auf und Ab der Geldmenge (und nicht umgekehrt)« (Kaldor 1970, S. 19). Im Falle von Kreditgeld ergibt sich so eine horizontale »Angebotskurve« des Geldes und keine, wie die Neoklassik unterstellt, vertikale. Die Geldpolitik kann daher zwar den Zinssatz bestimmen, nicht aber die Geldmenge; die Geldmenge hängt von der Nachfrage ab (Kaldor, 1982, S. 24, Hervorhebungen im Original).
Die postkeynesianische Inflationstheorie betrachtet Erhöhungen von G also als Wirkung, nicht als Ursache von Inflation. Aus dieser Sicht sind es die Kosten von Unternehmen (insbesondere von Löhnen und der Preise für Primärprodukte), die, oft sogar weit unter dem Vollbeschäftigungsniveau, einen Inflationsdruck erzeugen können. Dem kann nur der Staat mit einer entsprechenden Preis- und Einkommenspolitik begegnen.
Sechstens: Weitaus mehr als präzise Berechnungen künftiger Kosten und Erträge ist es das Bauchgefühl (»animal spirit«), das kapitalistische Unternehmer zu Investitionen motiviert. Wie viele andere menschliche Handlungen beruhen Investitionsentscheidungen eher »auf spontanem Optimismus als auf mathematisch fundierten Gewinnerwartungen« so Keynes (1936, S. 161).
Die von der Neoklassik unterstellte Gewinnmaximierung beruht auf einer Voraussetzung, die in der wirklichen Welt nicht gegeben ist. Sie unterstellt, dass den Resultaten von Handlungsalternativen zumindest eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann. Entscheidungen in der Wirklichkeit sind aber meist auf Basis fundamentaler Ungewissheit zu treffen:
»In dem Sinne, wie ich den Begriff [Ungewissheit] verwende, ist die Aussicht auf einen europäischen Krieg ungewiss, sind es der Kupferpreis und der Zinssatz in zwanzig Jahren, die Obsoleszenz einer neuen Erfindung, oder die Stellung der privaten Vermögensbesitzer im sozialen System des Jahres 1970. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage, auf der man irgendeine exakte Wahrscheinlichkeit angeben könnte. Wir wissen es einfach nicht.« (Keynes 1937, S. 214)
Keynes meinte damit keineswegs, dass »außer-ökonomische Motive und irrationales Verhalten« sämtliche Investitionsentscheidungen dominieren, was zu ständig wiederkehrenden »Manien und Paniken« führe, wie einige Ökonomen, die es eigentlich besser wissen müssten, gerne behaupten (Akerlof und Shiller 2009, S. ix-x). »Wir sollten daraus nicht schließen, dass alles von Wellen irrationaler Psychologie abhängt« (Keynes 1936, S. 162). In der Regel geben sich die meisten Unternehmen mit der Anwendung eher konservativer Konventionen und Faustregeln zufrieden. Zwar treten tatsächlich gelegentlich Manien und Paniken auf, aber was diese genau auslöst, bleibt umstritten.
Völlig klar sind hingegen die wirtschaftspolitischen Implikationen, die sich aus den sechs postkeynesianischen Überzeugungen ergeben. Im Mittelpunkt einer empirischen adäquaten Makroökonomik und einer darauf basierenden Wirtschaftspolitik muss das »Prinzip der effektiven Nachfrage« stehen. Die Erkenntnis also, dass das BIP und das Beschäftigungsniveau fast immer durch die Nachfrage und nicht durch das Angebot bestimmt wird.
Das »Say’sche Gesetz« muss also verworfen werden, und es bedarf zur Sicherstellung von Vollbeschäftigung in der Regel staatlicher Interventionen. Steuerpolitik ist daher nicht, wie die Neoklassik behauptet, schädlich oder aber auf Basis der sogenannten »Ricardianischen Äquivalenz« im besten Fall unwirksam (wie Ricardo selbst erkannt hat).
Die Geldpolitik darf sich nicht auf die Inflationsbekämpfung beschränken. Um Inflation und (zunehmend auch) Deflation in Zaum zu halten, benötigt man nicht nur die Geldpolitik allein, sondern unabdingbar auch eine Preis- und Einkommenspolitik.
Geldschulden sind von besonderer Relevanz im Rahmen einer Geldwirtschaft. Ein sinkendes Preisniveau ist deshalb keine Lösung wirtschaftlicher Probleme, sondern muss als ein zentrales Problem erkannt werden. In Kapitel 7 werden diese wirtschaftspolitisch relevanten Fragen ausführlicher behandelt.
»Fundamentalistische Keynesianer«
Alle Postkeynesianer würden den Thesen Thirlwalls zustimmen. Es gibt aber innerhalb dieses Rahmens unter Postkeynesianern erhebliche Meinungsunterschiede, die es notwendig machen, zwischen zumindest drei postkeynesianischen Denkrichtungen zu unterscheiden.
»Fundamentalistische Keynesianer« sind überzeugt, dass »alles in der ›Allgemeinen Theorie‹ steht«, und es lediglich darauf ankommt, Keynes’ Meisterwerk richtig zu interpretieren. Zu ihren bekanntesten Vertretern gehören Victoria Chick (1983), Mark Hayes (2006) und vor allem Paul Davidson, dessen Grundüberzeugungen sich seit fast einem halben Jahrhundert nicht nennenswert verändert haben (vgl. Davidson 1972 und 2011).
Davidson zufolge beruht die Theorie von Keynes auf der Ablehnung von drei grundlegenden Axiomen der »klassischen« Theorie: dem Prinzip der Ergodizität (die Zukunft kann zuverlässig aus der Vergangenheit abgeleitet werden), dem Prinzip der Bruttosubstitution (Preisflexibilität sorgt dafür, dass alle Märkte geräumt werden) und der Neutralität des Geldes. Sobald man der Meinung ist, dass das Gros von Entscheidungen auf der Basis fundamentaler Unsicherheit zu treffen ist, folgt, dass wir in einer nicht-ergodischen Welt leben, also in einer Welt, in der die Zukunft gerade nicht zuverlässig aus der Vergangenheit abgeleitet werden kann. Preisflexibilität ist dann aber keine Garantie für Vollbeschäftigung. Und Geld ist folglich nicht neutral; es beeinflusst sehr wohl Wirtschaftsleistung und Beschäftigungsniveau.
Aus diesen Realitäten leite Keynes in seiner »Allgemeinen Theorie« das Prinzip der effektiven Nachfrage ab. Davidson stellt die entsprechenden Zusammenhänge in einem Diagramm mit zwei Achsen dar, auf denen auf der Ordinate das »Aggregierte Angebot« und auf der Abszisse die »Aggregierte Nachfrage« abgebildet wird.
Die Unterschiede von Keynes





























