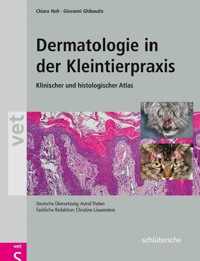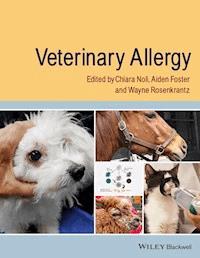149,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schlütersche
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Komplett überarbeitet und erweitert präsentiert sich die Neuauflage dieses Klassikers zur Kleintier-Dermatologie. Hauterkrankungen werden in der Kleintierpraxis besonders häufig vorgestellt. Sie zählen zu den größten Herausforderungen. Darauf geht das einzigartige Konzept dieses Buches ein. Die Autoren präsentieren neben Klinik und Diagnostik als weiteren Schwerpunkt die aktuellen Therapieoptionen bei Hauterkrankungen in sehr detaillierter Form. Ausführlich sind aktuelle Medikamente und Therapieprotokolle dargestellt. Die bewährte Einteilung des Buches in drei große Abschnitte wurde beibehalten und ermöglicht ein schnelles Zurechtfinden. Der erste Abschnitt vermittelt die Grundlagen der Dermatologie, den dermatologischen Untersuchungsgang sowie die Probengewinnung und -untersuchung. Der zweite Abschnitt, die Diskussion von Leitsymptomen, ist eine praxisorientierte Anleitung für die klinische Diagnostik. Der dritte Teil beschreibt die dermatologischen Erkrankungen nach Ätiologie, Pathogenese, klinischer Symptomatik und Therapie. 688 hervorragende Farbfotos und Zeichnungen sowie zahlreiche Algorithmen, Tabellen und Merkkästen veranschaulichen die klinische Symptomatik. Sie erleichtern die Wahl der weiterführenden diagnostischen Maßnahmen und die Therapie. Ideal für Einsteiger in die Dermatologie und für erfahrene Kleintierdermatologen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 882
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Chiara Noli | Fabia Scarampella | Stefano Toma (†)
Praktische Dermatologie bei Hund und Katze
Klinik | Diagnose | Therapie
Ins Deutsche übertragen und bearbeitet von Astrid Thelen | Maurizio Colcuc | Regina Wagner
3., überarbeitete und erweiterte Auflage
schlütersche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de/ abrufbar.
ISBN 978-3-89993-673-5 (Print)
ISBN 978-3-8426-8438-6 (PDF)
© 2014, Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover
Titel der Originalausgabe: Dermatologia del cane e del gatto. Seconda edizione.
© 2011, POLETTO EDITORE srl, via Marconi 25, 20080 Vermezzo (Milano), Italia
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden.
Eine Markenbezeichnung kann warenzeichenrechtlich geschützt sein, ohne dass diese gesondert gekennzeichnet wurde. Die beschriebenen Eigenschaften und Wirkungsweisen der genannten pharmakologischen Präparate basieren auf den Erfahrungen der Autoren, die größte Sorgfalt darauf verwendet haben, dass alle therapeutischen Angaben dem derzeitigen Wissens- und Forschungsstand entsprechen. Darüber hinaus sind die den Produkten beigefügten Informationen in jedem Fall zu beachten.
Der Verlag und die Autoren übernehmen keine Haftung für Produkteigenschaften, Lieferhindernisse, fehlerhafte Anwendung oder bei eventuell auftretenden Unfällen und Schadensfällen. Jeder Benutzer ist zur sorgfältigen Prüfung der durchzuführenden Medikation verpflichtet. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr.
Reihengestaltung: Groothuis, Lohfert, Consorten | glcons.de
Umschlaggestaltung: Kerker + Baum, Hannover
Repro: Euromediahouse, Hannover
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
Druck: Werbedruck Aug. Lönneker, Stadtoldendorf
Inhaltsverzeichnis
Autoren
Abkürzungsverzeichnis
Vorworte
Teil 1Einführung in die dermatologische Diagnostik
1Ökosystem Haut: Aufbau und Funktion
1.1Aufbau der Haut
1.1.1Epidermis und Basalmembran
1.1.2Dermis
1.1.3Hautadnexe
1.2Funktionen der Haut
1.2.1Schutz
1.2.2Thermoregulation
1.2.3Speicher
1.2.4Produktion
1.2.5Kognitive und soziale Aufgaben
1.3Mikroflora der Haut
2Geräte und Instrumente für die Dermatologie
3Dermatologischer Untersuchungsgang
3.1Signalement
3.2Anamnese
3.3Dermatologische Untersuchung
3.3.1Primäre Effloreszenzen
3.3.2Sekundäre Effloreszenzen
3.3.3Alopezie
3.4Differenzialdiagnosen
4Zusatzuntersuchungen für die Praxis
4.1Kämmen
4.2Wood-Licht
4.3Tiefes Hautgeschabsel
4.4Oberflächliches Hautgeschabsel
4.5Trichoskopie
4.6Mikroskopische Untersuchung der Schuppen und Klebestreifenabklatsch
4.7Pilzkultur
4.7.1Haarezupfen
4.7.2Geschabsel
4.7.3McKenzie-Technik
4.7.4Die Kralle als Untersuchungsmaterial
4.7.5Nährböden für die Pilzuntersuchung
4.7.6Bestimmung der Spezies
5Zytologische Untersuchung
5.1Probengewinnung
5.1.1Probengewinnung durch Feinnadelaspiration (FNA)
5.1.2Probengewinnung durch Nadelfission
5.1.3Probengewinnung durch Abklatsch
5.1.4Probengewinnung durch ein oberflächliches Hautgeschabsel
5.1.5Probengewinnung mit Wattestäbchen (Stieltupfer)
5.1.6Klebestreifenabklatsch
5.2Fixierung und Färbung
5.3Beurteilung und Lagerung der Proben
5.4Zytologischer Normalbefund der Haut
5.5Zytologie bei Erkrankungen der Haut
5.6Entzündungszellen
5.7Krankheitserreger
5.8Entzündungsmuster in der Zytologie
5.9Tumorzytologie
5.9.1Bestimmung der Zelllinie
5.9.2Malignitätskriterien
5.9.3Zytologische Charakteristiken häufig auftretender Neoplasien der Haut
6Hautbiopsien und Grundlagen der Dermatohistopathologie
6.1Hautbiopsie
6.1.1Indikationen
6.1.2Vorbereitungen des Tieres
6.1.3Vorbereitungen des Biopsiefeldes
6.1.4Anästhesie
6.1.5Entnahme mit der Hautstanze
6.1.6Exzisionsbiopsie
6.1.7Versenden der Proben
6.2Dermatohistopathologische Terminologie
7Fotografie und Bildbearbeitung
7.1Erstellung eines digitalen Bildes
7.2Archivierung von Bilddateien
7.3Digitalfotos
7.3.1Dimension und Auflösung
7.3.2Multimediale Präsentation, Ausdruck und Versand
7.4Gebrauch des Bildbearbeitungsprogramms
7.4.1Start des Programms und Öffnen von Dateien
7.4.2Bearbeitung eines Bildes
7.4.3Bildausschnitte auswählen
7.4.4Veränderung der Konturen eines gewählten Bildausschnittes
7.4.5Schärfe eines Bildes verbessern
7.4.6Farbkorrekturen
7.4.7Speichern von Bildern
7.4.8Dateiformate
7.4.9Veränderung von Größe und Auflösung einer Bilddatei
7.4.10Bildgrößenveränderung
Teil 2Dermatologische Leitsymptome
8Juckreiz beim Hund
8.1Pathogenese der Symptome
8.1.1Ursachen für Juckreiz
8.1.2Juckreizschwelle
8.2Klinisches Bild
8.3Klinisches Vorgehen
9Papel, Pustel, Kruste, Schuppenkranz und Furunkel beim Hund
9.1Pathogenese der Symptome
9.2Klinisches Bild
9.3Klinisches Vorgehen
10Fokale, multifokale und entzündliche Alopezie beim Hund
10.1Pathogenese der Symptome
10.2Klinisches Bild
10.3Klinisches Vorgehen
11Nicht-entzündliche Alopezie und diffuse Alopezie beim Hund
11.1Pathogenese der Symptome
11.2Klinisches Bild
11.3Klinisches Vorgehen
12Erosionen und Ulzera beim Hund
12.1Pathogenese der Symptome
12.2Klinisches Bild
12.3Klinisches Vorgehen
13Trockene Seborrhoe, fettige Seborrhoe und Exfoliation beim Hund
13.1Trockene Seborrhoe
13.1.1Pathogenese der Symptome
13.1.2Klinisches Bild
13.1.3Klinisches Vorgehen
13.2Fettige Seborrhoe
13.2.1Pathogenese der Symptome
13.2.2Klinisches Bild
13.2.3Klinisches Vorgehen
14Pigmentstörungen beim Hund
14.1Pigmentverlust
14.1.1Pathogenese der Symptome
14.1.2Klinisches Bild
14.1.3Klinisches Vorgehen
14.2Hyperpigmentierung
14.2.1Pathogenese der Symptome
14.2.2Klinisches Bild
14.2.3Klinisches Vorgehen
15Knötchen und Fisteln beim Hund
15.1Pathogenese der Symptome
15.2Klinisches Bild
15.3Klinisches Vorgehen
16Juckreiz bei der Katze
16.1Pathogenese der Symptome
16.2Klinisches Bild
16.3Klinisches Vorgehen
17Fokale und multifokale Alopezie bei der Katze
17.1Pathogenese der Symptome
17.2Klinisches Bild
17.3Klinisches Vorgehen
18Symmetrische Alopezie der Katze
18.1Pathogenese der Symptome
18.2Klinisches Bild
18.3Klinisches Vorgehen
19Papel, Pustel, Kruste, Schuppenkranz und Furunkel bei der Katze
19.1Pathogenese der Symptome
19.2Klinisches Bild
19.3Klinisches Vorgehen
20Erosionen und Ulzera bei der Katze
20.1Pathogenese der Symptome
20.2Klinisches Bild
20.3Klinisches Vorgehen
21Trockene Seborrhoe und Exfoliation bei der Katze
21.1Pathogenese der Symptome
21.2Klinisches Bild
21.3Klinisches Vorgehen
22Knötchen und Fisteln bei der Katze
22.1Pathogenese der Symptome
22.2Klinisches Bild
22.3Klinisches Vorgehen
23Erkrankungen des Nasenspiegels
23.1Anatomie und Physiologie
23.2Pathogenese der Symptome
23.3Klinisches Bild
23.4Klinisches Vorgehen
24Erkrankungen der Krallen
24.1Anatomie
24.2Pathogenese der Symptome
24.3Klinisches Bild
24.4Biopsie der Kralle
24.5Klinisches Vorgehen
25Pododermatitis und Erkrankungen der Ballen
25.1Anatomie
25.2Pathogenese der Symptome
25.3Klinisches Bild
25.4Klinisches Vorgehen
26Erkrankungen der Perianalregion
26.1Anatomie und Physiologie
26.2Klinisches Bild
26.3Analbeutelerkrankungen
26.3.1Obstruktion der Ausführungsgänge
26.3.2Infektionen und Abszesse
26.3.3Tumoren
26.4Tumoren der Zirkumanaldrüsen (hepatoide Drüsen)
26.5Perianalfisteln
27Otitis externa
27.1Anatomie und Physiologie
27.2Ätiologie und Pathogenese
27.3Klinisches Bild
27.3.1Otoskopische Untersuchung
27.3.2Mikroskopische Untersuchung des Zerumens
27.4Therapie
27.4.1Ohrspülungen
27.4.2Malassezia-Otitis
27.4.3Bakterielle Otitis: topische und systemische Antibiotika
27.4.4Antiinflammatorische Wirkstoffe
27.4.5Therapie der prädisponierenden und primären Faktoren
27.5Videootoskopie und Otitis media
28Dermatologische Erkrankungen mit Beteiligung der Maulhöhle
28.1Pathogenese der klinischen Läsionen
28.2Klinisches Bild
28.3Klinisches Vorgehen
29Erkrankungen des Skrotums
29.1Klinisches Bild
29.1.1Bakterielle Infektionen
29.1.2Erkrankungen durch Protozoen und Rickettsien
29.1.3Pilzerkrankungen
29.1.4Parasitäre Erkrankungen
29.1.5Kontaktallergie oder irritative Kontaktdermatitis
29.1.6Autoimmun- und immunmediierte Erkrankungen
29.1.7Endokrinologische, metabolische und alimentäre Erkrankungen
29.1.8Umwelterkrankungen
29.1.9Tumoren
29.2Klinisches Vorgehen
Teil 3Dermatologische Erkrankungen
30Bakterielle Hauterkrankungen
30.1Pyodermie
30.1.1Ätiologie und Pathogenese
30.1.2Klassifikation und klinisches Bild
30.1.3Bakteriologische Untersuchung
30.1.4Therapie
30.2Atypische Infektionen
30.2.1Bakterielles Pseudomyzetom
30.2.2Atypische Mykobakteriose
30.2.3Feline Lepra
30.2.4Aktinomykose und Aktinobazillose
30.2.5Nokardiose
31Pilzerkrankungen
31.1Oberflächliche Mykosen
31.1.1Dermatophytose
31.1.2Malassezia-Dermatitis
31.1.3Candida-Dermatitis
31.2Tiefe Mykosen
31.2.1Subkutane Mykosen: mykotisches Myzetom und Phäohyphomykose
31.2.2Tiefe Mykosen mit möglichen systemischen Komplikationen: Sporotrichose
31.3Systemische Mykosen
32Virale Erkrankungen
32.1Paramyxovirus beim Hund: Staupe
32.2Kanines Papillomavirus
32.3Andere Viruserkrankungen beim Hund
32.4Felines Poxvirus: Pocken
32.5Felines Herpesvirus: virale Rhinotracheitis
32.6Felines Papillomavirus
32.7Felines Calicivirus
32.8Infektionen mit Retroviren
32.8.1Felines Leukämievirus (FeLV)
32.8.2Felines Immnndefizienz-Vims (FIV)
32.9Felines Coronavirus: infektiöse Peritonitis
33Erkrankungen durch Protozoen
33.1Leishmaniose
33.1.1Ätiologie
33.1.2Epidemiologie
33.1.3Pathogenese
33.1.4Klinisches Bild
33.1.5Laborbefunde
33.1.6Differenzialdiagnosen
33.1.7Diagnostische Maßnahmen
33.1.8Therapie
33.1.9Verlaufskontrolle der Therapie
33.1.10Prognose
33.1.11Prävention und Kontrolle
33.2Toxoplasmose
33.2.1Ätiologie und Pathogenese
33.2.2Therapie
33.3Piroplasmose
33.4Neosporose
34Parasitäre Erkrankungen
34.1Kanine Demodikose
34.1.1Ätiologie
34.1.2Pathogenese
34.1.3Klinisches Bild
34.1.4Diagnose
34.1.5Therapie
34.2Feline Demodikose
34.2.1Ätiologie
34.2.2Klinisches Bild und Diagnose
34.2.3Therapie
34.3Sarcoptes-Räude
34.3.1Ätiologie
34.3.2Klinisches Bild
34.3.3Diagnose
34.3.4Therapie
34.4Notoedres-Räude
34.4.1Ätiologie
34.4.2Klinisches Bild und Diagnose
34.4.3Therapie
34.5Ohrräude durch Otodectes
34.5.1Ätiologie
34.5.2Klinisches Bild und Diagnose
34.5.3Therapie
34.6Cheylefiellose
34.6.1Ätiologie
34.6.2Klinisches Bild und Diagnose
34.6.3Therapie
34.7Trombikulose
34.7.1Ätiologie
34.7.2Klinisches Bild und Diagnose
34.7.3Therapie
34.8Pulikose
34.9Pedikulose
34.9.1Ätiologie
34.9.2Klinisches Bild und Diagnose
34.9.3Therapie
34.10Myiasis
34.10.1Ätiologie
34.10.2Klinisches Bild und Diagnose
34.10.3Therapie
34.11Prozessionarien
34.11.1Ätiologie
34.11.2Klinisches Bild und Diagnose
34.11.3Therapie
35Allergische Erkrankungen
35.1Flohbissallergie
35.1.1Ätiologie und Lebenszyklus des Flohs
35.1.2Epidemiologie
35.1.3Klinische Symptome
35.1.4Diagnose
35.1.5Therapie
35.2Kontaktallergie
35.2.1Epidemiologie und Pathogenese
35.2.2Klinische Symptome
35.2.3Diagnose
35.2.4Therapie
35.3Nahrungsmittelüberempfindlichkeiten
35.3.1Einleitung und Terminologie
35.3.2Epidemiologie
35.3.3Ätiopathogenese
35.3.4Klinische Symptome
35.3.5Diagnose
35.3.6Andere diagnostische Tests
35.3.7Therapie und Prognose
35.4Atopische Dermatitis
35.4.1Ätiopathogenese
35.4.2Pruritus, Schwellenwert und auslösende Faktoren bei atopischer Dermatitis
35.4.3Sekundärinfektionen bei atopischer Dermatitis
35.4.4Klinische Symptome
35.4.5Diagnose
35.4.6Allergologische Tests
35.4.7Therapie
35.5Urticaria und Angioödem
35.5.1Definition und Pathogenese
35.5.2Klinisches Bild
35.5.3Therapie
35.6Insektenstichüberempfindlichkeiten
35.6.1Überempfindlichkeit auf Stechmücken bei der Katze
35.6.2Nasale eosinophile Furunkulose des Hundes
35.7Eosinophile Erkrankungen der Katze
35.7.1Miliare Dermatitis
35.7.2Indolentes Ulkus
35.7.3Eosinophiles Granulom
35.7.4Eosinophile Plaques
35.7.5Therapie
35.8Papulöse eosinophile mastozytäre Dermatitis bei der Katze
36Immunmediierte Erkrankungen
36.1Pemphigus-Komplex
36.1.1Einleitung: Desmosomen und Desmogleine
36.1.2Pathogenese: Akantholyse (Verlust der Zellverbindung)
36.1.3Pemphigus foliaceus
36.1.4Pemphigus vulgaris
36.1.5Paraneoplastischer Pemphigus
36.1.6Pemphigus erythematosus
36.1.7Pemphigus vegetans und panepidermaler pustulöser Pemphigus
36.1.8Medikamenteninduzierter Pemphigus
36.2Autoimmunerkrankungen des dermoepidermalen Übergangs
36.2.1Bullöses Pemphigoid
36.2.2Epidermolysis bullosa acquisita
36.2.3Schleimhautpemphigoid (vernarbender Pemphigoid)
36.3Lupus erythematodes
36.3.1Einleitung und Ätiopathogenese
36.3.2Klassifikation der dieser Gruppe zugehörigen Erkrankungen
36.4Uveodermatologisches Syndrom
36.5Therapie von Autoimmunerkrankungen
36.5.1Auswahl der geeigneten Medikation
36.5.2Lokaltherapie
36.5.3Systemische Therapie
36.6Arzneimittelreaktionen
36.6.1Pathogenese immunologischer Reaktionen
36.6.2Klinisches Bild
36.6.3Diagnose
36.6.4Therapie
36.7Vaskulitis
36.7.1Ätiopathogenese
36.7.2Klinisches Bild
36.7.3Diagnose
36.7.4Therapie
36.8Dermatomyositis
36.8.1Ätiopathogenese
36.8.2Klinisches Bild
36.8.3Diagnose
36.9Sebadenitis
36.9.1Epidemiologie und Ätiologie
36.9.2Klinisches Bild
36.9.3Diagnose
36.9.4Therapie und Prognose
36.10Alopecia areata und Pseudopelade
36.10.1Alopecia areata
36.10.2Pseudopelade
36.11Murale Follikulitis
36.12Plasmazelluläre Pododermatitis
36.13Juvenile Zellulitis
36.14Sterile (Pyo-)Granulome und sterile noduläre Pannikulitis
36.15Metatarsalfisteln beim Deutschen Schäferhund
37Hormonelle und metabolische Erkrankungen
37.1Kanine Hypothyreose
37.1.1Schilddrüsenhormone
37.1.2Pathogenese
37.1.3Signalement
37.1.4Klinisches Bild
37.1.5Laboruntersuchungen
37.1.6Diagnose
37.1.7Untersuchungen zur Schilddrüsenfunktionalität
37.1.8Therapie
37.2Kaniner Hyperadrenokortizismus
37.2.1Hormone der Hypophysen-Nebennieren-Achse
37.2.2Pathogenese
37.2.3Signalement
37.2.4Klinisches Bild
37.2.5Laboruntersuchungen
37.2.6Diagnose
37.2.7Tests der Nebennierenfiinktionalität
37.2.8Therapie
37.3Hyperadrenokortizismus bei der Katze
37.3.1Klinisches Bild
37.3.2Diagnose
37.3.3Therapie
37.4Hyperöstrogenismus bei der Hündin
37.5Sertolizelltumor
37.6Hypophysärer Zwergwuchs
37.6.1Epidemiologie
37.6.2Genetische Aspekte
37.6.3Ätiologie und Pathogenese
37.6.4Klinisches Bild
37.6.5Diagnose
37.6.6Therapie und Prognose
37.7Zink-responsive Dermatose
37.7.1Pathogenese
37.7.2Klinisches Bild
37.7.3Diagnose
37.7.4Therapie
37.8Telogenes Effluvium
37.9Xanthomatose
38Umwelterkrankungen
38.1Solarinduzierte Dermatitiden
38.1.1Aktinische Dermatitis und Keratose
38.2Kontaktdermatitis
38.3Dermatitiden durch Verbrennungen oder Kälte
38.3.1Verbrennungen
38.3.2Erythema ab igne
38.4Dermatitis durch Trauma und Druck (Kallus)
38.5Dermatitis durch unsachgemäße Fellpflege oder Schur
38.5.1Post-clipping-Alopezie
38.5.2Traktionsalopezie
39Genetische Erkrankungen
39.1Epidermis
39.1.1Ichthyose
39.1.2Darier-Erkrankung
39.2Dermo-epidermaler Übergang
39.2.1Epidermolysis bullosa junctionalis
39.2.2Epidermolysis bullosa dystrophica
39.3Dermis
39.3.1Erbliche Kollagenopathien
39.3.2Familiäre Vaskulopathie des Deutschen Schäferhundes
39.3.3Muzinose beim Shar-Pei
39.4Haare
39.4.1Hypotrichosen und kongenitale Alopezien
39.4.2Anomalien der follikulären Melanozyten
39.4.3Follikeldysplasie beim Dobermann
39.4.4Weitere Follikeldysplasien
40Keratinisierungsstörungen
40.1Nasodigitale Hyperkeratose
40.2Katzenakne
40.3Primäre idiopathische Seborrhoe
40.4Komedonen-Syndrom beim Zwergschnauzer und bei Nackthunden
40.5Hyperplasie des suprakaudalen Organs
40.6Ohrrand-Seborrhoe
41Psychogene Erkrankungen
41.1Akrale Leckdermatitis
41.2Psychogene Dermatitis und Alopezie der Katze
42Tumoren der Haut und paraneoplastische Syndrome
42.1Plattenepithelkarzinom
42.2Epitheliotropes Lymphom
42.3Reaktive Histiozytose und histiozytäre Neoplasien
42.3.1Reaktive Histiozytose
42.3.2Kutanes Histiozytom
42.3.3Lokalisiertes histiozytäres Sarkom
42.3.4Disseminiertes histiozytäres Sarkom
42.3.5Progressive feline Histiozytose
42.4Felines digitopulmonales Syndrom
42.5Paraneoplastische Erkrankungen
42.5.1Feline paraneoplastische Alopezie
42.5.2Feline Thymom-assoziierte exfoliative Dermatitis
42.5.3Noduläre Dermatofibrose
42.5.4Hepatokutanes Syndrom
42.5.5Cushing-Syndrom
42.5.6Feminisierungssyndrom
42.5.7Paraneoplastischer Pemphigus
42.5.8Andere paraneoplastische Syndrome
43Idiopathische Erkrankungen
43.1Schablonenkrankheit (Pattern Baldness)
43.1.1Schablonenkrankheit der Ohrmuscheln
43.1.2Schablonenkrankheit bei Windhunden
43.1.3Klassische Schablonenkrankheit
43.2Saisonale Flankenalopezie
43.3Alopezie X
43.4Gesichtsdermatitis der Perserkatze
44Zoonotische Erkrankungen
44.1Parasitäre Erkrankungen
44.1.1Flöhe und Zecken
44.1.2Durch Flöhe und Zecken übertragene Krankheitserreger
44.1.3Larva migrans
44.1.4Otodectes cynotis
44.1.5Sarcoptes scahiei
44.1.6Cheyletiella spp.
44.2Pilzerkrankungen
44.2.1Dermatophytose
44.2.2Sporotrichose
44.3Bakterielle Erkrankungen
44.3.1Infektionen durch Staphylococcus pseudointermedius
44.4Protozoäre Erkrankungen
44.4.1Leishmaniose
44.5Viruserkrankungen
44.5.1Felines Poxvirus
Literatur
Stichwortverzeichnis
Autoren
Chiara Noli DVM, Dip ECVDVia Vocaturo 13Peveragno, Italien
Fabia Scarampella DVM, Dip ECVDStudio Dermatologico VeterinarioMailand, Italien
Stefano Toma (†) DVMDepartment of Small Animal Clinical SciencesCollege of Veterinary Medicine, University of FloridaFlorida, USA
Davide De Lorenzi DVM, PhD, Dip ECVCPClinica Veterinaria San MarcoPadua, Italien
Giovanni Ghibaudo DVMVia A. de Gabrielli 19Fano, Italien
Ivan Fileccia DVMClinica Veterinaria PrenesteRom, Italien
Abkürzungsverzeichnis
ACTH
Adrenokortikotropes Hormon
AD
Atopische Dermatitis
ALT (GPT)
Alanin-Amino-Transferase
ANA
Anti-nuclear-antigen
(Antinukleäre Antikörper)
ASIT
Allergen-spezifische Immuntherapie
BP
Bullöses Pemphigoid
BID
bis in die
– zweimal täglich
BUN
Blood Urea Nitrogen
(Blut-Harnstoff-Stickstoff)
CPV
Canine Papilloma Virus
(kanines Papillomavirus)
CRH
Corticotropin Releasing Hormone
CT
Computertomographie
cTSH
Canine Thyroid Stimulating Hormone
(kanines Thyreotropin)
DG I
Desmoglein I
DG III
Desmoglein III
DHEA
Dehydroepiandrosteron
DLA
Dog Leucocyte Antigen
(Histokompatibilitätsantigen)
DLE
Diskoider Lupus erythematodes
DMSO
Dimethylsulfoxid
DNA
Deoxyribonucleic acid
(Desoxyribonukleinsäure)
DSC
Desmocollin
DTM
Dermatophyte Test Medium
EBA
Epidermolysis bullosa acquisita
EDTA
Ethylene Diamine Tetra-Acetate
(Ethylendiamintetraessigsäure)
ELISA
Enzyme-Linked-Immunosorbent Assay
(heterologer Enzym-Immunoassay)
EM
Erythema multiforme
FeLV
Felines Leukämievirus
FIP
Feline infektiöse Peritonitis
FIV
Felines Immundefizienzvirus
FNA
Feinnadelaspiration
GABA
Gamma-Amino-n-Buttersäure
GALT
Gut-Associated-Lymphoid-Tissue
(Darmassoziiertes lymphatisches Gewebe)
GH
Growth Hormone
(Wachstumshormon)
HMG
High mobility-group non histone chromosomal Protein
hnRNP G
Heterogeneous nuclear Ribo Nucleo Protein G
IFA
Immunfluoreszenz-Assay
IGF-1
Insulin-like Growth Factor-1
IGR
Insectgrowthregulator
(Insekten-Wachstumsregulator)
IKT
Intrakutantest
IL
Interleukin
i. m.
intramuskulär
IU
International Unit
(Internationale Einheit)
i. v.
intravenös
JPEG
Joint Photographic Expert Group
KGW
Körpergewicht
kDa
Kilo Dalton
MAO
Monoaminooxidase
MDR
Multi-Drug-Resistance
MEN
Metabolische epidermale Nekrose (Hepatokutanes Syndrom; Erythema necrolyticum migrans)
MGG
May-Grünwald-Giemsa
MHC
Major histocompatibility complex
(Haupthistokompatibilitätskomplex)
MMP
Mucous membrane Pemphigoid
(Schleimhautpemphigoid)
MRSA
Methicillin-resistant
-Staphylococcus aureus
MRSP
Methicillin-resistant
-Staphylococcus pseudointermedius
MRT
Kernspintomographie
NME
Nekrolytisches migratorisches Erythem
NNN
Novy-MacNeal-Nicolle (Nährboden)
NNR
Nebennierenrinde
o. B.
ohne Besonderheit
OCD
Obsessive compulsive disorder
(Zwangsstörung)
o,p-DDD
Mitotane
PAS
Perjodsäure-Schiff
PCR
Polymerase chain reaction
(Polymerasekettenreaktion)
PE
Pemphigus erythematosus
PF
Pemphigus foliaceus
PgE
Prostaglandin E
POMC
Pro-opiomelanocortin
PPN
Paraneoplastischer Pemphigus
PU/PD
Polyurie/Polydypsie
PV
Pemphigus vulgaris
RIA
Radio-Immuno-Assay
s. c.
subkutan
SID
semel in die
– einmal täglich
SIS
Skin Immune System
SJS
Steven-Johnson-Syndrome
SLE
Systemischer Lupus erythematodes
T3
Triiodthyronin
T4
Thyroxin
TEN
Toxische epidermale Nekrolyse
Th
T-Helferzelle
TID
ter in die
– dreimal täglich
TIFF
Tagged Image File Format
TNF
Tumornekrosefaktor
TRH
Thyreotropin releasing hormone
TSH
Thyroideastimulierendes Hormon (Thyreotropin)
TT4
Gesamt-Thyroxin
UV
Ultraviolette Strahlung
WHWT
West Highland White Terrier
ZNS
Zentralnervensystem
Vorwort zur 3. deutschen Auflage
Mit Freude habe ich die Übersetzung der aktuellen Auflage des vorliegenden Fachbuches übernommen. Seit vielen Jahren gehören die italienischen Dermatologen, insbesondere Chiara Noli, zu den aktivsten, innovativsten und auch kritischsten Kollegen in diesem Fachbereich.
Bereits in der ersten Auflage konnte der Praktiker ein umfassendes und praxisnahes Nachschlagewerk für unkomplizierte, aber bisweilen auch sehr komplexe dermatologische Fälle vorfinden. Die aktualisierte Fassung wurde u. a. in denjenigen Bereichen umfangreich überarbeitet, in denen uns kontinuierlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, wie z. B. allergische und autoimmun-bedingte Erkrankungen. Weiterhin wurde die vorliegende Auflage durch zahlreiche neue Abbildungen und ergänzende Kapitel vervollständigt. Sie wird damit sowohl für dermatologisch interessierte Kollegen als auch für Allgemeinpraktiker ein hilfreiches Nachschlagewerk in der täglichen Praxis darstellen.
Bonn, September 2013Astrid Thelen
Vorwort zur 1. deutschen Auflage
Die steigende Zahl an Neuveröffentlichungen dokumentiert mehr als ausreichend, dass die Veterinärdermatologie unter den klinischen Fächern zu einer der innovativsten und produktivsten Disziplinen herangewachsen ist.
Mit dem vorliegenden Buch ist den beiden italienischen Autorinnen Chiara Noli und Fabia Scarampella ein beachtliches Opus gelungen. Eine detailreiche Übersicht der Untersuchungstechniken ermöglicht eine rasche Einarbeitung und Aneignung dermatologischer Handfertigkeiten. In den ersten beiden Abschnitten des Buches ermöglichen kurze kompakte Kapitel zu den Grundlagen der Dermatologie und zu den wichtigsten dermatologischen Leitsymptomen ein rasches Nachschlagen auch unter zeitknappen Praxisbedingungen. Ausführliche Darstellungen praxisrelevanter Fakten im dritten Teil erlauben es, auch Grundlegendes zu den einzelnen Krankheiten zu erfahren. Als Beispiel sei hier das Kapitel über die durch Protozoen hervorgerufenen Erkrankungen genannt. Die gelungene Darstellung der Leishmaniose in Zeiten einer wachsenden Bedeutung der Reisekrankheiten sucht im deutschen Sprachraum seinesgleichen.
Neben Klinik und Diagnose kommt bei Chiara Noli und Fabia Scarampella auch die Therapie nicht zu kurz. Möglichkeiten und Alternativen in der Therapie werden von den beiden Autorinnen ausführlich besprochen.
Wien, November 2003Maurizio ColcucRegina Wagner
Vorwort zur 2. italienischen Auflage
Nach dem Erscheinen der ersten Auflage des Buches „Praktische Dermatologie bei Hund und Katze“ vor fast zehn Jahren freuen wir uns, die neue, überarbeitete und erweiterte Version vorzustellen. Die vorausgegangene Auflage, die als erster Band einer Reihe von Fachbüchern von Tierärzten für Tierärzte erschienen ist, war ein großer Erfolg. Aus diesem Grund war unser Ziel bei der Überarbeitung die Vervollständigung und Integration der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten zehn Jahre.
Die neue Auflage ist umfangreicher und umfasst einige neue Kapitel mit entsprechend mehr Bildmaterial. Dazu gehören ein Kapitel zur Zytologie (in Zusammenarbeit mit dem Zytologen Davide De Lorenzi), eines über Digitalfotografie von Ivan Fileccia und drei weitere Kapitel über dermatologische Erkrankungen (mit Beteiligung der Maulhöhle, des Skrotums und über Zoonosen).
Einige Kapitel wurden relativ unverändert übernommen, andere hingegen völlig überarbeitet und durch unveröffentlichte Fotos ergänzt. Wieder andere wurden vervollständigt, z. B. das Kapitel über Hautbiopsien, das um einen Abschnitt zur Histopathologie erweitert wurde, um den Dialog zwischen Klinikern und Pathologen sowie die Interpretation der histopathologischen Befunde zu verbessern. Der aufmerksame Leser wird bemerken, dass einige Erkrankungen anders klassifiziert worden sind. Die eosinophilen Dermatitiden der Katze wurden z. B. vom Kapitel über idiopathische Erkrankungen in das über allergische Erkrankungen verschoben. Andere, seltene Pathologien wurden gestrichen, um häufigere oder immer häufiger auftretende Erkrankungen ausführlicher beschreiben zu können.
Wie in der ersten Auflage liefern die ersten Kapitel (Kapitel 1–7) eine Einführung und Informationen über den klinischen Untersuchungsgang sowie dermatologische Zusatzuntersuchungen; im zweiten Teil des Buches (Kapitel 8–29) wird das klinische Vorgehen bei spezifischen Leitsymptomen erörtert; im dritten Teil (Kapitel 30–44) wird ausführlich auf die einzelnen dermatologischen Erkrankungen nach ätiologischen Gesichtspunkten eingegangen. In diesem dritten Teil haben wir versucht, die wichtigsten Informationen über Ätiologie und Pathogenese der einzelnen Erkrankungen, eine detaillierte Beschreibung der klinischen Symptome, eine Anleitung zum klinischen Vorgehen sowie praktische und aktuelle Therapiemaßnahmen zu erstellen.
Die Autoren danken den Kollegen, die uns bei den Kapiteln fünf und sieben unterstützt haben: Davide De Lorenzi und Ivan Fileccia; ebenso danken wir den Kollegen, die uns Fotografien und hilfreiche Informationen zur Verfügung gestellt haben: Francesco Albanese, Chiara Caporali, Giovanni Ghibaudo, Federico Leone, Ivan Fileccia, Ersilia Pappalardo und Antonella Vercelli. Wir danken auch dem Verlagshaus Poletto, deren Mitarbeiter erneut unser Projekt unterstütz haben.
Peveragno-Gainsville, März 2011Chiara NoliStefano Toma
Danksagung
In der Hoffnung, dass dieses Werk dazu beiträgt, die Lebensqualität vieler anderer Hunde und Katzen zu verbessern, widme ich dieses Buch meinem ersten Hund Shibè, der kurioserweise aufgrund einer unheilbaren dermatologischen Erkrankung verstarb. (CN)
Mein Dank gilt meinen Lehrern und Studenten für all das, was sie mir beigebracht haben. (ST)
1Ökosystem Haut: Aufbau und Funktion
Abb. 1.1aSchichtung der Epidermis.1 – Basalmembran; 2 – Basalschicht; 3 – Stachelzellschicht; 4 – Körnerschicht; 5 – Hornschicht.
Abb. 1.1bHistologischer Schnitt der normalen behaarten Haut einer Katze. Dünne Epidermis, bestehend aus zwei bis drei Lagen von Zellen und lamellarer Hornschicht (Hämatoxylin-Eosin, 10x).
1.1Aufbau der Haut
Die Haut setzt sich aus Epidermis, Dermis, Subkutis und Hautanhangsorganen zusammen.
1.1.1Epidermis und Basalmembran
Die Epidermis besteht aus mehrschichtigen Lagen von Epithelzellen, die Keratinozyten genannt werden. In den behaarten Bereichen (Abb. 1.1a, Abb. 1.1b) findet man eine zahlenmäßig geringere Schichtung als in haarlosen Stellen (Ballen, Nasenspiegel) (Abb. 1.2). Die Keratinozyten sind in der Basalmembran verankert. Ihre Entwicklung und Differenzierung verläuft von der Tiefe der Basalmembran zur Hautoberfläche vom Stratum basale, über das Stratum spinosum zum Stratum granulosum und Stratum corneum (Abb. 1.1b). Während der Proliferation und Migration zur Hautoberfläche durchlaufen die Keratinozyten einen Reifeprozess. Dabei verlieren sie ihren Kern und wandeln sich allmählich in starre Hornschuppen um. Ihr Hauptbaustoff ist das Keratin (Korneozyten). Intrazelluläre Lipide gewährleisten ein starkes Haften der Korneozyten aneinander und an den tiefer liegenden Zellen. Gemeinsam bilden sie den Keratinschutzmantel, welcher wasserfest und für die meisten pathogenen Mikroorganismen undurchdringbar ist. Außerdem befindet sich auf dem Stratum corneum eine Emulsion, die sich aus Sebum und Schweiß zusammensetzt. Dort findet man etliche spezifische (wie z. B. die Immunoglobuline) und unspezifische (wie z. B. das Transferrin) Faktoren. Wenn diese empfindliche hydrolipide Schicht verletzt wird, wie bei der Sebadenitis oder durch wiederholtes Baden mit aggressiven und entfettenden Shampoos, kann dies zu bakteriellen Infektionen und Seborrhoe führen.
Abb. 1.2Histologischer Schnitt der normalen Haut des Nasenspiegels einer Katze. Die Epidermis baut sich aus zahlreichen Lagen von Zellen auf. Sie ist von einer dichten lamellaren bzw. kompakten Hornschicht bedeckt. Keine Hautanhänge (Hämatoxylin-Eosin, 4x).
Abb. 1.3aHistologischer Schnitt des Nasenspiegels eines Hundes. Zwischen den Zellen der Basalschicht sind die Melanozyten (dunkle Zellen) gut sichtbar (Hämatoxylin-Eosin, 4x).
Abb. 1.3bMelano-epidermale Einheit.M – Melanozyt; K – Keratinozyt.
Die Epidermis ist auf der Membrana basalis verankert. Diese komplexe Schicht setzt sich aus unterschiedlichen Molekülen zusammen. Sie gewährleistet die Verbindung mit der tiefer liegenden Dermis. Zwischen Epidermis und Dermis gelegen ist sie Filter für die aus dem Kapillarsystem der Dermis stammenden nutritiven Substanzen, da die Epidermis selbst nicht vaskularisiert ist. Sie ist aber auch eine wichtige Hürde für Mikroorganismen und Makromoleküle, welche die Epidermis überwunden haben und sich auf dem Weg zur Dermis befinden.
Zwischen den Keratinozyten an der Membrana basalis findet man Melanozyten. Diese schieben ihre zytoplasmatischen Fortsätze (Dendriten) zwischen die Keratinozyten (Abb. 1.3a). Die Melanozyten entstammen der Neuralleiste; ihre Aufgabe ist die Produktion von Melanin. Man kennt zwei Arten von Pigment: das schwarze oder braune Eumelanin und das rote Pheomelanin. Es wird in Form von Granula sogenannter Melanosomen hergestellt und über die dendritischen Enden an die umliegenden Keratinozyten abgegeben. Ein Melanozyt ist so imstande, bis zu 36 umliegende Keratinozyten mit Melanin zu versorgen (Abb. 1.3b). Verteilung und Art des Pigmentes sind genetisch vorherbestimmt. Hauptaufgabe des Melanins ist der Schutz der Epidermis und der tiefer liegenden Gewebe vor den schädlichen Auswirkungen der ultravioletten Sonneneinstrahlung. Die Melaninbildung wird durch Sonneneinwirkung gesteigert.
1.1.2Dermis
Die Dermis enthält kollagene und elastische Fasern, die sie produzierenden Fibrozyten und eine mukopolysaccharide Grundsubstanz. Darin betten sich Fasern, Adnexe, Blutgefäße und Nerven ein. In der oberflächlichen Dermis sind diese Strukturen in einer lockereren Anordnung vertreten, in der tiefen Dermis sind sie dichter gepackt. Ihre Zugfestigkeit schützt vor Risswunden. Die elastischen Fasern kann man im histologischen Präparat nur mittels Spezialfärbungen sichtbar machen. Sie erlauben der Haut nach Zug oder Bewegung eine Rückkehr in ihre ursprüngliche Lage. Diese Eigenschaft gewinnt an Bedeutung in der Umgebung von Gelenken und Knochenvorsprüngen. Die Grundsubstanz ist sowohl Puffer als auch Speicher von Wasser und Elektrolyten (sie kann Wasser bis zu einem Vielfachen ihres Eigengewichtes einlagern). Sie gewährleistet außerdem eine große Bewegungsfreiheit für Fibrozyten, Entzündungszellen u. a.
Abb. 1.4Aufbau der Haut.A – Epidermis; B – Dermis; C – Subkutis; 1 – Haar; 2 – Haarwurzel; 3 – Talgdrüse; 4 – apokrine Schweißdrüse; 5 – Haarbalgmuskel; 6 – Blutgefäße; 7 – Nerven (a – freie Nervenenden; b – Meissnersches Tastkörperchen; c – Vater-Pacinisches Lamellenkörperchen).
Die Blutversorgung der Haut wird durch drei Plexus gewährleistet (Abb. 1.4): Das oberflächliche Netz nährt die Epidermis, das mittlere den Haarfollikelisthmus sowie die Talgdrüsen und das tiefe die Haarpapillen sowie die Schweißdrüsen. Beinahe parallel erfolgt die nervale Versorgung der Haut. Eine ganze Reihe von Organen ermöglicht im Zusammenspiel mit dem Nervengewebe die Wahrnehmung von Schmerz, Juckreiz, Tastgefühl, Druck und Berührung. Zu diesen Organen zählen u. a. die Tasthaare (Vibrissae) (Abb. 1.5), die Vater-Pacini-La-mellenkörperchen (diese Mechanorezeptoren findet man vor allem in den Ballen) (Abb. 1.6), freie Nervenenden in der Epidermis (Schmerz und Juckreiz) und die Merkelschen Zellen (Druckempfindung). An den verschiedenen Körperstellen findet man je nach Tierart unterschiedliche dieser Organe.
Schließlich befindet sich in der Dermis auch die Haarbalgmuskulatur, die distal des Isthmus am Haarbalg verankert ist. Durch die Kontraktion der Muskulatur werden die Haare aufgerichtet.
Abb. 1.5Histologischer Schnitt eines Tasthaares (Vibrissae). Der Haarfollikel ist breiter als normale Follikel. Er steckt in einem Blutsinus, der von einem reichen Nervengeflecht umgeben ist (Hämatoxylin-Eosin, 4x).
Abb. 1.6Histologischer Schnitt durch ein Vater-Pacinisches Lamellenkörperchen einer Katze. Lamellare Struktur, die in der Tiefe zwischen den Haarfollikeln liegt (Periodsäure-Schiff, 4x).
Abb. 1.7Aufbau des Haarfollikels.E – Epidermis; H – Haar; M – Haarbalgmuskel; P – Dermalpapille; S – apokrine Schweißdrüse; T – Talgdrüse; 1 – Haaroberhäutchen; 2 – Haarrinde; 3 – Haarmark; 4 – Haarmatrix; 5 – äußere Wurzelscheide; 6 – innere Wurzelscheide.
1.1.3Hautadnexe
In der Haut eingebettet sind:
▶ Haarbalg (Haarfollikel)
▶ Krallen
▶ Talgdrüsen
▶ Schweißdrüsen
Haarfollikel und Haare
Haarbälge sind Invaginationen des epidermalen Gewebes: Dort entstehen Haare, die durch den Follikel gestützt werden (Abb. 1.7). Der Haarbalgtrichter (Infundibulum) als oberflächlichster Teil entspricht in seinem Aufbau der Epidermis. In den mittleren Teil, den Haarbalghals, münden Schweiß- und Talgdrüsen und der Musculus arrector pili findet dort seine Verankerung. Der Haarbalggrundauch Bulbus oder Wurzel genannt, setzt sich aus Matrix-Epithelzellen und Melanozyten zusammen. Sie sind jeweils für Produktion und Pigmentierung des Haares verantwortlich. In seinem proximalen Teil umgeben innere und äußere Wurzelscheide den neu gebildeten Haarschaft. Die innere Wurzelscheide keratinisiert und löst sich ab dem Isthmus auf. Ab hier ist der Schaft schon starr genug und bedarf nicht mehr dieser Stütze. Die äußere Wurzelscheide folgt dem Haarschaft bis zum Ostium des Balges, wo sie mit der Epidermis der Hautoberfläche in Verbindung tritt.
Abb. 1.8Zusammengesetzter Haarfollikel.1 – Deckhaar; 2 – Wollhaar; 3 – Epidermis; 4 – Haarbalgmuskel; 5 – Talgdrüse; 6 – Wurzeln der Sekundärhaare; 7 – Wurzel des Primärhaares; 8 – apokrine Drüse.
Bei erwachsenen Hunden und Katzen sind die Haarbälge in Gruppen angeordnet. Aus einem Haarbalgtrichter entspringen büschelförmig mehrere Haare (Abb. 1.8). Jedes besitzt eine eigene Wurzel. Unter den Haaren desselben Haarbündels erkennt man ein im Allgemeinen deutlich dickeres und gerades Leithaar (Primärhaar). Es besitzt eine Talg- und eine Schweißdrüse. Die Primärhaare bilden zusammen das Deckfell, schützen vor Regen und bestimmen sein Aussehen (Farbe, Länge). Die anderen Haare des Büschels, Sekundär- oder Wollhaare genannt, sind gewöhnlich dünner. Jedoch können Wollhaare im Durchmesser erhebliche Varianten aufweisen, von kaum dünner als ein Deckhaar bis sehr dünn. Wollhaare haben mit seltenen Ausnahmen keine Talg- und Schweißdrüsen. Sie bilden das schützende und isolierende Unterfell. Durch ihre oftmals vorhandene gewellte Form kommt es zur Ausbildung von kleinen Luftpolstern. Auch im Haarmark findet man Luft.
Abb. 1.9a (links)Aufbau des Haarschaftes.1 – Haaroberhäutchen; 2 – Haarrinde; 3 – Haarmark.
Abb. 1.9b (rechts)Foto eines Primärhaares (Trichoskopie).
Die Wurzeln von Haaren, die sich in der Wachstumsphase befinden, werden von kernhaltigen Keratinozyten gebildet. Diese sich vermehrenden Matrixzellen bauen den Haarschaft auf. Im Haar sieht man in der Mitte das Haarmark. Beim Leithaar findet man dort Glykogenvakuolen, im Wollhaar hingegen Luft. Auf das Mark folgt als nächste Schicht die Haarrinde. Sie produziert ein sehr starres Keratin, das dem Haar Widerstandskraft verleiht. Außen überzieht ein sehr dünnes Haaroberhäutchen das Haar (Abb. 1.9a, Abb. 1.9b).
Haarzyklus
Haare wachsen in der sogenannten anagenen Phase. Die Wurzel ist rundlich und pigmentiert. Sie enthält zahlreiche aktiv produzierende Matrixzellen (Abb. 1.10a, Abb. 1.10b). In der Wachstumsphase umgibt die Wurzel fingerhutartig die Dermalpapille. Diese ist mesenchymalen Ursprungs und reich an Blutgefäßen, welche die Matrixzellen mit Nährstoffen versorgen. Nachdem das Haar seine Länge erreicht hat und das Wachstum eingestellt wird, beobachtet man eine Loslösung der Wurzel von der Papille. Die Wurzel verliert ihre Pigmentierung und nimmt eine lanzettartige Form an (Abb. 1.11a, Abb. 1.11b). Ein amorphes Keratin, das trichilemmale Keratin, verankert in der telogenen Phase das Haar im Haarbalg. Es kann viele Monate bis zum Beginn des nächsten vegetativen Zyklus in Ruhe verharren. Dann beobachtet man, dass sich um die Dermalpapille eine neue Wurzel anordnet und diese mit der Herstellung eines neuen Haares beginnt. Das Wachstum des neuen bedingt das Abstoßen des alten Haares (Abb. 1.12a, Abb. 1.12b).
Abb. 1.10aDie Matrix umgibt die Dermalpapille, das Haar ist deutlich pigmentiert und in der Wachstumsphase.
Abb. 1.10bHistologischer Schnitt eines Haares in Anagenphase. Die Ummantelung der Dermalpapille durch die pigmentierte Haarmatrix ist klar ersichtlich.
Abb. 1.11aHaarfollikel in Katagenphase. Die Papille umgibt nicht mehr die Wurzel, die eine lanzettförmige Gestalt angenommen und das Pigment verloren hat.
Abb. 1.11bHistologischer Schnitt durch ein Haar in Katagenphase. Die Wurzel erscheint ausgefranst und ist durch trichilemmales Keratin an der Follikelwand verankert (Hämatoxylin-Eosin, 10x).
Abb. 1.12aHaarfollikel in früher Anagenphase. Eine neue Wurzel bildet ein neues Haar, das alte Haar wird hinausgedrängt.
Abb. 1.12bHistologischer Schnitt eines Haares in früher Anagenphase. Am unteren Bildrand sieht man eine Wurzel in Anagenphase, die eine darüber liegende Wurzel, die sich in Telogenphase befindet, hinausschiebt (Hämatoxylin-Eosin, 10x).
Abb. 1.13aMündung der Ausführungsgänge von Talg- und Schweißdrüsen in das Lumen des Haarbalges.E – Epidermis; H – Haar; M – Haarbalgmuskel; S – apokrine Schweißdrüse; T – Talgdrüse.
Abb. 1.13bHistologischer Schnitt der Talgdrüse einer Katze. Der Ausführungsgang der Talgdrüse mündet in das Follikellumen, das rechts zu sehen ist (Hämatoxylin-Eosin, 40x).
Abb. 1.14Histologischer Schnitt einer apokrinen Schweißdrüse (Hämatoxylin-Eosin, 10x).
Drüsen
In der Kutis sind Talg- sowie apokrine und ekkrine Schweißdrüsen eingebettet. Die ersten beiden Drüsen entleeren ihre Sekrete in den Haarbalgtrichter (Abb. 1.13a), während Letztere in haarlosen Körperregionen unmittelbar an der Hautoberfläche münden (Ballen). Talgdrüsen (Abb. 1.13b) sind holokrine Drüsen. Die Zellen der Drüsen füllen sich mit Sebum und lösen sich im Zuge der Sekretion auf. Sie produzieren ein fettiges Sekret, welches das Fell geschmeidig hält und den oberflächlichen Schutzfilm der Haut bildet. Apokrine Drüsen (Abb. 1.14) produzieren ein wässriges Sekret, in welchem man Abwehrfaktoren wie z. B. Antikörper findet. Dieses Sekret vermengt sich zu einer Emulsion mit dem Sebum und bildet den hydrolipiden Film der Hautoberfläche. Die ekkrinen Drüsen, die den Schweißdrüsen des Menschen ähneln, bilden ein wässriges Sekret. Es benetzt die haarlose Haut und verleiht den Ballen Griffigkeit auf glatten Oberflächen.
Es gibt weitere Drüsen mit besonderen Aufgaben, die man als modifizierte Talg- und Schweißdrüsen bezeichnet. Zu den Ersteren zählt man die Zirkumanaldrüsen, das dorsale Schwanzorgan, die Meibomschen Drüsen der Lider sowie die Zirkumoraldrüsen der Katze. Modifizierte Schweißdrüsen findet man in der Milchleiste, bei den Ohrschmalzdrüsen und in jenen Drüsen, die in die Analbeutel münden.
1.2Funktionen der Haut
Die Haut ist das Organ mit der größten Ausdehnung, sie bildet die Außenverkleidung des Organismus. Ihre Aufgaben sind vielfältig und allesamt wichtig für die Homöostase und für das Überleben des Organismus.
Abb. 1.15Das Schema des SIS (Skin Immune System).A – Antigen; D – Dermis; E – Epithelzellen; Ep – Epidermis; K – Keratinozyten; L – Langerhans-Zellen; LK – Lymphokine (Interleukine); Ly – Lymphozyten; Ma – Makrophagen; Mas – Mastzellen; Mb – Basalmembran; Mo – Monozyten; N – Neutrophile, Th – T-Helferzellen; Tm – T-Memoryzellen; Z – Zytokine.
▶ Schutz
▶ Thermoregulation
▶ Speicher
▶ Produktion
▶ Kognitive und soziale Aufgaben
1.2.1Schutz
Die Haut und ihre Anhangsorgane bilden die erste starke Abwehrfront gegen Erreger, die dem Organismus fremd sind. Das Fell und das kompakte Stratum corneum sind von einem wasserundurchlässigen Lipidfilm überzogen; des Weiteren filtern sie dank Melaninpigment und Keratin die ultraviolette Strahlung, sodass für das darunter liegende Gewebe Schaden abgewendet werden kann. Wimpern schirmen z. B. die Augen vor Sonnenstrahlen und Wind ab. Die widerstandsfähige Hornschicht und die kollagenen und elastischen Fasern schützen die Kutis vor Risswunden durch Zug oder Prellungen. Für den Fall von Verwundungen zeichnet sich die Haut durch rasche Wundheilungsfähigkeiten aus. Abhängig von der Schwere der Verletzung kommt es teilweise innerhalb von nur wenigen Tagen zu einer Wiederherstellung der intakten Hautoberfläche.
Epidermis und Dermis sind für Moleküle (insbesondere für wasserlösliche) und Mikroorganismen schwer zu durchdringen. Für den Fall einer Penetration kann dank des Hautimmunsystems und seiner unspezifischen und spezifischen Abwehrreaktionen einer Infektion entgegentreten werden. Das sogenannte SIS (Skin Immune System) (Abb. 1.15) ist einer der effizientesten Teile des Immunsystems und umfasst:
▶ Langerhans-Zellen. Es handelt sich dabei um dendritische Zellen in der Epidermis. Sie sind befähigt, Fremdmoleküle abzufangen (z. B. Allergene) und diese den Lymphozyten zu präsentieren, damit jene eine spezifische Immunantwort auslösen können.
▶ Lymphozyten. Einige sind in der Epidermis lokalisiert, andere in der Dermis. Viele sind Gedächtniszellen, die bei entsprechender Stimulation imstande sind, rasch eine Immunreaktion auszulösen.
▶ Mastzellen. Man findet sie in der Nähe von Blutgefäßen. Bei Degranulation setzen sie Entzündungsmediatoren frei. Sie bewirken Vasodilatation, Ödembildung und zelluläre Diapedese der zirkulierenden Lymphozyten.
▶ Endothelzellen. Sie binden zirkulierende Leukozyten und leiten sie in Richtung Entzündungsherd.
1.2.2Thermoregulation
Fell und subkutanes Fettgewebe tragen zusammen mit einer reichen dermalen Vaskularisierung wesentlich zur Konstanterhaltung der Körpertemperatur bei. Durch das Sträuben der Haare wird das wärmeisolierende Luftkissen vergrößert. Die periphere Gefäßerweiterung bzw. -verengung steuert die Wärmeabgabe durch Strahlung. Hund und Katze sind nicht in der Lage, ihre Schweißdrüsen zur Wärmesteuerung zu verwenden. Katzen können durch das Benetzen des Fells mit Speichel eine Körperabkühlung bewirken.
1.2.3Speicher
In der Kutis und Subkutis werden Wasser und Elektrolyte in den Mukopolysacchariden der Dermis gespeichert, Fette und Vitamine sammeln sich im subkutanen Fettgewebe.
1.2.4Produktion
Beim Menschen erfolgt durch die Einwirkung von ultravioletter Strahlung eine Vitamin-D-Produktion in der Haut. Anders verhält es sich beim Hund, da hier die Haut mit Fell überzogen ist. Bei allen Säugetieren findet in der Haut und in ihren Anhängen eine periphere Aromatisierung von östrogenen und androgenen Hormonen statt. Dabei können Hormone einer Gruppe in eine andere umgewandelt werden. Dies macht eine Beurteilung der Wirkung von Sexualhormonen, die exogen zugeführt werden, schwierig. Zurzeit kennt man weder den peripheren Metabolismus von Sexualhormonen genau noch die Endprodukte, die rezeptorwirksam sind.
Auch Hautanhangsgebilde wie Haare und Krallen sowie Drüsensekrete wie Talg und Schweiß sind Erzeugnisse, die von der Haut produziert werden.
1.2.5Kognitive und soziale Aufgaben
Viele kognitive Empfindungen wie Schmerz, Juckreiz, Wärme, Kälte, Druck und Berührung werden über die Haut wahrgenommen.
Die Pigmentierung des Fells stand ursprünglich im Dienste der Tarnung; die Farben graubraun, die Wildfärbung und die Streifung trugen dazu bei, Räuber und Beute wenig sichtbar zu machen. Die Zucht verschiedener Rassen durch den Menschen hat sich oft auf das Aussehen des Fells und auf die Pigmentierung von Haut und Adnexen fokussiert. Dadurch sind Farbschläge und Scheckung entstanden, die in der Natur unbekannt sind.
Das Sträuben der Haare erlaubt eine Vergrößerung des Körperprofils, um in der Gefahr einen Aggressor abzuschrecken. Mit dem Sekret der Anal- und der Zirkumanaldrüsen wird das Territorium markiert. Bei den Katzen nehmen auch die Zirkumoraldrüsen diese Aufgabe wahr. Drüsensekrete ermöglichen das Wiedererkennen von Individuen. Andere Drüsen wie die hepatoiden Drüsen im Perineum und das Suprakaudalorgan stehen unter dem Einfluss der Sexualhormone und es ist wahrscheinlich, dass sie bei den wild lebenden Ahnen von Hund und Katze eine Bedeutung bei der Paarung hatten.
1.3Mikroflora der Haut
Das Ökosystem Haut, d. h. das Mikroklima, das man auf der Oberfläche vorfindet, wird von biologischen, chemischen und physikalischen Faktoren sowie dem Verhältnis zueinander bestimmt. Zu den physikalischen und chemischen Faktoren zählt man den pH-Wert, das Wasser, Mineralsalze sowie spezifische und unspezifische Abwehrfaktoren im Sebum und im Schweiß. Zu den Mikroorganismen zählt man Bakterien, Hefen und Parasiten. Im Allgemeinen findet man zwischen »Gastgeber« und Mikroflora der Hautoberfläche stabile Verhältnisse. Diese stabilen Relationen tragen dazu bei, dass eine Besiedelung der Haut durch pathogene Mikroorganismen erschwert wird.
Bei der Isolierung von Bakterien der Hautoberfläche findet man meist aerobe Kokken und andere grampositive Mikroorganismen. Staphylokokken nehmen in diesem Spektrum eine dominante Stellung ein. Bei dauerhafter Besiedelung spricht man von Kommensalen. Sie absolvieren ihren gesamten Lebenszyklus auf der Kutis, sie beziehen Nährstoffe und halten die Besiedelung pathogener Bakterien dank der Herstellung von toxischen Metaboliten, Enzymen, Bakteriziden und Antibiotika fern. Opportunistische (wie Staphylococcus intermedius) oder pathogene Keime können nur schwer Fuß fassen und Infektionen hervorrufen. Beim Hund gelten Keime wie Micrococcus spp., koagulasenegative Staphylokokken wie St. epidermidis und St. xylosus (und viele andere) und alpha-hämolysierende Streptokokken, Acinetobacter spp., Propionibacterium spp. und Clostridium spp. als normale Hautflora. Bei der Katze findet man: Micrococcus spp., koagulasenegative Staphylokokken (hier ist St. simulans vorherrschend), alpha-hämolysierende Streptokokken und Acinetobacter spp. Die normale Hautflora ist im Allgemeinen nicht pathogen, manchmal jedoch kann sie sich pathogen verhalten. Eine Durchgangsflora kann nur fallweise von der Haut isoliert werden. Sie lebt hier nicht dauerhaft und vollbringt hier nicht ihren Lebenszyklus. Beim Hund findet man hier Escherichia coli, Proteus mirabilis, Corynebacterium spp., Bacillus spp. und Pseudomonas spp.; bei der Katze wurden alpha-hämolysierende Streptokokken, E. coli, P. mirabilis, Pseudomonas spp., Alcaligenes spp., Bacillus spp. und Staphylokokken angezüchtet. Wenn die Umweltbedingungen geeignet sind, wie z. B. in heißen und feuchten Gegenden, sowie nach Unterdrückung der Mikroflora, können diese Bakterien pathogen werden. Staphylococcus intermedius ist hauptverantwortlich für die meisten bakteriellen Hautentzündungen beim Hund. Der Erreger ist wahrscheinlich ein Bewohner der Schleimhäute und nicht der Haut. Außerdem wurde er aus den Haarbälgen und den Talgdrüsen gesunder Hunde isoliert, sodass man Haare und Schleimhäute als das große Reservoir dieser Mikroorganismen bei an Pyodermien erkrankten Hunden ansehen kann. Da bei der Fellpflege Haare abgeleckt werden, ist es denkbar, dass ihre Keimpopulation in Wahrheit von den Schleimhäuten stammt.
Malassezia pachydermatis ist eine Hefe. Sie lebt als Kommensale im Ohr, am Kinn, an der Unterlippe, im Zwischenzehenbereich, am und rund um den Anus und in den Analbeuteln von Hund und Katze. Die Anwesenheit dieser Hefe schränkt wahrscheinlich die Infektionsgefahr durch virulentere Pilze und Hefen ein. Von Haar und Haut kann man ebenso saprophytische Pilze isolieren. Die Gattungen Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Mucor, Penicillium und Rhizopus werden in der Umwelt aufgenommen und passiv vom Körper mitgeführt. Zufällige Wundkontaminationen können insbesondere bei immunsupprimierten Individuen (wie z. B. bei Katzen, die Träger des FIV, dem felinen Immunodefizienzvirus, oder des FeLV, dem felinen Leukämievirus, sind) tiefe Mykosen hervorrufen. Findet man bei gesunden Tieren Vertreter der geophilen Dermatophyten, wie z. B. Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum und T. terrestre, so handelt es sich dabei wohl um eine Durchgangsflora, im Unterschied zu Microsporum canis, den man immer als pathogen einstufen muss.
Demodex canis, eine parasitär lebende Milbe, trifft man gelegentlich bei etwa der Hälfte der gesunden Tiere in kleiner Zahl an. Die Invasion der Demodex-Milben erfolgt schon in den ersten Lebenstagen durch Direktkontakt mit dem Muttertier beim Säugen. Die Parasiten besiedeln Haarbälge und Talgdrüsen, ohne diese zu schädigen. Prädisponierte oder immungeschwächte Tiere ermöglichen es den Milben, sich im Übermaß zu vermehren. Es bildet sich die klinische Symptomatik der Demodikose aus.
2Geräte und Instrumente für die Dermatologie
Abb. 2.1Bedarf für die spezielle dermatologische Untersuchung: Schermaschine, Bajonettpinzette und Schere.
Abb. 2.2Bedarf für das Hautgeschabsel: scharfer Doppellöffel nach Volkmann, Skalpellklingen Nr. 10 oder Nr. 20, Objektträger, Deckgläschen und Paraffinöl.
Der Bedarf an Geräten und Instrumenten für die dermatologische Praxis ist weder groß noch kostspielig. Zum überwiegenden Teil erwächst der Bedarf aus Zusatzuntersuchungen.
Deshalb erschien es sinnvoll, die Geräte unter dem Gesichtspunkt der verschiedenen Tätigkeiten zu gruppieren.
Dermatologische Untersuchung(Abb. 2.1)
▶ Bajonettpinzette, um das Haar anzuheben und die Haut freizulegen
▶ Schermaschine, um das Fell zu kürzen, sodass man Effloreszenzen besser darstellen kann
▶ Schere für den gleichen Zweck
▶ Fotoapparat mit Makroobjektiv und Ringblitz zur Dokumentation von Hautveränderungen
Hautgeschabsel(Abb. 2.2)
▶ für das tiefe Hautgeschabsel einen scharfen Doppellöffel nach Volkmann mit 5–6 mm Durchmesser
▶ für das oberflächliche Hautgeschabsel Skalpellklingen Nr. 10 oder Nr. 20
▶ Paraffinöl (alternativ KOH oder Chlorlaktophenol)
▶ Objektträger ohne Mattrand
▶ Deckgläschen von 18 × 18 bis 24 × 24 mm
▶ Mikroskop in guter Qualität mit 4-facher und 10-facher Vergrößerung
▶ Watte und Alkohol zur Hautdesinfektion nach Entnahme des Geschabsels
Trichoskopie(Abb. 2.3)
▶ Arterienklemmen Mosquito nach Klemmer; die Maulschenkel der Klemme sollte man mit kleinen Gummiröhrchen überziehen (dafür kann man z. B. die Schutzkappen von Flügelkanülen [Butterflies] verwenden). Der Gummiüberzug ermöglicht ein festes, aber schonendes Fassen der Haare
▶ Objektträger, Öl und Mikroskop wie für das Geschabsel
Zytologie(Abb. 2.4)
▶ Objektträger mit Mattrand zum Beschriften der Proben
▶ graue Kanülen (21 G) zur Feinnadelfission
▶ orangefarbene Kanülen (24 G) zur Feinnadelaspiration von Pusteln und zum Abheben von kleinen Krusten
▶ Spritzen zu 5 und 10 ml sowie graue Kanülen (21 G) zur Feinnadelaspiration
Abb. 2.3Bedarf für die Trichoskopie: Arterienklemmen Mosquito nach Klemmer (bei einer Klemme sollte man die Maulschenkel mit Gummi überziehen), Objektträger und Deckgläschen, Paraffinöl.
Abb. 2.4Bedarf für die Zytologie: Bleistift, Spritze und Nadel, Schnellfärbemittel, Immersionsöl, Skalpellklingen Nr. 10 oder Nr. 20, Feuerzeug, Wattestäbchen, 21-G-Kanülen, Objektträger mit Mattrand, durchsichtiger Klebestreifen.
Abb. 2.5Bedarf für die Entnahme von Hautbiopsien: Spritze für Lokalanästhesie, Skalpellklinge, Arterienklemme Mosquito, Nadelhalter, kleine Gewebescheren, kleine chirurgische Pinzette, Haarscheren, Nadel und Faden, sterile Tupfer, Punch mit 4, 6 und 8 mm Durchmesser, Probenbehälter mit 10%igem Formalin, 2%iges Lidocain, wasserunlöslicher Farbstift.
▶ Ohrwattestäbchen zur Entnahme von Ohrenschmalz, Fistelexsudat oder zur Probenentnahme aus dem Zwischenzehenbereich
▶ Skalpellklingen Nr. 10 oder Nr. 20 zur Entnahme von öligen Exsudaten von der Gewebeoberfläche
▶ Klebestreifen zur Probengewinnung von haarlosen Stellen
▶ Feuerzeug zum Abflammen von Objektträgern mit Proben von Ohrenschmalz und von einer öligen Seborrhoe
▶ Wäscheklammer zum Eintauchen des Objektträgers in die Färbelösungen
▶ Set für schnelle Färbung, bestehend aus Fixier- und Färbelösung (drei kleine Wannen mit Alkohol, roter und blauer Lösung)
▶ Spritzflasche mit destilliertem Wasser zum Spülen der Objektträger oder der Klebestreifen nach dem Färben, wenn man nicht über fließendes Wasser unmittelbar am Arbeitsplatz verfügt
▶ Saugpapier zur Lagerung der Objektträger während der Lufttrocknung oder ein Haarföhn zur Schnelltrocknung
▶ Mikroskop in guter Qualität mit bis zu 100-facher Vergrößerung (Immersion)
▶ Immersionsöl
▶ Deckgläschen von 40 × 20 bis 50 × 24 mm
▶ Leim zum Kleben der Deckgläschen (Eukitt®)
▶ Objektträgerkasten zur Dunkellagerung der Proben
Hautbiopsie(Abb. 2.5)
▶ Haarschere zum Kürzen der Haare über den Effloreszenzen
▶ Farbstift mit mittlerer und dicker Spitze zum Kennzeichnen der zu entnehmenden Effloreszenzen
▶ 1%iges Lidocain (für die Katze) und 2%iges Lidocain (für den Hund) ohne Adrenalin und Spritzen zu 2,5 oder 5 ml, um das Lokalanästhetikum subkutan unter der zu entnehmenden Effloreszenz zu injizieren
▶ Alkohol oder ein anderes farbloses Desinfektionsmittel zur groben Vordesinfektion zu Beginn der Probenentnahme
▶ Kaltdesinfektionsmittel zum Eintauchen des chirurgischen Besteckes und des Nahtmaterials
▶ Biopsy-Punch mit 4, 6 und 8 mm Durchmesser
Abb. 2.6Bedarf für die Entnahme von bakteriologischen Proben: Sterile Tupfer mit Transportmedium, steriles Röhrchen mit physiologischer Lösung.
Abb. 2.7Bedarf für die Entnahme und zum Ansetzen von Pilzproben: Papiersäckchen, neue oder sterile Zahnbürste, Arterienklemme Mosquito, Pilznährboden (hier eine Doppelschale mit Sabouraud-Nährboden und Dermatophyte Test Medium [DTM]).
Abb. 2.8Sonstiges Instrumentarium für die dermatologische Sprechstunde: Wood-Licht, durchsichtiger Klebestreifen, Kamm mit feiner Zahnung aus Kunststoff oder Metall, Spritzen mit unterschiedlichem Volumen, Stauschlauch für die Blutentnahme.
▶ Skalpellgriffe und -klingen für Exzisionsbiopsien
▶ chirurgische Augenpinzette (mit einem sehr spitzen und genau schließenden Maul)
▶ kleine gebogene Schere für Weichteile
▶ kleine Mosquito-Klemmen zum Abbinden von eventuell auftretenden kleinen Blutungen
▶ Nadelhalter
▶ Nahtmaterial für Hautwunden; besonders eignen sich Nadel-Faden-Kombinationen mit einer Dreikantspitze
▶ Behälter mit 5–20 ml Volumen mit 10%igem abgepuffertem Formalin
▶ sterile Tupfer (5 × 5 cm oder Ähnliche)
Bakteriologische Untersuchung(Abb. 2.6)
▶ sterile Stiltupfer mit Transportmedium im Transportbehälter
▶ sterile Serumröhrchen ohne Gel mit steriler physiologischer Lösung zum Transport von Gewebe (z. B. zum Ansetzen von Bakterienkulturen aus Hautbiopsien)
Pilzuntersuchung(Abb. 2.7)
▶ sterile Arterienklemme Mosquito nach Klemmer
▶ einzeln verpackte Zahnbürste (z. B. preisgünstige Zahnbürsten für die Hotellerie)
▶ kleine Papiersäckchen (wie sie z. B. zum Verpacken von Briefmarken verwendet werden) zum Transport von Untersuchungsmaterial
▶ Petrischalen mit Sabouraud- und DTM(Dermatophyte Test Medium)-Doppelnährboden
▶ hochkonzentriertes Chlorhexidin und Bleichlauge zur Desinfektion der Geräte
Sonstiges Instrumentarium(Abb. 2.8)
▶ Woodsche Lampe, besser mit Stromanschluss als mit Batterien betrieben
▶ Kamm mit feiner Zahnung zur Untersuchung auf Parasiten
▶ transparenter Klebestreifen für den Klebestreifenabklatsch (Scotch-Test)
▶ Kanülen und Spritzen, Stauschlauch, Serum- und EDTA-Röhrchen (Ethylendiamintetraessigsäure) für Blutabnahmen
3Dermatologischer Untersuchungsgang
Eine dermatologische Untersuchung, die man mit Ruhe und Genauigkeit durchführt, dauert inklusive der Zusatzuntersuchungen zwischen 45 und 60 Minuten. Davon muss man etwa 20 Minuten für das vollständige Signalement und die ausführliche Anamnese, zehn Minuten für die klinische Untersuchung, 15 Minuten für die Zusatzuntersuchungen und weitere 15 Minuten für die Information und Unterweisung des Tierbesitzers einplanen. Dieser Zeitrahmen kann nur ein grobes Schema sein, das vom klinischen Bild und von der Gesprächigkeit des Tierbesitzers stark beeinflusst wird. Alle erfassten Daten, die im Zuge der Visite erhoben werden, sollten in einem eigenen dermatologischen Datenblatt festgehalten werden. Der Datenbogen ist sinnvollerweise wiederum in verschiedene Abschnitte für das Signalement, die Anamnese, die klinische Untersuchung, die Liste der Differenzialdiagnosen, die Zusatzuntersuchungen, die Enddiagnose, die Therapie und das Follow-up unterteilt. Im Folgenden wird auf die einzelnen Abschnitte näher eingegangen.
3.1Signalement
Neben den Personalien des Tierbesitzers werden auch Tierart, Rasse, Geschlecht des Tieres und eine mögliche Kastration erhoben sowie Geburtsdatum und Name des Patienten erfragt (Tab. 3.1). In der Veterinärdermatologie spielt die Rasseprädisposition für viele Hauterkrankungen eine wichtige Rolle. In Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3 sind die wichtigsten Rassen und deren Dermatopathien und umgekehrt die wichtigsten Hauterkrankungen, geordnet nach Rassen, aufgelistet.
Tabelle 3.1: Signalement
Tabelle 3.2: Prädisposition von Hunderassen für wichtige dermatologische Erkrankungen
Rasse
Erkrankung
Kurzhaarrassen
• bakterielle Follikulitis
Airdale Terrier
• saisonale Flankenalopezie
Akita Inu
• Pemphigus foliaceus
• Sebadenitis
• uveodermatologisches Syndrom
Basset Hound
•Malassezia-Dermatitis
• atopische Dermatitis
• Intertrigo
Belgischer Schäferhund
• Vitiligo
Berner Sennenhund
• malignes Histiozytom
Bordeauxdogge
• Follikulitis
• Demodikose
• Intertrigo
• Furunkulose/Pododermatitis
• Liegeschwielen
Boxer
• atopische Dermatitis
• Futtermittelallergie
• Urtikaria und Angioödem
• saisonale Flankenalopezie
• Cushing-Syndrom
• Hypothyreose
• bakterielle Follikulitis
• Furunkulose/Pododermatitis und Kinnakne
• Mastozytom und andere Tumoren
Bullterrier
• Furunkulose
• letale Akrodermatitis
• Sonnenbrand
• atopische Dermatitis
• Liegeschwielen
Chihuahua
• Schablonenkrankheit
• Demodikose
Chow-Chow
• Pemphigus foliaceus
• Alopezie X
• Follikulitis/Furunkulose
• uveodermatologisches Syndrom
Cocker Spaniel
• atopische Dermatitis
• primäre idiopathische Seborrhoe
• Ohrenentzündungen
•Malassezia-Dermatitis
• Intertrigo
Dackel
• Cushing-Syndrom
• Alopecia areata
• Demodikose
• Schablonenkrankheit
• Alopezie der Farbmutanten
Dalmatiner
• atopische Dermatitis
• bakterielle Follikulitis
• Sonnenbrand
Dänische Dogge
• Follikulitis
• Furunkulose/Pododermatitis
• Kinnakne
• Liegeschwielen
• Demodikose
• Hypothyreose
Deutscher Schäferhund
• atopische Dermatitis
• Flohbissallergie
• Schäferhund-Pyodermie
• Demodikose
• diskoider Lupus erythematodes
• systemischer Lupus erythematodes
• mukokutane Pyodermie
• Perianalfistel
• metatarsale/metakarpale Zellulitis
• Calcinosis circumscripta
• noduläre Dermatofibrose
• Ohrranddermatitis durch Insektenstiche
• Vitiligo
Dobermann
• Demodikose
• saisonale Flankenalopezie
• Schablonenkrankheit
• Follikulitis
• Furunkulose/Pododermatitis
• Hypothyreose
• Alopezie der Farbmutanten
• follikuläre Dysplasie des roten und schwarzen Dobermanns
Englische Bulldogge
• Demodikose
• atopische Dermatitis
• Follikulitis und Pododermatitis
• Intertrigo
• Schablonenkrankheit
• saisonale Flankenalopezie
•Malassezia-Dermatitis
Französische Bulldogge
• Cushing-Syndrom
• Schablonenkrankheit
• atopische Dermatitis
Golden und Labrador Retriever
• atopische Dermatitis
• Futtermittelallergie
• Pododermatitis
• juvenile Zellulitis
Husky
• diskoider Lupus erythematodes
• Zinkmangelsyndrom
• Alopezie X
• eosinophiles Granulom
• uveodermatologisches Syndrom
Jack Russel Terrier
• atopische Dermatitis
• Demodikose
Mops
• Demodikose
• Intertrigo
• atopische Dermatitis
• Follikulitis
Neufundländer
• Hypothyreose
• Follikulitis/Furunkulose
• Pemphigus foliaceus
Pudel
• Cushing-Syndrom
• Sebadenitis
• Talgdrüsenadenom
• Alopezie X
Riesenschnauzer
• Hypothyreose
• saisonale Flankenalopezie
Rottweiler
• Follikulitis/Furunkulose
• Vitiligo
Samojede
• Alopezie X
• Sebadenitis
• uveodermatologisches Syndrom
Shar-Pei
• kutane Muzinose
• Ohrenentzündungen
• atopische Dermatitis
• Futtermittelallergie
• Demodikose
• Intertrigo
• Follikulitis
•Malassezia-Dermatitis
Sheltie und Collie
• diskoider Lupus erythematodes
• Pemphigus erythematosus
• Dermatomyositis
• ulzerative Dermatitis des Collies
• Intertrigo
Shih Tzu
• atopische Dermatitis
• Intertrigo
• Demodikose
West Highland White Terrier (WHWT)
• atopische Dermatitis
• Futtermittelallergie
•Malassezia-Dermatitis
• Demodikose
Yorkshire Terrier
• atopische Dermatitis
• Alopezie der Farbmutanten
• Dermatophytose
Zwergspitz
• Alopezie X
Tabelle 3.3: Prädisposition von Hunderassen, gelistet nach Krankheiten
Erkrankung
Rasse
Alopezie X
Wolfsspitz, Chow-Chow, Husky, Malamute, Pudel
Alopezie der Farbmutanten
Dobermann, Dackel, Yorkshire Terrier, alle Windhunde
Atopische Dermatitis
Dalmatiner, Boxer, Retriever, Terrier, WHWT
Bakterielle Follikulitis
Kurzhaarrassen, Shar-Pei, Bordeauxdogge
Demodikose
Dobermann, Mops, Shih Tzu, Bordeauxdogge, Bull Terrier, Boxer, Shar-Pei
Dermatophytose
Perser und Katzen im Allgemeinen, Yorkshire Terrier
Diskoider Lupus erythematodes
Deutscher Schäferhund, Collie, Sheltie
Hyperadrenokortizismus
Pudel, Yorkshire Terrier, Französische Bulldogge, kleine Hunde im Allgemeinen, Boxer, Dackel
Hypothyreose
Riesenschnauzer, Neufundländer, mittlere und große Hunde im Allgemeinen, Boxer
Intertrigo
Französische und Englische Bulldogge, Shar-Pei, Mops, Shih Tzu, Pekingese
Kinnakne
Dobermann, Boxer, Dänische Dogge, Bordeauxdogge
Malassezia
-Dermatitis
WHWT, Basset Hound, Pudel, Cocker, Rex-Katzen
Pododermatitis
Englische Bulldogge, Bull Terrier, Boxer, Kurzhaarrassen
Schablonenkrankheit
Dackel, Boxer, Französische Bulldogge, Pitbull, Dobermann, Kurzhaarwindhunde
Tiefe Pyodermien
Englische Bulldogge, Bullterrier, Boxer, Kurzhaarrassen
Vitiligo
Englische Bulldogge, Rottweiler, Boxer, Belgischer Schäferhund, Dobermann
Zinkmangelsyndrom
Husky, Malamute
Ähnliches kann man auch für verschiedene Altersgruppen erwägen. Die Tabelle 3.4 sollte jedoch nur als Hinweisliste betrachtet werden.
Tabelle 3.4: Prädisposition von Altersgruppen für einige dermatologische Erkrankungen
Altersgruppe
Erkrankung
Welpe
Demodikose, Dermatophytose,
Cheyletiella
-Dermatitis, Futtermittelallergie, angeborene Krankheiten, Naevus, ektodermale Defekte, Impetigo, juvenile Zellulitis, Dermatomyositis
Jungtier (1–3 Jahre)
Flohbissallergie, atopische Dermatitis, oberflächliche Pyodermie, nicht-entzündliche und nicht-hormonbedingte Alopezien (Alopezie der Farbmutanten, Schablonenkrankheit, saisonale Flankenalopezie, Alopezie X)
Ausgewachsenes Tier (4–7 Jahre)
Schäferhund-Pyodermie, Hypothyreose, Autoimmunkrankheiten
Ältere Tiere (> 8 Jahre)
Hyperadrenokortizismus, epitheliotropes Lymphosarkom
Das Geschlecht und die Frage nach der Kastration liefern nur selten einen entscheidenden Hinweis bei der Diagnosefindung (Tab. 3.5).
Tabelle 3.5: Prädisposition des Geschlechts für einige dermatologische Erkrankungen
Nicht-kastrierter Rüde/Kater
• Verweiblichungssyndrom des Rüden durch Hodentumoren
• Verletzungen und Abszesse beim Kater durch Kämpfe, tiefe Mykosen und Infektionen durch atypische Bakterien
• durch Kastration behebbare Alopezie des Rüden
• Zirkumanaldrüsenadenome
• »Hengstschwanz«
Nicht-kastrierte Hündin/Katze
• nicht-entzündliche Alopezie durch Ovarialzysten oder -tumoren
• Mammatumoren und kutane Metastasen von Mammatumoren
• Analdrüsenkarzinome
• Rekrudeszenz oder Remission einiger Dermatopathien während der Läufigkeit oder der Trächtigkeit
• telogenes Effluvium post partum
3.2Anamnese
Eine gute allgemeine und dermatologische Anamnese bedingt etwa 70% der Diagnose (Tab. 3.6). Das Aufarbeiten der längeren wie der kürzeren Vergangenheit und das Dokumentieren der schon verabreichten Medikamente sind Schlüsselelemente dieser Erhebung.
Die Frage nach dem »Warum« des Tierarztbesuches setzt den Auftakt. Diese Information ist sehr wichtig, um zu erfahren, welches Problem vom Tierbesitzer als größte Belastung oder welches klinisches Symptom als besonders gravierend empfunden wird. Wenn es hier gelingt, rasch eine Lösung herbeizuführen, wird man den somit zufriedengestellten Besitzer besser zur Mitarbeit für die verbleibende Problemliste gewinnen können.
Tabelle 3.6: Erkennungsbogen zur Anamnese
Es folgen einige allgemeinere Fragen über das Tier: »Wie alt war das Tier zum Zeitpunkt der Anschaffung?« (mit der Antwort auf diese Frage kann man die Glaubwürdigkeit von Aussagen zu Beobachtungen über die weiter zurückliegende Vergangenheit besser einschätzen), über Krankheiten in der Vergangenheit (z. B. Ohrentzündungen), über Reisen in Gegenden mit endemischen Krankheiten (Leishmaniose, Ehrlichiose usw.), familiäre Prädisposition für Hauterkrankungen (wichtig für Allergien, Demodikose und andere ansteckende Krankheiten). Es ist von Bedeutung zu verstehen, wie und ob sich der Besitzer um sein Tier kümmert: jährliche Impfung, regelmäßige Kotuntersuchungen auf Parasiten und, falls notwendig, die Prophylaxe gegen die kardiopulmonale Dirofilariose.
Anschließend versucht man sich ein Bild über die Lebensumstände und -gewohnheiten des Tieres zu machen: Was frisst das Tier, wo lebt es, gibt es andere Tiere, mit denen es engeren Kontakt hat, und gibt es bei diesen oder bei deren Besitzern Hautveränderungen? Dann werden die physiologischen Körperfunktionen abgeklärt: Frisst das Tier mit Appetit, wie viel trinkt es (Hyperadrenokortizismus), wie oft werden Urin und Kot abgesetzt, gibt es hier Besonderheiten, wie ist das Allgemeinverhalten? Bei weiblichen Tieren erkundigt man sich nach den Läufigkeiten: Verlaufen sie still oder stellen sich im Anschluss Scheinträchtigkeiten ein? Bei männlichen Tieren wird nach dem Interesse für läufige Weibchen gefragt und ob es beim Harnabsatz des Rüden zum Heben des Beines kommt (im Zusammenhang mit Hodentumoren, die mit einer Verweiblichung einhergehen).
Erst jetzt beginnt die dermatologische Anamnese: Seit wann besteht das Problem und in welchem Alter sind erstmals Symptome aufgetreten (s. Tab. 3.4). Für die Beurteilung des Geschehens sind folgende Informationen entscheidend: Juckreiz, der schon seit Jahren besteht, spricht eher für ein allergisches Problem. Wenn das Entstehen des Juckreizes jüngeren Datums ist, so liegt der Verdacht eines parasitären Befalls nahe. Das jahreszeitliche Auftreten von Symptomen führt zum Verdacht von Parasitenbefall (Flöhe, Zecken) oder atopischer Dermatitis, im Falle von bilateral symmetrischem Haarausfall an den Flanken sollte man an eine zyklische Flankenalopezie denken.
In Bezug auf die zeitliche Entwicklung der Effloreszenzen ist es wichtig, Informationen über Beginn, Ort des Ersterscheinens, Veränderungen und Ausbreitung bis zum Zeitpunkt des Besuchs beim Tierarzt zu erfragen. Anhand solcher Auskünfte ist es oft möglich, Primärerkrankungen von sekundären Infektionen wie z. B. mit Bakterien oder Hefen zu unterscheiden.
Eine etwas genauere Ausführung verdient das Symptom Juckreiz: Schweregrad (Tab. 3.7) und topographische Lokalisation (Tab. 3.8) sind von besonderer Bedeutung. Hochgradigen Juckreiz findet man bei Sarcoptes-Räude, schweren Allergien (z. B. Futtermittelallergie der Katze) oder schweren bakteriellen und durch Hefen bedingten Infektionen. Nicht sekundär infizierte Atopien, hormonelle Dermatitis oder Demodex-Räude mit sekundärer Bakterienbeteiligung sind oft von mittelgradigem Juckreiz begleitet. Nicht-infektiöse Alopezien, hormonelle Erkrankungen, Demodikosen und Leishmaniosen, die nicht durch Sekundärinfektionen mit Bakterien oder Hefen überlagert sind, jucken selten bzw. gar nicht.
Tabelle 3.7: Intensität des Juckreizes bei verschiedenen veterinärdermatologischen Erkrankungen
Grad des Juckreizes
Erkrankung
Ohne Befund
• nicht-entzündliche Alopezien
• Endokrinopathien ohne Komplikationen
• Leishmaniose
• Demodikose ohne Komplikationen
• Dermatophytose ohne Komplikationen
Mittelgradig
• atopische Dermatitis ohne Komplikationen
• Futtermittelallergie normalen Schweregrades
• bakterielle Infektionen
• ggr. Malassezia-Dermatitis
• Demodikose mit Pyodermie
• Endokrinopathie mit Pyodermie
•Cheyletiella-Dermatitis
Hochgradig
•Sarcoptes-Räude des Hundes
• ggr. Malassezia-Dermatitis
• hgr. Futtermittelallergie (besonders bei der Katze)
• einige Fälle von Pemphigus foliaceus
•Notoedres-Räude der Katze
Tabelle 3.8: Lokalisation des Juckreizes bei verschiedenen veterinärdermatologischen Erkrankungen
Lokalisation des Juckreizes
Erkrankung
Rücken
• Flohbissallergie
•Cheyletiella-Dermatitis
• selten Futtermittelallergie
• bakterielle Follikulitis bei Kurzhaarrassen
Pfoten, Gesicht, Ohren, Augen, Bauch
• atopische Dermatitis (Hund)
• Futtermittelallergie (Hund)
• Kontaktallergie (selten)
Kopf
• Ohrräude
• Futtermittelallergie (Katze)
•Notoedres-Räude
Hals
• Flohbissallergie (Katze)
• Futtermittelallergie (Katze)
Abdomen (Katze, Alopezie durch übermäßige Fellpflege)
• atopische Dermatitis
• Flohbissallergie
• Futtermittelallergie
• Flohbissdermatitis
•Cheyletiella-Dermatitis
Laterale Extremitäten (Hund)
•Sarcoptes-Räude
Das Gefühl des Juckreizes wird individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen und ist auch rasseabhängig, sodass nervöse Tiere (z. B. Deutscher Schäferhund) bei gleichem Schweregrad der Krankheit mehr Juckreiz entwickeln können als ruhigere (z. B. Englische Bulldogge).
Juckreiz am Rücken und auf der Kruppe ist sehr häufig Symptom einer Flohbissallergie, manchmal einer Cheyletiella-Dermatitis oder einer Futtermittelallergie. Wenn man insbesondere beim Hund Juckreiz an den Körperspitzen (Pfoten, Kinn, Lippen, Ohren und Augen) und an den ventralen Körperflächen findet, so sollte an Atopie und an Futtermittelallergie gedacht werden. Bei der Katze findet man Juckreiz am Kopf gepaart mit der Futtermittelallergie, der Otodectes- und der Notoedres-Räude. Effloreszenzen am Hals treten bei Katzen auch im Verlauf einer Flohbissallergie auf. Starker Juckreiz am gesamten Körper inklusive der Lateralflächen der Extremitäten ist ein Hinweis für die Sarcoptes-Räude des Hundes.
Abschließend erfragt man vom Besitzer eine möglichst vollständige Liste der topischen und systemischen Medikationen, die dem Tier im Zusammenhang mit dermatologischen Problemen verabreicht wurden. Idealerweise erfährt man neben dem Präparat auch Dosierung, Behandlungsdauer, Wirkung und Länge der Periode zwischen Absetzen des Medikamentes und Rückfall der Erkrankung. Besonders wichtig sind die Informationen in Bezug auf Antibiotika, da primäre und sekundäre Pyodermien zumindest beim Hund einen Großteil der dermatologischen Fälle stellen. Von geringer Bedeutung sind Informationen in Bezug auf Antibiotika, wenn
▶ das verabreichte Antibiotikum nicht Betalactamase-resistent (z. B. kein potenziertes Amoxicillin) war;
▶ das Antibiotikum weniger als 20 Tage bei oberflächlichen und weniger als 40 Tage bei tiefen Hautentzündungen verabreicht wurde;
▶ das Antibiotikum zusammen mit einem Glukokortikoid verabreicht wurde;
▶ das Antibiotikum unterdosiert verabreicht worden ist (Näheres zur Antibiotika-Therapie s. Kap. 30).
Auskünfte zu durchgeführten Therapien mit Glukokortikoiden sind nur dann von Bedeutung, wenn sich dadurch die klinische Symptomatik verschlechtert hat, da man bei den meisten dermatologischen Krankheiten mit Kortisonen aufgrund ihrer entzündungs- und juckreizhemmenden Wirkung eine Verbesserung erfährt.
Antiparasitika sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden Therapieplanes. Vom Besitzer sollte man Folgendes ermitteln:
▶ Namen des Produktes
▶ Verabreichungsform (Spray oder Spot-on)
▶ Anwendungsfrequenz in Sommer und Winter
▶ Mitbehandlung von anderen Tieren, die in der Familie leben
▶ Behandlung der Umgebung
▶ fielen Therapie und Baden zusammen
▶ Anzahl der Bäder, Shampooapplikationen und Schwimmgewohnheiten des Tieres in den Behandlungsintervallen
Nur eine gründliche Anamnese erlaubt es, Lücken in der Behandlung parasitärer Infektionen zu finden und den Besitzer zu überzeugen, Antiparasitika gezielter einzusetzen.
3.3Dermatologische Untersuchung
Die dermatologische Untersuchung beginnt tatsächlich schon mit der Erhebung der Anamnese, bei der man sich nur vordergründig nicht mit dem Tier beschäftigt. Da sich das Tier in dieser Zeit nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit fühlt, hat es die Möglichkeit zur Entspannung und man kann das Verhalten beobachten: Kratzt sich das Tier? Wenn ja, so ist dies ein Zeichen für starken Juckreiz (z. B. bei Sarcoptes-Räude), da normalerweise Tiere mit mittelgradigem Juckreiz von der ungewohnten Umgebung so stark abgelenkt sind, dass sie sich weder kratzen noch lecken. Wenn im Unterschied dazu ein Tier an der Umgebung kein Interesse zeigt, ja vielleicht sogar einschläft (ein nicht zu erwartendes Verhalten in einer Tierarztpraxis, wo Tiere sonst nervös und aufgeregt sind), kann die Ursache in einer Schilddrüsenunterfunktion oder einer anderen systemischen Erkrankung liegen.
Während der eigentlichen dermatologischen Untersuchung muss man anfangs das Tier als Ganzes beurteilen, insbesondere:
▶ Ernährungszustand
▶ Haarglanz
▶ Haardichte
▶ Haarfarbe (Handelt es sich um einen Farbmutanten? Gibt es Körperregionen, die eine unnatürliche Färbung aufweisen, wo gibt es abgeleckte Bereiche?)
▶ Geruch des Fells und der Haut
▶ Lokalisierung der sichtbaren Effloreszenzen
Anschließend unterzieht man das gesamte Fell und die Haut einer gründlichen Untersuchung.
Die Autoren folgen hier einer standardisierten Reihenfolge, um keine Region des Körpers zu vergessen.
1) Untersucher stellt sich hinter das Tier:
▶ Untersuchung von der Schwanzwurzel über den dorsalen Thorax bis zum Hals
▶ Untersuchung der Schwanzunterseite, rund um den Anus, Perianalbezirk, bei weiblichen Tieren Perivaginalbezirk
▶ Hinterextremitäten (Ertasten von eventuellen linearen Granulomen)
▶ kaudale Pfoten mit Untersuchung aller dorsalen und plantaren/palmaren Zwischenzehenbereiche sowie der Krallenbette (bei der Katze sollten alle Krallen ausgefahren werden)
2) Untersucher stellt sich seitlich des Tieres:
▶ Untersuchung der seitlichen Thoraxwand und des seitlichen Halses, der dazugehörigen Vorderextremitäten mit Pfote
▶ Untersuchung des Ohres und Beurteilung des Geruchs
▶ Wiederholung auf der anderen Körperseite
3) Tier in Seitenlage, die Extremitäten sind dem Untersucher zugewandt:
▶ Untersuchung der medialen Flächen der Hinterextremitäten, der Leiste und der Bauchwand
▶ Untersuchung der äußeren Genitalien mit Ausschachten des Penis und Adspektion der Vulva
▶ Untersuchung der ventralen Thoraxwand und der Axilla sowie der medialen Flächen der Vordergliedmaßen
Abb. 3.1Mit einer Pinzette kann man die Haare scheiteln, um die darunter liegende Haut sichtbar zu machen.
4) Untersuchung seitlich und von vorne:
▶ Untersuchung des Kopfes inklusive der Konjunktivalschleimhäute und der Maulöffnung
Will man bei mittel- und langhaarigen Hunden die Haut untersuchen, so kann man sich mit einer Bajonettpinzette helfen. Mit ihrer Hilfe wird das Haar gescheitelt und die Haut sichtbar gemacht (Abb. 3.1). Neben der Adspektion sollte auch eine Palpation der Haut am ganzen Körper vorgenommen werden, da das Fell Effloreszenzen verdecken kann und diese nur mittels der Palpation wahrgenommen werden.
Tabelle 3.9: Datenerfassungsblatt für die dermatologische Untersuchung
Abb. 3.2Macula erythematosa.
Abb. 3.3Erythroderma. Die Färbung verschwindet nicht durch Druck (Diaskopie). Hier durch Blutung in der Haut hervorgerufen.
Lokalisation und Art der Effloreszenzen werden auf einem Datenblatt erfasst. Damit kann man bei Folgeuntersuchungen den Fortschritt beurteilen (Tab. 3.9)