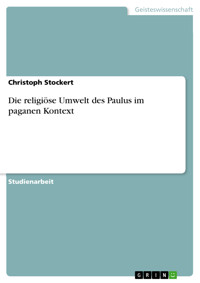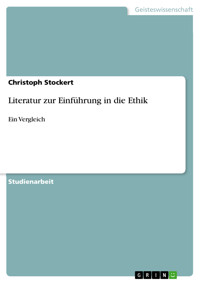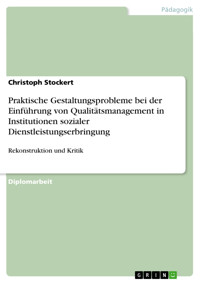
Praktische Gestaltungsprobleme bei der Einführung von Qualitätsmanagement in Institutionen sozialer Dienstleistungserbringung E-Book
Christoph Stockert
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Pädagogik - Allgemein, Note: 1,0, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg (Sozialpolitik und Organisation sozialer Dienstleistungen), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit setzt sich mit Qualitätsmanagement in Einrichtungen Sozialer Arbeit auseinander. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Einführung von Qualitätsmanagement in einer solchen Einrichtung, wobei jedoch auch die Gründe, die die Geschäftsführung zu einer derartigen Entscheidung veranlassen können, zur Sprache kommen sollen. In der gegenwärtigen Fachliteratur sind bereits einige Abhandlungen dieses Themenbereiches zu finden . Jedoch haben sich die jeweiligen AutorInnen entweder nur theoretisch damit auseinander gesetzt oder aus verschiedenen Einrichtungen einige Beispiele zur Erläuterung des Implementationsprozesses gewählt. Diese Arbeit soll die Einführung eines QM-Systems in eine soziale Einrichtung vom „ersten Bleistiftstrich“ bis zur Erteilung des Zertifikates anhand einer einzigen konkreten beispielhaften Einrichtung verdeutlichen, die jedoch einen fiktiven Charakter besitzt. Eine derartige Auseinadersetzung mit dem Qualitätsthema ist bisher in der Literatur noch kaum zu finden. Daher wird sich diese Arbeit auch als Leitfaden für soziale Einrichtungen eignen, die Überlegungen anstellen, ein QM-System einzuführen. Jedoch ist sie nicht nur als reines Hilfsmittel gedacht, sie soll sich auch kritisch mit dem Qualitätsbegriff, den normativen Grundlagen und ihrer Bedeutung für die Soziale Arbeit auseinandersetzen und zu einer kritischen Denkweise ihnen gegenüber anregen. Darüber hinaus soll in diesem Zusammenhang der bisweilen recht komplexe Qualitätsbegriff mit dem ihm in dieser Hinsicht in nichts nachstehenden Begriff der sozialen Dienstleistung zur Passung gebracht werden. Dieser Prozess stellt die elementarste Voraussetzung dar, damit ein QM-System sich in einer Institution sozialer Dienstleistungserbringung überhaupt etablieren und seine volle Wirksamkeit erlangen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Page 2
! !∀∀ # ∃ % & ∀ ∋ ∀∀∀ &
()%∗ ! ∀∀∋ ) + ∃ % , − ), . #∋ −
/0 ∀# % ∀# 1 #& ∗ ) ! /00 #& ∀∀∀∋ % + ∗ )∀∀ ∃ % ∀2 ) ∗ ,∗+ ,∗(3 %∋ 4 ∃ % ∀#& 5 1 . ∀# & ∗ ) ∃ % 6 7∀∀∀ 8 ∗ ! 9 # %∀∀ 5 ∗ ): ; (∀##7
:,)) ∀∀7 ∋∋
) ∀# %∋
<1 + ∗= ∀∀ ( ## ∗ & 6 > 2 ∋ & 1−+ ∀∋∋− ,! ∀= ∗& ∀ ∀1∗ + )%( ( =∀# ∋ << 5 ∋, ∀ ∗∀ ()! % ∋
&
Page 3
<1 #−+ ∀∋∋∀ ∀# ? ; ∋
.∗∗∗2 ≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ Α
&&
Page 5
3.3.3 Effizienz und Effektivität 36 38 3.3.4 Die KundInnen sozialer Dienstleistungen 3.3.5 Die Normenreihe DIN EN ISO 9000 ff. 40
3.3.6 Das Modell der European Foundation for Quality Management 44
3.3.7 Total Quality Management 49
3.4 Die KickOff-Veranstaltung 53
3.4.1 Entwicklung eines Qualitätsbewusstseins 53
3.4.2 Beschäftigung mit Einwänden und Widerständen 56
3.4.3 Gemeinsame Entwicklung eines Leitbildes 58
3.5 Personalwahl und Gremienbildung 60 3.5.1 QM-Beauftragter 61 3.5.2 Lenkungsausschuss 63 3.5.3 Steuergruppe 63 3.5.4 Qualitätszirkel 64
3.6 Ist-Analyse des bereits vorhandenen Qualitätsprofils 65
3.7 Festlegung der Qualitätskritierien 68
3.8 Herstellung der Überprüfbarkeit der Qualitätskriterien 72
3.9 Analyse und Gestaltung der Prozesse 76
3.10 Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems 80
3.10.1 Qualitätsmanagementhandbuch 83
3.10.2 Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen 85
4 Implementationsphase 86
5 Auditierung des QM-Systems 88 5.1 Internes Audit 89 5.2 Externes Audit 90
6 Zusammenfassung und Schlussbemerkung 93
Literaturverzeichnis 96
Anhang 101
Page 6
Page 7
Page 8
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O. am angegebenen Ort Abb. Abbildung Abs. Absatz bezügl. bezüglich BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BSHG Bundessozialhilfegesetz bspw. beispielsweise bzw. beziehungsweise ca. circa DGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. DIN Deutsches Institut für Normierung d.h. das heißt EDV Elektronische Datenverarbeitung EN Europäisches Komitee für Normung EFQM European Foundation for Quality Management etc. et cetera f. folgende Seite ff. folgende Seiten GG Grundgesetz gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haft Hrsg. Herausgeber i.d.R. in der Regel ISO International Organisation for Standardisation QM Qualitätsmanagement QM-Beauftragter Qualitätsmanagementbeauftragter QM-Handbuch Qualitätsmanagementhandbuch QM-System Qualitätsmanagementsystem Kap. Kapitel KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII) o.g. oben genannte PQsG Pflegequalitätssicherungsgesetz S. Seite
Page 9
SGB Sozialgesetzbuch TQM Total Quality Management z.B. zum Beispiel
§ Paragraph §§ Paragraphen
Page 1
1. Einleitung
Die Bundesrepublik Deutschland als Sozialstaat befindet sich in einem Wandel. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Medien nicht von steigenden Arbeitslosenzahlen und Massenentlassungen sowohl in kleinen und mittelständischen Unternehmen als auch in großen global agierenden Konzernen berichten. Die zunehmende Globalisierung hat die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zum Handeln gedrängt. Daraus resultierten viele Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch in den sozialen Dienstleistungsangeboten des Staates und der privaten Träger.
Angesichts nicht unerheblicher Budgetengpässe wird von Seiten des Staates massiv Druck auf die Institutionen sozialer Dienstleistungserbringung ausgeübt. Dieser Druck zielt im formalen Sinne auf die Steigerung der Produktivität sozialer Dienstleistungen, in Wirklichkeit zwingt er die Verantwortlichen im sozialen Bereich, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit die Rationalisierungsmaßnahmen nicht zu einer Verschlechterung der Qualität führen und zu Lasten der AdressatInnen sozialer Dienstleistungserbringung gehen (Badelt, 1995). In diesem Zusammenhang
Es ist unbedingt erforderlich, dass die Institutionen sozialer Dienstleistungserbringung ein Selbstverständnis dahingehend entwickeln, dass sie sich als Anbieter von Dienstleistungen betrachten, die in hohem Maße auf Kundenzufriedenheit1und eine entsprechende Nachfrageorientierung der KundInnen2hinsichtlich des Dienstleistungsangebotes angewiesen sind. Mittlerweile stehen sich Einrichtungen Sozialer Arbeit3daher zunehmend Konkurrenzanbietern gegenüber (Gitschmann, 1999). Die Vergabe von Förderverträgen von Seiten der Finanzierungsträger an die Leistungsträger ist beispielsweise im Bereich der
1Als KundInnen werden hier die Empfänger Sozialer Dienstleistungen bezeichnet. Darüber hinaus können aber
auch Mitarbeiter innerhalb einer Institution oder auch Kostenträger Kunden darstellen. Eine ausführliche
Auseinendersetzung mit dem Kundenbegriff findet sich in Kap. 3.3.4.
2Diese Schreibweise wird angewendet, sofern das Geschlecht im jeweiligen Zusammenhang unerheblich ist
oder es sich um Gruppen beiden Geschlechts handelt. In anderen Fällen findet die männliche oder weibliche
Form ganz bewusst Verwendung.
3Die Bezeichnungen Institution sozialer Dienstleistungserbringung und Einrichtung Sozialer Arbeit werden in
dieser Arbeit synonym verwendet.
Page 2
Kinder- und Jugendhilfe zunehmend davon abhängig, ob die jeweilige Einrichtung ein QM-System4betreibt und in dieser Hinsicht auch rechtlich fixiert (Merchel, 2004; Schefold, 2005) Aus diesem Grund kann es sich heutzutage eine Institution sozialer Dienstleistungserbringung kaum noch leisten, über die Einführung und den Betrieb eines QM-Systems hinwegzusehen, sofern sie angehalten ist, über die Effektivität ihrer Prozesse Rechenschaft gegenüber dem Kostenträger abzulegen sowie Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -verbesserung zu ergreifen, um im Wettbewerb mit anderen Anbietern bestehen zu können. Jedoch ist es für die Einrichtungen der Sozialen Arbeit in der Regel noch relativ schwer, die Anforderungen und Normen im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement für ihren Bereich umzusetzen, da sie ursprünglich aus dem industriell-gewerblichen Sektor stammen (Merchel, 2004). Daher stellt mittlerweile die Entwicklung von geeigneten Konzepten zur Implementation und zum Betrieb von QM-Systemen in sozialen Institutionen sowie die Einbindung und Motivation der MitarbeiterInnen eine enorme Herausforderung für das Sozialmanagement dar.
1.1 Thematik der Arbeit
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit Qualitätsmanagement in Einrichtungen Sozialer Arbeit auseinander. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Einführung von Qualitätsmanagement in einer solchen Einrichtung, wobei jedoch auch die Gründe, die die Geschäftsführung zu einer derartigen Entscheidung veranlassen können, zur Sprache kommen sollen. In der gegenwärtigen Fachliteratur sind bereits einige Abhandlungen dieses Themenbereiches zu finden5. Jedoch haben sich die jeweiligen AutorInnen entweder nur theoretisch damit auseinander gesetzt oder aus verschiedenen Einrichtungen einige Beispiele zur Erläuterung des Implementationsprozesses gewählt. Diese Arbeit soll die Einführung eines QM-Systems in eine soziale Einrichtung vom „ersten Bleistiftstrich“ bis zur Erteilung des Zertifikates anhand einer einzigen konkreten beispielhaften Einrichtung verdeutlichen, die jedoch einen fiktiven Charakter besitzt. Eine derartige Auseinadersetzung mit dem Qualitätsthema ist bisher in der Literatur noch kaum zu finden. Daher wird sich diese Arbeit auch als Leitfaden für soziale Einrichtungen eignen, die Überlegungen anstellen, ein QM-System einzuführen. Jedoch ist sie nicht nur als reines Hilfsmittel gedacht, sie soll sich auch kritisch mit dem Qualitätsbegriff, den normativen Grundlagen und ihrer Bedeutung für die Soziale Arbeit
4Im Folgenden QM-System.
5An dieser Stelle sei beispielhaft verwiesen auf Merchel (2004), Meinhold/ Matul (2003) und Busse/ Riehle
(2003). Weitere AutorInnen werden im weiteren Verlaufe dieser Arbeit angeführt.
Page 3
auseinandersetzen und zu einer kritischen Denkweise ihnen gegenüber anregen. Darüber hinaus soll in diesem Zusammenhang der bisweilen recht komplexe Qualitätsbegriff mit dem ihm in dieser Hinsicht in nichts nachstehenden Begriff der sozialen Dienstleistung zur Passung gebracht werden. Dieser Prozess stellt die elementarste Voraussetzung dar, damit ein QM-System sich in einer Institution sozialer Dienstleistungserbringung überhaupt etablieren und seine volle Wirksamkeit erlangen kann.
1.2 Aufbau und Struktur der Arbeit
In Kapitel 2 soll zu Beginn die Institution vorgestellt werden, in der ein QM-System eingeführt werden soll. Kapitel 3 befasst sich mit der Vorbereitungs- und Planungsphase, in der es zunächst einmal um die Definition und Festlegung der grundsätzlichen Begrifflichkeiten sowie die Bildung von Qualitätskriterien und die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Normforderungen geht. Darüber hinaus werden hier auch Möglichkeiten zu einer effektiven Beteiligung der MitarbeiterInnen an der Konzeption des QM-Systems angesprochen. Kapitel 4 geht auf den eigentlichen Implementationsprozess ein, mit dessen Beginn all die neuen Prozess- und Verfahrensbeschreibungen sowie alle anderen Vorgaben und Richtlinien ihre Gültigkeit erlangen. In Kapitel 5 wird die Auditierung des QM-Systems beschrieben. Den Abschluss findet die Arbeit in Kapitel 6 mit der Zusammenfassung und Schlussbemerkung. An dieser Stelle sollen noch einmal die wesentlichen Erkenntnisse aufgegriffen werden. Der Aufbau der einzelnen Kapitel dieser Arbeit stellt sich wie folgt dar:Kapitel 2:Hier wird zunächst die Einrichtung und ihre Gliederung vorgestellt, an deren Beispiel die Einführung eines QM-Systems vollzogen werden soll. Abschnitt 2.1 erläutert die Art der Finanzierung der Einrichtung, während in Abschnitt 2.2 auf die Zielgruppe eingegangen wird. In Abschnitt 2.3 werden die Dienstleistungen der Einrichtung beleuchtet. Schließlich geht der Abschnitt 2.4 noch auf die Gründe ein, die die Einführung von Qualitätsmanagement in eine Einrichtung Sozialer Arbeit rechtfertigen können, bei denen es sich sowohl um interne als auch um externe Aspekte handeln kann.Kapitel 3:Der Prozess der Einführung von Qualitätsmanagement beginnt mit der Planungs-und Vorbereitungsphase, in der es um die Konzeption des Systems geht. Es müssen sich Gedanken über dessen Ziele, seine normativen und begrifflichen Grundlagen sowie über den zeitlichen Rahmen und das erforderliche Personal gemacht werden. Abschnitt 3.1 geht erst einmal auf den Zweck des QM-Systems ein, der konkret in der Einrichtung verfolgt wird. Eine Projektskizze wird in Abschnitt 3.2 dargestellt, in der einige grundsätzliche
Page 4
Rahmendaten enthalten sind, die für die weitere Planung zu berücksichtigen sind. Dem Abschnitt 3.2 sind die Definitionen der wesentlichen Begriffe zu entnehmen, die im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement häufig Verwendung finden. Vor allem der Qualitätsbegriff und der Bergriff des QM-Systems selbst bedürfen einer genauen Reflexion hinsichtlich ihrer Bedeutung für das eigene soziale Arbeitsfeld. In Abschnitt 3.4 wird die KickOff-Veranstaltung für die MitarbeiterInnen thematisiert. Sie dient in erster Linie dazu, die MitarbeiterInnen für das Qualitätsthema zu sensibilisieren und ihr Qualitätsbewusstsein zu fördern. Abschnitt 3.5 bezeichnet die Personal- und Gremienwahl. Um die Funktion eines QM-Systems gewährleisten zu können, bedarf es eines gewissen Umfangs an Funktionspersonal, das diesbezüglich eine erhöhte Verantwortung übertragen bekommt. Abschnitt 3.6 befasst sich mit der Durchführung einer Bestandsaufnahme des aktuellen Qualitätsprofils der Einrichtung. In Abschnitt 3.7 soll auf die Festlegung der Qualitätskriterien eingegangen werden, die spätere eine wesentliche Rolle bei der Bewertung des QM-Systems spielen werden. Abschnitt 3.8 stellt die Art und Weise dar, wie die zuvor festgelegten Qualitätskriterien operationalisiert werden können. Abschnitt 3.9 widmet sich der Prozessanalyse, die zur Festlegung und Klassifizierung der elementaren Prozesse der Einrichtung dient. Schließlich geht Abschnitt 3.10 noch auf die Dokumentation des QM-Systems ein.
Kapitel 4:An dieser Stelle wird die Implementationsphase dargestellt, deren Beginn den Zeitpunkt markiert, an dem das QM-System mit all seinen Anweisungen, Richtlinien und Vorgaben in Kraft tritt und für die weitere Arbeit in der Einrichtung bindend ist.Kapitel 5:Nachdem das QM-System nun eingeführt worden ist, muss es nach einiger Zeit auch auditiert werden, um zu überprüfen, um seine Instrumente ihre beabsichtigte Wirksamkeit erlangt haben und die Normvorgaben erfüllt worden sind. Abschnitt 5.1 geht zunächst auf das interne Audit ein, dass von den eigenen MitarbeiterInnen der Einrichtung durchgeführt wird. Schließlich ist Abschnitt 5.2 noch das externe Audit zu entnehmen, das bei einem erfolgreichen Abschluss mit der Zuerkennung des Zertifikates endet, jedoch in gewissen Abständen erneut durchgeführt werden muss, um die fortwährende Funktion des QM-Systems und die Erfüllung der ihm zugrunde liegenden normativen Vorgaben zu gewährleisten.
Page 5
2. Die Institution und ihre Struktur
Bei der Einrichtung6, in die ein QM-System eingeführt werden soll, handelt es sich um ein Internat, das an eine Schule7für Körperbehinderte angeschlossen ist. Die Schule besitzt die Eigenschaft einer staatlich anerkannten Privatschule, die mit dem Internat eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung bildet. Sie befindet sich in freier Trägerschaft eines privaten Dienstleistungskonzerns.
Das Internat verfügt über eine eigene Leitung, untersteht aber der Geschäftsführung der Schule. Es hat insgesamt 225 Plätze zur Verfügung, die sich auf 15 Wohngruppen mit jeweils 15 HeimbewohnerInnen verteilen. Die 15 BewohnerInnen innerhalb einer Wohngruppe sind wiederum in jeweils 4 Doppel- und 7 Einzelzimmern untergebracht. Die MitarbeiterInnen pro Wohngruppe setzen sich dabei aus einem Wohngruppenleiter, einer Pflegekraft und zwei BetreuerInnen zusammen. Die Leitung des Internats obliegt dem Internatsleiter und seinem Stellvertreter und der Pflegedienstleiter ist für die Organisation der Pflege verantwortlich.
Abb. 01: Organigramm des Internats (eigene Darstellung)
6Die Einrichtung orientiert sich hinsichtlich ihrer Struktur an der Stephen-Hawking-Schule gGmbH in
Neckargemünd, ist mit ihr jedoch nicht identisch.
7Auf die Schule soll - abgesehen von der Geschäftsführung - im Laufe der Arbeit nicht näher eingegangen
werden, da die Einführung eines QM-Systems nur das Internat betrifft.
Page 6
2.1 Finanzierung
Das Internat finanziert sich über die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aus dem Sozialgesetzbuch8XII gemäß der Paragraphen953 Absatz101, 54 Abs. 1 Nr.1 sowie 92 Abs. 2 Nr. 211. Bei den Kostenträgern handelt es sich um die Sozialämter der Stadt- und Landkreise12im Einzugsgebiet des Internats. Die Pflegesätze13, die im Rahmen der Eingliederungshilfe mit den Kostenträgern vereinbart wurden, unterscheiden sich hinsichtlich der Hilfebedarfsgruppe, in die die jeweiligen HeimbewohnerInnen eingestuft sind, in Hilfebedarfsgruppe 1 und 2.14
Abb. 02: Übersicht der Pflegesätze15(eigene Darstellung)
Ein Pflegesatz teilt sich in drei Pauschalen auf. Die Investitionspauschale bezieht sich dabei auf betriebliche Investitionen, wie z.B. medizinische Geräte, EDV-Systeme oder Sport bzw. Spielgeräte. Für die Instandhaltung des Internatsgebäudes und die Bereitstellung der Verpflegung ist die Grundpauschale vorgesehen. Schließlich ist noch die Maßnahmenpauschale zu erwähnen, die für die jeweils erforderlichen Betreuungsmaßahmen
8Im Folgenden SGB.
9im Folgenden mit „§“ bezeichnet, beim Bezug auf mehrere Paragraphen mit „§§“
10Im Folgenden Abs.
11Siehe dazu Bundessozialhilfegesetz (BSHG) §§ 39 Abs. 1, 40 Abs.. 1 Nr. 4 sowie 43 Abs. 2.
Im Zuge des „Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch“ vom 27.12.2003, welches
in seinen wesentlichen Teilen zum 01.01.2005 in Kraft trat, wurde das BSHG reformiert und in das SGB XII
überführt. Eine genaue Darstellung der wesentlichen Änderungen findet sich bei Marburger (2005, S. 42 ff.)
12Siehe dazu BSHG § 100 Abs. 1 Nr.1 und SGB XII § 97 Abs. 1
13„Der Pflegesatz […] hat nicht mehr die Funktion, Kosten in weitgehender Abstraktion von erbrachten
Leistungen zu ersetzen, sondern konkrete vollstationäre oder teilstationäre Pflegeleistungen zu vergüten und
zwar differenziert nach dem Versorgungsaufwand, den der Pflegebedürftige nach Art und Schwere seiner
Pflegebedürftigkeit benötigt.“ (Bundestags-Drucksache 12/5262, 1993, S. 144)
14Da die Bewohner des Internats entweder in Hilfebedarfgruppe 1 oder 2 eingestuft sind, besitzen die übrigen
Hilfebedarfsgruppen in diesem Zusammenhang keine Relevanz und werden nicht aufgeführt.
15Die hier beispielhaften Pflegesätze sind rein fiktiv gewählt, orientieren sich jedoch an den in dieser Hinsicht
gängigen Pflegesätzen.
Page 7
der HeimbewohnerInnen bestimmt sind. Die Höhe des Betreuungsaufwandes ist in diesem Zusammenhang das entscheidende Kriterium für die Einstufung in eine der in Abbildung 02 dargestellten Hilfebedarfsgruppen. In die Hilfebedarfsgruppe 1 eingestuft werden
„Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrmals in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen (erheblich Pflegebedürftige) […]“ (SGB XII § 64 Abs. 1)
Die Hilfebedarfsgruppe 2 betrifft
„Pflegebedürftige, die bei der Körperpflege der Ernährung oder der Mobilität für mehrere Verrichtungen mindestens drei mal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen (Schwer-Pflegebedürftige) […]“ (SGB XII § 64 Abs. 2)
Der Anteil, der HeimbewohnerInnen, die in die Hilfebedarfsgruppe 2 eingestuft sind, beträgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt ca. 30 Prozent. Es ist dabei zu beobachten, dass der Hilfebedarf der HeimbewohnerInnen allgemein zunimmt, wobei die Bereitschaft der Kostenträger, sie gegebenenfalls in die Hilfebedarfsgruppe 2 einzustufen, sich zunehmend verringert.