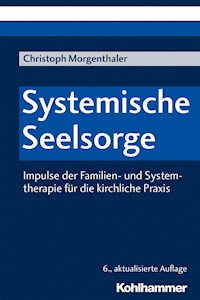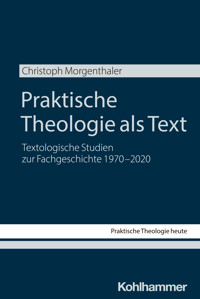
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Morgenthaler untersucht Texte und Textformationen aus fünf bewegten Jahrzehnten der Praktischen Theologie. Genaue Lektüren zeigen auf, wie sprachliche Gestalt und konzeptioneller Gehalt praktisch-theologischer Texte und Diskurse zusammenhängen. Historiografische Längsschnitte zeichnen nach, wie Praktische Theologie semantisch umgebaut wird und praktisch-theologische Themen und Erkenntnismittel werden und vergehen. Wissenschaftslinguistische Analysen legen offen, wie die Macht dieser Texte verfasst ist. Wissenschaftliche Autorschaft, Fallarbeit in der Seelsorge, praktisch-theologische Ritualistik, empirische Religionsforschung und die Theologie der Praktischen Theologie lassen sich so praxeologisch erhellen. Ebenso wie die Praxis, die Praktische Theologie fördern will, können auch die Lese- und Schreibpraktiken reflektiert werden, mit denen sie ihre Theorie der Praxis entwickelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Praktische Theologie heute
Herausgegeben von
Stefan AltmeyerChristian BauerMoritz EmmelmannKristian FechtnerThomas KlieHelga Kohler-SpiegelBenedikt KranemannIsabelle NothTeresa SchweighoferBirgit Weyel
Band Band 207
Christoph Morgenthaler
Praktische Theologie als Text
Textologische Studien zur Fachgeschichte 1970–2020
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-045780-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-045781-2
epub: ISBN 978-3-17-045782-9
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Morgenthaler untersucht Texte und Textformationen aus fünf bewegten Jahrzehnten der Praktischen Theologie. Genaue Lektüren zeigen auf, wie sprachliche Gestalt und konzeptioneller Gehalt praktisch-theologischer Texte und Diskurse zusammenhängen. Historiografische Längsschnitte zeichnen nach, wie Praktische Theologie semantisch umgebaut wird und praktisch-theologische Themen und Erkenntnismittel werden und vergehen. Wissenschaftslinguistische Analysen legen offen, wie die Macht dieser Texte verfasst ist. Wissenschaftliche Autorschaft, Fallarbeit in der Seelsorge, praktisch-theologische Ritualistik, empirische Religionsforschung und die Theologie der Praktischen Theologie lassen sich so praxeologisch erhellen. Ebenso wie die Praxis, die Praktische Theologie fördern will, können auch die Lese- und Schreibpraktiken reflektiert werden, mit denen sie ihre Theorie der Praxis entwickelt.
Prof. em. Dr. Dr. Christoph Morgenthaler lehrte Praktische Theologie an der Universität Bern.
Inhalt
Vorwort
1. Praktische Theologie schreiben und lesen
1.1 Praktische Theologie schreiben
1.1.1 Der gute und schöne Text
1.1.2 Praktische Theologie schreiben im Selbstversuch
1.1.3 Schreibpraxis und Praxis
1.2 Praktische Theologie lesen
1.2.1 Textologie praktisch-theologischer Texte
1.2.2 Textgenese und Historiografie
1.2.3 Text und Macht
1.2.4 Der empirische Umbau Praktischer Theologie
1.3 Vorgehen und Aufbau
1.4 Praktische Theologie des dritten Lebensalters
2. Autorschaft
2.1 Sich selbst neu lesen – ein Experiment
2.2 Selbstdarstellung als Genre
2.3 Autorschaft
2.4 Autorschaft, Intertextualität und Generation
2.5 Individualstil, Fachstil und Denkstil
2.6 Wissenschaft als Raum der Selbstthematisierung
2.7 Coda
3. Die ›Praxis‹ der Seelsorge im Fall
3.1 Unter der Strassenlampe – Textologie und Seelsorgelehre
3.2 Fallgeschichten und die Geschichte des Falls
3.2.1 Vom Fall zum Fallbeispiel
3.2.2 Zur Geschichte des Falls in der Poimenik
3.2.3 Fälle und Paradigmenwechsel
3.2.4 Fälle als ›Scharnierpraktiken‹ – das Fallbeispiel im interdisziplinären Vergleich
3.3 Die ›Praxis‹ im Fall – textwissenschaftliche Vertiefungen
3.3.1 Die Strittigkeit des Falls
3.3.2 Texttypen – Erzählung, Drama und das elektronische Patientendossier
3.3.3 Wahrheitsansprüche und Kommentar
3.3.4 Fallbeispiele im Textzusammenhang
3.4 Handeln im Fall
3.4.1 Das Figurenkabinett
3.4.2 Macht und Ohnmacht der Autor:innen
3.4.3 Macht und Subversion
3.5 Fälle und der empirische Umbau der Poimenik
3.5.1 Fallbeispiel, ›Praxis‹ und ›Empirie‹
3.5.2 Praktische Theologie als Fall
4. Die empirische Wendung der Religionspädagogik
4.1 Empirische Wendung – das Programm
4.2 Von der Wendung zur Wende und zurück
4.2.1 Der Transfer empirischen Wissens in die Religionspädagogik
4.2.2 Empirische Forschung in religionspädagogischer Eigenregie
4.2.3 Geschichten zur Geschichte der Wende
4.2.4 Doppelstufige historische Epistemologie
4.3 ›Empirie‹ – textwissenschaftlich
4.3.1 Welt als Textwelt – Mimesis
4.3.2 »Aber gerne auch beten« – Mimesis quantitativ
4.3.3 »Nach meinem Führerschein« – Mimesis qualitativ
4.3.4 Textpraktiken empirischer Forschung
4.3.5 Autorschaft und Leserschaft empirischer Texte
4.4 Empirie und die Handlungsmacht der Praktischen Theologie
4.5 Fächer als Membrane im empirischen Umbau
5. ›Das Ritual‹ – Praktisch-theologische Ritualistik
5.1 Textologie eines Klappentextes
5.2 Ritual im Werden – historiografische Perspektiven
5.2.1 Karriere eines Begriffs
5.2.2 Kasualien – rituell aufgefrischt
5.3 ›Das Ritual‹ in textologischer Perspektive
5.3.1 Vom Werden einer ›wissenschaftlichen Tatsache‹
5.3.2 Geschichtlichkeit des Ungeschichtlichen
5.3.3 Textoberfläche und Textgenese
5.3.4 Sinnbezirk Ritualistik
5.4 Rituelle Macht
5.5 Ritual als ›Scharnierbegriff‹
6. Die Theologie der Praktischen Theologie
6.1 Rechtfertigung von Lebensgeschichten
6.1.1 Lektüre eines »Klassikers«
6.1.2 Form und argumentative Kraft
6.1.3 Aufstieg in den Textkanon
6.2 Theologie und Empirie im Kasualdiskurs
6.2.1 Von der Lücke zum neuen Entwurf
6.2.2 Empirie – die Stimmen der Anderen
6.2.3 Theologie – Rechtfertigung & Co.
6.2.4 Kasualtexte als Metatexte
6.2.5 Kasualmacht
6.3 Theologie, Empirie und Praxis
6.3.1 Das praktisch-theologische Denkprogramm
6.3.2 Theologie und Empirie – eine ›Unschärferelation‹
6.3.3 Theologie von Fall zu Fall
6.3.4 Theologie – textologisch
7. Praktische Theologie als Text – Fazit, Kritik und Ausblick
7.1 Die Sprache praktisch-theologischer Texte
7.1.1 Gestalt und Gehalt
7.1.2 Das Dilemma und die Grenzen
7.1.3 Eine Poetologie Praktischer Theologie
7.2 Praktisch-theologische Texte mit ihren Geschichten
7.2.1 Die Geschichtlichkeit Praktischer Theologie
7.2.2 Fortschritt in Verdacht
7.2.3 Umschlagsplätze von Herkunft in Zukunft
7.3 Macht und Ohnmacht praktisch-theologischer Texte
7.3.1 Macht im Text und Macht des Textes
7.3.2 Das Handwerk beherrschen, das mich beherrscht
7.3.3 Die der Theologie bedürftige Überlegenheit der Aufklärer
7.4 Der Dauerumbau praktisch-theologischer Texte
7.4.1 Empirie der Vielstimmigkeit
7.4.2 Häuschen umbauen
7.4.3 Fröhlich scheitern und davon erzählen
Literatur
Vorwort
Vorworte sind eigentlich Nachworte.1 So schicke ich meinem Text in diesem Vorwort einige Worte nach, bevor er seinen Weg zur Leserin und zum Leser antritt. Ich habe vor allem zu danken, belasse es bei diesem Dank und überlasse alles andere dem Text.
Ein grosser Dank gilt zuerst meiner Frau, Verena Reinhard. Sie hat mich während Jahrzehnten unterstützt, mir Raum gegeben und mich immer wieder ermutigt. Ich danke unserem Sohn, Simon Morgenthaler. Von ihm habe ich gelernt, wie wissenschaftliche Texte unter literaturwissenschaftlichen und historischen Gesichtspunkten analysiert werden können – und andere, subversive Sprachspiele oft interessanter sind.
Ich danke meinem Kollegen David Plüss, der dieses Projekt von seinen Anfängen an mit Rückmeldungen, hilfreichen Hinweisen und Gesprächen begleitet und unterstützt hat. Für kritische Lektüre und Rückmeldungen danke ich den Kolleginnen Ulrike Wagner-Rau und Stefanie Lorenzen. Ich danke Miriam Löhr, die den Text sorgfältig korrigiert und kommentiert hat. Gespräche, die mich weiterbrachten, habe ich meinen Kollegen und Freunden Christoph Müller und Jürg Zürcher zu verdanken. Dem Herausgeber:innenkreis danke ich für die Aufnahme des Bands in die Reihe ›Praktische Theologie heute‹, Sebastian Weigert und Florian Specker vom Kohlhammerverlag für die Unterstützung bei der Schlussredaktion und Publikation des Textes.
Christoph MorgenthalerBern, September 2024
1. Praktische Theologie schreiben und lesen
Ich bin ein Schriftsteller.
Nicht ich, sondern die Feder denkt, erinnert sich oder entdeckt.
Albert Camus1
Praktische Theologie lebt von Menschen, die sie betreiben. Sie lebt vom Gespräch, von kritischen Fragen und präzisen Antworten. Praktische Theologie lebt von Texten – von Monografien, Aufsätzen, Habilitationsschriften und Masterarbeiten, von Literaturlisten, Klappentexten, Editorials und Rezensionen, von Handbüchern, Handreichungen, Abstracts und Inhaltsverzeichnissen. Sie lebt auch als Text.
Die Zahl praktisch-theologischer Texte steigt seit Mitte des letzten Jahrhunderts von Jahrzehnt zu Jahrzehnt stark an.2 Wie Texte in diesem Fach verfasst sind, wird aber kaum einmal zum Thema. Das ist seltsam, so seltsam, dass es reizvoll erscheint, darüber zu schreiben. Genau dies will ich tun. Es ist aufschlussreich und produktiv, wissenschaftliche Texte als Texte zu untersuchen, beim wissenschaftlichen Schreiben auf das Schreiben zu achten und beim Lesen auf das Lesen. Das ist meine These. Ich bin damit nicht allein. Wissenschaftliche Texte, Schreiben und Lesen sind längst Gegenstand der Forschung. Was in Textologie, Literaturwissenschaft, Wissenschaftslinguistik und Diskursanalyse dazu erarbeitet wurde, lässt sich auch für die Praktische Theologie fruchtbar machen. Es ist Thema dieses Buchs. Hier soll erprobt werden, welche neuen Perspektiven sich auf eine Disziplin eröffnen, die auf religiöses Handeln aus ist und zugleich schreibend handelt, und welche Ansichten Praktischer Theologie, ihrer Schreibpraxis und Praxis, ein solcher Zugang ermöglicht. Das Buch handelt vom praktisch-theologischen »Schreibtisch mit Aussicht« (Piepgras 2020), vom Schreibtisch zwischen fiktiver Praxis und praktischer Fiktion.3
In textologischen Studien zur Geschichte der Praktischen Theologie nach 1970 werde ich Texte und Texttraditionen aus unterschiedlichen Fachbereichen der Praktischen Theologie genauer untersuchen. Ich bringe praktisch-theologische Sprachspiele mit literaturwissenschaftlichen Sprachspielen ins Spiel.4 Sprachspiele durchziehen praktisch-theologische Fachkulturen und Fachkommunikation, spielen ihr Spiel auch beim Lesen und Schreiben. Ich beginne mit dem Sprachspiel des Schreibens.
1.1 Praktische Theologie schreiben
1.1.1 Der gute und schöne Text
Natürlich wollte ich, als ich mich an den vorliegenden Text machte, einen guten Text schreiben, womöglich gar einen schönen, vielleicht sogar einen vergnüglichen. Nur: Was macht einen Text zu einem wissenschaftlich guten Text? Können wissenschaftliche Texte auch schön sein? Dürfen sie gar vergnüglich sein? Damit verbunden sind wissenschaftstheoretische Fragen, denn eine Antwort auf diese Fragen setzt voraus, dass ich weiss, was Wissenschaft, im konkreten Fall praktisch-theologische Wissenschaft, ausmacht.
Ich weiss, was ein wissenschaftlicher Text ist. Ein Text in deutscher Wissenschaftssprache erinnert mich zuerst einmal an Texte in deutscher Wissenschaftssprache.5 Er erinnert mich an all die wissenschaftlichen Texte, die ich bereits gelesen habe, interessiert, irritiert, gelangweilt, selten amüsiert. Er erinnert mich an das, was ich im ersten Proseminar bereits lernte und so zur Gewohnheit wurde, dass ich nicht mehr darüber nachdenke: wie ein wissenschaftlicher Text auszusehen hat. Ich liebe es, solche Texte zu schreiben. Ich kann mich einer Sache öffnen. Ich lerne fremde Welten, unbekannte Stimmen und nicht gedachte Zusammenhänge kennen. Es ist eine Ekstase der besonderen Art, nüchtern, präzise, sachlich. Und ich weiss, wie ich das zu Papier bringen soll: ebenso nüchtern, präzise und sachlich, to the point, so dass die Sprache transparent wird für den Inhalt und ich diesem nicht in der Sonne stehe.
Nur: Wenn ich schreibe »ich weiss«, stehen die Sätze, die folgen, bereits in einem schiefen Licht, denn sie brechen das Ich-Tabu wissenschaftlichen Schreibens. Und wenn ich von Ekstase schreibe, ist auch dies eigentlich verpönt. Dann breche ich ein zweites Tabu, das Metapherntabu. Und wenn ich erzähle, dass ich mich manchmal langweile, folgt gleich der dritte Tabubruch. Auch erzählen sollte ich eigentlich nicht, schon gar nicht von Langeweile.6 Diese Tabus sichern den wissenschaftlichen Stil vor Abweichungen, sie tragen zu seiner Durchsichtigkeit, seiner perspicuitas, auf die ›Wirklichkeit‹ bei, reinigen das window pane des plain style, der sich als Norm wissenschaftlichen Schreibens in einer langen Geschichte ausgebildet hat.7 Diese sachliche Durchsichtigkeit des ›Schaufensters Wissenschaft‹ ist aber erkauft mit Undurchsichtigkeit. Entstehungsbedingungen und die, die einen Text schreiben oder lesen, bleiben unsichtbar. Und auch das Lachen ist verpönt, da es Gift ist, wie ich spätestens in Umberto Ecos »Der Name der Rose« gelernt habe (Eco 1986). Es bedroht den Ernst der Worte und stellt in Frage, dass sie je ein Spiegel von Wirklichkeit sein können. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Die Rose von einst erscheint im Namen, wir halten nackte Namen.
Viele weitere Normen und Konventionen leiten mich, wenn ich einen guten Text schreiben will. Zitate sind korrekt nachzuweisen, Nachweise sind nach einem bestimmten System zu bibliografieren, Bibliografien sind konsequent durchzustrukturieren. Auch Artikel sind in einer bestimmten Weise aufzubauen. Nach Weinrich enthalten sie vier Teile, die je einen spezifischen Wahrheitsanspruch erfüllen müssen (Weinrich 1994). Im ersten Teil ist es die Referenzwahrheit. Der Forschungsstand wird nach jeweils geltenden Regeln mit einer angemessenen historischen Tiefe dargestellt, so dass die festgestellte Lücke den Plan der Forschung bestimmt, und nicht umgekehrt. Im zweiten Teil folgt die Protokollwahrheit. Ergebnisse werden »schlicht, ohne Schielen nach Opportunität und natürlich ohne Verfälschung der Resultate berichtet« (164). Der dritte Teil handelt von der Dialogwahrheit, die argumentativ »den kritischen Dialog mit den Partnern des Forschungsprozesses vorwegnimmt« (ebd.), und der vierte Teil bietet die Orientierungswahrheit, einen »Ausblick«, der »anderen Forschern gegenüber einen eigenen Anspruch [›claim‹] definiert, der als solcher alle Merkmale eines schützenswerten geistigen Eigentums hat« (165). Wissenschaft erscheint hier als eine auskunftspflichtige, sich der Realität immer besser annähernde Darstellung von Wirklichkeit. Es sind mit diesem wissenschaftlichen Stil der adaequatio ad rem, der stufenweisen Annäherung an die ›Sache‹, grundlegende epistemische Optionen im Spiel.8
Richtigkeit und Relevanz, nicht Schönheit stehen beim wissenschaftlichen Schreiben im Vordergrund, so argumentiert Weinrich an anderer Stelle. »Neben der Wahrheit scheint in der Wissenschaft für die Schönheit kein Platz zu sein. Gerade an seiner Ungeschicktheit scheint folglich der wissenschaftliche Stil am zuverlässigsten erkennbar zu sein. Diese Überzeugung ist so fest in den Köpfen fast aller Wissenschaftler verankert, dass es Aberwitz wäre, sie in Frage stellen zu wollen« (Weinrich 1995a, 7).9 So aberwitzig möchte ich in meinem Text nun aber sein. Nicht nur, weil mich die Lust zum Fabulieren, zum Ich, zur Metapher und Narration auch beim wissenschaftlichen Schreiben nie losgelassen hat. Ich frage mich auch (und da geht der Pastoralpsychologe mit mir durch): Welchem Phantasma hänge ich nach, wenn ich meine, das Ich sei nicht nötig, mit ihm würde ich mich als Steinmetz von Texten, die in die Kathedrale der Wissenschaft eingebaut werden sollen, selbst in ein ungebührliches Licht setzen? Welche Potentiale abweichenden Denkens verscherze ich, wenn ich Metaphern mit ihren unkontrollierbaren Ableitungen aus meinen Texten verbanne? Welche Schicksale sperre ich aus, wenn ich nicht erzählen darf? Und wohin verkriecht sich das Ich, wenn es nicht mehr im Text selbst auftreten darf? Es zieht aus dessen Kulissen seine Fäden.
Deshalb liegen mir Theoriebildungen näher, die in den Spuren einer praxeologischen Sicht von Wirklichkeit wandeln, den Aberwitz riskieren, das universalistische Ethos der Textnorm des plain style loszulassen, und Wissenschaft als Prozess konzeptualisieren, getragen vom Schreiben als sozialer Praxis, gewürzt mit Ironie. Nach Haraway sind gute Darstellungen der Welt immer verortet und vernetzt, sind Praxis und Prozess. Sie sind kreatürliche Wissenschaftsfiktionen und -fabeln, geschrieben von »beings of the mud more than of the sky« (Haraway 2016, 11). Staying with the trouble und eine offengelegte Selbstpositionierung sind für sie die »Möglichkeit, die Machtstrukturen, die der akademisch-philosophischen Wissensproduktion inhärent sind, zu konfrontieren, statt sie zu reproduzieren« (Dätwyler 2021, 204). »The conquering gaze from nowhere« (Haraway 1988, 581) lässt sich überwinden zugunsten einer weniger machtvoll organisierten Welt, obschon Wissenschaft und Philosophie an Macht immer auch partizipieren. Haraway nannte diesen Blick in einem bahnbrechenden Aufsatz gar den »god trick of seeing everything from nowhere« (ebd.), eine Formulierung, die den Theologen in mir in Wallung bringt. Was hiesse es für praktisch-theologisches Schreiben, nicht diesem god trick auf den Leim zu gehen, sondern von der qualitativen Differenz von Gott und Mensch her ganz menschlich und fragmentarisch zu schreiben und zu denken?
Ich mache mir in meinem Text auch deshalb die Hände schmutzig und schöpfe aus dem bodenlosen Sumpf des Subjektiven, weil ich mich lieber in diese wissenschaftstheoretische Tradition einreihe. Habermas’ »Erkenntnis und Interesse« hat mich nachhaltig geprägt (Habermas 2011 [1968]), später Lyotards »Le différend« (Lyotard 2001), narrative Epistemologien (Hauerwas/Jones 1997) und die Vorstellung der pensiero debole, des schwachen Denkens, das sich seinen Gegenständen, und seien es Texte, anschmiegt (Vattimo 1997). Perspektivität, Subjektivität, Narrativität, Historizität, Dialogizität, Kontextualität und – für Praktische Theologie nicht unwesentlich – Praktikabilität sind das entschönte Gerüst einer etwas anderen Form von Schönheit und damit auch von Theoretizität. Und mit diesen Substantiven, die sich in ihrer Abstraktion auch wissenschaftlich gut machen – der plain style lenkt mich, selbst wenn ich über einen anderen Stil nachdenke –, postuliere ich alternative Formen wissenschaftlichen Schreibens. Muss ich so schreiben, wie ich meine, schreiben zu müssen? Geht es auch anders? Geht es anders leichter? Geht es leichter anders?
In diesem Text werde ich mit unterschiedlichen Stilen experimentieren. Ich leiste mir die Ekstase der Sachlichkeit, referiere, stelle dar und reflektiere, was mir aus Schreib- und Leseforschung, aus Textologie, Literaturwissenschaft und Wissenschaftslinguistik für das Erschliessen der literarischen Form und des Gehalts praktisch-theologischer Texte aufschlussreich erscheint. Und ich werde die Texte, die ich lese, so genau, pingelig und zeitaufwändig lesen, wie es eigentlich anständig und wissenschaftlich korrekt wäre, praktisch aber kaum einmal realisierbar ist. Ich leiste mir aber auch metaphorische Umwege, narrative Seitenwege und ironische doppelte Böden.10 Zudem experimentiere ich mit dem Ich in diesem Text. Ich mache meine Position durchsichtiger, meine historische Besonderheit, die Perspektivität meiner Wahrnehmungen, die sich in Texten verfestigt – und damit wird auch der Text durchsichtiger. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich werde mich in meinem Text manchmal auch gut verstecken und hoffe, die Leserin zähle auf zwanzig, bevor sie mich zu suchen beginnt.
Dass solche Schönheit ihre eigene Theoretizität aufweist, kann der Theologie, bescheidener: der Praktischen Theologie, noch bescheidener: einzelnen praktisch-theologischen Texten, ganz unbescheiden: mir ein neues Gesicht geben. Praktisch-theologische Literatur ahmt in ihren Texten Formen wissenschaftlichen Schreibens nach, die sich erst in der Neuzeit etablierten. Dies ist nicht der einzige Weg. Die Ressourcen der Praktischen Theologie schwinden in Kirchen, Gesellschaft und Universität. Einer neuen Schönheit praktisch-theologischer Texte bedürfen auch theologische Fakultäten und Kirchen, die ihre hegemoniale Stellung verloren haben und damit auf den god trick universalistischer Theoriebildung nicht mehr unbesehen bauen können, damit Gott anders, vielstimmiger, perspektivenreicher – schön – wird in praktisch-theologischen Texten.
Bohren skizzierte unter dem Titel »Dass Gott schön werde« vor langer Zeit eine Praktische Theologie, »die erst noch zu finden und zu erfinden ist« (Bohren 1975, 13). Von der Pneumatologie her und auf die Pneumatologie hin reflektiert er das »Praktisch-Werden Gottes«. »Das Praktisch-Werden Gottes ist ein Schön-Werden, weil Gott selbst schön ist. Gott wird uns in seiner Gegenwart schön, so daß wir ihm in unserer Gegenwart schön werden« (14, kursiv im Original). Pneumatologie versteht er biblisch und trinitarisch als »Lehre von der zunehmenden und fortschreitenden Verkleinerung Gottes« (58). Von einer solchen Perspektive her ist ein Verzicht auf den god trick ein Machtverzicht in praktisch-theologischem Schreiben, ein Versuch, Gott verkleinert weiterzuschreiben, ihn schriftlich verkleinert als schön zu entdecken und ihm schriftlich verkleinert schön zu werden.11
1.1.2 Praktische Theologie schreiben im Selbstversuch
Ein Text muss allerdings zuerst geschrieben werden. Wie gut er ist, hängt auch daran, wie er geschrieben wurde und nun geschrieben steht. Nur: Was heisst Schreiben eigentlich? Und wie geht das? Auch dies ist kein Thema Praktischer Theologie. Das hat seine Gründe.
Howard Becker erzählt, es hätte eine gewisse ›Chuzpe‹ erfordert, Seminare über das wissenschaftliche Schreiben für Graduierte anzubieten, obschon doch jeder wisse, »dass Sozialwissenschaftler sehr schlecht schreiben, so schlecht, dass Literaten, die über schlechtes Schreiben witzeln, einen sicheren Lacherfolg erzielen, wenn sie einfach nur das Wort ›Soziologie‹ fallen lassen« (Becker 1993, 69). Trotzdem riskierte er einen Versuch. Es kam zu seinem Erstaunen eine stattliche Gruppe zusammen. Er wusste noch nicht richtig, wie einsteigen, so erzählt er. Nach ein paar linkischen Einleitungsworten traf ihn ein Geistesblitz. Er sprach eine Bekannte, die rechts von ihm sass, an: »Louise, wie schreibst Du?« Er wollte konkrete Details wissen: Womit sie schreibe, wann und wo und wie genau sie schreibe. Was Louise dann erzählte – die Anwesenden rutschten peinlich berührt auf ihren Stühlen hin und her – war eine komplizierte Prozedur, die so und nicht anders ablaufen durfte. Sie konnte nur auf gelben, linierten Blöcken schreiben, mit grünem Filzstift. Schreiben war nur zu bestimmten Zeiten möglich und zuerst musste sie noch ihre Wohnung reinigen. Gegen Widerstände fragte Becker in der Runde weiter. Vielen war peinlich, was sie erzählten. Es wurde aber oft auch gelacht und das Gespräch mündete in grosse Gelöstheit. Dies ist eine Weile her. Wie hier eine Frau von einem Mann vorgeführt wird, verrät zeittypisches Kolorit. Trotzdem illustriert die Szene Widerstände gegen eine Thematisierung des wissenschaftlichen Schreibens, die keinesfalls Geschichte sind, und verdeutlicht, wie viel hier eigentlich zu erzählen wäre, wie selten dies geschieht und wie aufschlussreich und befreiend dies sein kann.12 So mache ich mir – in einem »autoethnografischen Experiment« (Meiler 2018, 263) – nun Beckers Frage zu eigen: Christoph, wie schreibst Du?
Die Tastatur klappert. Schriftzeichen erscheinen in Sekundenbruchteilen auf dem Bildschirm. Ich kann sehen, wie sie sich zu Worten und Sätzen formieren und so aufmarschieren, wie ich es ihnen auf der Tastatur einhämmere, jedenfalls meistens, regelmässiger, geordneter, aufrechter, als ich sie mit meiner alterskrakeligen Schrift zu notieren vermöchte. Ich beobachte und erlebe mich beim schreibenden Verfertigen der Gedanken und, indem ich gegen aussen und innen offenbleibe, stellen sich neue Sätze ein, die sich mehr oder weniger in den Text eingliedern oder auch ganz vom Weg abkommen. Es ist eine latente Aufmerksamkeit da für diesen Akt des Schreibens, die abbricht, wenn ich nicht weiter weiss und meine Augen über das bereits Geschriebene irren, die verschwindet, wenn ich ganz im Schreiben aufgehe, aufflackert, wenn ich mich verschreibe, schwindet, wenn der Schreibfluss wieder einsetzt.
Was davon eine gewisse Schwelle der Irritation übersteigt, halte ich fest. Ich schreibe laufend Texte zu meinem Text.13 Ich füge Randbemerkungen ein, wenn mir beim Schreiben Gedanken kommen, die abseits der Schreibspur davonzulaufen drohen. Ich führe ein ›Logbuch‹, halte Gedanken zur Textproduktion fest, wenn der Schreibfluss stockt oder längere Textabschnitte geschrieben sind. Auch dies tue ich computergestützt, in einer Datenbank, die es mir ermöglicht, solche Notizen nach Themenbereichen, Stichworten und Datum zu suchen, Textelemente herauszukopieren und in den Lauftext einzufügen. Ich schreibe – das fiel mir erst nach ziemlich langer Zeit auf – ein fortlaufendes Protokoll meiner Textpraktiken.14 Diese Notizen – sie sind eine Art Korrespondenz mit mir selbst15 – zeigen mein individuelles Profil des Schreibens. Genauer: Sie zeigen meine Ideen darüber, welche gedanklichen Aktivitäten zu einer bestimmten Form von Text führen und zu dessen Verfeinerung, Erweiterung und Glättung beitragen. Sie explizieren etablierte Regeln des wissenschaftlichen Schreibens und meine persönlichen Tricks und Ticks.16 Und sie verraten, wer mich bei extensiver Lektüre von Wissenschaftslinguistik beeindruckt hat.
»Habe gerade Bruffees Text zum peer tutoring gelesen. Ein schöner Text. Was macht ihn mir schön? Er macht Denkräume zugänglich, die vorher nicht zugänglich waren. Er enthält genau jene Informationen, die nötig sind, damit er auf eigenen Beinen seinem Schicksal zwischen Buchdeckeln enteilen und mich heimsuchen kann. Es ist jene Schönheit, die zu glänzen beginnt, wenn mir jemand von einer Entdeckung erzählt. Das Narrationstabu schrumpft zur Frage: Wieviel Erzählung ist sinnvoll, damit der Text seine Ziele erreicht und die Position des Autors verdeutlicht? Und schliesslich verwirklicht er Werte, sowohl durch das Ethos der Praxis, auf die er sich bezieht, wie das Ethos der Theorie, die diese Praxis transparenter, verständlicher und bedeutsamer, d. h. sinnhaltig, macht. Es sind Werte wie Kooperation, Ermächtigung, Einsicht, um nicht zu sagen: Weisheit.«
Mein Schreiben übers Schreiben kann ich auf drei unterschiedliche Konzeptualisierungen des Schreibens beziehen:
Schreiben als intentionale Handlung: Das Schreiben praktisch-theologischer Texte kann als zweckrationales, intentional gesteuertes Handeln verstanden werden. Es ergibt sich aus einer Reihe von Schreibakten, die Schreibplänen folgen, die ich nach und nach entwickle, mit dem Ziel, einen kohärenten und erhellenden Text zu Texten der Praktischen Theologie zu schreiben, für eine Leserschaft, an deren Interesse ich zweifle, um deren Aufmerksamkeit ich mich umso mehr bemühe. In den 1980er und 1990er Jahren erhielten Konzeptionalisierungen des Schreibens als intentionaler Handlung zuerst im englisch-, dann auch deutschsprachigen Bereich eine gewisse Prominenz.17 So finden sich unter meinen Notizen viele, die ich Kategorien zuordnen kann, die mir aus intentionalen Handlungstheorien des Schreibens bekannt sind.18 In der Mehrzahl aller Notate geht es um den Dreischritt planen, schreiben und überprüfen. Dominieren zuerst Notizen zur Planung, finden sich gegen Ende der Arbeit vor allem Notizen zur Überarbeitung des Textes. Themenentwicklung und Schreibpraktiken sind zudem eng miteinander verzahnt. Wie ich weiterschreibe, entscheidet auch darüber, wie ich weiterdenke.
In diesen Notizen konkretisiere ich Ziele des ganzen Texts (»Ich will ein zugleich persönliches wie sachliches Buch schreiben.«) und einzelner Textteile (»Kapitel weiter glätten. Themen noch besser platzieren und konturieren.«). Ich antizipiere die Zielerreichung (»Wenn mir das gelingt, habe ich die Kuh im Stall.«). Ich plane den Aufbau des Buchs und merke mir damit verbundene Herausforderungen (»Problem der Disposition wieder identifiziert: Wohin kommt die historiografische Perspektive?«). Textpraktiken werden konkretisiert (»Elemente anders gruppieren.«). Auch materielle Voraussetzungen der Textproduktion bleiben nicht ungenannt (»Nun habe ich einen Rucksack voller Bücher heimgekarrt auf dem Velo.«). Ich vermerke Schwierigkeiten (»Eine letzte? Knacknuss, ohne Genuss.«). Ich reflektiere Verzweigungen auf der Schreibspur, an denen ich entscheiden musste, in welche Richtung weiterzuschreiben (»Frage mich, ob eine andere Rahmung nicht doch besser wäre: die textuelle Selbstkonstruktion praktisch-theologischer Autor:innen.«). Viele Memos enthalten zudem Evaluationen: Ich beurteile den Stand des Textes (»Themen sind gesetzt, müssten noch etwas weiter ausgearbeitet werden.«), seine Folgerichtigkeit (»Die Systematik stimmt immer noch.«), seinen Informationsgehalt (»Es steht ein Text, in den doch recht viel Wissen bereits eingebunden ist.«) und seine Viabilität (»Der Ansatz ist brauchbar, das Programm umsetzbar.«). Ich evaluiere die Zielerreichung (»Auch die Idee des letzten Abschnitts konnte ich gut umsetzen.«) und das Verhältnis von Länge und Funktion (»Aber als Lauftext braucht dieses Kapitel nicht viel länger zu werden, um seine Funktion zu erfüllen.«). Ich vergleiche wertend die Textteile (»Hitparade der Kapitel: zuerst die Fälle der Seelsorge, dann folgt lange nichts mehr, doch, jetzt: der Einstieg zum Schreiben und Lesen, die Theologie, die Bilanz, die Rituale, die Religionspädagogik. An die Autorschaft konnte ich mich nicht mehr erinnern…«). Zudem identifiziere ich konzeptionelle Schwächen (»Ich drifte ins Fachliche. Die Textkonstruktion selbst durchgehend im Blick zu behalten, ist nicht so einfach.«). Solche Evaluationen werden zum Ausgangspunkt von Überarbeitungsvorgängen (»Insgesamt ist der Text noch ziemlich schwerfällig. Könnte ihn in einem weiteren Durchgang leichter machen: Abstrakta ersetzen, Verben: farbiger.«).
Schreiben als Habitus: Daneben stehen Notizen, die nicht zu dieser intentionalen Auffassung des Schreibens passen. Sie sind an der Grenze zu schwer fassbaren Anmutungen, ungeordneten Einfällen, angedachten Gedanken und ausformulierten Textteilen angesiedelt und betreffen Emotionen, Motive, Beziehungen und Identität in meinem Schreiben. Diese Notizen weisen deutlicher in Richtung einer praxeologischen Sicht des Schreibens. Schreiben beruht »in hohem Masse auf implizitem Wissen und Können – auf einem Know-how«, wird »durch Imitation und Beispiele erworben« (Abrecht et al. 2015, 2) und lässt sich nur teilweise explizieren. Besonders häufig sind Annotate zum Schreiben als emotionaler Erfahrung, zum Schreiben im Beziehungsfeld und zum Schreiben als Selbsterfahrung.19
Dazu gehören Notizen zur Motivation (»Das Ross scharrt im Stall ...«), zur Genese des Texts (»Der vorliegende Text war einfach mal runtergeschrieben.«), zum Erschreiben von Gedanken (»Probeweise verschiedene Varianten ausprobieren. Gedanke klärt sich erst beim Schreiben. Es ist eben auch ein Er-schreiben. Was dieses ausmacht: die Aktivität des Schreibens, in der sich Gedanken einstellen, Gedanken über die Gedanken, sich Formulierungen entwickeln, Zusammenhänge sichtbar werden.«). Andere Notizen betreffen das Schreiben als emotionale Erfahrung (»Ich bin glücklich, wenn ich am Texten bin. Flow-Erfahrung. Es ist ein Gesamtzustand des Organismus. Mir ist warm. Was soll das bedeuten?«). Ich artikuliere meine Ambivalenz (»Aber für heute reicht’s mal. Vielleicht reicht’s überhaupt. Und trotzdem kann ich nicht aufhören ...«) und notiere, wie ich mit dem mental load des Schreibens umgehen will (»Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht wieder zu sehr in Beschlag nehmen lasse.«). Es finden sich Notizen zum Drang, eine Gestalt zu schliessen (»Schliesst in gewisser Weise die ›Figur‹, entlastet.«) und zum Loslassen von Textteilen (»Einen fertig geschriebenen Text wieder rausgeworfen. Schwierig.«). Das Verhältnis von Emotionalität und Dialekt wird zum Thema (»Interessant: Es fallen mir oft Dialekt-Ausdrücke ein, wenn ich Textpraktiken beschreibe: ›grede‹, ›strähle‹, ›zämebüetze‹.«20). Zudem betreffen die Notizen das Schreiben im Beziehungsumfeld (»Ihre Frage war gut: Und was machst Du, wenn Du fertig bist?«), Gespräche (»Die Frage D.s gestern nach dem Ziel meiner Analysen hat mich weiter begleitet.«), Lektüreerfahrungen (»W.s Diktion in seinem Text hat mich eingeschüchtert.«) und Feedbacks (»Ich erhalte Ermutigung und Unterstützung für dieses Projekt. Es ist eine Brücke zu spannenden Gesprächen.«). Träume, die ich mit meinem Schreiben in Verbindung brachte, habe ich ebenfalls notiert (»Ich bin unterwegs in einem Höhlensystem, mit anderen, Kollegen, auf unebenem Weg. Rechts öffnen sich Nischen, mit Bogen oben. Ich mache jemand anderes darauf aufmerksam. Es sind Durchbrüche, sie geben Ausblick auf unerwartet farbige, gestaltete Formen, etwas fast Sakrales, berührt, erstaunt mich. Es geht weiter, nun habe ich aber J. aus dem Blick verloren. Er ist weg, weiter. Dazu: Habe genug, verliere den Überblick. Ich ver-grabe mich. Der Traum warnt und gibt Hoffnung. Es gibt Durchbrüche. Schönheit leuchtet.«). Zudem deuten Notizen das Schreiben als ›Auto-Grafie‹ und berühren seine identitätsrelevanten Aspekte (»Ich und der Buchstabe sind eins ...«) und meine Rolle als Autor (»Spreche von Positionierungen, positioniere mich selbst zu wenig.«).
Schreiben als Grenzerfahrung: Schreiben führt auch an Grenzen: an Grenzen der Motivation, des Könnens und des Denkbaren. Der Prozess des Schreibens selbst ist nur begrenzt verfügbar und steuerbar. Der Erinnerungsraum, in den ich meinen Text hineinschreibe, ist nicht verfügbar. Die, welche meinen Text lesen werden, sind nicht verfügbar. Ich selbst bin mir beim Schreiben nicht verfügbar. Das Schreiben trägt mich über mich hinaus, plötzlich schreibt eine Stimme, die mir noch nicht bekannt war und kippt meine Sichtweise ins Unwegsame. Auch dabei bleibe ich Praktiker praktisch-theologischen Schreibens. Solche Prozesse lassen sich kreativitätspsychologisch deuten, zum Beispiel als Varianten eines »thinking at the edge«21 oder psychoanalytisch als Ligaturen von Symbolisiertem und Verdrängtem, als Verneinung dessen, was der Text vollzieht. Als praktischer Theologe frage ich mich aber, ob ich hier, an der Grenze des Schreibbaren und Beschreibbaren, möglicherweise an eine Grenze gerate, die in christlicher Tradition die Pneumatologie umspielt. Unverfänglicher wäre es heute wohl zu sagen, beim Schreiben gerate ich an Grenzen, an denen Tippen zur spirituellen Erfahrung wird, die etwas »fast Sakrales« umklappert.
Ich suche Momente der Unverfügbarkeit festzuhalten (»Mich treiben lassen und plötzlich ist etwas Neues da. Das überrascht mich noch immer.«). Die Flüchtigkeit der Gedanken wird zum Thema (»Kurz streifte mich ein Gedanke. Nein! Weg ist er wieder, dieser flüchtige Vogel.«), ihre Abwegigkeit (»Ich komme auf wunderbare und wundersame Abwege.«) und die Brüchigkeit dessen, der schreibt (»Ich bin wie ein schwankendes Rohr im Wind ...«). Pesanteur liegt mir auf und grâce trägt mich fort22 (»Vielleicht kann ich dem Text noch etwas Leichtigkeit verleihen. Er wird nicht fliegen, wohl eher irgendwo runterplumpsen.«). Ich erlebe unerwartete Perspektivenwechsel (»Ich konzipierte meinen Schreibprozess bisher ganz als empirischen Prozess, da war ich fast finster entschlossen dazu. Könnte es aber nicht auch entlastend und befreiend sein, ihn theologisch zu denken? Von der Differenz zwischen Gott und Mensch ausgehend schreiben. Haraways god trick auf theologische Beine stellen.«). Die Eigendynamik von Einsichten registriere ich erstaunt (»Die Unschärferelation kommt per Schneckenpost.«) und Dankbarkeit für Durchbrüche klingt an (»Halleluja! Es geht doch weiter!«). Die Notizen artikulieren Selbstzweifel (»Was will ich mit meinem Besenstiel gegen dieses argumentative Florett ausrichten?«), das Leiden (»V. leidet, meine Beziehungen leiden, leide auch ich selbst?«) und blanke Verzweiflung (»Ich bin komplett erschöpft, mag nicht mehr, brauchte eine grosse, grosse Pause, mit dem Risiko, dass ich nie mehr fertig werde.«). Sie spiegeln die fragmentarische Versöhnung mit dem Fragmentarischen (»Es ist ein Buch, kein Knaller, voller bugs.«). Und Endlichkeit in ihrer biografischen Unerbittlichkeit holt mich ein (»Barthes’ ›Tod des Autors‹ kommt in greifbare zeitliche Nähe.«).
Die Notizen verraten ein Geheimnis, das keines ist. Ich bin Praktischer Theologe, wenn ich zielbewusst formuliere. Ich bin ganz Praktischer Theologe, wenn ich mich als Person ins Schreiben verwickle. Und ich bin Praktischer Theologe, wenn ich an die Grenzen des Schreibens gelange, wo nicht nur die Differenz klafft zwischen dem Guten, das ich mit meinem Schreiben tun möchte, und dem Schlechten, das herauskommt, sondern ich gnädig über das hinausgetragen werde, was ich mir schreibend erarbeiten kann.
Praktische Theolog:innen als Schriftsteller:innen: Über mein Schreiben zu schreiben ist dialogisches, kritisches Schreiben, eine Weise, beim Schreiben meinen Text auch in den Blick eines alter ego, eines anderen, der ich bin und nicht bin, zu fassen. Dies hat etwas Befreiendes. Es hält nicht nur den Schreibfluss in Gang. Schreiben und Denken sind eng miteinander verbunden. So ist das Schreiben über das Schreiben auch inhaltlich produktiv. Über das Schreiben zu schreiben, ist deshalb mehr als eine Schreibpraktik. Es ist eine Denkpraktik. Es ist nicht nur kritisches Schreiben, es ist »epistemisches Schreiben«23. Es verankert den Text zudem in der Person, die schreiben will (intentionale Perspektive), bindet ihn zurück an deren Identität, Korporealität und Sozialität (praxeologische Perspektive) und erinnert an die qualitative Differenz zwischen Gott und dem Schreiber-Mensch (theologische Perspektive).
Schreiben geschieht – das ist die gängige Sicht wissenschaftlichen Schreibens – ›von innen nach aussen‹. Das Nachdenken übers Schreiben legt aber noch eine andere Möglichkeit offen. Die Materialität des Schreibakts ist keine Nebensache. Schreiben ist ein eigener Akt. Und dieser Akt wirkt zurück auf den, der schreibt. Wissenschaftliches Schreiben geschieht also auch ›von aussen nach innen‹. Camus sagt es in seinem Tagebuch so: »Ich bin ein Schriftsteller. Nicht ich, sondern die Feder denkt, erinnert sich oder entdeckt.« Auch als Praktischer Theologe bin ich Schriftsteller. Der Computer schreibt, ich, nicht ich.24
1.1.3 Schreibpraxis und Praxis
Schreiben ist eine Tätigkeit. Dies ist der Tenor der Schreibforschung. Die Akzente werden dabei je etwas anders gesetzt. Schreiben ist ein Prozess (Kinkel 2010), körperbasierte Textproduktion (Niemann 2018), eine Handlung (Wrobel 2012), eine zeitlich und räumlich zerdehnte Schrifthandlung (Maik 2017), ja, eine soziale Handlung (Knappik 2018). Schreiben ist Beziehungshandeln in und mit Texten, historisch verortet und eingebettet in soziale sowie gesellschaftliche Verhältnisse, die auch Machtverhältnisse sind. Praktische Theologie zu schreiben, bedeutet, sich auf einen unabsehbaren Prozess der »Reziprozitätsherstellung«25 einzulassen, mit Händen und Kopf Text zu produzieren und sich damit in einen Diskurs einzuschreiben.
Praktische Theologie ist überdies auf religiöse Praxis bezogene Schreibpraxis. Praktische Theologie beschreibt und analysiert diese Praxis und will sie verändern. Sie tut dies auch in Form ihrer Schreibpraxis. Auch Theorie, auf deren Unterschied zu Praxis Praktische Theolog:innen oft pochen, ist Praxis, Praxis des Schreibens. Die Frage nach Praxis lässt sich also in doppelter Weise stellen, sowohl praxisreflexiv wie wissenschaftsreflexiv. Gefragt ist ein konsistenter Praxisbegriff.
Mir scheint in sich widersprüchlich, wenn Theoretiker des Fachs Praktikerinnen zu einer reflektierten – nicht zuletzt selbstreflexiven – Form von Praxis inspirieren wollen und selbst die Praxis der Theorie – ihre Schreibpraxis – kaum mitreflektieren. Mir scheint widersprüchlich, wenn sie Praktiker zu innovativen Formen der Kommunikation des Evangeliums anleiten wollen und selbst in konventionellen Formen der wissenschaftlichen Kommunikation befangen bleiben. Mir scheint widersprüchlich, wenn sie Körperlichkeit und Performativität behandeln, ihrer eigenen Körperlichkeit und der Performativität ihres wissenschaftlichen Handelns jedoch wenig Aufmerksamkeit schenken. Mir scheint widersprüchlich, wenn sie beim Schreiben ihrer Texte reinszenieren, was sie inhaltlich in ihren Texten überwinden wollen. Konsequenter schiene mir, das Verständnis wissenschaftlichen Handelns mit dem Verständnis praktischen Handelns in Übereinstimmung zu bringen. Eine geschärfte Selbstaufmerksamkeit für Praktiken des wissenschaftlichen Texthandelns dient auch dem wissenschaftsgeleiteten Handeln in der Praxis.26
Barton, Vertreter der kritischen Diskurstheorie, geht davon aus, dass Formen von literacy27, die zu sachkundiger Teilnahme an schriftlicher und mündlicher Kommunikation befähigen, einander in unterschiedlichen »configurations of language« (Barton 2007, 87) beigeordnet sind. Geschriebene und gesprochene Sprache sind unterschiedlich. Aber sie sind einander nicht einfach entgegengesetzt, sondern es finden sich »continua from written to spoken« (91). Entsprechend sind auch praktisch-theologische Literatur und die Sprache religiöser Praxis in Kirche und Gesellschaft einander nicht diskontinuierlich entgegengesetzt, sondern können ebenfalls auf ihre Verbindungsstellen und Abstufungen hin befragt werden.
Als Beispiel nehme ich das Gebet. Auf der Seite der praktisch-theologischen literacy reichen Texte von abstrakt-begrifflich verfassten Auseinandersetzungen mit Gebet über literacies des Gebets, die sich stufenweise der Praxis annähern, bis hin zu konkreten Gebetsvorlagen für spezifische situative Kontexte. Auch auf der Seite der Praxis sind unterschiedliche literacies im Spiel. Sie reichen von mündliche Varianten des Gebets, die sich an tradierten literarischen Formen (wie dem Bitt- oder Dankgebet) orientieren, über Gebetseinträge in Büchern in Autobahnkirchen, das Beten von vorformulierten Texten bis hin zu reflexiven, abstrahierenden Gedanken über Sinn und Funktion von Gebeten (z. B. in Tagebüchern oder Anleitungen zur spirituellen Praxis). Dazwischen finden sich Texte, in denen diese unterschiedlichen Variationen von literacy direkt ineinandergreifen. Alltagstheorien und professionelle Theorien zu Literalität sind grundsätzlich ähnlicher Art und überschneiden sich. Professionelle Literalität ist (meist) expliziter, formalisierter und reflektierter, in Institutionen abgestützt, manchmal rechtlich geregelt, finanziell gefördert, in gedruckter Form geadelt und mit Dominanzansprüchen verbunden.
Damit lässt sich auch das Verhältnis von Theorie und Praxis neu formulieren. Wenn praktisch-theologische Theorie wesentlich auch in Texten verfasst ist, die in einer Schreibpraxis wurzeln, dann lässt sich dies in Kontinuität mit persönlicher, kirchlicher und gesellschaftlicher Praxis des Religiösen verstehen, die ihrerseits sprachlich verfasst ist und sich in vielen Texten materialisiert. Wenn praktisch-theologische Wissenschaft als soziale Praxis, als ein doing practical theology, verstanden wird, lässt sich zudem analysieren, »welche Gemeinsamkeiten wissenschaftliche und andere Praktiken im Kontext von Predigt, Religionsunterricht, Seelsorge u.v.m. aufweisen« (Suchhart-Kroll 2023, 163). Zudem lassen sich Hierarchisierungen von alltagssprachlichen und professionellen Formen von Literalität hinterfragen. Da Kognition und Schreiben so eng miteinander verbunden sind, betrifft diese Reflexion von Schreiben und Schriftlichkeit zudem den ganzen praktisch-theologischen Apparat zur Erfassung und Gestaltung von Praxis und werden Alternativen denkbar und (be)schreibbar. Schliesslich spielt Aufmerksamkeit für die performative Wirkung von Texten auch den Leser:innen mehr Freiheit in der Rezeption des Texts zu. Daraus lässt sich eine einigermassen konsequente praxeologische Praxistheorie entwickeln. Dies alles, so bilde ich mir ein, kann man beim Lesen des vorliegenden Textes lernen. Man muss ihn allerdings lesen, nicht überfliegen.
1.2 Praktische Theologie lesen
Wie steht es nun mit dem Lesen? So viel steht jedenfalls fest: Wenn wissenschaftliche Texte nicht auch Genuss versprächen, würden sie nicht gelesen. Man kann dies auch grundsätzlicher formulieren: »Erst die Rezeption vollendet das Werk« (Kinkel 2010, 86). Lesende übernehmen die »Mitautorschaft, die Fortschreibung des Werks« (ebd.). Wissenschaftliche Texte im Besonderen werden zu wissenschaftlichen Texten durch Rezeption und Kritik. Erst wenn sie kritisch gelesen werden, realisieren sie neben ihrer kognitiven Funktion der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung auch die kommunikative Funktion der Kenntnisverbreitung (Dressler 1998, 611).28 Lesen gehört zum Ethos insbesondere geisteswissenschaftlicher Disziplinen. Lektüren sind ihre Experimente. Wie also lese ich die praktisch-theologischen Texte, über die ich mich in den folgenden Kapiteln beugen werde?
Lesen ist ein hochkomplexer kognitiver Prozess. Er lässt sich wie das Schreiben schwer fassen.29 Meistens lese ich wissenschaftliche Texte schnell und manchmal lasse ich es beim Inhaltsverzeichnis bewenden, wenn ich nichts finde, was ich für den Text, den ich schreiben will, verzwecken kann. Manchmal lese ich genauer und exzerpiere Text, wobei meine Exzerpte bereits verraten, worauf ich in meinem eigenen Text aus sein werde. Manchmal genügt mir ein Blick auf den Titel, um das Strickmuster eines Textes zu erkennen, seltener lese ich mich fest, noch seltener schmunzle ich. Und es kommt mir so vor, wie wenn ich durch die Jahrzehnte immer mehr Texte immer schneller gelesen hätte. Der exponentielle Ausstoss praktisch-theologischer Schreibtische führt zum Lesenotstand: Viel lesen, schnell lesen, oberflächlich lesen, genau mit jenem Fokus lesen, den ich mir als Mitglied des »mentalen Kapitalismus« (Franck 2005) für das Lesen praktisch-theologischer Texte angeeignet habe. Und kaum einmal habe ich einen praktisch-theologischen Text zweimal gelesen. Auch hier suche ich einen anderen Weg: Vom reading zum re-reading (Greenham 2019), vom schnellen Überlesen zum mehrfachen Lesen, zu einem Lesen vom Anfang bis zum Schluss, vom Schluss zurück zum Anfang, vom Titel hinunter zum einzelnen Wort, vom Wort hinauf zum Titel. Es ist ein genaues, detailversessenes, bemühtes und mühsames30 Lesen, mit dem ich die, die sich meinem Text aussetzen, über Gebühr versäumen werde.
Es ist zudem ein bi-fokales Lesen. Ich konzentrierte mich auf Text und Textur, Inhalt und Semantik, Struktur und Grammatik, Wirkung und Pragmatik. Mit dieser ›Les-Art‹ hintergehe ich habitualisierte Formen des Umgangs mit wissenschaftlichen Texten und zeige, was allzu offensichtlich ist: Praktisch-theologische Texte sind Texte, nicht mehr und nicht weniger. Die Frage, wie sachgemäss und realitätsnah praktisch-theologisches Schreiben und wie überzeugend die Argumentation sei, kann nur in und durch die sprachliche Verfasstheit ihrer Texte und nicht diesseits und jenseits davon behandelt werden. Und umgekehrt gilt: Textmerkmale in ihrer bedeutungstragenden Funktion zu erörtern, ist nur sinnvoll, wenn gleichzeitig auch die Gedanken nachvollzogen werden, die beim Schreiben entwickelt werden. Es geht mir also um eine spezifische Lesekompetenz, die Kompetenz, sprachliche Formen und Formationen wissenschaftlicher Texte zu erkennen, die auch als Grundlage des Sinnerkennens dienen.
Schliesslich befolge ich eine Maxime für wissenschaftliches Schreiben, die Weinrich formuliert: »Berücksichtige immer, wenn Du ein wissenschaftliches Problem behandelst, mindestens einen Beitrag, der aus einem anderen Fach stammt!« (Weinrich 1995a, 4). Mein Text baut auf dieser Maxime auf und folgt ihr bis zum Überdruss. Mit dem Bezug auf Textologie, Literaturwissenschaften und Wissenschaftslinguistik schliesse ich an ein vielfältiges wissenschaftliches Paradigma an. Dies ermöglicht Lektüren praktisch-theologischer Texte, die anders sind, abweichend, ungewohnt und irritierend. Dies hilft mir dabei, mich aus der in praktisch-theologische Texte eingeschriebenen Leserolle zu lösen und alternative, leicht subversive Leseperspektiven ausserhalb der generic confort zone einzunehmen.31
1.2.1 Textologie praktisch-theologischer Texte
Als Ausgangspunkt und Klammer meiner Analysen dient eine textologische Perspektive (Endres/Pichler/Zittel 2017). Textologie versammelt textwissenschaftliche Interpretationspraktiken und fasst philosophische, literarische und wissenschaftliche Texte unter einer entschieden textorientierten Perspektive in den Blick. Am Anfang solcher Analysen steht keine generelle Methodologie. Am Anfang steht der Text. Textologische Untersuchungen sind »von der Überzeugung geleitet, dass sich die Frage, was ein Text ist, nur aus der aufmerksamen Auseinandersetzung mit einem einzelnen Text und seinen Merkmalen sowie vermöge einer hohen Sensibilität für die Unablösbarkeit von Textbegriff, Textfaktur, Interpretation und Edition beantworten lässt« (Endres/Pichler/Zittel 2017a, 3, kursiv im Original). Dabei geht es nicht nur um Formalia, sondern um Formen, die über Inhalte mitbestimmen. Wissenschaftliche Texte sind, im Licht kulturalistischer Wissenstheorien betrachtet, ebenso kulturbedingt wie literarische Texte. Logische Verfahren greifen bei der Analyse deshalb zu kurz. Die individuelle Textgestalt hat vielmehr kognitive, ja epistemologische Relevanz, dient der Lancierung, Konstruktion und Plausibilisierung von Inhalt und Argumentation. Eine solche Lektüre diskutiert und erprobt immer neu, was einen Text ausmacht, wie er im Detail konstruiert ist, wie er wurde, wirkt und weiterwirkt. Philologische, editionswissenschaftliche und ästhetische Gesichtspunkte müssen mit einbezogen werden, »um die Relation von materialer Textstruktur und Erkenntnis textologisch wie erkenntnistheoretisch zu erfassen.«32 Die philologische Analyse auch wissenschaftlicher Publikationen folgt mit Gewinn einem solchen material- und praxisaffinen Textverständnis, das auch Marginalien mitberücksichtigt: Klappentexte, Fussnoten, Literaturverzeichnisse und anderes mehr.
Viele Fragen, die zu einer genauen Lektüre wissenschaftlicher Texte inspirieren, lassen sich aus wissenschaftslinguistischer und literaturwissenschaftlicher Perspektive hier einfügen. Ich nenne nur einige.33 Wie sind praktisch-theologische Texte auf der Makro-, Meso- und Mikroebene aufgebaut? Welche Konzepte von Autorschaft werden in sie eingebaut und welche Leserollen sind vorgesehen? Welche kognitiven frames werden bei Leser:innen aktiviert?34 Welcher rhetorischer Figuren und Strategien bedienen sich wissenschaftliche Texte?35 Welche Implikationen hat die Figurativität von Verben, Substantiven und Adjektiven der allgemeinen deutschen Wissenschaftssprache? Welche ›Vorstellungen‹36 wissenschaftlichen Denkens werden dadurch transportiert? Wie ist die Thema-Rhema-Gliederung dieser Texte ausgestaltet?37 Wie werden in Fachkulturen Wissensordnungen (re)produziert und weitergegeben? Welchen Denkzwängen folgen »Denkkollektive« (Fleck 2021 [1935])? Wie werden »semantische Kämpfe« ausgefochten (Felder 2006)? Wie werden Texte mit hedges, Hecken, gegen kritische Einwände geschützt oder sprachlich geboosted, aufgebläht?38
Was ich hier vorschlage, kann auch als ein close reading wissenschaftlicher Texte verstanden werden. Close reading wurde zwar vor allem zur Analyse literarischer Texte entwickelt (vgl. Greenham 2019). Prinzipien des close reading, die detaillierte Berücksichtigung semantischer, grammatikalischer, pragmatischer und genrespezifischer Kontexte, lässt sich aber auch auf viele andere Textsorten, also auch wissenschaftliche Texte übertragen (vgl. Brummet 2019). Das erhöht die pleasures of reading (Greenham 2019, 8ff.). Beginnings können genussvoller gelesen werden, ebenso erhöht sich das Vergnügen an meeting people, creating a world of words, hearing voices, finding ourselves, anticipating plot; und neue lessons along the way lassen sich auch lernen.
Als Praktischer Theologe kehre ich damit in gewisser Weise in die späten 1960er Jahre zurück, als ich Theologie studierte. Es war die Zeit der Vorherrschaft philologischer und hermeneutischer Analysen in der Theologie, nicht nur in der Exegese, sondern auch der Praktischen Theologie. Alte Fragen lassen sich mit einer textologischen Perspektive neu auflegen. Kann man das, was als Form- und Redaktionsgeschichte, als Bestimmung des ›Sitzes im Leben‹ literarischer Gattungen, später auch als synchrone Lektüre, Analyse der Lesesteuerung und anderes mehr an biblischen Texten abgehandelt wurde, unter geänderten Vorzeichen auf die Genese, Form und Lektüre praktisch-theologischer Texte übertragen? Textologische Analysen müssten keine philologische Kränkung der Praktischen Theologie bedeuten.39 Eher vollziehen sie eine Rückkehr zu philologischen Traditionen der Theologie und schaffen die Basis für neue Kooperationen zwischen theologischen Fächern.40
1.2.2 Textgenese und Historiografie
Wissenschaftliche Texte, die gedruckt vorliegen, sind nur eine Stufe in der Produktion und Rezeption von Wissenschaft. Vorher und nachher nimmt der Text ganz unterschiedliche Formen an: vorher im dossier génétique von Materialien41, in der zündenden Idee, der gedanklich-schreibenden Entwicklung von Textelementen, der Organisation von Textbausteinen in Kapitel, der automatisierten Herstellung und laufenden Aktualisierung eines Inhaltsverzeichnisses – also auch in Anwendung der digitalen Techniken der fortlaufenden Textgestaltung – und nach der ›Niederschrift‹42 und Publikation des Textes: in der Fussnote eines anderen Textes, einem geschickt platzierten Zitat, manchmal einem Plagiat, was selten auffliegt, oder in einer Autorin, die sich beim Schreiben eines neuen Textes implizit auf diesen Text bezieht und ihn so weiterschreibt.43 Texte sind in the making, unter stets sich ändernden wissenschafts- und technikgeschichtlichen, ökonomischen und sozialen Bedingungen. Auch wissenschaftliche Sprachformen entwickeln und verändern sich, haben ihre Karrieren und high noons, bilden sich zurück, verblassen und leuchten an unerwarteten Orten wieder auf. Der schriftliche Text selbst ist also nur ein Moment in der Genese und Wirkung einer Thematik. Daraus folgt ein stärker prozessorientiertes Verständnis von Texten, das auch deren Produktion und Rezeption einbezieht.
Wie verhält sich dies aber zur Tatsache, dass die Buchstaben still und stumm auf einer Seite stehen, unverrückbar dort, wo sie die Formatierung belassen hat, bevor der Text zum Verlag ging? Wie verhält sich die Wandelbarkeit von Texten zu ihrer Kompaktheit, die Geschichte zu ihrer physischen Präsenz, die historischen Tiefen, in die sie reichen, zu ihrer Oberfläche hier und jetzt? Altern sie oder vergilbt nur das Papier, das sie geduldig trägt? Texte als Artefakte sind jedenfalls anders als die Geschichte, aus der sie kommen und in der sie stehen: ›abgeschlossen‹, der Autor hat sich mit einem Seufzer der Erleichterung verabschiedet und die Form ist konserviert (bis zur nächsten Auflage oder zum Einstampfen).
Die im vorliegenden Text entwickelte Les-Art trägt dazu bei, dieses Wechselspiel von Stillstand und Prozess wahrzunehmen. Sie nimmt dem Text seine Einmaligkeit und profiliert diese gleichzeitig. Beides sind Aspekte der Textproduktion: die Veränderung, das Formulieren, Umschreiben und Überarbeiten eines Textes, und sein Stillstand, die Erstarrung der Worte auf ihren Seiten, die Lektüren ermöglichen, die ebenfalls wieder dynamisch sind und bleiben. Der geschriebene Text wird in textologischer Perspektive dezentriert zugunsten seines Werdens im Autor (und seiner Bibliothek) und seines Weiterlebens in denen, die ihn lesen (und ihn vielleicht in ihre Bibliothek einreihen). Und dazwischen wird der konservierte Text inspiziert: seine Struktur, sein Aufbau, seine ›Raumtemperatur‹ und die ›gebrechliche Einrichtung‹ seiner Welt.
Praktische Theologie lebt von der Statik und Dynamik ihrer Texte. Sie ist als Wissenschaft am Stillstand des Textes orientiert. Dies hat gute Gründe. Sie basiert auf Texten, die soziale Kontrollgänge unterschiedlichster Art überstanden haben und nun nach Regeln auf Regalen etabliert sind. Sie lebt zudem vom Werden der Gedanken beim Schreiben und Lesen. Und sie lebt von der erhabenen Stille ihrer Buchstaben in den Grabmälern ihrer Folianten und dem Krähen ihrer Worte in den Geburtshäusern der Seiten.
Mit dieser textgenetischen Perspektive lässt sich ein in einem weiteren Sinn historiografisches Interesse verbinden. Texte sind dynamische Elemente der fachwissenschaftlichen Entwicklung der Praktischen Theologie der letzten Jahrzehnte. Es sind fünfzig bewegte Jahre, wenn man 1970 als Einstieg nimmt. Im Vergleich dazu ist es erstaunlich, wie spärlich Arbeiten sind, die sich der Aufgabe einer neueren Geschichte des Fachs, seiner Teildisziplinen oder auch der Entwicklung zentraler kategorialer Komplexe widmen.44
Mit dieser textgenetisch-historiografischen Perspektive lassen sich zudem Fragestellungen der historischen Epistemologie verbinden. Ihr geht es um »die Reflexion auf die historischen Bedingungen, unter denen, und die Mittel, mit denen Dinge zu Objekten des Wissens gemacht werden, an denen der Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung in Gang gesetzt sowie in Gang gehalten wird« (Rheinberger 2007, 11, kursiv im Original). Wissenschaftliches Tun, auch praktisch-theologische Textpraktiken, sind historischen Entwicklungen unterworfen. Damit sind auch die Erkenntnismittel der Praktischen Theologie und ihr Erkenntnisgegenstand geschichtlich wandelbar und beide immer auch unter historischen Gesichtspunkten zu erschliessen.
1.2.3 Text und Macht
Wie wird in praktisch-theologischen Texten Handlungsmacht beschrieben, wie ist ihnen Macht eingeschrieben und wie üben sie Macht aus? Dies ist die dritte Analyseperspektive, die ich verfolge. Es wird um eine Textologie in machtanalytischer Hinsicht gehen. Auch hier kann Praktische Theologie an einen seit langem etablierten wissenschaftlichen Diskurs anschliessen. Die Erforschung und Konzeptualisierung von agency im Schnittbereich von Disziplinen ist weit verzweigt.45Agency ist »Grundbestandteil aller Konzepte, die erforschen und erklären, wer oder was über welche Art von Handlungsmächtigkeit verfügt oder diese zugeschrieben bekommt bzw. als welchen und wessen Einwirkungen geschuldet etwas zu erklären ist« (Helfferich 2012, 10). Agency entsteht dabei nicht nur in der alltäglichen diskursiven Praxis. Vorstellungen von agency wachsen auch aus einer diskursiven Praxis im Wissenschaftsbetrieb, die sich teilweise in Texten verfestigt.
Handlungsmacht – worin sie besteht, wie sie entsteht bzw. konstruiert wird, wer die Folgen zu spüren bekommt, wer den Finger auf die Lippen hält, psst, wenn jemand sie in Frage stellt – wird in Texten abgebildet, aber auch vorgebildet und den Lesenden eingebildet. Textuelle Repräsentationen von Macht wachsen aus der diskursiven Praxis im Wissenschaftsbetrieb. Texte spuren ihrerseits vor, was als Handlungsmacht in wissenschaftlichen Diskursen eingesetzt wird. Und in beidem zeigt sich, dass wissenschaftliches Schreiben mit Dominanzansprüchen verbunden ist und auch praktisch-theologische Texte eine dominante Form von Literalität bilden, wobei einzelne Texte dominanter auftreten als andere. Schreiben ist auch in diesem Sinn eine durch und durch soziale Praxis, politisiert und politisch relevant. Ein diskurskritischer Zugang kann dazu dienen, wissenschaftliche Handlungsmacht genauer zu untersuchen und zu hinterfragen.46
Ganz offensichtlich wird diese Macht, auch die Macht, die den vorliegenden Text ermöglicht hat, wenn Gender einbezogen wird. Dies wurde mir im Spiegel der Texte bewusster, die Schriftstellerinnen zu ihrem Schreiben schreiben (Piepgras 2020). Sie suchen immer neue Formulierungen dafür, wie eingeschränkt Möglichkeiten des Schreibens für Frauen unter den Bedingungen der vorherrschenden Arbeitsteilung unserer Gesellschaft immer noch sind. »Schriftsteller gehen unter privilegierten Bedingungen an die Arbeit: Niemand fragt sie, ob sie schon Arbeit gefunden haben oder immer noch nur schreiben, ihr Selbstbild ist allgemein anerkannt. […] Frauen schon. Ihr Geschlecht wird zwischen den Zeilen mitgelesen, es hat, lange bevor das erste Wort zu Papier gebracht worden ist, Konsequenzen für ihre Arbeit« (8).47 Was Piepgras über die Belletristik sagt, lässt sich auf wissenschaftliche Schriftstellerei übertragen und ändert sich erst seit 2010 – allmählich.
Mein Beispiel zeigt es. Ich bin ein alter, weisser Mann, der schreibt, ein Prototyp der europäischen Wissenschaftsgeschichte in Kleinformat. Ein Teil der versteckten Macht, die auch in meinen Texten wabert, liegt in den Bedingungen, unter denen ich schreiben konnte: Ein ›Studierzimmer‹, ja zwei, eins zu Hause mit Aussicht auf die Berge, ein anderes an der Universität mit Aussicht auf die nächste Mauer der umfunktionierten Schokoladefabrik48, klösterlich. Ein von Kindern wenig gestörter Alltag, die Möglichkeit, über Jahrzehnte Themen entwickeln zu können, weniger biografische Brüche als im Leben meiner Frau, die immer wieder neu anfangen musste, und bezahlt fürs Schreiben, aber anders als bei Schriftsteller:innen, die meist erst nachträglich bezahlt werden, im Voraus, absehbar, immer ein wenig mehr in diesen Jahrzehnten. Sozial legitimiert war dieses Schreiben durch den Soll-Wert im Leben des akademischen Personals höherer Weihen, publish orperish, eine Regel, die nachweislich falsch ist, wenn man nicht Schreiberfolg und Existenz verwechselt, und doch von Generation zu Generation dramatisierend weitergegeben wird. Der Ermöglichungsgrund des Schreibens – earning while publishing – wird zum Imperativ stilisiert. In diesem gesicherten Rahmen habe ich im Stil der Männerkommunikation publiziert: konzeptorientiert, mich selbst in meinen Texten externalisierend, one up, one down in der argumentativen Intention, unter Aussparung jeglicher Körperlichkeit und an Lesern orientiert, die ähnlich ticken. Auch die Anstrengung, ja das Leiden des Schreibens – in den Texten der Schriftstellerinnen ein häufiges Motiv – habe ich bisher für mich behalten. Piepgras reklamiert die Metapher »Schreiben ist Kampf« zwar für Frauen – ich fühle mich trotzdem angesprochen.
1.2.4 Der empirische Umbau Praktischer Theologie
Untersuchungen zum semantischen Umbau wissenschaftlicher Systeme legen offen, wie sich politisch-gesellschaftliche Umbrüche in einer veränderten Semantik von wissenschaftlichen Texten abzeichnen (vgl. Bollenbeck/Knobloch 2001, 2004). So lässt sich auch fragen: Wie haben sich Themen, Argumentationen und Methoden in Texten der Praktischen Theologie seit den 1970er Jahren verändert? Strategien und Redeweisen praktisch-theologischer Texte werden in den Fokus gerückt, die einerseits dem Fachdiskurs Rechnung tragen, andererseits legitimatorisch auf exoterische, öffentlichkeitswirksame Resonanzeffekte abzielen.49 Solche Redeweisen sind »Schlüssel für ›akademische‹ Praxen, die sich auf die ›Forschungslogik‹ und die ›politische Logik‹ ausrichten« (Bollenbeck 2001, 16, kursiv im Original). An ihnen lassen sich auch in praktisch-theologischen Texten Aufschlüsse gewinnen »über Denkstile, Argumentationsmuster, Narrative und prototypische Probleme der Disziplin, über deren Kontinuität und Diskontinuität vor dem Hintergrund des gewandelten politischen Systems« (Kaiser 2008, 29).
Semantische Umbauten wurden im Zusammenhang mit historischen Einschnitten untersucht, in deren Folge sich fachexterne und -interne Ressourcenkonstellationen markant verschoben.50 Solche Mittelpunktverschiebungen in der fachlichen Diskussion finden aber auch kontinuierlich statt. »Schon der alltägliche Normalbetrieb eines Faches verschiebt kaum merklich, aber beständig das Zentrum im Komplex allgemein akzeptierter Probleme, Methoden, Themen und Begriffe« (Knobloch 2001, 227). Dabei ist das Verhältnis zwischen semantischen Umbauten und dem gesellschaftlichen Ermöglichungszusammenhang »hochkomplex« (Bollenbeck 2001, 28). Fachsprachliche Elemente, ›Scharnierbegriffe‹, die sowohl eine fachliche wie auch öffentliche Resonanz entfalten, und die »Basissemantik des jeweiligen politischen Systems« (17) greifen ineinander. Semantische »Membrane« halten auch ein Fach wie die Praktische Theologie »mit seinen Grundbegriffen, Argumentations- und Deutungsmustern im beständigen Austausch mit der gesellschaftlichen Deutungs- und Weltbildkonstruktion« (ebd.).
»Gerade geisteswissenschaftliche Traditionsfächer müssen sich auf den Wechsel von Resonanzbedingungen, die den Zugang zu Macht, Geld und Reputation regeln, einstellen«, so schreibt Bollenbeck zur Germanistik (Bollenbeck 2001, 15). Praktische Theologie ist innerhalb des theologischen Fächerkanons jene Disziplin, die diese »Resonanzbedürftigkeit« (ebd.) besonders sensibel registriert und unmittelbar auf veränderte persönliche, kirchliche und gesellschaftliche Ressourcenkonstellationen reagieren muss. Sie ist mit ihren häufig auch an eine weitere Öffentlichkeit gerichteten »exoterischen«51 Publikationen ein Ort, an dem die Grenz- und Mittelpunktverschiebungen der theologischen Fächer »kommunikativ erprobt, validiert, ausgehandelt und bekräftigt werden« (Knobloch 2001, 231).
Ich konzentriere mich auf einen Teilbereich semantischer Verschiebungen, auf den erfahrungswissenschaftlichen, empirischen Umbau der Praktischen Theologie zwischen 1970 und 2020. In der Religionspädagogik wurde bereits in den späten 1960er Jahren die »Wendung« zur Empirie ausgerufen (Wegenast 1999c [1968]). Eine ähnliche Wende vollzogen etwas später Kybernetik und Kirchentheorie mit ihren kirchensoziologischen Studien. In der Seelsorge setzte dieser Umbau in den 1970er Jahren im Rückgriff auf therapeutische Modelle und Techniken ein. Erfahrungswissenschaftliche Zugänge führten in den Fächern Homiletik und Liturgik in den 1990er Jahren zu entsprechenden Verschiebungen. Was gerade als praktisch-theologische Leitdisziplin galt, verschob sich entsprechend dem empirischen Umbau eines Fachs. Umbauprozesse machen Fächer attraktiv, signalisieren wissenschaftlichen Fortschritt und verändern Fächerstrukturen und -hierarchien. Deshalb bin ich auch gerne Praktischer Theologe. Es ist ein aufregender und anregender Ort. Praktische Theologie lässt sich herausfordern, sucht nach neuen Ressourcen, eignet sich diese an und baut ihre Texte kontinuierlich um. Baut ihr Denken um.
Diese vier Perspektiven sind Lesehilfen. Ich nehme sie nicht immer in gleicher Weise in Anspruch, sondern jeweils dann, wenn sie bestimmte Aspekte eines Textes besser fokussieren helfen. Denn: Textologie setzt sich dem Text aus.52 Es inspiriert sie eine bestimmte Form von Lektüre, die sich den Besonderheiten praktisch-theologischer Texte »vorbehaltlos« aussetzt, sie »respektiert und zur Geltung bringt« (Endres 2017, 91).
1.3 Vorgehen und Aufbau
Im Folgenden finden sich Annäherungen an die skizzierte Problematik. Sie illustrieren einzeln, was ein textologischer Zugang zu wissenschaftlichen Texten leisten kann, und können auch einzeln gelesen werden. Sie ergänzen sich, indem ich Analysen schrittweise vertiefe. Der skizzierte textologische Zugang wird an exemplarischen Texten der Praktischen Theologie zwischen 1970 und 2020 erprobt. Detailstudien zu einzelnen Texten und ganzen Text- und Themenformationen der Praktischen Theologie dieses Zeitraums ermöglichen Probebohrungen, ob, wie und mit welchem Gewinn die sprachliche Verfasstheit von Praktischer Theologie, ihre spezifische Literalität, erschlossen werden kann.
Jede Periodisierung ist gleichzeitig auch ein Mittel der Konstruktion von Texten, also auch des vorliegenden Textes. Sie ist nur eines der sprachlichen Mittel, mit denen ich meinen Text vorwärtstreibe. Ich schreibe den Text mit den Mitteln, die ich untersuche. Stolperfallen sind eingebaut. Stolpern ist produktiv, provoziert schnelle Schritte vorwärts, hoffentlich vor dem Fall.53
Autorschaft: Praktisch-theologische Texte werden von Autoren und im Verlaufe dieser Jahrzehnte zunehmend auch von Autorinnen verfasst. Dabei wird Autorschaft selbstverständlich praktiziert. Aber: Welche Formen der Autorschaft werden – literaturwissenschaftlich betrachtet – in diese Texte eingebaut? Wie konstituiert sich ein praktisch-theologisches Subjekt beim Schreiben seiner Texte? Oder sind solche Fragen überholt und ist es Zeit, auch den praktisch-theologischen Autor zu Grabe zu tragen (Barthes 2000 [1968])?
Die ›Praxis‹ der Seelsorge im Fall: Der Fallgebrauch ist seit den 1960er-Jahren ein Merkmal praktisch-theologischer Literatur. Am Beispiel der Poimenik untersuche ich, welche Typen von Fallbezug sich durch die Jahrzehnte hindurch entwickelt haben, wie diese textuell ausgestaltet sind, welche Funktionen sie in der Seelsorgelehre übernehmen und inwiefern dieser Fallgebrauch ein Licht auf die Praktische Theologie als ›Fall‹ wirft.
Die empirische Wendung der Praktischen Theologie: Nach 1960 wanderte ›Empirie‹ auf breiter Front in praktisch-theologische Texte ein. Wie und mit welchen Folgen werden empirische Daten, Methoden und Theorien sprachlich in praktisch-theologische Texte hineinmontiert? Wie verändert dies Wahrnehmung und Denken? Texte aus der Religionspädagogik werden hier unter die textologische Lupe genommen.
Praktisch-theologische Ritualistik: ›Das Ritual‹ wurde seit dem Aufkommen der ritual studies in den 1970er Jahren zunehmend zum Thema Praktischer Theologie. Wie wurde das Ritual zur wissenschaftlichen Tatsache? Wie hat sich dabei insbesondere in Texten zu den Kasualien eine spezifisch praktisch-theologische Ritualistik entwickelt?
Die Theologie der Praktischen Theologie: Auch die Theologie Praktischer Theologie wird geschrieben und erschrieben. Sie wird in Texte eingeschrieben, in Texten weitergeschrieben und in Texte abgeschrieben. Im Besonderen interessiert mich, wie theologische und empirische Sprach- und Argumentationsformen dabei vermittelt werden.
Praktische Theologie als Text – Fazit, Kritik und Ausblick: Zum Schluss wird bilanziert, wie sich praktisch-theologisches Denken verändert, wenn seine textuelle Verfasstheit kritisch in den Blick genommen wird. Dabei inspiziere ich die Grenzen dieser Herangehensweise und wage einen Ausblick. Das gehört sich so.
Die Studien sind für alle gedacht, die der Produktion praktisch-theologischer Wissenschaftlichkeit auf die Spur kommen wollen, für Studierende, die sich einen Weg ins wissenschaftliche Schreiben bahnen, Promovendinnen und Promovenden, die ihr Können an einem ersten grossen wissenschaftlichen Schreibprojekt weiterentwickeln, Kolleginnen und Kollegen, zu deren Alltag das Schreiben gehört, und alle, denen es Spass macht, sprachlichen Finten und Finessen wissenschaftlicher Texte auf die Spur54 zu kommen. Es geht um Aufklärung dessen, was in den üblichen Praktiken des Schreibens und Lesens unter Zeit- und Produktionsdruck unbeachtet bleibt, unbeachtet bleiben muss, weil sonst kein Text fertig geschrieben und zu Ende gelesen werden könnte. Mit diesem Kurs in angewandter Textologie sind grundsätzliche Fragen verbunden: die Fragen nach dem Verhältnis von Form und Inhalt, Textur und Text, Sprache und Denken, Schreiben/Lesen und Wissenschaftlichkeit, Praxis der Theorie und Theorie der Praxis. Und vielleicht wird die Lektüre und das Schreiben wissenschaftlicher Texte so auch ein Quäntchen vergnüglicher. Vielleicht.
1.4 Praktische Theologie des dritten Lebensalters
Natürlich, ich höre den Einwand, kann ich mir dieses Nachdenken über die Sprache der Praktischen Theologie leisten. Ich habe die Entwicklung des Fachs von 1970 bis 2012 an einem etwas exzentrischen Ort, in der Schweiz, miterlebt. Damit war ich nicht so eng eingebunden in die Gepflogenheiten der Deutschen Akademie, in ihre Seilschaften und ihr begriffliches Kampfgetöse, das ich von der helvetischen Seitenlinie meist eher etwas erschreckt verfolgte. Mein Interesse an der Manufaktur des Schreibens ist zudem dem existentiellen semantischen Umbau meiner Interessen in der Folge der Emeritierung geschuldet. Es ist eine Distanz, aus der ich einen anderen Blick auch fürs Schreiben gewann. Den Anstoss gab mein Sohn, Simon Morgenthaler. Seine historische und philologische Rekonstruktion von »Formationen« einer Wissenschaft, in seinem Fall der Kunstwissenschaft, haben mir den literaturwissenschaftlich-historiografischen Zugang zu Wissenschaftlichkeit nähergebracht und haben mich dazu inspiriert, meinen praktisch-theologischen Ansatz, mit dem ich am empirischen Umbau der Praktischen Theologie an einer Ecke mitwerkelte, philologisch rückzubauen.55
Der biografische Ort dieser Beobachtungen und Überlegungen ist das dritte Lebensalter, jene Spanne zwischen dem Erwachsenenalter und dem hohen Alter, die sich erst zwischen 1970 und heute geöffnet hat. Gibt es ein drittes Lebensalter für Praktische Theolog:innen? Gibt es vielleicht sogar eine Praktische Theologie des dritten Lebensalters? Welches wäre deren Chance? Dieses dritte Lebensalter gibt mir jedenfalls Zeit, befreit vom Druck des publish or perish nochmals in Ruhe zurückzuschauen, ohne den Anspruch, es noch besser machen zu müssen, aus der Perspektive des Lehnstuhls und nicht des Lehrstuhls. Dieser Text ist möglicherweise auch eine Art wissenschaftlicher Ersatzhandlung für das Schreiben von Memoiren oder andere Beschäftigungen in meinem Alter, wie: Stammbäume zeichnen, Kochkurse besuchen oder einer Sterbehilfeorganisation beitreten. Es ist in diesem Sinn ein persönliches, in Teilen auch persönlich formuliertes Buch. Ich trotze damit Altersstereotypien. Sie schnappen zwar zu, selbst wenn ich gegen sie anschreibe. Und doch: Wie kann ich mir als Praktischer Theologe, der ich geblieben bin, eine gewisse Handlungsmächtigkeit erhalten?56
2. Autorschaft
Wir wissen, dass der Mythos umgekehrt werden muss, um der Schrift eine Zukunft zu geben. Die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors.
Roland Barthes1