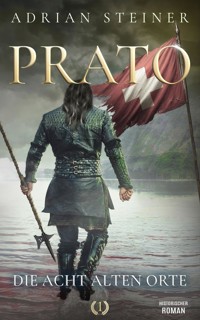6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Militär
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Schweiz im frühen 15. Jahrhundert … Folgen Sie dem jungen Krieger Prato aus dem Land Uri, der im Ringen der Eidgenossen und Mailänder um Macht und Besitzungen zu einem der mächtigsten Männer der Eidgenossenschaft aufsteigt …
Nach dem Überfall auf den Turm sind Prato und seine Gefährten gesuchte Männer in der gesamten Eidgenossenschaft. Von ihrem Versteck aus überfallen sie von nun an Nauen, die wohlhabende Händler über den Vierwaldstättersee bringen.
Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Als die Mailänder den Ort Bellinzona erobern, scheint ein Krieg unausweichlich. Und Prato, der sein Leben nicht als einfacher Dieb fristen möchte, wittert seine Chance, als Anführer eines Söldnerheers zu Ruhm und Wohlstand zu kommen.
In Luzern heuert er mit dem gestohlenen Geld Männer aus seiner Heimat an. Bald schon zieht er an der Spitze seiner „Söldner aus Livinien“ in den Kampf …
Der Zyklus „Prato“ funktioniert auch, ohne „Die Nacht am Feuer“ gelesen zu haben!
„Prato“ besticht besonders durch die Ortskenntnisse und akribische Recherche des Autors, wodurch er die Schweiz des Spätmittelalters in Ihrem Kopfkino lebendig werden lässt. Adrian Steiner ist selbst Schweizer aus dem Land Uri und lässt eine unvergleichliche Authentizität in seine Texte einfließen. Profitieren Sie zudem von den historischen Hinweisen und Abbildungen, die Ihnen die realen Hintergründe zu der beschriebenen Welt liefern.
Erkunden Sie die Schweiz im Mittelalter! Lesen Sie jetzt Band 2 des dreiteiligen Zyklus‘ „Prato“ über den skrupellosen Schweizer Räuberkönig. Band 3 erscheint bereits im 1. Quartal 2025.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Adrian Steiner
Prato
Band 2
Die Zeit der Räuber
Aus der Reihe
Schweizer Mittelalter-Saga
EK-2 Militär
Hinweis
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Karte
Kapitel 1: Gruebisbalm
Kapitel 2: Luzern
Kapitel 3: Einsiedeln
Kapitel 4: Chur
Glossar
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Über die Schweizer Mittelalter-Saga
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Impressum
Hinweis
Dieser Roman behandelt die Alte Eidgenossenschaft im frühen 15. Jahrhundert und spielt somit hauptsächlich in der heutigen Schweiz. Auch ist der Autor Schweizer. Für maximale Authentizität folgt der Text den Regeln der Schweizer Rechtschreibung; so gibt es beispielsweise kein ss. Die Guillemets (französische Anführungszeichen) werden umgekehrt dargestellt: «»
Das heisst, aus Sicht eines Deutschen oder Österreichers sind sie umgekehrt dargestellt – für Schweizer ist die Darstellung in diesem Buch üblich.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Jill & Moni
von
EK-2 Publishing
Karte
Abbildung 1: Schweizerkarte um 1400: Prato I - Die acht alten Orte (Nach Faden, 1799)
Kapitel 1: Gruebisbalm
A
m nächsten Morgen wachte ich in der Höhle auf. Meine Glieder schmerzten von der unbequemen Nacht auf dem nackten, kalten Gestein. Wir hatten nichts, um den harten Untergrund etwas weicher zu gestalten. Ich richtete mich auf und streckte vorsichtig die Arme und Beine aus.
Nachdem wir am Vortag endlich die Höhle erreicht hatten, waren wir so tief wie möglich hineingekrochen. Sie war überraschend gross, vom Eingang aus konnte man wohl etwa fünfzig Fuss weit hineingehen. Im hinteren Bereich entdeckten wir einige trockene Äste, die wir nutzten, um ein Feuer zu entfachen, obwohl ich mich dagegen aussprach, denn die Männer bei der Treib hatten inzwischen sicher bemerkt, dass wir verschwunden waren, und suchten nach uns. Trotzdem blieb uns keine andere Wahl: Ohne Feuer würden wir die Nacht nicht überleben. Wir drängten uns dicht um die wärmenden Flammen und streckten ihnen unsere kalten Hände entgegen. Veit, Felis und ich waren von den letzten Tagen gezeichnet. Seit wir Grinau verlassen hatten, hatten wir kaum geschlafen. Wir waren verfolgt und geschlagen worden und ohne Unterlass der widerlichen Kälte ausgesetzt. Tus hielt das Feuer die Nacht hindurch am Brennen und übernahm die Wache, während wir anderen in einen komatösen Schlaf fielen.
Nun war es früher Morgen, oder herrschte bereits Mittag? Ich vermochte es tief aus der Höhle heraus nicht zu sagen. Noch immer fror ich, und war erleichtert zu sehen, dass Tus am Feuer sass und Scheite nachlegte. Er schien durchgängig wach gewesen zu sein und grüsste mich mit einem leichten Kopfnicken.
«War es ruhig draussen? Hat uns jemand gesucht?», wollte ich von ihm wissen.
«Ich habe niemanden bemerkt. Bin mehrmals nach draussen gegangen, habe gehorcht und mich umgesehen. Aber es war nichts zu hören.»
Ich ass etwas von unserem spärlichen Proviant, den wir von Grinau mitgenommen hatten, und blickte zum Höhleneingang, der umrahmt von den dunklen Felswänden zu strahlen schien. Das Tageslicht drang ins Innere und ich sah mich erstmals genauer um. Als wir am Vortage hier angekommen waren, hatte tiefe, pechschwarze Nacht geherrscht, und wir waren lediglich durch die Dunkelheit gestolpert und hatten uns den Weg ertastet.
Also stand ich auf und nahm mir die Zeit, die Höhle gewissenhafter zu untersuchen. Vorne am Eingang begutachtete ich den Wasserfall, welcher fast über die gesamte Breite der Höhlenöffnung wie ein verschleierter Vorhang herunterplätscherte und dadurch unser geheimer Unterschlupf verbarg.
Der Eingang selbst mass vielleicht 24 Fuss in der Breite und war an der höchsten Stelle ungefähr neun Fuss hoch. Gleich hinter dem Eingang fand sich innerhalb der Höhle einen kleinen, etwa mannslangen See, in dem sich das Frischwasser des Wasserfalls sammelte, bevor es dann von diesem natürlichen Becken weiter ins Tal hinunterfloss. Die tiefste Stelle von unserem Versteck befand sich ungefähr 50 Fuss weit vom Eingang entfernt, mit zunehmend abfallender Decke, sodass ich zuhinterst nur noch gebückt gehen konnte. Es war eine recht ansehnliche Höhle.
Ich begab mich wieder zum Eingang, wo das Wasser des kleinen Baches heruntertröpfelte. Um die Höhle zu verlassen, zog ich reflexartig den Kopf ein, während ich durch das kühle Nass trat. Draussen fand ich mich in einer schmalen, kleinen Schlucht wieder. Zu beiden Seiten ragten steile Hänge empor, die von dichten Bäumen gesäumt waren.
Rechts von mir führte ein kleiner Trampelpfad aus dem Tobel. Als ich dem Pfad folgte, erreichte ich bereits nach wenigen Atemzügen das Ende und fand mich auf einem freien Feld wieder, von wo aus sich mir ein atemberaubender Blick auf den See bot. Es war ein klarer Tag im Januar und nur leichter Dunst trübte die weite Sicht.
Der See lag im Herzen der Eidgenossenschaft. Die Länder Uri, Schwyz, Unterwalden und die Stadt Luzern befanden sich alle an diesem verzweigten Gewässer, wobei Luzern am nördlichen Ufer des Sees lag, wo das Gelände flacher war. Wenn man von Luzern aus in die anderen Länder rudern wollte, musste man eine Engstelle zwischen dem sogenannten Oberen und Unteren Nas durchqueren. Von meiner Position aus konnte ich direkt auf diese Engstelle weit unter mir blicken und erkannte eine Naue, die soeben hindurchsteuerte.
Natürlich drehte sich der Rest der Welt weiter, auch wenn sie am Vorabend für uns beinahe stehengeblieben wäre. Und so melkten die Bauern ihre Kühe, die Fischer zogen mit ihren Netzen auf den See hinaus, Schmiede hämmerten auf den Stahl und die Händler fuhren mit den Nauen durch diese Engstelle von Flüelen nach Luzern oder umgekehrt. Ich stellte mir vor, dass die Naue dort unten vielleicht sogar von Otto Vischlin gesteuert wurde, der Bruder des Urner Schiffsmeisters, auf seiner wöchentlichen Fahrt von Flüelen in die Stadt Luzern. Ich schirmte meine Augen mit der flachen Hand gegen den grellen Himmel ab und folgte der Uferlinie, um den Weg der Naue zu erkennen. Wenn ich meinen Kopf drehte und vorausschauen wollte, wohin sie wohl rudern würde, konnte ich in der Ferne eine Stadt erkennen. Das musste Luzern sein.
Abbildung 7: Gruebisbalm (Nach: Faden, 1799)
Als wir am Abend zusammen assen, fragte mich Tus, wie es nun weitergehen solle. Verständlicherweise war er besorgt darüber, einen Fehler begangen zu haben, als er sich uns anschloss. Zweifellos befürchtete er, wir würden uns damit begnügen, in dieser Höhle Däumchen zu drehen und auf bessere Zeiten zu warten.
Also erklärte ich ihm: «Hier haben wir ein ideales Versteck gefunden. Nur wenige kennen die Höhle und die, die sie kennen, meiden sie wegen der bösen Geister.» Ich hielt inne und fuhr dann fort: «Wir haben von hier aus eine gute Sicht auf einen Grossteil des Sees. Wir können alle Nauen beobachten, die darauf verkehren. Wenn eine Naue von Luzern ablegt und sich auf den Weg nach Flüelen macht, sehen wir das, sobald sie den Hafen von Luzern verlässt. Wenn eine Naue von Flüelen her in Richtung Luzern unterwegs ist, sehen wir auch das, sobald sie sich der Engstelle nähert.»
Ich wartete einen Augenblick ab und sah Tus an. Auch Veit und Felis hörten aufmerksam zu, obwohl sie die groben Umrisse des Plans bereits kannten.
«Was befindet sich meistens auf den Nauen?», wollte ich wissen.
Wir alle richteten unsere Aufmerksamkeit auf Tus.
«Vieh, Weizen, Stoffe. Alles Mögliche», antwortete er.
«Und Händler», ergänzte Veit.
«Genau, Händler, Kaufleute, Adlige. Reiche Menschen aus aller Herren Länder. Stellt euch vor, wie viele Münzen auf so einer Naue zu finden sind», sagte ich.
Ich dachte an die vielen italienischen Händler mit ihren wertvollen Truhen, die wir zum Schutz ihrer Kostbarkeiten auf den Nauen von Herrn Vischlin begleitet hatten. Wir alle, wohl auch der Schiffsmeister Albrecht Vischlin, hatten ab und zu daran gedacht, den Händler einfach zu töten und den Inhalt der Kiste unter uns aufzuteilen.
«Du willst die Nauen überfallen?» Tus zog die Augenbrauen nach oben.
«Ja!», antwortete ich überzeugt, «Wir sehen die Nauen von hier oben früh genug. Wir steigen hinunter, gehen mit unserer Jasse auf den See und stehlen von den Händlern, was wir kriegen können.»
«Und wohin verschwinden wir dann, ohne, dass sie sehen, wohin wir gehen und uns verfolgen?»
«Habt ihr schon von der Wispelenegg gehört?», fragte ich die Männer und blickte dabei in unwissende Gesichter. Auch Veit hatte noch nie davon gehört. Aber das war auch nicht weiter verwunderlich, denn er war nie mit dem Herrn Vischlin auf den Urner Nauen gewesen. Stattdessen hatte er zu jener Zeit im Schächental gedient, weit weg vom Wasser des Sees.
Doch die beiden Vischlin-Brüder kannten zahlreiche Geschichten von gefährlichen Stellen auf dem See. Sie erzählten von Strudeln, von mysteriösen Kräften, die eine Naue plötzlich in die Tiefe zogen. Allen voran Otto Vischlin, der jede Woche nach Luzern schiffte, kannte fürchterliche Geschichten von Seeungeheuern und bösen Geistern. Eine dieser gefährlichen Stellen hiess Wispelenegg. Er erklärte uns in den Gasthäusern von Flüelen ganz genau, wo diese Stelle zu finden war:
Die dort eingezeichnete «Wispelenegg», ein kanzelförmiger Felsvorsprung am Ufer der «Nas», taucht bereits in Schriftquellen des 15. Jahrhunderts auf. (…) Auch noch 1764 und 1796 wird von «der gefaehrlichen Spitze Wispeleneck berichtet, «da sich viele Schiffbrueche begeben.»
(Reitmaier & Egloff, 2008)
«Die Wispelenegg befindet sich beim Unter Nas», erklärte ich den anderen. «Sie liegt direkt auf der üblichen Strecke von Luzern nach Flüelen. Und die Stelle ist verwünscht. Heimtückische Winde und gefährliche Strudel lassen dort immer wieder Boote verschwinden. Ausserdem befindet sich die Stelle dort, wo die Ufer von unwegsamem Gelände gezeichnet sind. Eine Naue kann dort nicht anlegen, weil nur nackter Fels aus dem See ragt. – Sie werden dort also in der Falle sitzen. Daher werden wir an dieser Stelle die Nauen überfallen. Wir nehmen, was wir kriegen, und schlagen ein paar Löcher in den Boden der Nauen. Nicht so grosse, dass sie direkt sinkt, es soll nur so viel Wasser hereinlaufen, dass die Besatzung mit Ausschöpfen beschäftigt ist, während wir das Weite suchen.»
«Das Weite – wohin?», fragte Tus.
«Wir verschwinden durch die Engstelle zwischen Ober und Unter Nas, rudern in Richtung Brunnen und gehen an Land, sobald uns die Naue nicht mehr sehen kann. Dort verstecken wir unser Boot und flüchten hinauf in unsere Höhle», endete ich meine Erklärungen. Ich war ziemlich zufrieden mit mir und ich hörte bereits die Münzen klimpern.
Stille kehrte in unserem Versteck ein und alle dachten über das Gesagte nach. Bevor jemand Zweifel äussern konnte, ergänzte ich: «Natürlich müssen wir vorsichtig sein und nach einem Überfall eine gewisse Zeit abwarten. Wir dürfen nicht jede Naue überfallen. Vielleicht eine alle paar Wochen. Und wir dürfen keine einheimischen Händler ausrauben.»
Das leuchtete allen ein. Solange wir nur die ausländischen Händler und Kaufleute behelligten, würden die Einheimischen nicht so nervös werden. Solange es nicht ihr Geld war, das gestohlen wurde, konnte es ihnen beinahe egal sein.
Die nächsten Tage nutzten wir dazu, uns in der Höhle einzurichten. Wir waren uns einig darin, dass wir uns für den Moment am besten überhaupt nicht in der Öffentlichkeit blicken liessen. Man würde bestimmt noch eine Zeit lang nach uns suchen. Ich hoffte nur, dass niemand unser Boot entdecken würde, das wir unten am Ufer zurückgelassen hatten. Ich beruhige mich aber immer wieder damit, dass wir es gut versteckt hatten.
Wir richteten provisorische Nachtlager ein. Jeder versuchte seinen Platz mit Ästen und Laub so bequem wie möglich zu gestalten. Wir sammelten Steine, türmten sie um die Feuerstelle herum auf und dichteten die Spalten mit Erde ab, um die grellen Lichtstrahlen daran zu hindern, in die dunkle Nacht zu entweichen.
Wir wagten nur in der Nacht das Feuer zu entfachen, denn wir fürchteten, dass man am Tag die Rauchsäule am klaren Himmel erkennen würde. Es war tiefster Winter und so kam es, dass wir tagsüber ohne das wärmende Feuer mehr froren als in der Nacht.
Immer wieder wagten wir uns vorsichtig nach draussen, schlichen aus dem Tobel, um einen Blick auf den See zu erhaschen. Ständig befürchtete ich, dass man uns finden würde. Doch ein Tag nach dem anderen verstrich und niemand kam. Die Höhle war gut versteckt. Und niemand hatte uns gesehen, als wir von der Treib Reissaus genommen hatten. Niemand hatte gesehen, wohin wir geflohen waren. Genauso gut hätten wir nach Unterwalden gegangen sein können, oder über die Berge in den Osten, oder noch weiter in den Norden. Alles wäre möglich gewesen. Vermutlich war sogar alles andere wahrscheinlicher als unser Versteck mitten in der Eidgenossenschaft. Mit jedem Tag, der verstrich, fühlte ich mich sicherer und meine Zuversicht wuchs.
Wir veränderten unser Aussehen. Wir liessen unsere Bärte und Haare wachsen. Zum einen wollten wir nicht mehr auf den ersten Blick als die Männer von Grinau erkannt werden. Zum anderen war es uns aber auch einfach nicht möglich, uns in der Höhle richtig zu rasieren.
Nach ungefähr acht Tagen wagten wir uns wieder hinunter an den See, um nach unserer Jasse zu sehen. Wir fanden das Boot an derselben Stelle, an der wir es unter Gestrüpp versteckt hatten. Um sicherzugehen, bauten wir das Versteck noch weiter aus.
Danach schlichen wir im Schutze des Waldes auf das Dorf Vitznau zu, darauf bedacht, niemandem zu begegnen. Wir brauchten etwas zu essen und noch ein paar andere Alltagsgegenstände, die wir anders nicht beschaffen konnten. Natürlich wollte ich es vermeiden, dass wir uns mit anderen Menschen treffen mussten, doch nach acht Tagen in unserem Versteck waren unsere Nahrungsmittel vollständig erschöpft.
Als wir in die Nähe des Dorfes kamen, verharrten wir im Wald und beobachteten die einfachen Hütten für ein paar Augenblicke.
In dem kleinen Weiler wohnen höchstens eine Handvoll Familien, dachte ich.
Wir bestimmten Felis, der in das Dorf gehen und nach Nahrungsmitteln fragen sollte. Er sah von uns allen am wenigsten wie ein Dieb aus, da er einigermassen saubere Kleider trug.
«Und was soll ich ihnen sagen, wenn sie Fragen stellen?», wollte Felis von uns wissen.
Das war ein guter Punkt. Und ich wusste keine Antwort. Bestimmt wollten die Menschen in dem Weiler Neuigkeiten austauschen und wissen, woher Felis kam und was er bei ihnen wollte. Bestimmt würden sie Klatsch und Tratsch erfahren wollen, mit dem sie die Langeweile ihres eigenen Lebens aufwerteten.
Veit schlug vor: «Sag ihnen, ein reicher Adliger hätte sich irgendwo in der Nähe niedergelassen und möchte frischen Fisch kaufen. Sag ihnen, dass du ab jetzt jede Woche vorbeikommen wirst, wenn ihr euch einig werdet. Dann wissen sie, dass es für sie ein lohnendes Geschäft werden könnte.»
Felis sah uns abwechselnd an. Offensichtlich wartete er auf ein Urteil der Gruppe. Schliesslich ruhte sein Blick auf mir.
«Versuch es», sagte ich knapp, da ich auch keinen besseren Einfall hatte. Felis zuckte mit den Schultern und entgegnete: «Gut. Dann bleibt nur noch die Bezahlung.» Er sah mich eindringlich an.
Ich hatte die Annelises Kette mithilfe meiner Hellebarde in der Höhle in mehrere Teile zerhackt und gab Felis nun eines. «Das ist Silber. Gib ihnen das.»
Ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob es wirklich Silber war. Aber die Farbe stimmte. Ich wusste auch nicht, wie viel das Bruchstück wert war. Sein Gewicht konnte ich in der Hand gerade so spüren. Wenn es Silber war, war die Bezahlung für ein paar Lebensmittel wohl sehr grosszügig. Und wenn es zusätzlich die Verschwiegenheit der Leute förderte, sollte es mir recht sein.
Felis nahm das Bruchstück entgegen und wog dessen Gewicht ebenso in der Hand ab wie ich. Er sah mich an und machte sich davon. Als er aus dem Unterholz hervortrat, straffte er seinen Leib und streckte den Rücken durch. Er schüttelte alle Äste und sonstiges Grünzeug von seinem Umhang, strich seine Haare nach hinten und ging raschen Schrittes auf die Hütten zu.
Schon bald war er aus unserem Sichtfeld verschwunden und das angespannte Warten begann. Es war wichtig, Proviant zu besorgen, denn wir besassen nichts mehr. Veit, Tus und ich warteten schweigend. In Gedanken waren wir bereits in der Höhle und genossen unser Essen.
Ich beobachtete den Schatten, den die Sonne hinter einem einzelnen Ast warf. Der Schatten wanderte etwa einen halben Fuss weit, ehe Felis endlich mit einer Tasche über der Schulter zurückkehrte. Er grinste uns zu, was wohl nur Gutes bedeuten konnte.
«Männer, heute gibt es ein Festmahl!», verkündete er.
«Was hast du erhalten?», wollte Veit als Erster wissen.
«Hühnchen, Fisch, Brot und Bier», antwortete er gutgelaunt.
«Haben sie Fragen gestellt?», fragte ich.
«Ich habe ihnen die Geschichte erzählt und ihnen das Hacksilber entgegengestreckt. Ein Mann nahm es und schickte die Frauen los, um Essen zusammenzutragen. Ich sagte ihnen, dass ich ab jetzt öfters kommen werde. Sie meinten, ich sei jederzeit willkommen.»
Und damit schlichen wir wieder tiefer in den Wald hinein, um wenig später den steilen Aufstieg in unsere Höhle in Angriff zu nehmen.
Inzwischen waren zwei Wochen vergangen, seit wir von der Treib entkommen waren. Jedes Mal, wenn ich aus der Höhle heraustrat und auf die Welt im Tal unter uns hinuntersah, erkannte ich, dass alles seinen üblichen Gang nahm. Ich konnte keinerlei Auffälligkeiten entdecken; alles schien den Gewohnheiten zu entsprechen.
Ich entschloss mich, dass es an der Zeit war, wieder aktiv zu werden. Vier Männer, isoliert in einer Höhle, konnte auf die Dauer nicht gutgehen. Wir langweilten uns und drohten fahrlässig zu werden. Die Männer entfernten sich immer weiter von unserem Versteck und ich musste sie daran erinnern, nicht unnötig umherzuwandern. Wir stritten immer öfter. Jeder fragte sich, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte, in diese eintönige Höhle hinaufzusteigen. Die Stimmung verdüsterte sich und Kleinigkeiten führten zu Auseinandersetzungen.
Wenn wir in das Wasserbecken am Höhleneingang blickten, erkannten wir in unserem Spiegelbild, dass wir wie Wilde aussahen. Wie Ausgestossene oder Verbannte, die im Wald lebten. Ich erinnerte mich an die Diebe, die wir in Uri im dunklen Wassener Wald verfolgt hatten. Einer war über die Klippe in den Tod gestürzt, den anderen hatten wir festnehmen können. Ich meinte, dass wir nun ähnlich aussahen wie sie damals.
Also bereitete ich die Männer auf unseren ersten Überfall vor. Auch ich wusste zunächst nicht genau, wie wir vorgehen sollten. Doch hatte ich mir in den letzten Tagen den Kopf darüber zerbrochen und versuchte alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und die Risiken abzuwägen.
«Ab jetzt beobachten wir die Nauen, die von Luzern herkommen», erklärte ich meinen Mitstreitern. «Wir müssen sicher sein, dass es nicht die Urner Naue ist, denn der Schiffsmeister würde mich mit Sicherheit erkennen. Vielleicht sogar auch Veit oder Tus. Wir alle haben in Uri unter Arnold Schick gedient.»
«Und wie erkennen wir das von hier oben?», wollte Felis wissen.
«Die Urner Naue ist etwas grösser als die Luzerner. Wir werden es schon merken. Am besten ist es, wenn wir die Luzerner Naue überfallen. Denn niemand von uns hat je etwas mit Luzern zu tun gehabt.» Ich sah sie fragend an, worauf alle zustimmten.
«Am besten machen wir den Überfall, wenn es dämmerig ist. Die Dunkelheit begünstigt unsere Flucht; niemand wird sehen, wohin wir fliehen. Um diese Jahreszeit ist es nicht lange hell und irgendeine Naue wird irgendwann verspätet vom Hafen in Luzern ablegen. Vielleicht sind nicht genügend Ruderer verfügbar oder das Wetter ist schlecht. Früher oder später wird eine in der Abenddämmerung auf das Wispelenegg zufahren.» Ich legte eine Pause ein. «Dann werden wir hinuntersteigen, unsere Jasse zu Wasser lassen, zum Wispelenegg rudern und die Naue überfallen.»
«Der Schiffsmeister wird versuchen seine Fracht zu schützen», gab Tus zu bedenken. Und damit hatte er natürlich recht. Trotz all meiner Planungen wusste ich nicht genau, wie wir es im Detail am besten anstellen sollten. Aber irgendwann wurde ich der Grübeleien überdrüssig und entschied, dass wir es einfach versuchen mussten.
Also teilte ich uns in zwei Gruppen ein: «Felis und ich springen auf die Naue, während Veit und Tus auf unserer Jasse bleiben. Tus, du wirst die Jasse mittels der Ruder auf Position halten, während du, Veit, deine Armbrust zu jeder Zeit auf den Schiffsmeister gerichtet hältst. Er soll spüren, dass eine falsche Bewegung sein Todesurteil bedeutet.»
Ich sah Felis an. «Wir beide treiben die Ruderer und den Schiffsmeister auf einer Seite der Naue zusammen. Dann sollen sie uns ihre wertvollsten Waren herüberwerfen. Wenn wir alles haben, schlägst du mit dem Spitz der Hellebarde ein Loch in die Naue. Das Wasser dringt ein, wir gehen von Bord und rudern davon, während die Ruderknechte das Wasser ausschöpfen müssen, um nicht unterzugehen.»
Angespannt sah ich die anderen an. Hatte ich sie überzeugt? Sie sahen sich gegenseitig an und begannen zustimmend zu nicken.
Dann, eines Abends, war es so weit. Nachdem wir mehr als drei Wochen untergetaucht waren, glaubten wir, die richtige Naue für unseren ersten Überfall rudere in unsere Richtung.
Wir stimmten überein, dass es sich um eine Luzerner Naue handeln musste. Es war später Nachmittag, eher schon Abend. Wir spürten einen leichten Wind, der jedoch nicht zu stark war, um unser Vorhaben zu gefährden. Wir blickten uns gegenseitig an, hielten Hellebarde und Armbrust griffbereit. Jeder trug einen Harnisch, aber keinen Helm. Alles stimmte und wir hatten uns selbst davon überzeugt, dass gar nichts schief gehen konnte.
Trotzdem standen wir vier in voller Montur wie angewurzelt nebeneinander da und starrten zu der kleinen Naue auf dem See hinunter. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Niemand sprach ein Wort. Warteten wir auf ein Zeichen?
Irgendwann beschloss ich, dass es kein Zeichen geben würde und dass wir auch keines brauchten. Also tat ich wortlos den ersten Schritt und stapfte den Hang hinunter. Ich drehte mich nicht um, sondern folgte stur dem Weg. Ich wusste, dass die anderen mir folgen würden. Vier Männer, vier wild aussehende, bärtige Höhlenbewohner begaben sich auf den Weg, ihr hilfloses Opfer auszunehmen.
Wir nahmen unseren üblichen Trampelpfad durch den Wald, um von niemandem gesehen zu werden. Als wir unten am Ufer unsere Jasse erreichten, sahen wir die Naue bereits näherkommen. Mir bereitete Sorgen, dass wir sie vielleicht nicht rechtzeitig erreichen würden. Doch wir zogen die Jasse ins Wasser, setzten uns hinein. Tus und Veit übernahmen die Ruder. Schnell glitten wir über das eiskalte Wasser, der Naue entgegen. Die Distanz zwischen uns und unserem Ziel verringerte sich rasch, weil wir uns aufeinander zu bewegten. Ich stand vorne in der Jasse und liess meinen Blick über beide Uferseiten wandern. Dann prüfte ich die Engstelle auf andere Schiffe, konnte aber keine ausmachen. Es schien alles zu passen.
Wir erreichten die Wispelenegg vor der Naue und warteten weit genug von den Ufern entfernt auf sie. Wir konnten die Ruderschläge hören, vernahmen leise Stimmen und bereiteten uns vor. Es handelte sich um eine kleinere Naue als die Urner Naue. Ich zählte vier Ruderknechte und den Schiffsmeister. Ausserdem befanden sich zwei Männer an Bord, die keine Aufgaben erfüllten und offensichtlich Gaststaus genossen.
«Wer seid ihr?», rief uns der Schiffsmeister zu, als sie nahe genug herangekommen waren.
«Wir wollen mit euch Handel treiben», rief ich zurück.
«Jetzt», zischte ich Tus und Veit zu. «Rudert auf sie zu und drängt sie zu den Felsen ab.» Und damit bewegte sich unsere Jasse auf die Naue zu. Offensichtlich waren die Ruderknechte droben verwirrt und verunsichert. Auch der Schiffsmeister schien ratlos.
Aber es war schon zu spät. Unsere Jasse berührte ihre Naue und ich sprang hinüber. Ich schwang meine Hellebarde bedrohlich in Richtung des Schiffsmeisters und drängte ihn somit zurück. Er wich aus und bewegte sich in die Mitte der Naue.
«Ihr verdammten Landratten. Verflucht seien eure Seelen und die Seelen eurer stinkenden Mütter! Mögen sie im ewigen Höllenfeuer verrotten», wetterte er, als er erkannte, was vor sich ging.
«Sei still», herrschte ich ihn an. In der Zwischenzeit war auch Felis auf die Naue gesprungen. Ich sah zu Veit hinüber und erkannte seine gespannte Armbrust, die er auf den Schiffsmeister richtete. Dieser folgte meinem Blick und sah dem tödlichen Bolzen entgegen.
«Hüte dich davor, den Bolzen abzuschiessen, Jungchen!», brüllte er und lief puterrot im Gesicht an.
«Ihr!» Ich sah die Ruderknechte an. «Steht auf, geht auf die andere Seite.»
Drei von ihnen waren Jünglinge. Nicht, dass ich viel älter gewesen wäre, aber doch fühlte ich mich älter – ihnen überlegen. Sie gehorchten und bewegten sich torkelnd zum Heck des Schiffs. Offensichtlich waren sie betrunken. Ich vermutete, dass die Abfahrt in Luzern aus irgendwelchen Gründen verzögert worden war, und die Knechte verbrachten also die Wartezeit in einem Wirtshaus und betranken sich ordentlich. Von ihnen würde keine Gefahr ausgehen.
Als Felis und ich auf der einen, der Schiffsmeister, die Ruderknechte und die beiden Gäste auf der anderen Seite der Naue standen, sagte ich: «Was habt ihr geladen? Reicht uns das Wertvollste herüber!»
«Einen Teufel werden wir tun», antwortete einer der Gäste. Dann drehte sich dieser zum Schiffsmeister um und herrschte ihn an: «Tut etwas. Ihr seid in der Überzahl. Verjagt diese Diebe.»
Der Schiffsmeister sah Felis und mich, dann Veit und Tus an. Natürlich hatte er die auf ihn gerichtete Armbrust nicht vergessen. Er verstand, dass wir bewaffnet und nüchtern waren, während seine Besatzung unbewaffnet und betrunken war. Er erkannte, dass wir bei einem Kampf auf der Naue einen nach dem anderen ohne Mühen mit der Hellebarde totschlagen und in den kalten See werfen würden.
«Besser, Ihr gebt ihnen, was Ihr habt», sagte er schliesslich zu den beiden Gästen.
«Seid Ihr von Sinnen?», herrschte einer von ihnen ihn an.
«Schiffsmeister, nehmt es ihnen ab und werft es zu uns, oder der Bolzen wird sich schon bald lösen. Wir haben nicht viel Zeit», sagte ich.
Der Schiffsmeister funkelte mich wild an. «Dafür werdet ihr gerädert und ohne Gnadenstoss aufgestellt. Ihr werdet in die Hölle fahren und ewige Qualen erleiden.» Er hielt einen Augenblick lang inne und drehte sich dann zu den Gästen um. «Los, her mit euren Säckchen.»
Einer der Männer protestierte weiter und wehrte sich. Doch es nützte nichts, ein Ruderknecht hielt ihn fest, während der Schiffsmeister ihnen die prallgefüllten Säckchen abnahm sie und uns zuwarf. Mit einem dumpfen Geräusch schlugen sie vor uns auf den Boden. Beide Gäste mussten Kaufleute sein auf dem Weg zu fremden, vielleicht italienischen Märkten.
Ich sah mich rasch auf der Naue um und erkannte nichts weiter von Wert. Vermutlich waren sie nur auf Wunsch der beiden Kaufleute noch so spät von Luzern fortgerudert. Ich packte die Säckchen und versuchte sie an meinem Gürtel zu befestigen. Doch sie waren zu gross und zu schwer und drohten sich wieder zu lösen. Also reichte ich sie Tus hinüber, der sie sicher auf dem Boden unserer Jasse verstaute. Ich nickte Felis zu, der ausholte und die Spitze der Hellebarde in die Mitte der Jasse niederfahren liess. Glücklicherweise traf er genau den Spalt zwischen zwei Brettern, sodass sich das Holz teilte und sich bereits nach dem ersten Schlag ein bisschen Wasser zeigte.
«Gottverfluchte Halunken! Was im Herrgottshimmel tut ihr da?», schrie der Schiffsmeister entsetzt. «Ihr verdammten Gauner. Ihr habt, was ihr wolltet. Wenn ihr uns hier draussen versenkt, tut ihr des Teufels Werk. Das ist bösartig. Ich verfluche euch. Hört ihr? Ich verfluche euch!»
Felis liess die Hellebarde ein zweites Mal niederfahren und nun strömte ein Strahl Wasser in die Naue.
«Wir werden euch nicht versenken, Schiffsmeister. Ihr könnt das Wasser ausschöpfen und ans Ufer rudern», versuchte ich den aufgebrachten Mann zu beruhigen.
Daraufhin gingen Felis und ich von Bord, während die Ruderknechte sofort mit dem Schöpfen begannen und der Schiffsmeister weiter schimpfte und jammerte.
«Los!», sagte ich zu Veit und Tus, die sofort kräftig die Riemen durchzogen. Schnell entfernten wir uns von der Naue, die sich selbst nur langsam in Bewegung setzte. Die Ruderknechte begannen zu rudern, während die Kaufleute das Wasser ausschöpften.
«Werden sie es schaffen?», fragte Tus.
«Ja», antwortete Felis, «das Loch ist nicht gross. Wenn zwei Leute schöpfen, werden sie nicht untergehen.»
Ich hoffte, dass das stimmte. Denn inzwischen war es richtig dunkel geworden. Es war kalt und an dieser Stelle gab es keine Möglichkeit, an der sie hätten ans Ufer gehen können. Die besten Überlebenschancen boten sich ihnen, wenn sie wieder zurückruderten. Dann würden sie rasch zu einem flachen Ufer gelangen, an dem sie an Land gehen konnten.
Wir konnten schon bald die Engstelle zwischen Ober und Unter Nas passieren, sodass wir die Naue aus unserem Sichtfeld verloren, und damit wendeten wir unsere Gedanken der weiteren Flucht zu. Irgendwann hob ich die beiden Säckchen vom Boden unserer Jasse auf und öffnete sie, während mich die anderen erwartungsvoll ansahen. Als ich hineinsah, erkannte ich lauter funkelnde Gulden. Ich konnte es kaum fassen und grinste meine Kameraden breit an.
«Sag schon, was ist drin?», wollte Veit wissen.
«Ein kleiner Schatz», antwortete ich und legte die Säckchen wieder beiseite. Wir würden sie später in der Höhle noch weiter bestaunen können. Jetzt galt es, ungesehen und heil dorthin zu kommen.
Ich versuchte mich in der Dunkelheit zu orientieren, doch es war schwierig, überhaupt die Uferlinie auszumachen. Aber eigentlich war es gleich, wo wir an Land gingen, solange uns niemand verfolgte und uns niemand sah. Also bestimmte ich einfach eine Stelle, zeigte dorthin und sagte: «Dort, rudert dorthin. Da können wir an Land gehen und die Jasse verstecken.»
Wir versuchten möglichst lautlos anzulanden, zogen die Jasse vorsichtig die Uferböschung hinauf und versteckten sie unter Ästen und Zweigen. Danach machten wir uns daran, den steilen Aufstieg zu unserem Versteck zu bewältigen.
Als wir das Tobel mit unserer Höhle erreichten, verweilten wir noch kurz draussen und sahen zu der Stelle hinunter, wo wir die Naue überfallen hatten. Wir versuchten das Schiff auszumachen, konnten in der Dunkelheit auf dem See aber nichts erkennen. Nur bei einer Wiese, nahe der Unglücksstelle, vermochten wir ein kleines Flackern zu sehen. Möglicherweise waren sie das. Sie mussten an Land gegangen sein und ein Feuer entfacht haben.
Wir taten es ihnen gleich und zogen uns zu unserer Feuerstelle zurück. Tus schaffte Holz von einem trockenen Stapel herbei, den wir eigens dafür angelegt hatten. Kurz darauf loderten kleine, wärmende Flammen in unserer Mitte. Ich schüttete den Inhalt der Säckchen vor mir aus. Schweigend sassen wir da und liessen unseren Blick über die Münzen gleiten, die im Feuerschein glänzten.
Es handelte sich um 20 Goldstücke, italienische Gulden, wie wir an der Prägung erkannten. Mit der flachen Hand teilte ich die Münzen in vier Teile, wovon einer etwas grösser war als die anderen. Diesen behielt ich für mich. Niemand widersprach, schliesslich war es meine Idee gewesen.
«Wir müssen uns wieder bedeckt halten», sagte ich zu meinen Gefolgsleuten. «Wir müssen mindestens zwei oder drei Wochen warten, ehe wir die nächste Naue überfallen können.»
Sie stimmten mir zu.
Also verbrachten wir weitere zwei Wochen isoliert in der Höhle. Vier Männer ohne Beschäftigung. Ich führte täglich meine Kampfübungen aus und trat gegen Gegner an, die nur in meiner Fantasie existierten. Ich versuchte die anderen dazu zu bewegen es mir gleichzutun, doch meist fanden sie lahme Ausreden, obwohl genügend Zeit vorhanden war.
Wie in dem Wirtshaus in Tuggen würfelten wir oft und tranken Bier. Der einzige Unterschied war, dass nun Tus Edgars Platz einnahm. Natürlich bedauerte ich Edgars Schicksal. Der arme Kerl war tot und es hätte ihm zugestanden, hier mit uns zu sitzen und seinen Teil der Beute in der Tasche zu haben. Doch das Schicksal wollte es anders.
Wir verhielten uns weiterhin bedeckt und waren damit beschäftigt, die Höhle winterfest zu machen. Wir zogen uns tiefer ins Innere zurück und errichteten eine stabile Mauer aus Steinen und Stämmen im Eingangsbereich. Diese erfüllte mehrere Funktionen: Zum einen sollte sie die Kälte draussen halten, damit wir nicht länger erbärmlich frieren mussten. Zum anderen sollte sie im Falle eines Angriffs die Angreifer eine ganze Zeit lang aufhalten und den Zugang ins Innere auf eine schmale Engstelle begrenzen. Natürlich wären wir in einem solchen Fall dennoch gefangen, sollte man uns aufspüren, um uns unserer gerechten Strafe zuzuführen. Dennoch bot die Mauer ein Minimum an Schutz und würde uns wertvolle Zeit verschaffen.
Auch schützte uns die Mauer vor neugierigen Blicken. Zwar war die Höhle bereits durch die natürliche Umgebung hervorragend verborgen, denn wer nicht wusste, dass sie existierte, konnte sie von aussen kaum entdecken.
Um die Mauer stabil und wetterfest zu machen, verwendeten wir dicke Baumstämme, die wir übereinanderlegten und mit Querbalken sicherten. Die Balken konnten gut in die Höhlenwand eingearbeitet werden, sodass wir die Stämme verkeilen konnten. Ausserdem wies ich die Männer an, die Baumstämme mit Russ aus unserer Feuerstelle schwarz einzufärben. Mit Erde verstopften wir sämtliche Spalten.
Als wir diese Arbeiten abgeschlossen hatten, blieb wieder viel Zeit für Grübeleien. Dabei dachte ich oft an Elisabeth. Sie hatte auf Drängen ihrer Eltern hin dem Kloster gegenüber ein Gelübde geleistet. Sollte sie dieses Gelübde brechen, würde sie in Ungnade fallen. Doch mit dem nötigen Kleingeld würde der Abt bestimmt darüber hinwegsehen und ihr Absolution erteilen.
Nun besass ich ein kleines Vermögen und könnte ihr diese Absolution erkaufen. Doch wie konnte ich sie erreichen? Wir wagten kaum, die Höhle zu verlassen, wie also sollte ich nach Uri gelangen? Das schien mir ausgeschlossen.
«Ich kann Joss bitten, sie zu holen», meinte Felis eines Abends, als wir über Frauen sprachen und ich von Elisabeth erzählte.
«Wer ist Joss?»
«Das ist der Bauer unten in Vitznau, von dem ich das Essen kaufe.» Felis begab sich einmal in der Woche hinunter nach Vitznau und holte dort unsere Lebensmittel. Anscheinend hatte er in der Zwischenzeit die Menschen dort besser kennengelernt.
«Joss …», wiederholte ich den Namen, «und du meinst, man kann ihm trauen?»
Felis zuckte mit den Schultern. «Ich weiss, wo er wohnt. Ich weiss, wie seine Frau und seine Kinder aussehen. Wenn er uns helfen würde, dann wäre ihm sicher bewusst, dass er uns nicht übers Ohr hauen sollte.»
Ich dachte darüber nach. Wenn besagter Joss einwilligen würde, müsste er sich nach Seedorf begeben. Das wäre bestimmt kein Problem. Als Bauer, der auch an den Markt von Luzern ging, wäre es plausibel, dass er auf einer Naue zum Markt von Uri reisen würde. Es erschien mir machbar.
Doch war das wirklich eine gute Idee? Ich fragte mich, ob die anderen Männer später auch ihre Frauen holen wollten. Von Veit wusste ich, dass er keine Frau hatte. Ihm genügte es, gelegentlich mit einer Hure ins Bett zu gehen. Tus schien es ähnlich zu halten. Zudem fühlte ich mich als der Anführer unserer Bande und glaubte, dieses Recht einfach für mich beanspruchen zu können. Ich beschloss, dass Felis mit Joss darüber sprechen sollte.
Als Felis das nächste Mal von Vitznau zurückkehrte, berichtete er knapp: «Er wird es machen.»
«Was hat er gesagt?» Ich wollte es ganz genau wissen.
«Er hat die Münzen gesehen, die du mir mitgegeben hast, und meinte, er werde irgendwann in nächster Zeit mit dem Schiff nach Flüelen reisen und dann in Seedorf Elisabeth zu sprechen wünschen.»
Ich hatte Felis zwei Gulden von meinem Anteil mitgeben, damit er sie Joss überreichen konnte. Das war ein guter Ertrag für ihn. Er musste lediglich eine kleine Ausfahrt unternehmen, um den Lohn von mehreren Monaten zu verdienen.
«Und er hat keine Fragen gestellt?» Ich war besorgt und wollte mich vergewissern.
«Joss kennt mich inzwischen. Er vermutet wohl, dass etwas an mir nicht ganz geheuer ist. Doch offensichtlich will er gar nicht genau wissen, was los ist, solange ich ihn gut bezahle.»
Ein paar Tage, nachdem wir Joss beauftragt hatten, beschloss ich, dass wir eine weitere Naue überfallen sollten. Ich nahm an, dass genügend Zeit verstrichen wäre. Ausserdem hatten wir während der letzten Woche den See beobachtet und bereits zwei Luzerner Nauen gesichtet, die wieder in der Dämmerung das Wispelenegg passiert hatten. Anscheinend sahen die Schiffsmeister keine Gefahr darin, um diese Zeit über den See zu fahren. Das konnte nur bedeuten, dass sich unser letzter Überfall in der Stadt Luzern nicht herumgesprochen hatte. Oder der Schiffsmeister hatte davon berichtet und man hatte ihm keinen Glauben geschenkt. Schliesslich musste er behaupten, dass er ausgerechnet beim gefürchteten Wispelenegg überfallen worden sei. Viele mussten das für eine Ausrede dafür halten, dass der Schiffsmeister sein Handwerk nicht verstand und die Naue auf einen Felsen gesetzt hatte.
Eines Abends kam Tus in die Höhle gestürmt. «Eine Naue kommt von Luzern und steuert jetzt in diesem Moment auf das Wispelenegg zu.»
«Ist es eine Luzerner Naue?», fragte Veit.
«Ja, ich glaube schon.»
«Aber nicht mehr dieselbe wie letztes Mal?», fragte ich.
«Woher soll ich das wissen? Das erkenne ich doch nicht von hier oben», entgegnete Tus gereizt.
Das stimmte wohl. Das würden wir erst unten sehen können, vom Ufer aus.
Ich überlegte kurz und beschloss dann, dass es so weit war. «Also gut, los», sagte ich.
Wir zogen unsere Harnische an und nahmen die geschärften Waffen auf. Wir eilten nach draussen und folgten unserem Trampelpfad zum See hinunter. Wir liessen die Jasse ins Wasser und ruderten der Naue entgegen.
Dieses Mal schien es sich um eine grössere Naue zu handeln. Trotzdem hielten wir an unserem Vorgehen fest. Felis und ich sprangen auf das Schiff und trieben den fluchenden Schiffsmeister mitsamt den Ruderknechten auf die andere Seite. Nur ein Gast sass an Bord, der jedoch wie ein Kaufmann aussah. Wieder verlangte ich vom Schiffsmeister, er solle mir alles Wertvolle zuwerfen. Der Kaufmann beschwerte sich, doch nach einigem Drohen nahm der Schiffsmeister ihm ein Säckchen ab und warf es mir zu.
Sofort bemerkte ich, dass das Säckchen fast leer war, denn es verursachte beim Aufprall auf das Deck kaum ein Geräusch.
«Das ist alles?», fragte ich und vermochte meine Verwunderung nicht zu verbergen. «Das kann nicht sein.»
«Das ist alles, was ich habe, ihr Halunken», antwortete der Kaufmann.
«Nennt mir das Ziel Eurer Reise!»
«Süden», antwortete er knapp.
Wenn er nicht viele Münzen bei sich trug, so musste er etwas anderes haben, das er auf den Märkten verkaufen wollte. Also entdeckte ich die Holztruhe hinter ihm.
«Was ist in der Truhe?»
Niemand antwortete, weshalb ich einen der Ruderknechte direkt ansah und knurrend sagte: «Was ist in der Truhe?»
Der Ruderknecht entgegnete meinem Blick ausdruckslos und gab auch keine Antwort. Also verpasste ich ihm mit dem Stiel meiner Hellebarde einen Schlag gegen die Schulter.
«Was ist in der Truhe?», fragte ich abermals.
Der Schiffsmeister begann zu lachen, worauf ich mich wütend zu ihm umdrehte. «Willst du den Bolzen in deiner Brust spüren, Schiffsmeister?» Ich deutete zur gespannten Armbrust, die Veit im Anschlag hielt.
„Was ist daran so lustig?»
«Die Knechte könnt ihr noch lange bedrohen und schlagen, die verstehen euch nicht. Sie sprechen nur Italienisch», entgegnete der Schiffsmeister in einem Habitus arroganter Überlegenheit.
Italienisch? Von wo kamen sie dann? Ich taxierte die Ruderknechte, während der Schiffsmeister fortfuhr: «Sie mögen strohdumm sein, doch sie ziehen an den Rudern wie Ochsen an einem Pflug.»
«Woher kommt ihr?», fragte ich die Ruderknechte auf Italienisch. Der Schiffsmeister und erst recht die Ruderknechte sahen mich erstaunt an, also wiederholte ich meine Frage. Der Kerl, den ich geschlagen hatte, antwortete dann: «Südlich des Berges. Livinien, Herr.»
«… Herr …», klang es in meinen Ohren nach. Das war das erste Mal in meinem erbärmlichen Leben, dass mich jemand «Herr» nannte. Und ja, es gefiel mir.
«Aus Livinien?», fragte ich konsterniert. Somit waren sie meine Landsleute. Wie kam ich dazu, meine eigenen Landsleute zu bedrohen und zu schlagen?
«Wie seid ihr hier im Norden Ruderknechte geworden?», wollte ich von ihm wissen.
«Es sind viele Livinier in Luzern, Herr. Wir arbeiten dort als Tagelöhner, Handwerksknechte oder eben als Ruderer», sagte er aufrichtig.
«Was redet ihr da?», wollte der Schiffsmeister wissen, weil er kein Italienisch sprach und uns nicht verstand.
«Seid still!», herrschte ich ihn an und wandte mich dann wieder an den Livinier: «Wie viele von euch befinden sich in der Stadt?»
«Das ist schwer zu sagen, Herr.» Ein anderer half ihm und antwortete: «Vielleicht 300 Männer, Herr.»
«Und ergeht es euch gut?», wollte ich wissen. Denn oft wurden meine Landsleute und ich herablassend behandelt, da wir zumeist mittellos waren und deshalb mit den niederen Aufgaben betraut wurden.
Die Knechte zuckten die Schultern. «Wir arbeiten, Herr. Und ernähren so unsere Familien.»
«Herr, wir müssen uns beeilen», unterbrach Veit mein Gespräch mit den Liviniern.
Ich musste mich zuerst vergewissern, wer gesprochen hatte, so verwundert war ich über die Ansprache «Herr». Als ich erkannte, dass es Veit gewesen war, verstand ich, dass er mich natürlich nicht bei meinem Namen nennen wollte, um mich vor dem Schiffsmeister nicht zu verraten. Ich nickte ihm zu. Also wandte ich mich wieder den Ruderknechten zu. «Was befindet sich in der Truhe?»
«Die Truhe gehört dem Kaufmann, Herr. Wir kennen ihren Inhalt nicht, da er sie bereits verschlossen auf die Naue bringen liess», antwortete nun ein anderer Knecht.
«Schliess die Truhe auf», herrschte ich den Kaufmann an.
«Niemals», antwortete er trotzig.
Ich beschloss, einfach die ganze Truhe mitzunehmen. Also befahl ich den Ruderknechten, sie mir herüberzureichen. Sie sahen sich gegenseitig an und dann den Schiffsmeister.
«Los jetzt!», schrie ich sie an. Damit löste sich ihre Starre und sie begannen, die Kiste von hinten nach vorne durchzureichen.
«Ihr Diebesgesindel. Das werdet ihr bereuen! Glaubt ihr, wir werden euch nicht finden? Oh, und wie wir das werden, und dann bringen wir euch an Ort und Stelle zur Strecke», schimpfte der Schiffsmeister.
Der Kaufmann sah mich drohend an und flüsterte: «Ihr wisst nicht, welchen Fehler Ihr begeht. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich werde 1 000 Söldner auf euch ansetzen. Ich werde nicht ruhen, ehe ich Euren Schädel als Trinkschale benutzen kann.»
In der Zwischenzeit hatte Felis die Truhe auf unsere Jasse hinübergewuchtet.
«Wer seid ihr denn?», wollte ich von dem Kaufmann wissen.
«Jakob Muser aus Köln. Ich werde mich beim SchultheissUlrich Walker in Luzern beschweren. Man hat uns sicheres Reisen durch die barbarische Eidgenossenschaft zugesichert.» Er lächelte wissend. «Ihr werdet von euren eigenen Leuten gejagt werden.»
Als er seine Ansprache beendet hatte, überlegte ich kurz, ob es besser wäre, den Mann zu töten. Doch irgendwer würde sowieso davon berichten. Wenn, müssten wir gleich alle umbringen. Aber das brachte ich nicht übers Herz. Also nickte ich Felis zu, während ich die Männer auf der Naue mit meiner Hellebarde bedrohlich in Schacht hielt.
Auch sie schrien auf, als Felis den Spitz seiner Waffe in den Schiffsboden versenkte und Wasser in die Naue zu strömen begann. Ein zweiter Schlag und schon floss eine ansehnliche Menge Wasser in die Naue. War das schon zu viel?
Seis drum, wir begaben uns auf unsere Jasse und ruderten davon. Während wir uns entfernten, schöpften die Ruderknechte verzweifelt Wasser, während der Schiffsmeister und der Kaufmann uns düster nachsahen.
Als die Naue aus unserem Sichtfeld verschwunden war, hob ich die Truhe auf einer Seite an, um zu erfassen, wie schwer sie war. Anhand des Gewichts konnte ich nicht abschätzen, was sich im Inneren befinden mochte. Also ruderten wir weiter, gingen an Land und schleppten die Truhe mit vereinten Kräften in die Höhle.
Dort angekommen, konnten wir es kaum erwarten, die Truhe zu öffnen. Wir schafften zunächst zu unserer Feuerstelle. So hatten wir Licht und konnten das grosse, eiserne Schloss begutachten, das den geheimnisvollen Inhalt vor uns zu schützen versuchte.
Unmittelbar und unüberlegt begannen wir mit Steinen auf das Schloss einzuschlagen. Wir benutzten Stöcke und unsere Waffen, ohne dass es nachgab. Schliesslich schlug Felis vor, das Schloss so nahe wie möglich in die Flammen zu halten, bis es sich rötlich zu verfärben beginnen würde.
Also schoben wir die Truhe ganz nah ans Feuer und legten alles so zurecht, dass das Schloss von den Zünglein der Flammen geküsst wurde. Und tatsächlich, ganz langsam begann sich das Metall zu verfärben. Auch das Holz wurde Schwarz, doch wir bestrichen es immer wieder mit Wasser, sodass sich nur das Schloss erhitzte. Als wir glaubten, es wäre ausreichend erhitzt, bestand Felis darauf, noch länger zu warten.
Dann endlich, als das Schloss orange leuchtete, schlugen wir wieder mit Steinen darauf ein. Und tatsächlich begann sich der Bügel des Schlosses zu verformen. Wir schlugen so lange darauf ein, bis er sich schliesslich löste und sich das zuvor starke Eisen geschlagen auf den Boden fallen liess.
Wir sahen einander ehrfürchtig an, als ich schliesslich die Truhe öffnete. Die Enttäuschung folgte auf dem Fusse. Wir fanden keine Florentiner Gulden vor, auch keine Pfennige und keine anderen Münzen. Wir fanden stattdessen einige feine Tücher und darunter viele Schmucksteine. Einige waren zu Ketten oder Talismanen verarbeitet worden. Ausserdem fanden wir ein Pergament mit einer Botschaft darauf, die jedoch niemand von uns lesen konnte.
Bestimmt besassen die Schmucksteine und Tücher einiges an Wert, aber nur auf dem entsprechenden Marktplatz. Wir konnten hier und jetzt nichts damit anfangen. Es blieb uns nur, die Tücher möglichst trocken aufzubewahren, damit sie nicht schimmeln würden. Die Schmucksteine waren natürlich weniger anfällig. Ich legte sie in ein Säckchen und das wiederum legte ich zu den Bruchteilen von Annelises Kette. Damit schlossen wir ernüchternd unseren glücklosen, zweiten Überfall ab.
Das nächste Mal, als Felis von Vitznau zurückkehrte, brachte er unvermittelt Elisabeth mit. Natürlich hatte ich oft an Sie gedacht und inzwischen waren etwa zwei Wochen vergangen, seit wir Joss beauftragt hatten. Trotzdem war ich völlig überrumpelt, als Sie plötzlich vor mir stand.
Sie war dreckig und verschwitzt, und doch sah sie wunderschön aus. Wir mussten sie allesamt dümmlich angestiert haben, denn Felis räusperte sich und sagte zu ihr: «Das ist Tus. – Veit kennst du ja. Und der besonders Hässliche da ist Prato. Du magst ihn als den Höhlenbewohner, der er jetzt ist, vielleicht nicht mehr erkannt haben. Ich hoffe, du bist nicht allzu enttäuscht, dass du für diesen hässlichen Kerl deine warme Stube verlassen hast.»
Mit diesem Spruch löste er die angespannte Stimmung und ich ging auf Elisabeth zu und umarmte sie.
«Wie ist es dir ergangen?», wollte ich von ihr wissen.
Sie sah mich mit einem breiten Lächeln an und sagte: «Wichtiger wäre wohl zu wissen, wie es dir ergangen ist. Was macht ihr hier oben, versteckt in dieser Höhle?»
Erst jetzt wurde mir bewusst, dass sie ja gar nicht hatte wissen können, in welches neue Leben sie Joss folgen würde. Natürlich kannte er auch unser Versteck nicht. Er hatte sie lediglich freigekauft und an Felis übergeben. So erfuhr ich, dass sie sich bereits seit vier Tagen in Vitznau aufgehalten und auf Felis gewartet hatte. Sie hatte die Zeit in Joss’ Haus wohnen dürfen.
Ich führte sie tiefer in die Höhle hinein, etwas weg von den anderen.
«Wir leben nun seit fast zwei Monaten hier oben», erklärte ich ihr, nachdem wir uns auf einen Baumstamm gesetzt hatten, und dann begann ich – erst etwas zögerlich – unsere ganze Geschichte zu erzählen. Ich berichtete, was wir in Grinau getan hatten, wie wir gegen die Zürcher Soldaten gekämpft und die Mönche überfallen hatten, wie wir von Grinau geflohen und auf der Treib gelandet waren. Wie Tus sich uns angeschlossen hatte, wie wir in diese Höhle gekommen waren und was wir nun taten.
Als ich ihr von alledem erzählte, fragte ich mich, ob sie überhaupt bei einem Verbrecher wie mir sein wollte. Sie kannte mich doch nur als mehr oder weniger gesetzestreuen Soldaten, der seinen bescheidenen Sold von Hauptmann Arnold Schick erhielt! Ich stellte ihr diese Frage geradeheraus. «Ein Leben an der Seite eines Verbrechers, ein Leben im Verborgenen, immer der Gefahr ausgesetzt, erwischt zu werden … kannst du dir das vorstellen?«
«Ich wusste, dass du Grinau ausgeraubt hast und dass ihr geflohen seid.» Sie legte eine Pause ein. «Ich wusste es und bin dennoch gekommen.»
«Du wusstest es?»
«Ja», antwortete sie. «Wir sind in deiner Abwesenheit natürlich weiterhin nach Flüelen gegangen, um dort das Wort Gottes zu verbreiten. So konnte ich die Männer des Hauptmanns ausfragen.»
«Was haben sie gesagt?», wollte ich wissen.
Sie lachte. «Das kannst du dir bestimmt denken. Sie haben geschimpft und dich einen Verräter genannt. Der Hauptmann tobte, als die Boten des Pannerherrs Heinrich Püntiner mit der Nachricht von Grinau bei ihm eintrafen. Ich glaube, du solltest ihm besser aus dem Weg gehen.» Sie zwinkerte mir zu.
«Das denke ich auch», antwortete ich.
«Also wusste ich, auf was ich mich einlasse, wenn ich mit Joss mitgehe. Denn mir war klar, dass nur du es sein konntest, der mich freikaufen möchte.» Sie sah mich eindringlich an. «Du hast es mir schliesslich versprochen, Prato.»
Die anderen Männer hielten sich abseits. Doch da sie nicht miteinander sprachen, wusste ich ganz genau, dass sie lauschten. Dennoch liess ich mich nicht beirren und fragte Elisabeth: «Du wusstest also, dass ich dahinterstecke … Und du wusstest auch, dass ich ein gesuchter Verbrecher bin. Und trotzdem bist du gekommen?»
«Natürlich», antwortete sie, «du weisst doch, dass ich das Kloster hasse. Ich will nicht mein ganzes Leben dort verbringen müssen und als alte Frau immer noch dasselbe trostlose Gewand tragen. Ich will nicht jeden Tag beten. Tagein, tagaus. Ich verabscheue das Leben im Kloster!»
Die nächste Zeit verbrachten wir ausschliesslich zusammen. Wir mussten uns wieder ganz neu kennenlernen, da wir uns so lange nicht gesehen hatten. Wir hatten bis anhin überhaupt noch nie uneingeschränkt Zeit miteinander verbringen können. In Flüelen waren unsere gemeinsamen Ausflüge immer begrenzt gewesen.
Nun konnten wir das erste Mal die Nacht zusammen verbringen. Elisabeth schlief an meiner Seite auf meiner provisorischen Schlafstelle.
Am nächsten Morgen bereitete sie aus den verbliebenen Essensresten eine Suppe zu. Sie ging in den Wald, sammelte Kräuter und gab sie der Suppe bei. Das war das erste Mal seit Langem, dass wir richtig gut speisten.
Sie war aufmerksam und sorgte dafür, unser Leben in der Höhle so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie räumte auf, sorgte sich um eine saubere Feuerstelle, sammelte Pilze, flickte unsere Kleider und schnitt uns die Haare. Die anderen akzeptierten sie somit rasch.
Eines Abends erkundigte sich Elisabeth danach, wie wir denn bei den Überfällen auf die Nauen vorgehen würden. Wir sassen alle am Feuer und schilderten ihr mit gewaltigen Worten unsere Heldentaten. Wir übertrieben hier und da, doch es wurde eine gute Geschichte und sie strahlte uns die ganze Zeit über gewissenhaft an. Zweifelsfrei trug sie dazu bei, dass wir vier uns wie die grössten Krieger fühlten.
«Was stand denn auf dem Pergament?», wollte sie schliesslich wissen, als ich ihr von der letzten Ausbeute erzählte.
«Das wissen wir nicht; keiner von uns kann lesen», antwortete ich.
«Ich kann lesen», sagte sie.
«Du kannst lesen?», fragte Veit verwundert.
«Ja, das musste ich im Kloster lernen. Schliesslich mussten wir regelmässig Schriften vervielfältigen. Das war eine meiner Aufgaben.»
Also holte ich das Pergament hervor und gab es ihr. Ihre Augen folgten den Zeichen auf dem Pergament wie damals die des Pannerherrs Heinrich Püntiner, als er den Brief des Mönches Willibert gelesen hatte.
«Es handelt sich um einen Brief vom Statthalter Ulrich Walker von Luzern an Landammann Johannes Rot von Uri.»
Der höchste Mann des Landes Luzern schrieb einen Brief an den höchsten Mann des Landes Uri. Hatten wir mit diesem Brief doch noch eine wertvolle Beute ergattert?
«Und was schreibt er?», wollte ich aufgeregt wissen.
«Er bittet Landammann Rot, seine Truppen von Grinau abzuziehen», sagte Elisabeth.
«Na, wir vier sind schon abgezogen», lachte Tus.
Elisabeth sagte weiter: «Der Zürcher Bürgermeister Jakob Glentner beschwerte sich bei Luzern, dass die beiden eidgenössischen Länder Uri und Schwyz die Grenzen von Zürich in der Linth-Ebene verletzen würden.