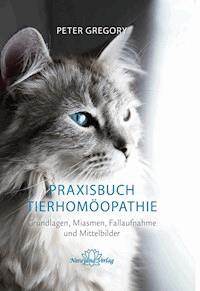
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Narayana
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
„Dieses Werk ist ein Meilenstein für die Tierhomöopathie – voller Humor, Ehrlichkeit, Inspiration und erstaunlichem Wissen. Die Mittelbeschreibungen sind unvergesslich – im Stil von Herscus Kindertypen. Die Mittel sind so lebendig beschrieben, dass man sie kaum vergessen kann, sie hüpfen, kriechen oder galoppieren einem sprichwörtlich aus den Seiten entgegen. Es ist das mit Abstand beste Buch zur Tierhomöopathie, das ich je gelesen habe. Es deckt Gebiete ab, die nie zuvor berücksichtigt worden sind.“ Geoff Johnson, homöopathischer Tierarzt, Rezension aus „The Homeopath“ Peter Gregory zählt zu den erfahrensten homöopathisch arbeitenden Tierärzten Großbritanniens. Sein besonderes Engagement gilt dabei der homöopathischen Ausbildung. Dieses Werk gibt eine fundierte Einführung in die veterinärhomöopathische Praxis. Dabei sind die Erklärungen äußerst originell und basieren auf der großen Erfahrung Gregorys. So schildert er die Miasmen aus einem neuen Blickwinkel und erklärt, warum z.B. Jagdhunde tuberkulinisch sind. Besonders wertvoll ist der große Materia-Medica-Teil, der fast die Hälfte des Buches ausmacht. Dabei geht er über die in der Tierhomöopathie oft noch üblichen Mitteleinzelbeschreibungen hinaus und erklärt viele der Polychreste anhand ihrer Familienzugehörigkeit. So vermittelt er z.B. das Mittelbild Sepia in Bezug auf die Meeresmittel sowie Pulsatilla und die Hahnenfußgewächse. Die Mittelbilder sind originell und durch die Beziehung zur Mittelfamilie leichter zu verstehen und zu verinnerlichen. Weitere Themen sind u.a. die Konstitution, Fallaufnahme mit Übungen zur Entwicklung der Achtsamkeit, Erst- und Folgeverschreibungen, Potenzwahl, Supervision, Betreuung von sterbenden Tieren und die Zukunft der Tierhomöopathie. Ein erfrischend neuer Leitfaden, der kaum einen Wunsch offen lässt. „Dieses Buch zeigt ein tiefes Verständnis in allen Aspekten der Tierhomöopathie, welches auf sehr persönlicher und einzigartiger Erfahrung in der Homöopathie beruht, auf. Es gibt dieses entscheidende Wissen erfolgreich an alle, die daran interessiert sind Homöopathie zu verwenden um die Gesundheit ihrer tierischen Gefährten zu verbessern, weiter.“ Tim Couzens, homöopathischer Tierarzt und Autor
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 820
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Peter Gregory
PRAXISBUCH TIERHOMÖOPATHIE
Grundlagen, Miasmen, Fallaufnahme und Mittelbilder
Impressum
Peter Gregory Praxisbuch Tierhomöopathie Grundlagen, Miasmen, Fallaufnahme und Mittelbilder
Titel der englischen Original-Ausgabe: Insights Into Veterinary Homeopathy Copyright © 2013 by Saltire Books Ltd., Glasgow, Scotland. All rights reserved.
1. deutsche Ausgabe 2016 2. deutsche Ausgabe 2017 ISBN 978-3-95582-151-7 Übersetzt von Angela Nowicki
Herausgeber: Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, 79400 Kandern Tel.: +49 7626 974970-0 E-Mail: [email protected]© 2016, Narayana Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).
Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Hinweis
Dieses Buch ist dazu gedacht, die Anweisungen und Ratschläge Ihres Tierarztes/Ihrer Tierärztin zu ergänzen. Krankheiten sind niemals gleichartig. Wir können auch nicht für die Folgen von Behandlungen verantwortlich gemacht werden, die ohne fachmännische Anweisung zu Hause durchgeführt werden.
Daher möchten wir Sie dringend bitten, sich nach den besten tiermedizinischen Möglichkeiten für Ihr Tier umzusehen, um sich umfassend zu informieren und so die besten Entscheidungen zum Wohle Ihres Tieres treffen zu können. Die Erwähnung bestimmter Firmen, Organisationen oder Fachleute bedeutet nicht, dass der Herausgeber diese unterstützt, noch, dass diese das vorliegende Buch unterstützen
Inhalt
Danksagungen
Der Autor
Einführung
Über mich
Über dieses Buch
Teil 1 · Die Grundlagen
1 Hin zu einer dynamischen Sicht der Homöopathie: Die Arzneimittel
Potenzierung
Das „Gedächtnis des Wassers“
Die Struktur des Wassers
Elektromagnetismus
Wellenformen und Frequenz
Parallelen
2 Biodynamik
Hormesis
Signale
Kommunikation
Resonanz
Chaos
Gesundheit
Mittelreaktionen
3 Gesundheit und Krankheit
Symptome
Modalitäten
Rückkehr zur Gesundheit
Krankheitsursachen
Anfälligkeit
Krankheit als unangemessener Zustand
Krankheitsebenen
Unterdrückung
Zusammenfassung
4 Die Konstitution
Das Simillimum und die Totalität
Polychreste
Die Konstitution
Die Ursprünge der Konstitution
Die Wirkungsweise der Konstitution
Die Bestimmung der Konstitution
Archetypen
Kann sich die Konstitution ändern?
Die Folgen der Zuchtwahl
Unterdrückung
Zusammenfassung
5 Ein anderer Blick auf die Miasmen
Chronische Krankheiten
Miasmen und miasmatische Krankheitsmuster
Zwei weitere Miasmen
Syphilinie
Sykose
Psora
Tuberkulinie
Karzinogenie
Die praktische Bedeutung einer miasmatischen Behandlung
Eine erweiterte Sichtweise der Miasmen
Weitere Kandidaten für ein Miasma
Tinea
Staupe und Tollwut
„Vakzinose“
6 Die Konsultation
Der Rahmen
Die Erstanamnese
Die Krankengeschichte
Lokal-, Allgemein- und Gemütssymptome
Psychodynamik
Worte
Ein geschützter Raum
Die Beziehung
Die Rolle unserer Gefühle
Untersuchen Sie den Patienten!
Weitere Vorteile
7 Die homöopathische Mittelwahl
Zum Simillimum
Die Erstverschreibung
Die Potenz
Was passiert nun? Die Mittelreaktionen
Die Erstverschlimmerung
Die Zweitanamnese
Neue Symptome
Arzneimittelbeziehungen
Das Schichtenmodell
Der Verlauf der Heilung
Problemfälle
Die Wiederholungsgabe
Teil 2 · Die Muster
8 Muster erkennen
Rajan Sankaran
Jan Scholten
Die Anwendung in der Tierhomöopathie
Der „Jizz“
Die Muster
Haiku
9 Die Naturreiche
Einführung
Tiermittel
Mineralmittel
Pflanzenmittel
10 Pulsatilla und die Hahnenfußgewächse
Pulsatilla nigricans
Staphisagria
Weitere Mittel aus der Familie der Hahnenfußgewächse
11 Phosphorus
12 Graphites und die Kohlenstoffmittel
Graphites
Weitere Kohlenstoffmittel
13 Sepia und die Meeresmittel
Sepia officinalis
Weitere Meeresmittel
14 Silicea
15 Ignatia und die Brechnussgewächse
Ignatia amara
Nux vomica
Gelsemium sempervirens
16 Natrium muriaticum und die Natriummittel
Natrium muriaticum
Weitere Natriummittel
17 Causticum und die Kaliummittel
Causticum
Weitere Kaliummittel
18 Sulphur
19 Arsenicum
Arsenicum album
Arsenicum iodatum
20 Lycopodium
21 Calcium carbonicum und die Calciummittel
Calcium carbonicum
Calcium fluoratum
Calcium phosphoricum
Calcium sulphuricum
Hepar sulphuris calcareum
22 Argentum, Aurum und die Metallmittel
Argentum metallicum
Aurum metallicum
Platinum metallicum
Mercurius
Zincum metallicum
Plumbum metallicum
23 Lachesis und die Schlangenmittel
Lachesis mutans
Weitere Schlangenmittel
24 Tarentula und die Spinnenmittel
Tarentula hispanica
Weitere Spinnenmittel
25 Lac caninum und die Milchmittel
Lac caninum
26 Thuja
27 Bellis, Arnica und die Korbblütler
Bellis perennis
Arnica montana
Weitere Mittel aus der Familie der Korbblütler
Teil 3 · Der Weg
28 Unterstützung finden: der Wert der Supervision
Das Bedürfnis nach Unterstützung
Was ist Supervision?
Weitere Formen der Unterstützung
29 Herausforderungen meistern: Probleme in der tierhomöopathischen Praxis
Unterschiedliche Erwartungen
Unterschiedliche Meinungen
Der „entmutigende“ Patient
Grenzen
Fernkonsultationen
30 Die Gegenseite
Woher kommt der Widerstand?
Was steckt dahinter?
Wie geht man damit um?
31 Tiefer wahrnehmen: praktische Tipps zur Entwicklung der Achtsamkeit
Die beobachtende Wahrnehmung
Die intellektuelle Wahrnehmung
Eine vertiefte Wahrnehmung
Anleitung
Weitere Vorteile
32 Homöopathie als universelle Wahrheit
Lektionen in Mitgefühl
Verbundenheit
Freiheit des Denkens
Beziehungen
Parallelen
Die Spirale
33 Das Ende naht: vom Tod und vom Sterben
Der alte Patient
Das Ende
Die Einschläferung
Unterstützung für den Klienten
34 Die Zukunft der Tierhomöopathie
Ausbildung
Gesetzliche Regelungen
Forschung
Die integrative Praxis
Viehzucht
Zukunftstrends
Nachwort
Anhang
ArzneimitteI-Verzeichnis
Tierarten-Verzeichnis
Stichwort-Verzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Für Jane, ihre Liebe und ihr Wissen, und für Bunyip Bluegum, Esq. („Bunnie“), 1995-2013, meinen besten Kameraden und Lehrer
Danksagungen
Ein Projekt wie dieses ist die Frucht eines langen Prozesses. Die Personen, denen ich zu danken habe, gehören drei Kategorien an:
Ohne diese Personen wäre dieses Buch nie veröffentlicht worden. Mein Dank geht an…
… Steven und Lee Kayne von Saltire Books für ihre Unterstützung, ihre Anleitung und ihre Bereitschaft, über eine etwas andere Form zu verhandeln.
… Tim Couzens für seine umfangreiche und gewissenhafte Arbeit am ersten Entwurf.
… Sheila Ryan für unsere Supervisionswanderungen, die mir halfen, meine Absichten zu klären, sowie für ihre Großzügigkeit und ihre wertvollen Ratschläge zu wichtigen Kapiteln.
… Cyril Smith für seine Ermutigung und die Erlaubnis, mich immer wieder an seinen Werken schadlos zu halten.
… meine Partnerin Jane für ihre unermüdliche Ermutigung und die Akzeptanz der Ausrede „hab‘ am Buch gearbeitet“.
… Bunyip Bluegum, Esquire („Bunnie“), der durchgehalten hat, bis das Ende in Sicht war.
Ohne diese Personen hätte ich kaum etwas zu schreiben gehabt. Mein Dank geht an…
… den Tierhomöopathen Chris Day, Mitglied des Royal College of Veterinary Surgeons, dafür, dass er mich mit der Homöopathie bekannt gemacht hat, und für fast 30 Jahre Hilfe und Inspiration.
… den verstorbenen Lewis Bishop, Mitglied des Royal College of Veterinary Surgeons, meinen Arbeitgeber in der Whitchurch Road Practice in Cardiff, Wales, für seinen offenen Geist und seine Erlaubnis, Homöopathie an echten Patienten auszuüben.
… meine ehemaligen Partner in der Homeopathic Professionals Teaching Group Charles Forsyth, Brian Kaplan und den verstorbenen David Curtin, mit denen ich gemeinsam das Lehren lernte, und insbesondere an David Owen und Alice Green, die mir beide den Wert der „prozessorientierten“ Arbeit nahe brachten.
… Robin Shohet, der mich in der Supervision unterrichtete.
… meine derzeitigen Partner in der Homeopathic Professionals Teaching Group John Saxton, Sue Armstrong und Jane Keogh sowie Hilary Millichamp, unserer Buchhalterin und „fünften Partnerin“.
… meine Hunde Big Ears, der mir viel über Psorinum, Arsenicum und die Homöopathie als Ganzes beibrachte, Bodhi für Calcium carbonicum, Taz für Carcinosinum und, am allerwichtigsten, Bunnie für Tuberculinum.
… all meine Freunde an der Faculty of Homeopathy, der British Association of Homeopathic Veterinary Surgeons und der International Association for Veterinary Homeopathy für ihr Festhalten an der Wahrheit.
… Tim Couzens, der mir gleitende Arbeitszeiten ermöglichte.
… vor allem aber meine Patienten und deren menschliche Begleiter, die mir die Gelegenheit zum Lernen gaben.
Ohne diese Personen hätte ich das Buch nie beenden können. Mein Dank geht an…
… Steve Bellenie vom Bakehouse in Abbotsbury, dessen gute Laune und Cappuccinos die Montagmorgen lebenswert machen.
… das Personal vom Holistic Veterinary Medicine Centre, vor allem Sally und Gina, für ihre Unterstützung, Kaffee und Kuchen.
… VW für die Erfindung der Campingbusse und meinen Mechaniker James dafür, dass er meinen so lange fahrtüchtig gehalten hat.
… Edward und Katie für ihre Schlafzimmer, wenn ich irgendwo Ruhe zum Schreiben brauchte.
… meine Freunde Sally und Gerry fürs Zuhören.
… den Sheffield Wednesday Football Club, der mich lehrte, mit Widrigkeiten und Enttäuschungen fertig zu werden.
… den Weymouth Football Club, der mir zeigte, dass Beharrlichkeit die Hoffnung nie sterben lässt.
… Palmers in Bridport für ihr Dorset GoldAle, Harveys in Lewes für ihr Best Bitter und Timothy Taylor in Keighly für ihr LandlordAle, das unbestreitbar beste Bier der Welt.
… die Tanzgruppe Festus Derriman Morris, die mir (paradoxerweise) geholfen hat, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben.
… den Music Room in Cleckheaton, der mir mein erstes Melodeon verkauft hat, gerade das zweite liefert (und zweifellos auch noch ein drittes).
… die Ordnance Survey, ohne deren Landkarten ich verloren wäre.
… Cher für die Einführung in die Meditation und das Gaia House Meditation Retreat Centre für die Mittel und die Inspiration zum „Weiterstreben“.
… Richard Thompson für Beeswing, den besten Song, der je über Tuberculinum geschrieben wurde.
… den Caravan Club für stille Plätzchen ohne zivilisatorischen Luxus.
… Jane für ihre Liebe und Unterstützung und für ihre Begleitung auf der Suche nach einer Möglichkeit, es anders zu machen.
Der Autor
Peter Gregory hat 1972 ein Studium zum Veterinärmediziner an der School of Veterinary Sciences der Bristol University abgeschlossen. In den ersten 12 Jahren seiner Laufbahn arbeitete er in gemischten Tierpraxen, zunächst in seiner Heimatstadt Sheffield in Großbritannien, anschließend im tropischen North Queensland in Australien. Während dieser Zeit wuchs nach und nach seine Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der Schulmedizin bei seinen Patienten. Das betraf vor allem die Behandlung von Hunden mit chronischen Hautallergien, bei denen die Symptome nur für eine gewisse Zeit unterdrückt zu werden schienen, um später mit zunehmender Schwere wiederzukehren.
Auf der Suche nach einer Alternative kehrte er nach Großbritannien zurück, wo er Bekanntschaft mit der Homöopathie machte und sich entschied, sie in der Praxis auszuprobieren. Die Ergebnisse überzeugten ihn von ihrem Potenzial, daher nahm er sich vor, mehr zu lernen und die Kompetenz zu erwerben, die für eine erfolgreichere Behandlung seiner Patienten nötig war. Nach Abschluss einer veterinärmedizinischen Ausbildung an der Faculty of Homeopathy in London trat er 1991 der Fakultät als VetMFHom bei und wurde 2004 zum akademischen Mitglied erhoben. 1995 richtete er eine Überweisungspraxis für Alternative Veterinärmedizin in Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, ein, die in erster Linie Homöopathie und Akupunktur anbot. Im selben Jahr schloss er sich der Homeopathic Professionals Teaching Group als Stammdozent und später als Partner an. Dies und verschiedene Einladungen von anderen Organisationen brachten ihn dazu, Vorlesungen in mehreren Ländern der ganzen Welt zu halten, einschließlich Australien, den USA und Japan. Seit 2000 arbeitet er zusammen mit Tim Couzens am Holistic Veterinary Medicine Centre in East Sussex. Er behandelt ebenfalls Patienten in Dorset, wo er mit seiner Partnerin Jane Keogh und zwei Jack Russell Terriern lebt. In seiner spärlichen Freizeit geht er wandern, spielt Melodeon für eine Morris-Dance-Gruppe und unterstützt den Weymouth Football Club.
Peter war Vorsitzender der British Association of Homeopathic Veterinary Surgeons und hat den aktuellen Vorsitz der International Association for Veterinary Homeopathy inne. Er ist Mitautor des Lehrbuchs der Veterinärhomöopathie und hat Beiträge für verschiedene andere Publikationen verfasst.
„Da nun das Tier nichts von Verstellung weiß und nicht wie der Mensch weder den Ausdruck des Schmerzes übertreibt noch seine Gefühle verheimlicht oder Beschwerden lügt, welche nicht da sind, wie oft der Mensch, durch Erziehung verdorben, in Sitten verderbt oder von Leidenschaften bald auf diese, bald auf jene Weise abgeändert tut, so fällt deutlich in die Augen, dass das, was das Tier von seiner Krankheit durch Symptome zeigt, wahrer Ausdruck des inneren Zustandes und reines wahres Bild der Krankheit ist.
Die Tiere sind mit einem Wort durch die homöopathische Heilart wenigstens ebenso sicher und gewiss wie die Menschen zu heilen.
Von den Einrichtungen und Behandlungen des Krankenstalles im Besonderen werde ich vielleicht ein andermal die Ehre haben, vor dieser ansehnlichen Versammlung zu reden.
Soviel für heute, um doch wenigstens das rechte Losungswort zur zweckmäßigen Befreiung der uns so schätzbaren Haustiere von Krankheiten ausgesprochen zu haben.
Denn auch diese armen Tiere, welche ihre Quäler nicht zur Verantwortung ziehen können, verdienen das Mitleid humaner Weltbürger.“
Aus dem Vortrag „Homöopathische Heilkunde der Hausthiere“ von Samuel Hahnemann, gehalten vor der Leipziger Ökonomischen Sozietät, ca. 1813
Einführung
Der Experte ist ein gewöhnlicher Mann, der – wenn er nicht daheim ist – Ratschläge erteilt.
Oscar Wilde
Was bringt einen Tierarzt dazu, Homöopathie zu studieren?
Wozu sollte jemand, der praktische Erfolge verzeichnen kann und in den Augen seiner Zeitgenossen viel erreicht hat, vom geraden, schmalen Pfad abweichen, dem er, wie es scheint, schon seit seiner Kindheit gefolgt ist?
Und warum sollte er sich in Unterfangen verwickeln, die seine Sicherheit in jeder Hinsicht aufs Spiel setzen und ihn in eine Welt führen, in der sein Selbstwert und die meisten seiner Überzeugungen in Bezug auf seinen Beruf ernsthaft in Frage gestellt werden?
Die Beschäftigung mit der Homöopathie wirft ein ums andere Mal diese Fragen auf, deshalb möchte ich versuchen, sie mit meiner persönlichen Geschichte zu beantworten: Wie ich zur Homöopathie kam, wohin sie mich geführt hat und schließlich: Wie es dazu kam, dass ich dieses Buch schrieb. Auf unserem Lebensweg schreiben wir unweigerlich unsere eigenen Geschichten um unsere Erfahrungen herum. Die Homöopathie hebt das Individuum hervor, und die Erfahrungen eines jeden Menschen sind einzigartig. Dies nun ist meine Geschichte. Sie wird aus der Perspektive eines Veterinärmediziners erzählt, der in seinem Beruf homöopathisch heilt, doch vermute ich, dass sie auch allgemeine Gültigkeit besitzt. Wenn Sie, der Leser, sie für hilfreich befinden, ist das in Ordnung – wenn nicht, ist es auch in Ordnung, ich aber biete sie Ihnen ohne Bedingungen an.
Über mich
Die Anfänge
Geboren und aufgewachsen bin ich im englischen Sheffield. Diese Stadt ist immer noch weltweit berühmt für ihren Stahl und für die Bestecke, die ihre Fabriken produzieren. Besonders bekannt ist Sheffield für Spezialstähle; Brearley erfand dort 1912 den rostfreien Stahl. Entsprechend seiner industriellen Herkunft hat Sheffield den Ruf einer schmutzigen Großstadt mit schlechter Luft und verseuchtenWasserstraßen, und in den 1950er Jahren meiner Kindheit war das mit Sicherheit der Fall. Im Winter legten sich dicke Schwefeldämpfe über das Don Valley Stadium; sie dehnten sich sogar noch bis ins Dorf Dore aus, wo ich 5 Meilen vom Stadtzentrum entfernt wohnte, und blieben an den Hügeln des Peak District National Park hängen. Im darauf folgenden Jahrzehnt jedoch setzte sich der Clean Air Act von 1956 auch hier durch, und als ich 1967 die Schule verließ, konnte Sheffield sich der saubersten Luft aller nordeuropäischen Industriestädte rühmen. Heute ist es eine saubere und attraktive Stadt, in der sich Neuankömmlinge meist gern niederlassen.
Meine Mutter stammte aus einer Theaterfamilie und war daher ebenso emotional wie mütterlich. Sie lechzte nach Zuwendung, und als ihr die in einer gescheiterten Ehe verweigert wurde, stützte sie sich ganz auf mich, ihren jüngeren Sohn. Sie war sehr fürsorglich und hegte eine tiefe Liebe zur Natur, und sie war es, die mich die natürliche Welt respektieren lehrte. Sie starb mit 73 Jahren an Krebs. Mein Vater wiederum war Bankdirektor – ein Zuchtmeister mit sehr festen Prinzipien. Er geriet leicht in Zorn und musste alles unter Kontrolle haben. Von ihm lernte ich, wie wichtig Ordnung und finanzielle Sicherheit sind. Während ich einen ernsthaften Versuch unternahm, erstere in mein Leben zu integrieren, kam die Bedeutung letzterer zugegebenermaßen nie ganz bei mir an, doch mein Vater weckte in mir auch das Interesse am Fußball, und das setzte sich durch. Wir sahen uns gemeinsam die Spiele des Sheffield Wednesday an, und ich verbrachte einen Großteil meiner Freizeit als Schüler beim Fußballspiel. Später spielte ich Amateurfußball, bis ich 50 war. Ich liebe nach wie vor das „schöne Spiel“ und unterstütze meine Lokalmannschaft in Weymouth, wo ich heute lebe. Mein Vater starb 2011 mit 88 Jahren.
Mein Großvater väterlicherseits war Metallurg. Er wohnte in der benachbarten Industriestadt Rotherham und arbeitete als Hauptmetallurg in einem der großen Stahlunternehmen in Sheffield. Er war ein angesehener Mann, der nicht nur an der Universität, sondern auch im Ausland Vorträge hielt. Er weckte in mir die Liebe zur Wissenschaft, und als ich ein Interesse an Fossilien, Steinen und Mineralien zeigte, förderte er dies, indem er mich mit Büchern, einem Mikroskop und einem Geologenhammer ausstattete. Für einen mit solchen Interessen war der nahegelegene Peak District ein Zufluchtsort. Der kohlehaltige Kalkstein, der den südlichen Teil des Nationalparks umschließt, ist reich an Fossilien, und das ganze Gebiet war in der Vergangenheit ein wichtiger Fundort von Mineralien, allen voran Blei und Kupfer. So verwundert es nicht, dass ich noch vor meinen Teenagerjahren Geologe werden wollte und damit bezeichnenderweise auch den Ehrgeiz entwickelte, ein Hochschulstudium zu absolvieren.
Hunde gehörten bei uns immer zur Familie. Ich machte meine ersten Schritte in Begleitung eines Scottish-Terrier-Mischlings namens Kim, an den ich mich kaum noch erinnern könnte, wären da nicht ein paar alte zerfledderte Fotos. Er war das Ergebnis einer zufälligen Paarung mit dem Hund meiner Großmutter in Rotherham und war ein bissiger kleiner Teufel. Ich kann mich nicht erinnern, jemals mit ihm geschmust zu haben, doch ich weiß noch, dass er sich einmal in etwas Widerlichem gewälzt und meine Mutter beim Versuch, ihn zu baden, schlimm gebissen hatte. Als ich etwa sechs Jahre alt war, erkrankte Kim an Prostatakrebs und musste eingeschläfert werden. Das weiß ich nur aus Gesprächen mit meinem Vater in der jüngsten Vergangenheit. Ich habe keine Erinnerung daran, wie sein Tod auf meine Familie gewirkt haben musste.
Ein paar Jahre lang hatten wir keinen Hund, bis Rusty kam. Er war ein junger Golden Cocker Spaniel, und ich war gerade neun geworden, als er in mein Leben trat. Er stammte aus einem Wurf im Haus des Arztes meines Großvaters. Schon bald wurde er mein Hund – er schlief mit in meinem Bett, und wir verbrachten ungeheuer viel Zeit miteinander. Er war leidlich abgerichtet, doch nicht in dem Maße, das ihn vom Streunen abgehalten hätte. Oft wurde er gesehen, wie er durch das Dorf eine halbe Meile von unserem Heimatort trottete, und ich erinnere mich noch gut an die Angst beim Absuchen der umliegenden Straßen und Felder, wenn er seit mehreren Stunden vermisst wurde. Rustys anderes Talent war das eines Wachhundes: Er belegte irgendein unbelebtes Objekt, wie einen Pullover oder einen Schuh, mit Beschlag und setzte sich daneben. Er hatte die Angewohnheit, aufs Bett meiner Eltern zu springen und jedes Kleidungsstück zu bewachen, das zufällig dort herumlag. Sobald sich jemand näherte, fletschte er die Zähne und knurrte böse, und wenn dann seine Autorität in Frage gestellt wurde, ging er wütend zum Angriff über. Zum Glück hat er nie jemanden wirklich gebissen. Von diesen Verhaltensweisen abgesehen, blieb Rusty ein treues und vertrautes Familienmitglied, vor allem aber natürlich mein bester Freund.
Rustys Botschaft
Meine Ausbildung an der Dorfschule verlief glatt, und ich gelangte mühelos durch das „11 plus“-Examen, worauf ich mich voller Stolz an der King Edward V11 Grammar School for Boys angenommen sah, der unbestreitbar besten Sekundarschule in der Stadt. Es war mitten im zweiten Schuljahr, als der mittlerweile dreijährige Rusty sich die Staupe einfing. Trotz der Fürsorge unseres örtlichen Tierarztes, der regelmäßig zu Hausbesuchen kam und ihm die neuesten Antibiotika (Tetrazykline) verabreichte, verschlimmerte sich sein Zustand, und er musste eingeschläfert werden. Zwar erinnere ich mich an keine konkrete Inspiration, doch es muss bei einem Besuch dieses Tierarztes gewesen sein, dass ich beschloss, selbst einer zu werden, und von da an hatte meine akademische Laufbahn nur noch ein Ziel.
Im Laufe meiner langjährigen Tierarztpraxis bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass unsere Tiere als Lehrer in unser Leben treten. Das ist nun keine besonders originelle Idee; tatsächlich glaubten das schon viele alte Kulturen, nur unsere moderne Gesellschaft scheint es weitgehend vergessen zu haben. Ich jedoch habe mir oft ins Gedächtnis gerufen, was Rusty mich gelehrt hat: Er lehrte mich, wie eng die Bindung zwischen Mensch und Tier sein kann. Er lehrte mich, wie schmerzvoll und verheerend es sein kann, wenn man ein geliebtes Tier verliert. Er weckte in mir den Wunsch, Tierarzt zu werden – und er lehrte mich, dass die Schulmedizin nicht im Besitz aller Antworten ist, vor allem bei der Behandlung von Viruserkrankungen.
Viele Jahre später dachte ich über das „Impfproblem“ nach. Es waren Fälle wie Rustys, die dazu führten, dass das Impfprotokoll für Hunde durch Auffrischungsimpfungen ergänzt wurde, anstatt sich nur auf eine Serie von Welpenimpfungen zu verlassen. Eine lebenslange Immunität hing vom Kontakt mit dem Feldvirus ab, der damals noch in Stadtgebieten vorherrschte, doch in einer ländlichen Gegend wie unserer kamen solche „natürlichen Auffrischungsimpfungen“ nicht zwingend vor, sodass die Immunität mit der Zeit nachließ und das Tier ungeschützt blieb. Heute wissen wir, dass eine einzige Auffrischungsimpfung im Alter von etwa einem Jahr lebenslange Immunität gegen Virenerkrankungen wie Staupe verleiht. (Leider haben die Hersteller von Impfstoffen die Gelegenheit ergriffen, die Situation auszunutzen, indem sie lebenslang jährliche Auffrischungsimpfungen empfehlen – eine schwere und ungerechtfertigte Überlastung für viele Tiere, die bis in die jüngste Zeit vom ganzen Berufsstand weitgehend ignoriert wurde.)
Von diesem Zeitpunkt an wurde mein Leben überwiegend vom Ehrgeiz bestimmt, Tierarzt zu werden. Erholung von meinem Studium fand ich in ausgedehnten Wanderungen durch die Natur und im Fußballspiel, dem ich bei jeder Gelegenheit frönte. Den A-Level schaffte ich mit ausreichend guten Noten, um an der Bristol University Veterinary School angenommen zu werden.
Nach fünf zermürbenden Studienjahren und einem scheinbar endlosen Leidensweg an Prüfungen machte ich meinen Abschluss. Wie viele meiner Kollegen schwor ich mir, nie wieder eine Prüfung abzulegen.
Der Weg in die Praxis
Auf der Suche nach einer Anstellung bewarb ich mich um eine Assistentenstelle in der Sheffielder Praxis, in der Rusty behandelt worden war und in der ich auch mein Praktikum als Student absolviert hatte. Die Teilhaber waren nicht gerade erpicht darauf, einen „Frischling“ anzustellen. Was sie am Ende überzeugte, waren wohl die Gelegenheit, jemanden aufzunehmen, den sie bereits kannten, sowie der relative Mangel an weiteren Bewerbern.
In dieser Zeit durchlebte ich wohl die letzten Jahre der „James-Herriot-Ära“*: Eine gemischte Praxis in den Yorkshire Pennines, in der ich mit allem zu tun bekam, vom Wellensittich bis zum Spitzenbullen, wo ich morgens Hunde und Katzen operierte und nachmittags Kälber enthornte. Die Arbeit war hart, die Stunden waren lang und für einen frischgebackenen Absolventen voller Ängste, doch auch unsäglich befriedigend. Eine überraschende Wendung in Bezug auf die Arbeitszeit brachten die Abende im Dienst an der örtlichen Windhunde-Rennbahn; das war zunächst ein Novum, doch später langweilte es mich eher.
Wenige Wochen nach Arbeitsbeginn trat ein weiterer vierbeiniger Begleiter in mein Leben. Es war ein sieben Wochen alter Welpe mit gebrochener Hüfte. Er wurde uns von seinen Besitzern gebracht, die in einer der ärmeren Gegenden von Sheffield wohnten. Wir röntgten ihn, und die Besitzer rieten uns, ihn zusammenzuflicken und ihm viel Ruhe zu gönnen. Nach mehreren Versuchen ihrerseits, den Welpen mit nach Hause zu nehmen, ohne die Rechnung zu bezahlen, hörte die Praxis nichts weiter von ihnen, und es wurde klar, dass sie ihn ausgesetzt hatten. Natürlich hatte er laut dagegen protestiert, eingesperrt zu werden, und die Oberschwester bat mich inständig – oder sollte ich sagen: Erteilte mir den Befehl? –, ihn mit zu mir nach Hause zu nehmen. So kam Big Ears in mein Leben. Sein Stammbaum war natürlich ein Diskussionsgegenstand: Wahrscheinlich ein Collie, gekreuzt mit einem Whippet, und irgendwo vielleicht noch ein wenig Terrier drin. Später bezeichnete ihn ein Freund einmal als Alten Sheffielder Straßenhund, was vermutlich am besten passte.
Nach und nach hatte ich genügend Erfahrung gesammelt, um die Behaglichkeit bietende Stufe zu erklimmen, die sicherlich jeder Tierarzt besonders schätzt: Ich hatte das Gefühl, mit allem fertig werden zu können, was durch die Sprechzimmertür kam oder wozu ich mitten in der Nacht zum Hausbesuch gerufen wurde. Ich konnte eine Hündin sterilisieren, ein Kalb entbinden und einen Oberschenkelbruch flicken, und ich kannte alle neuesten Medikamente, die mir zur Verfügung standen. Dennoch verspürte ich ein schleichendes Unbehagen. Das wuchs sich allmählich zu der beklommenen Erkenntnis aus, dass ich auf ein Leben zusteuerte, in dem ich unaufhörlich dieselben Landstraßen entlang fahren und für den Rest meiner Zeit im Grunde dieselbe Arbeit verrichten würde. Es war, als blicke ich in eine Zukunft wie auf ein windstilles Meer, wo am Horizont nichts als Vergessen auf mich wartete.
Australien
Die Lösung des Problems hieß: Auswandern. Die Schwester meiner Mutter hatte im Krieg einen australischen Piloten geheiratet. So fand ich mich 1977 in einer kompletten Familie aus Tante, Onkel und fünf Cousins in Mackay wieder, einer Kleinstadt an der tropischen Küste von North Queensland. Zu jener Zeit bestanden für einen Blechschlosser größere Chancen, die Einwanderungserlaubnis zu bekommen, als für einen Tierarzt, doch war erst kürzlich das Windhunderennen hier eingeführt worden, und in Mackay gab es eine neue Rennbahn, sodass mein potenzieller Arbeitgeber nur wenige Strippen ziehen musste, um mir ein Visum zu verschaffen. Nach einiger Überlegung wurde beschlossen, dass Big Ears mitkommen sollte. Er musste eine dreimonatige Quarantäne über sich ergehen lassen, bevor er sich in sein neues Leben eingewöhnen konnte.
Ein Teil meiner Arbeit war der, die ich gewohnt war, überraschend ähnlich: Hündinnen sterilisieren, Befruchtung von Milchvieh, Abkalbungen und Kaiserschnitte. Andererseits gab es drastische neue Bedingungen zu bewältigen: Bei den Kleintieren hatte ich plötzlich mit Schlangenbissen, Zeckenlähmungen und Herzwurmerkrankungen zu tun, und bei den Großtieren mussten meine Kollegen und ich hinaus zu einer Rinderfarm fliegen, um 1000 Stück halbwilder Brahman Bullen Bluttests zu unterziehen, oder 100 Meilen „in den Busch“ fahren, um ein Pferd zu betäuben und eine Wunde zu nähen oder eine Augen-OP durchzuführen. Wir hatten auch einen ständigen Zustrom an Hunden und Katzen mit Verletzungen durch Verkehrsunfälle zu verzeichnen, und da es niemanden gab, an den wir die Patienten überweisen konnten, mussten wir uns selbst zu Orthopäden qualifizieren. Wir erwarben die ganze Palette an bestem Equipment und flickten die Knochen unserer Patienten mit allen möglichen Nägeln und Platten, Drähten und Schrauben wieder zusammen.
Eine der Folgen des tropischen Klimas war ein Sommer der räudigen Hunde. Die Ursache vieler dieser Probleme waren Flöhe und Zecken, doch sie schienen sich dann zu multiplen Allergien auszuwachsen, gegen die keine Flohbäder mehr halfen. Das einzige Medikament, das wir in unserem Arsenal zur Bekämpfung dieses Problems zur Verfügung hatten, war Cortison in der einen oder anderen Form. Innerhalb weniger Monate nach seiner Ankunft erlag Big Ears einem solch unbehandelbaren Juckreiz, dass auch er schon bald regelmäßig Injektionen eines Langzeit-Corticosteroids erhielt. Während der sieben Jahre, die er in Australien verbrachte, stieg seine Abhängigkeit von diesen Injektionen und damit natürlich auch seine Resistenz gegen das Medikament mit dem Effekt, dass er noch höhere und häufigere Dosen bekam.
Mackay ist eine Kleinstadt, und so sehr ich das Leben dort genoss, so war es doch recht isoliert. Ich hatte einen Freundeskreis aufgebaut, der sich auf die Arbeit und den unvermeidlichen Fußball („Soccer“) konzentrierte, und ich holte das meiste aus den erstaunlichen Attraktionen heraus, die Australien zu bieten hat, doch 1984 juckten mir schon wieder die Füße. Es war an der Zeit für eine neue Veränderung, also verbrachte ich sechs Monate auf Reisen durch Südostasien und kehrte dann nach England zurück. Mittlerweile litt Big Ears an Osteoporose, die durch die Corticosteroide ausgelöst worden war, und daraus resultierender Hinterbeinlähmung, daher fiel mir die Entscheidung, ihn mitzunehmen, nicht schwer, trotz der sechsmonatigen Quarantäne, die er durchmachen musste. Mir war klar geworden, dass es irgendwo eine bessere Behandlungsweise für solche Patienten wie ihn geben muss, und ich hatte beschlossen, eine Zeitlang alle Möglichkeiten zu erkunden.
Die Entdeckung der Homöopathie
Im Rückblick war ich bis zu einem gewissen Grad darauf vorbereitet, mit der Homöopathie Bekanntschaft zu schließen. Erstens hatte mein Arzt in Sheffield bei mir eine hässliche, tiefe Wunde am Knie, die ich mir beim Fußballspiel zugezogen hatte, homöopathisch behandelt. Er hatte mir damals erklärt, wie Homöopathie funktioniert, und das war mir logisch erschienen, doch ich hatte nie daran gedacht, dem weiter nachzugehen. Zweitens erinnere ich mich an eine ältere Dame in Mackay, die einen Dackel mit Ekzem zur Behandlung brachte. Sie lehnte mein Angebot ab, ihm Corticosteroide zu verabreichen, und sagte, sie werde ihren Hund selbst behandeln. Als sie einige Wochen später wegen eines anderen Problems wiederkam, präsentierte sie mir einen Hund mit perfekter Haut. Ich fragte, was sie gemacht habe, und sie entgegnete: „Homöopathischer Schwefel.“ Damals bedeutete mir das nichts, doch die Erfahrung lehrte mich, dass es noch etwas jenseits der Medizin, die ich erlernt hatte, geben musste. So traf ich 1984 in Großbritannien ein und sah mich nach einem Job um. Ich fand ihn in Gestalt einer sechsmonatigen Stellvertretung über den Winter hinweg in einer kleinen Tierpraxis in Cardiff. Ein paar Wochen vor meiner Arbeitsaufnahme jedoch fand ich eine Anzeige im Veterinary Record für einen Einführungstag in die Homöopathie, der in Glastonbury von Christopher Day (dessen Buch Homöopathie in der Kleintierpraxis gerade erschienen war) und Jeremy Swayne, einem homöopathischen Arzt, abgehalten wurde. Ich nahm ordnungsgemäß daran teil und fand das ganze Konzept so faszinierend, dass ich Christophers Buch kaufte und es in den darauf folgenden Wochen von vorn bis hinten durchlas. Bei Antritt meiner Stelle in Cardiff ging ich zum Chef, erzählte ihm von meinem Interesse an der Homöopathie und bat um die Erlaubnis, sie auszuprobieren. Zu meiner Überraschung und meinem Entzücken erwies er sich als durchaus offen für diese Idee – unter der einzigen Bedingung, dass der Klient darüber informiert werde, was ich tue. Es dauerte einige Wochen, bis ich genügend Selbstvertrauen hatte, eine homöopathische Behandlung zu wagen, denn ich zögerte, meine Patienten als „Versuchskaninchen“ zu missbrauchen. Eines Tages jedoch wurde mir ein Hund vorgestellt, bei dem sich die Schulmedizin als unwirksam erwiesen hatte und der Gefahr lief, eingeschläfert zu werden: Ein Bobtail, der einige Wochen zuvor von einem Zug gestreift worden war. Die anderen Tierärzte in der Praxis hatten mit der Wiederherstellung seiner Hinterbacken hervorragende Arbeit geleistet, aber er wurde daraufhin von einer Arthritis der Wirbelsäule befallen, die so schlimm war, dass er vor Schmerzen heulte, wenn er von seinem Lager aufstehen wollte. Wenn er einmal auf den Beinen und ein paar Schritte gelaufen war, war alles in Ordnung, doch der Schmerz bei der ersten Bewegung war dramatisch. Alle herkömmlichen Entzündungshemmer und Schmerzmittel halfen drei oder vier Tage lang und verloren dann ihre Wirkung. Aufgrund des charakteristischen Symptoms „Schmerzen zu Beginn der Bewegung, besser bei fortgesetzter Bewegung“ verschrieb ich das homöopathische Mittel Rhus toxicodendron C 6, zweimal 1 Tablette täglich. Es geschah ein Wunder: Innerhalb einer Woche waren sämtliche Schmerzen verschwunden, und bei einem Follow-up lief mir ein glücklicher, lebhafter, sich frei bewegender Hund entgegen. Darin steckte eine ganze Portion Anfängerglück, doch das reichte, um den Haken zu schlucken und weiterzulernen. Ich machte schnell Fortschritte und behandelte viele einfache Akuterkrankungen mit einer durchaus hohen Erfolgsrate. Zu Beginn beschränkte ich meine Behandlungen auf Patienten mit einfachen Erkrankungen, bei denen ich mir des passenden Mittels sicher war, doch binnen Kurzem versuchte ich mich auch schon an komplexeren Fällen, häufig solchen, bei denen die Schulmedizin versagt hatte.
Inzwischen war Big Ears rechtzeitig aus seinem Gefängnis entlassen worden, um einen Winter in Wales zu erleben. In der relativ allergenfreien Umgebung seines Quarantänezwingers hatte sich seine Haut schön erholt, doch als der Frühling kam, erlitt er einen Rückfall, und im Sommer bekam er richtige Schwierigkeiten: Seine Haut war rot und juckte, sodass er sich durch sein ständiges Kratzen und Kauen selbst zu verletzen begann. Mir wurde klar, dass es an der Zeit war, die Homöopathie in meiner eigenen Familie auszuprobieren. Nachdem ich mich durch die wenigen Bücher, die ich bislang besaß – Christophers Buch, eine kleine Broschüre von George McLeod, Homeopathy in Veterinary Practice von Ken Bidiss und Boerickes Handbuch der homöopathischen Materia Medica – hindurchgelesen hatte, kam ich zu dem Schluss, dass das homöopathische Mittel Psorinum helfen müsste. Ordnungsgemäß verabreichte ich ihm alle 12 Stunden eine Tablette in der Potenz M, insgesamt drei Dosen. Ein paar Tage lang passierte gar nichts, bis ich plötzlich Massen weißer Schuppen entdeckte, zusammen mit einer deutlichen Besserung des Juckreizes. Ich wartete ab, doch weiter passierte nichts. Nach einer Woche oder zwei wurden die Symptome wieder schlimmer, und die Schuppen verschwanden. Ich wiederholte das Mittel – mit genau demselben Ergebnis wie zuvor. Inzwischen hatte ich den Boericke nochmals durchgelesen und herausgefunden, dass „Psorinum neun Tage brauchen kann, bevor es Wirkung zeigt“. Mir war aufgefallen, dass die Schuppen am zehnten Tag aufgetreten waren. (Ich habe oft gewitzelt, Big Ears müsse das Buch gelesen haben.) Nach der dritten Kur mit Psorinum mit identischem Resultat und nach erneuter Konsultation meiner Bücher begriff ich, dass Psorinum offensichtlich geholfen hatte, dass ich jetzt nur ein Folgemittel finden müsse, das noch besser zum Patienten als Ganzes passt. Mithilfe der Materia Medica fand ich heraus, dass Big Ears‘ Persönlichkeit und all seine Symptome zu Arsenicum album passten, also gab ich ihm die C 30, ich glaube, eine Woche lang. (Eine eingehendere Besprechung dieses Mittels findet sich in Kapitel 19.)
Big Ears‘ Reaktion auf dieses Mittel grenzte an ein Wunder: Seine Haut hörte auf zu jucken und heilte aus. Über die folgenden Monate hinweg musste ich die Arsenicum-Kur noch mehrere Male wiederholen, doch Fakt ist, dass Big Ears vollständig von etwas geheilt wurde, was ich mittlerweile als atopische Dermatitis identifiziert hatte, und die ihm verbleibenden vier Jahre mit einer vollständig gesunden Haut verbrachte.
Die Entwicklung meiner homöopathischen Fähigkeiten
Nun war ich so begeistert von der Homöopathie, dass ich mir vornahm, so viel zu lernen wie möglich. Da ich vorhatte, nach Australien zurückzukehren, setzte ich mir das eher hochtrabende Ziel, genügend Erfahrungen in der Tierhomöopathie zu sammeln, um ihre Entwicklung „Down Under“ zu fördern. Tatsächlich kehrte ich zurück, zunächst nach Mackay, landete jedoch aus verschiedenen Gründen 1987 wieder in Großbritannien. Christopher Day hatte inzwischen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung einer veterinärhomöopathischen Ausbildung an der Faculty of Homeopathy in London, die den Anreiz einer Qualifikation zum Veterinary Member of the Faculty of Homeopathy (Vet MFHom) bot. Die Voraussetzung dafür war eine bestandene Prüfung nach der vorgeschriebenen Anzahl an Unterrichtsstunden. Wenn ich zurückblicke, war der Unterricht an der Fakultät ziemlich altmodisch: Der letzte Schrei waren Overheadprojektoren mit Acetatfolie, Handouts gab es oftmals gar nicht, und die Referate waren gewöhnlich improvisiert – manche Ärzte hielten ihre Vorlesungen sogar im Talar! Ich glaube nicht, dass es damals schon Computerpräsentationen gab. Trotz dieser Nachteile fand ich die Veranstaltungen hochspannend. Nach einem viertägigen Modul, das von homöopathischen Ärzten präsentiert wurde, hatten die Tierärzte eine zusätzliche halbtägige Veranstaltung mit Christopher und anderen erfahrenen Tierhomöopathen, wie Francis Hunter, George McLeod und John Saxton. Die fand ich besonders inspirierend. Doch mit der Zeit wuchs in mir die Überzeugung, dass ich mit genügend Erfahrung in der Homöopathie es vielleicht noch besser machen könnte als viele Dozenten, deren Vorlesungen ich im medizinischen Teil des Kurses hatte über mich ergehen lassen. Ich bekam den Wunsch, selbst zu unterrichten. Drei Jahre lang studierte ich und vervollkommnete meine homöopathischen Fähigkeiten mit einer Vielzahl lang- und kurzfristiger Stellvertretungen (einschließlich Arbeiten für Christopher, John und Phillippa Rodale, eine homöopathische Tierärztin in Dorset). Selbstredend las ich Samuel Hahnemanns Organon, das nach wie vor die Grundlage der gesamten homöopathischen Heilkunde bildet, doch ich studierte auch die Schriften vieler berühmter Homöopathen der Vergangenheit und Gegenwart. Sukzessive verbesserten sich meine Kenntnisse und meine Kompetenz, bis ich 1991 schließlich die Prüfungen zur Faculty Membership absolvierte. In dieser Zeit erlebte ich die wahre Macht der Homöopathie. Krankheiten, die ich vorher für unheilbar oder wenigstens unbehandelbar erachtet hatte, begannen unter meiner Fürsorge zu heilen, und ich nahm voller Begeisterung Patienten mit chronischer Colitis und atopischer Dermatitis an, Myelopathy bei einem Deutschen Schäferhund und Kopfschlagen bei Pferden. Bei anderen Erkrankungen, wie Arthritis und Hornhautulcera, erwies sich die Homöopathie der konventionellen Therapie als ebenbürtig und oft sogar überlegen. Mit der Zeit erkannte ich auch immer besser die Phänomene, die meine homöopathische Ausbildung vorhergesehen hatte, wie etwa die Folgen von Unterdrückung oder Impfschäden. Natürlich erlebte ich auch meinen angemessenen Anteil an Enttäuschungen: Manche Patienten reagierten nicht auf scheinbar präzise Verschreibungen, bei anderen konnte ich einfach kein passendes Mittel ausmachen. Kurz gesagt, wusste ich bald immer besser, welche Patienten aller Voraussicht nach auf die Homöopathie ansprechen würden und wie sehr diese ihnen helfen könnte. 1993 kehrte ich nach Australien zurück und reiste nach Tasmanien. Doch wenige Monate später holte mich eine Erkrankung in meiner nächsten Familie zurück nach Großbritannien, und meine Idee, Pionierarbeit für die Tierhomöopathie in Australien zu leisten, wurde abgelöst vom Ziel, diese bemerkenswerte Heilkunde meinen Kollegen in der Heimat beizubringen.
Spezialisierung und Lehrtätigkeit
Bis 1995 hatte ich meine eigene Überweisungspraxis in Newcastle-under-Lyme bei Stoke-on-Trent in Staffordshire eingerichtet, und wieder einmal war ich am Rand des Peak District gelandet, wenngleich südlich davon. Mittlerweile hatte die Fakultät beschlossen, die laufenden Kurse selbst ruhen zu lassen, das Akkreditierungs- und Prüfungsgremium aber zu erhalten, was damit endete, dass die veterinärhomöopathischen Kurse ins Royal London Homeopathic Hospital (RLHH) verlegt wurden. Das erwies sich aus vielen Gründen als unbefriedigend, und so beschloss man, sie nach Oxford zu verlegen und in die medizinischen Kurse der Homeopathic Physicians Teaching Group einzugliedern. Diese HPTG war zwei Jahre zuvor auf die Beine gestellt worden mit der Absicht, etwas zu entwickeln, was die acht Gründungsmitglieder als „die Ausbildung, die wir gern gehabt hätten“ beschrieben. Neben Christopher Day als Leiter der Veterinärausbildung und John Saxton wurde ein dritter „Stammtutor“ gebraucht, und ich war überglücklich, diese Position angeboten zu bekommen. Bis dato hatte ich bereits ein paar Veranstaltungen an der Fakultät abgehalten und großen Gefallen daran gefunden, doch ich machte mir Sorgen, dass mein relativer Erfahrungsmangel zum Problem werden könnte. Chris versicherte mir, er suche in erster Linie Enthusiasten, und so begann meine Karriere als Tutor der Veterinärhomöopathie.
Die Zugehörigkeit zur HPTG war eine Offenbarung. Ich schloss Bekanntschaft mit Konzepten, die mir bislang unbekannt gewesen waren, so etwa mit der Psychodynamik in Gruppenprozessen oder modernen Unterrichtsverfahren, wie Rollenspiel und Kleingruppenarbeit. 1999 erhielt ich eine Anfrage von Dr. Doug Wilson aus Adelaide, ob ich bei der Einrichtung einer Ausbildung zum Veterinärhomöopathen in Australien helfen könnte. Uns wurde klar, dass es am einfachsten und sichersten sein würde, den HPTG-Kurs dort abzuhalten, und so geschah es, dass John Saxton und ich im Mai 2001 das erste Modul des australischen Kurses für Veterinärhomöopathie in Melbourne leiteten. Weitere fünf viertägige Module verteilten sich über die folgenden drei Jahre. Im Anschluss daran hielten wir gemeinsam einen weiteren Kurs in Australien ab, einen in Irland, einen in Südafrika, einen in Kanada und einen in Lettland. Um unsere veränderte Rolle deutlich zu machen, änderten wir den Namen der Gruppe in Homeopathic Professionals Teaching Group. Bis 2006 wuchs unsere Partnerschaft auf vier Tierärzte an, und so war es auch noch zur Zeit der Veröffentlichung dieses Buches.
Publizistische Tätigkeit
Im Laufe der Zeit schloss ich enge Freundschaften mit all meinen Mittutoren, doch keine war so eng wie die mit John Saxton. Da wir beide aus Nordengland stammen, haben wir ähnliche Ansichten übers Leben und einen ähnlichen Humor, und beide wissen wir die Feinheiten eines guten Biers zu schätzen. Manchmal reisten wir zum Unterricht nach Oxford, wo wir nach Feierabend verschiedentlich die Theke stützten. Aus dieser Freundschaft entstand das Lehrbuch der Veterinärhomöopathie, eine Idee, die beim Warten auf einen Zug in Didcot nach einem gemeinsamen Arbeitswochenende ausgebrütet wurde. Uns war aufgegangen, dass es zwar mehrere Einführungsbücher für Studenten der Humanhomöopathie gab, aber nichts Vergleichbares für die Veterinärhomöopathie. Um diese Lücke zu schließen, begannen John und ich ein Buch zu konzipieren, das die Veterinärkurse der HPTG ergänzen sollte. Es wurde 2005 veröffentlicht, und soweit mir bewusst ist, ist es immer noch das einzige Buch seiner Art, das sich an Tierärzte wendet.
Ein Buch zu schreiben, kostet unweigerlich eine Menge Zeit; von der Idee bis zur Veröffentlichung des Lehrbuchs brauchten wir etwa fünf Jahre. Die Homöopathie ist eine absolut dynamische Heilkunst; je häufiger man sie ausübt, umso besser versteht man sie, doch umso mehr Fragen entstehen auch, weshalb die Praxis zwangsläufig in ständiger Änderung begriffen ist. Seit ich das Lehrbuch zu schreiben begann, hat sich vieles verändert. 2000 zog ich nach Sussex, um mit Tim Couzens am Holistic Veterinary Medicine Centre zusammenzuarbeiten, und ich habe mein klinisches Arbeitsaufkommen reduziert, um mehr Zeit zum Reisen und Unterrichten zu haben. Meine Erfahrungen in der homöopathischen Praxis und meine Versuche, sie zu begreifen, haben in mir viele Fragen aufgeworfen. Am einen Ende der Skala stehen fundamentale Fragen, wie: „Wie genau wirken homöopathische Arzneimittel?“ – am anderen eher esoterische, wie: „Was genau meinen wir mit ‚Gesundheit‘ und ‚Krankheit‘?“ So ist es wenig verwunderlich, dass mir einige Zeit nach Veröffentlichung des Lehrbuches auffiel, dass ich nicht immer auf die „klassische“ Art vorgehe, wie John und ich sie im Buch beschrieben hatten. Das soll nicht heißen, dass ich an ihrem Wert zweifeln würde – in jedem Unterfangen muss man zuerst die Grundlagen erlernen, und das, was ich als „traditionelle Homöopathie“ bezeichnen würde, bleibt weiterhin die Basis meiner Praxis. Doch es gibt viele neue Interpretationen des homöopathischen Phänomens, und es gibt andere Arten zu praktizieren, die ich für nützlich befunden habe. Auf den folgenden Seiten möchte ich einige Konzepte und Erfahrungen vorstellen, die mir geholfen haben, die Veterinärhomöopathie zu verstehen und auszuüben. Im Laufe der Jahre hatte ich das Glück, einige der fortschrittlichsten Homöopathen der Welt zu hören, darunter George Vithoulkas, Jan Scholten, Rajan Sankaran, Jeremy Sherr und meinen lieben Freund David Lilley. Diese großartigen Lehrer hatten einen enormen Einfluss auf mein Denken, ebenso wie meine früheren und gegenwärtigen Partner in der HPTG, nicht zu vergessen David Owen und Alice Green. Vieles von dem, was ich mitzuteilen habe, ist nicht neu, doch die Homöopathie ist eine universelle Wahrheit, und so hoffe ich, dass meine persönliche Darstellung der Geschichte von einigem Interesse für alle ist, die tiefer in die Tierhomöopathie eindringen möchten. Nach meiner Erfahrung hat die homöopathische Praxis Konsequenzen: Herausforderungen und Vorteile, die über die gesundheitliche Besserung der Patienten hinausgehen. Darüber werde ich in den späteren Kapiteln des Buches schreiben. Ich habe meinen Studenten immer etwas flapsig gesagt: „Nach einem Studienjahr solltet ihr die Regeln kennen, nach dem zweiten Jahr solltet ihr wissen, wie ihr sie umgeht, und nach dem dritten Jahr solltet ihr eure eigenen Regeln machen können.“ Alles Folgende ist meine eigene Auffassung von der Veterinärhomöopathie.
Nun kennen Sie den Autor
Sie mögen sich fragen, warum ich dieses Buch mit einer so persönlichen Geschichte beginne. Die Antwort lautet: Ich möchte, dass Sie, die Leserin und der Leser, wissen, wer diese Worte schreibt und welchen Hintergrund er hat. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich diesen Weg verfolgt habe, weil ich so gute Erfahrungen bei der Linderung der Leiden meiner Patienten gesammelt habe. Ich habe viele Jahre lang als Schulmediziner gearbeitet, und ich habe den Krankheitsverlauf bei zahllosen Patienten beobachtet, die mit diesen Methoden behandelt wurden, kurzum: Ich weiß, was die Schuldmedizin kann und was nicht. Zusammen mit meinen Kollegen habe ich sterilisiert und kastriert, genagelt und verplattet, geimpft und injiziert. Ich weiß, welche lebensrettenden Wunder die chirurgische Intervention vollbringen kann, und ich habe die Wirkungen intravenöser Antibiotika bei einer septikämischen Hündin mit Pyometra verfolgen können. Ich habe einen Zwinger voller „Parvovirus-Fälle“ gehabt, alle nach lebensrettenden intravenösen Infusionen, und ich musste mitten in der Nacht aufstehen, um einem Hund mit einem blutenden Milztumor das Leben zu retten. Ich wurde mitten in einer hektischen abendlichen Operation mit einem an chronischem Juckreiz leidenden Hund konfrontiert und habe frustriert und vergeblich zwischen den Zehen eines Hundes nach einem Grassamen gesucht, der eine rezidivierende Sinusitis verursacht. Ich habe auch eine Hündin erlebt, die nach der geringstmöglichen Dosis eines Corticosteroids inkontinent wurde, und einen Hund, der nach der Behandlung seiner Colitis mit dem einzigen Medikament, das zu helfen schien, ein „trockenes Auge“ bekam. Ein andermal musste ich hilflos dem raschen Verfall eines Hundes mit degenerativer Myelopathie zusehen, und ich hatte den trauernden Besitzern eines Patienten mit Krebs im Endstadium wenig bis gar nichts zu bieten.
Ich erlernte die Homöopathie, weil sie in vielen Situationen der chemiebasierten Schulmedizin überlegen ist und weil sie dem Patienten immer noch helfen kann, wenn die Schulmedizin wenig oder gar nichts mehr zu bieten hat. Ich habe gesehen, welche Wirkungen die Homöopathie bei meinen Patienten zeigte, was von den Besitzern als „Wunder“ bezeichnet wurde. Mithilfe der Homöopathie konnte ich ein hochbetagtes Tier mit sanfter Pflege bis zu einem würdigen Lebensende begleiten. Ich bin überzeugt, dass unsere vierbeinigen Patienten die Wohltaten jeder dem Tierarzt verfügbaren Therapieform verdienen. Die Veterinärmedizin darf nicht auf eine Therapieform beschränkt werden und schon gar nicht auf die chemische Schulmedizin, im Gegenteil: Sie sollte ein ganzes Spektrum an Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung haben, von denen die Homöopathie nur eine ist. Wo es angemessen ist, sollten die Vorteile der Homöopathie jedoch keinem Patienten verweigert werden. Unsere Aufgabe als Tierärzte ist es, die Leiden unserer Patienten zu lindern und ihnen zu helfen, ihre Tage in höchstmöglicher Gesundheit und Harmonie zu verleben. Ich hoffe, dass dieses Buch jedem hilft, der diese Aufgabe mithilfe der Homöopathie erfüllen möchte.
Über dieses Buch
Als ich die Homöopathie zu studieren begann, hatte ich das große Glück, dies zusammen mit George MacLeod und Ken Biddis zu tun, zwei der wenigen Menschen, die über die 1950er Jahre hinweg die Tierhomöopathie in Großbritannien am Leben erhielten. Ich habe es immer bedauert, dass die Schriften, die diese Tierärzte hinterlassen haben, nur einen geringen Teil ihres Wissens über die Homöopathie enthüllen. Vor einigen Jahren beschloss ich, nicht denselben Fehler zu begehen. Im Homöopathieunterricht für Tierärzte habe ich meine Studenten immer ermutigt, das Gelernte weiterzugeben. Ich sage ihnen, dass die Homöopathie ein weites Feld ist und sie von Beginn ihres Studiums an ein Wissen erwerben werden, das ich nicht habe. Aus diesem Grund fühlte ich mich in dieser Phase meiner beruflichen Laufbahn verpflichtet niederzuschreiben, was ich bislang gelernt hatte, im Vertrauen darauf, dass einiges davon anderen nützen könnte. Ich möchte meine Erfahrungen aus der homöopathischen Praxis mit allen teilen, die bereit sind, mir zuzuhören.
Dies also ist eine Sammlung von Aufsätzen, die zusammen die Geschichte meines Weges zur Homöopathie dokumentieren. Jedes Kapitel beschäftigt sich mit einem Aspekt meiner Erkenntnisse, die ich über diese Heilkunde gewonnen habe, und zusammen stellen sie in komprimierter Form dar, wie ich die Homöopathie für Tiere verstehe und ausübe.
Es ist kein Lehrbuch, kein Handbuch und keine Materia Medica – solche Bücher sind anderweitig erhältlich, nicht zuletzt im Lehrbuch der Veterinärhomöopathie und im Projekt der IAVH Materia Medica Homoeopathica Veterinaria. Mein Buch beschäftigt sich mit Konzepten, Wahrnehmungen und Querverbindungen, es dreht sich um Emotionen und Gefühle, den Zugang zum Unbewussten, um die Begegnung mit unseren Patienten auf der Ebene des Herzens. Vor allem aber ist es ein Buch über Beziehungen: zwischen der Homöopathie und mir, zwischen den Tieren und ihren Besitzern, zwischen Tierarzt und Klient, zwischen homöopathischem Tierarzt und dem Rest des Berufsstandes, zwischen der Homöopathie und der uns umgebenden Welt – ganz besonders aber über die Beziehung zwischen mir und meinen vierbeinigen Patienten.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Leser mit den Grundlagen der Homöopathie vertraut ist (und hoffentlich das Lehrbuch gelesen hat), doch ich hoffe, dass es jedem von Nutzen sein kann, der sich für das Thema interessiert.
In DieGrundlagen beschreibe ich das Modell der Homöopathie, das meiner Praxis zugrunde liegt. Die ersten beiden Kapitel beschäftigen sich mit der Homöopathie als bioenergetischem Phänomen. Die folgenden Kapitel vervollständigen das Bild der Grundlagen, die ich bei der Arbeit im Sinn habe: Was entscheidet darüber, wie ich die Sprechstunde durchführe? Wie analysiere ich die Patientenhistorie? Hier erfahren Sie, wie ich den Patienten kennen und verstehen lerne, wie ich versuche herauszubekommen, „wer er ist“.
Der Abschnitt Die Lebensmuster beschreibt, wie ich bei der Begegnung mit einem Patienten versuche, sein Lebensmuster zu erkennen. Es ist ein multidimensionales Muster, das Sehen, Hören, Riechen, Tastsinn und – ganz wichtig – Fühlen beinhaltet.
Die Anordnung der Kapitel beruht auf der Idee, dass wir, wenn wir das „Lebensgefühl“ des Leitmittels jeder Mittelgruppe erkennen können, auch jedes andere Mittelbild aus dieser Gruppe leichter zu bestimmen vermögen und das oftmals allein anhand der physischen Symptome.
Bei jedem Mittelbild habe ich versucht, den Leser auf eine Reise mitzunehmen. Sie beginnt mit einem Zitat und führt über die Beschreibung der Ausgangssubstanz und ihrer Wiedergabe in der Materia Medica bis hin zu Gruppencharakteristika und weiter zur lokalen Symptomatik. Unbewusst gegebene Hinweise des Besitzers, rassespezifische Neigungen, miasmatische Veranlagungen und konstitutionelle Verhaltensmuster führen weiter zur Beschreibung, wie man solch einem Patienten begegnet und ihn untersucht – und nicht zuletzt, wie es sich anfühlt und was das aussagt. Es handelt sich also im Grunde eher um Beschreibungen fühlender Wesen als um „Mittelbeschreibungen“. Das Ganze endet mit einem Haiku, einer japanischen Gedichtform, in der die Zeilen sich aufeinander beziehen. Es soll eine Idee vermitteln, die größer ist als die Summe der Worte.
Im Abschnitt Der Weg erzähle ich von meinen Erfahrungen als homöopathisch behandelnder Tierarzt: Wohin sie mich gebracht, welche Herausforderungen sie aufgeworfen haben und wie ich versucht habe, damit fertigzuwerden. Sie spiegeln unsere Beziehung zu unserer Umwelt wider, wenn wir sie aus (veterinär)homöopathischer Perspektive betrachten.
Ich glaube, die Homöopathie hat inzwischen eine Entwicklungsstufe erreicht, auf der wir uns von ihren Wurzeln aus dem 19. Jahrhundert wegbewegen können. Es ist eine Heilkunde, die den Status quo auf vielen Ebenen in Frage stellt. Auf der einen Seite stellt sie das konventionelle Verständnis von Krankheit und mehr noch das von Gesundheit in Frage, auf der anderen unsere Auffassung von der physischen Wirkung der Medikamente. Heute haben wir genügend Indizien, um die Homöopathie in einem zeitgemäßeren Kontext verstehen zu können. Natürlich müssen wir den Meistern, die vor uns da waren, unsere Wertschätzung zollen, und es ist wichtig, dass wir ihr Erbe nicht aus dem Blick verlieren, doch ich meine, dass wir uns nicht mehr auf ihre Erfahrungen beschränken müssen. Wir können ein moderneres Gedankengut einbinden und eine neue Sichtweise ausbilden.
Im Alltag versuche ich in der Regel, ein einfaches Leben zu führen. Bill Shankly, der legendäre Manager des Liverpooler Fußballclubs von 1959 bis 1974 sagte einmal: „Fußball ist ein einfaches Spiel.“ Ich denke, das Leben kann ebenfalls ein einfaches Spiel sein, wenn wir es nur zulassen, und ich denke auch, dass die homöopathische Praxis einfach sein kann. Ich hoffe, dieses Buch ermöglicht es dem Leser, eine Therapie zu verstehen, die nur allzu oft im Dogma stecken bleibt.
* aus der beliebten britischen Fernsehserie „Der Doktor und das liebe Vieh“
TEIL
1
Die Grundlagen
1
Hin zu einer dynamischen Sicht der Homöopathie: Die Arzneimittel
Ich kann nicht behaupten, dass die Homöopathie immer Recht hat. Was ich heute sagen kann, ist, dass die hohen Verdünnungen richtig sind. Etwas stark Verdünntes ist nicht nichts. Es sind Wasserstrukturen, die die ursprünglichen Moleküle nachahmen.
Luc Montagnier (Medizin-Nobelpreisträger 2008)1
Potenzierung
Es besteht kein Zweifel, dass die homöopathischen Arzneimittel ihre Wirkung auf der energetischen Ebene entfalten. Für alle, die das Organon gelesen haben, versteht sich das von selbst; Hahnemann erklärte die von ihm beobachteten Wirkungen mit einer Idee, die er die „Dynamis“ nannte. Das wird oft als „Lebenskraft“ oder „Lebensenergie“ übersetzt, doch diese Übersetzungen gehen an der Grundidee der Dynamis als eines Systems vorbei, das sich in ständiger Bewegung oder auch Schwingung befindet. Eine Kraft kann potenziell sein, und eine elektromagnetische Frequenz kann eine Art Stabilität oder Kohärenz aufweisen, doch die Grundeigenschaft der Dynamis ist die kontinuierliche Veränderung. Die homöopathische Methode beruht auf der Verabreichung einer Substanz, die in der Lage ist, die Symptome des Patienten bei einem gesunden Menschen zu reproduzieren. So kann Arsen eine bestimmte Art von Erbrechen und Durchfall hervorrufen; haben wir nun einen Patienten, der eine ähnliche Symptomatik aufweist, kann die Verabreichung des homöopathischen Mittels Arsenicum diese heilen. Dieses Phänomen hängt nicht von der Dosis ab. Hahnemann allerdings beobachtete eine anfängliche Verschlimmerung der Symptome vor dem Einsetzen des Heilprozesses. Um die Schwere dieser Verschlimmerung zu minimieren, experimentierte er mit verdünnten Arzneien. Er entdeckte, dass einfache serielle Verdünnungen die Wirksamkeit der Arznei schwächten; wurde die Dilution jedoch zwischen jedem Verdünnungsschritt kräftig verschüttelt, ging nicht nur die Erstverschlimmerung zurück, sondern das Mittel wirkte sogar noch besser. Da hierbei eine Steigerung des energetischen Potenzials aufzutreten schien, bezeichnete er diesen Prozess als „Dynamisierung“ (auch „Potenzierung“ genannt), womit er ein weiteres Mal ein Wort mit derselben linguistischen Wurzel benutzte wie das, mit dem er das Energiesystem als Ganzes beschrieben hatte.
Es ist üblich, potenzierte Arzneien als „homöopathische“ Arzneien zu bezeichnen, doch streng genommen ist eine Arznei nur dann „homöopathisch“, wenn sie auf der Grundlage der homöopathischen Wirkung verschrieben wird. Auch eine unverdünnte Arznei kann durchaus homöopathisch angewendet werden.
Idealerweise erfolgt die Verschreibung eines homöopathischen Mittels auf der Basis aller Symptome, die der Patient zeigt, der „Totalität“, und das Symptommuster einer bestimmten Arznei bezeichnen wir als „Mittelbild“ oder „Mittelzustand“. Dabei vergessen wir jedoch leicht, dass wir es nicht mit einem statischen Phänomen zu tun haben. Wenn wir ein Tier sehen, scheint es absolut stabil dazustehen, während doch in Wirklichkeit die Muskeln im ganzen Körper ständig die Lage prüfen und ausbalancieren. Genauso ist die Dynamis im konstanten Fluss und erhält das System im Zustand einer relativen Homöostase, die wir als Gesundheit ansehen.
Bei der Herstellung homöopathischer Mittel werden verschiedene Potenzierungsarten angewendet, wovon die mit einem Verdünnungsfaktor von 1:100 am meisten verbreitet ist. Diese Verdünnungsskala wird als „Zentesimalskala“ bezeichnet, und die solcherart entstehenden Mittelpotenzen werden durch ein C gekennzeichnet. Nach sechs Verdünnungs- und Verschüttelungsschritten erhalten wir demnach die Potenz C 6. Eine weitere bekannte Potenzskala ist die „Dezimalskala“, gekennzeichnet durch ein D oder ein X, deren Verdünnungsfaktor 1:10 beträgt. Ab der 12. Zentesimal- bzw. der 24. Dezimalpotenz besteht nur noch eine außergewöhnlich geringe statistische Chance, dass noch ein einziges Molekül der Ausgangssubstanz übrig ist.
Das „Gedächtnis des Wassers“
Ich habe keinen Zweifel daran, dass die allgemeine Ablehnung der Homöopathie durch die Schulmedizin in erster Linie den hohen Verdünnungen geschuldet ist, mit denen die höheren Potenzen hergestellt werden. Dennoch hat das Phänomen der Potenzierung die Aufmerksamkeit einiger angesehener Wissenschaftler außerhalb der Homöopathie angezogen. Sie haben über Jahre hinweg viel Arbeit in die Untersuchung der biologischen Aktivität homöopathischer Arzneien investiert, deren Verdünnung die Potenz C 12 überschreitet. Die Existenz einer solchen Aktivität war ohne jeden vertretbaren Zweifel nachweisbar; es wurden zahlreiche Experimente durchgeführt, die eine Wirkung auf so verschiedenartige biologische Systeme zeigten, wie im Wachstum begriffene Weizensämlinge oder Jungfrösche. Im Mittelpunkt dieser Erkenntnisse steht die Idee vom „Gedächtnis des Wassers“, ein Begriff, der in der Folge von Benvenistes Studie über die Degranulation von Basophilen im Jahr 1988 geprägt wurde.2 Viele Wissenschaftler und Homöopathen sind der Meinung, dass Benveniste von seinen Kollegen abscheulich behandelt wurde, insbesondere von der Redaktionsleitung des Wissenschaftsmagazins Nature, das den ursprünglichen Artikel veröffentlicht hatte. Nachfolgende Experimente jedoch, die das System der Histamine und die Degranulation der Basophilen untersuchten, überzeugten mit Ausnahme der Engstirnigsten alle.3,4
Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist es daher nicht länger vertretbar, die Homöopathie als unglaubwürdig abzuqualifizieren, nur weil die Mittel stark verdünnt werden. Ungeachtet dessen ziemt es sich für einen Wissenschaftler, eine Erklärung für diese Aktivität zu suchen. Wenn die Aktivität nicht durch die Ausgangssubstanz (den gelösten Stoff) erklärbar ist, muss sie doch logischerweise in der Trägerflüssigkeit (Wasser oder Alkohol: dem Lösungsmittel) zu finden sein.
Wie also können wir uns dieses Phänomen erklären?
Werfen wir einen genaueren Blick auf den Prozess der Potenzierung. Als Beispiel soll uns eine einfache Kochsalzlösung dienen, aus der das homöopathische Mittel Natrium muriaticum hergestellt wird. Unser Ausgangspunkt ist eine Lösung in Wasser oder Alkohol. Beides sind polare Lösungsmittel, das heißt, sie spalten die Substanz in positiv und negativ geladene Ionen auf. Als Nächstes haben wir einen Prozess, durch den die Lösung in Bewegung versetzt wird: die „Verschüttelung“. Diese kann auf vielerlei Weise durchgeführt werden. Hahnemann soll die Ampullen angeblich gegen die Familienbibel geschlagen haben, und seitdem wurden noch allerlei andere Arten der Verschüttelung entwickelt. Dem amerikanischen Homöopathen James Tyler Kent wäre es unmöglich gewesen, mit Hochpotenzen von M (C 1000) und höher zu arbeiten, wäre nicht eine mechanische Methode der Verschüttelung erfunden worden. Viele Beispiele für solche Methoden sind historisch belegt, wie etwa die Korsakoff-Maschine oder die kontinuierlichen „Fluxionspotenzen“ von Finke. Klar ist, dass all diese Prozesse eines gemeinsam haben: Sie erzeugen eine Verwirbelung in der Lösung. So kommt zum Beispiel bei der Massenproduktion von homöopathischen Mitteln unter anderem ein Behälter mit mehreren Litern Fassungsvermögen zum Einsatz, der sachte entlang der Längsachse geschüttelt wird. Dieses Verfahren ist etwas sanfter als die Potenzierung von Hand, bei der der Laborant eine Glasampulle gegen die Oberfläche eines Materials, wie Polystyrol, schlägt. David Lilley berichtet, er habe zu einer bestimmten Zeit seiner Laufbahn eine Maschine mit einem kleinen Elektromotor und einer Gummimembran gebaut, die die Ampulle bis zu hundert Mal pro Sekunde vibrieren lassen konnte und Mittel produzierte, die er als „Supersukussionen“ bezeichnete.5 Einem Ingenieur oder Chemiker mag es bizarr vorkommen, dass so viele sich stark unterscheidende Verfahren entwickelt werden konnten, die alle Anspruch darauf erheben, ein ähnliches Produkt zu erzeugen. Doch eine genaue Untersuchung zeigt, dass all diese Verfahren eine bemerkenswert gleichbleibende Wirkung auf die verwendete Lösung ausüben.
Es wurden verschiedene Wirkmechanismen zur Sprache gebracht, die erklären sollten, weshalb die auf diese Weise erzeugten Lösungen biologisch aktiv sein müssen, aber es stellt sich doch auch die Frage, ob die entstandenen Lösungen von reinem Wasser oder voneinander zu unterscheiden sind. Sollte das der Fall sein, so haben wir den Beweis, dass die Lösungen verändert wurden, und können die Modifizierung beibehalten, und dann haben wir vielleicht ein Stück besser verstanden, wie homoöpathische Mittel wirken. Es haben sich schon viele Wissenschaftler mit diesem Problem beschäftigt. So untersuchte zum Beispiel Rey die Thermolumineszenz potenzierter Lösungen von Lithium und Natriumchlorid. Er konnte nicht nur die beiden Mittel voneinander unterscheiden, sondern auch verschiedene Potenzen desselben Mittels.6
Was unser Beispiel mit dem Kochsalz betrifft, so erforschte Assumpcao potenzierte Natriumchlorid-Lösungen im Hinblick auf den Wechselstromwiderstand und ihr Hochspannungsplasma-Bild.7 Wie rein physikalisch zu erwarten war, erhöhte sich der Wechselstromwiderstand bei seriellen Dilutionen anfänglich, doch sobald die Potenz die kritische C 12 erreicht hatte, geschah eine faszinierende Umkehrung dieser Tendenz. Auch die Hochspannungsplasma-Bilder wiesen deutliche qualitative Unterschiede bei jeder Potenzzahl auf.
Was also ist der Wirkungsmechanismus, und wie wird diese „Information“ im Laufe einer seriellen Verdünnung und Verschüttelung in der Lösung herausgebildet und erhalten?
Die Struktur des Wassers
Es ist eine überraschend weit verbreitete Meinung, dass Wasser einfach nur eine homogene Flüssigkeit sei, die von Wasserstoffbindungen zusammengehalten wird, deren Lebensdauer in Nanosekunden gemessen wird, und dass es daher schlicht unmöglich sei, dass Wasser Informationen in irgendeiner festen Form speichern könne. Diese Überzeugung wird zunehmend in Frage gestellt, und einige wichtige Indizien kommen aus dem Bereich der Werkstoffkunde. Roy et al., die auf diesem Gebiet gearbeitet haben, kamen zu dem Schluss, dass eine typische Wasserprobe mit großer Sicherheit aus mindestens mehreren hundert verschieden großen Clustern besteht. Wie sich herausstellte, blieben die unterschiedlich strukturierten Formen bis zu mehreren Minuten stabil – weit länger als die eine Mikrosekunde, die Wasserstoffbindungen halten.8, 9 Sie erklärten das mit den Van-der-Waals-Kräften, die zwischen und innerhalb den unterschiedlich strukturierten Clustern wirken müssen. Diese Kräfte würden die Strukturveränderungen erklären, die unter Verwendung elektrischer und magnetischer Felder beobachtet wurden, und sie scheinen innerhalb der Cluster noch stärker zu wirken als zwischen ihnen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass dies das Wasser zum wahrscheinlich am leichtesten veränderbaren Aggregatzustand der uns bekannten kondensierten Materie macht und eine Erklärung für seine einzigartigen und wundersamen Eigenschaften liefern könnte, wozu auch die hohen Verdünnungen und die berichteten Einflüsse schwacher Magnetfelder gehören.
Die Autoren beziehen sich auch auf das Phänomen der „Epitaxie“, die sie als „Übertragung struktureller Informationen von der Oberfläche eines Stoffes (meist eines kristallinen Feststoffes) auf die eines anderen (meist, aber nicht immer, eine Flüssigkeit)“ definieren. In den meisten Fällen wird keine Materie von einem Feststoff auf eine Flüssigkeit übertragen. Nach diesem Prinzip und mit einer spezifischen Struktur als Vorlage (und das kann sowohl ein Feststoff als auch eine Flüssigkeit sein) ist es möglich, einen ganzen Flüssigkeitskörper dazu zu bringen, sich in einer vorher gewählten Struktur auszufällen oder zu kristallisieren. So kann eine Struktur durch Epitaxie übertragen werden, ohne eine Spur des Ausgangsmusters zu hinterlassen.
Roy und seine Mitarbeiter zitieren auch die Studie von Samal und Glecker10, die Ansammlungen von Clustern aus gelösten Substanzen und Wasser um eine Vielzahl gelöster Substanzen herum nachweist, welche sich bis in die Größenordnung von Mikrometern hinein erstrecken.
Da Wasser einen feststehenden Temperaturbereich hat, ist Druck eine wichtige Variable bei der Bestimmung, welche Struktur sich unter neuen Bedingungen herausbilden wird. Laut Roy erzeugen „normale“ Verschüttelungsverfahren einen Druck von etwa 1 Kilobar. Die Verschüttelung produziert auch Nanoblasen, deren Existenz zweifelsfrei nachgewiesen wurde.11 Auch die können über einen sehr langen Zeitraum hinweg stabil bleiben und damit zu den Mechanismen gehören, die für das „Gedächtnis des Wassers“ verantwortlich sind.





























