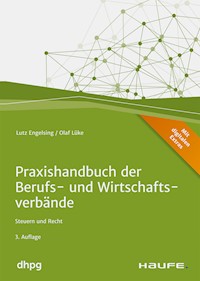
Praxishandbuch der Berufs- und Wirtschaftsverbände - inkl. Arbeitshilfen online E-Book
Lutz Engelsing
87,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Das Praxishandbuch bietet einen einmaligen Überblick zum Spezialthema Wirtschafts- und Steuerrecht von Berufs- und Wirtschaftsverbänden. Es wird auf die besondere steuerliche Behandlung und die vielfältigen zivilrechtlichen Fragen, die sich bei diesen Verbänden stellen, eingegangen. Daher ist es optimal geeignet für Verbandsgeschäftsführer, Rechtsanwälte und Steuerberater von Verbänden. Inhalte: - Gestaltungsempfehlungen zur Organisation des Verbandes und zur Besteuerung der Verbandstätigkeit - Steuerliche Auswirkungen von Änderungen in der Verbandsstruktur - Beendigung des Verbandes durch Auflösung, Insolvenz, Entziehung der Rechtsfähigkeit - Neu in der 3. Auflage: Rechtsschutz versus Rechtsberatung als Steuerfalle, mit allen aktuellen Rechtsänderungen und auf dem neuesten Stand der RechtsprechungArbeitshilfen online: - Mustertexte (z. B. Gründungsprotokoll, Satzung). - Amtliche Formulare (z. B. Erklärung zur Körperschaftsteuerpflicht von Berufsverbänden, Antrag auf Ausstellung einer NV-Bescheinigung).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort zur 3. AuflageVorwort zur 1. AuflageAbkürzungsverzeichnisLiteraturverzeichnisA Einführung1 Begriff des Berufsverbands2 Abgrenzung zu Berufsvertretungen3 Aufgaben4 Steuerliche BehandlungB Gründung1 Rechtsform2 Zivilrechtliche Grundlagen2.1 Abgrenzung rechtsfähiger/nichtrechtsfähiger Verein2.2 Abgrenzung Idealverein/wirtschaftlicher Verein2.3 Gründungsakt2.3.1 Feststellung der Satzung2.3.2 Bestellung des ersten Vorstands2.3.3 Gründungsprotokoll2.3.4 Anmeldung zum Vereinsregister2.3.5 Meldung zum Transparenzregister 2.3.6 Erlangung der Rechtsfähigkeit2.4 Satzung2.4.1 Name des Vereins2.4.2 Sitz des Vereins2.4.3 Absicht zur Eintragung in das Vereinsregister2.4.4 Zweck des Vereins2.4.5 Erwerb der Mitgliedschaft2.4.6 Beendigung der Mitgliedschaft2.4.7 Mitgliedsbeiträge2.4.8 Bildung des Vorstands2.4.9 Mitgliederversammlung2.4.10 Sonstige Satzungsbestimmungen 2.4.11 Unterzeichnung der Satzung2.5 Vereinsordnung und Geschäftsordnung2.6 Dachverband und Gesamtverein3 Steuerliche Besonderheiten3.1 Zweckrichtung des Verbands3.1.1 Ausgestaltung der Satzung3.1.2 Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung3.1.3 Auseinanderfallen von Satzung und tatsächlicher Geschäftsführung3.2 Wechsel in die und aus der SteuerbefreiungC Organisation des Verbands1 Mitgliedschaft1.1 Erwerb der Mitgliedschaft1.2 Rechte der Mitglieder1.3 Pflichten der Mitglieder1.4 Beendigung der Mitgliedschaft1.4.1 Austritt1.4.2 Ausschluss1.4.3 Streichung aus der Mitgliederliste1.4.4 Rechtsfolgen 2 Organe2.1 Mitgliederversammlung2.1.1 Einberufung2.1.2 Durchführung und Beschlussfassung 2.1.3 Covid-19-Übergangsregelung2.2 Vorstand2.2.1 Bestellung2.2.2 Notbestellung durch das Amtsgericht2.2.3 Amtszeit2.2.4 Beendigung des Vorstandsamts2.2.5 Anstellungsverhältnis/Auftragsverhältnis2.2.6 Vertretung2.2.7 Geschäftsführung2.3 Sonstige Organe2.3.1 Besonderer Vertreter2.3.2 Geschäftsführer und Geschäftsstelle3 Haftung3.1 Haftung des Verbands3.1.1 Organhaftung3.1.2 Haftung für Erfüllungsgehilfen3.1.3 Haftung für Verrichtungsgehilfen3.2 Persönliche Haftung von Organmitgliedern3.3 Haftung der VereinsmitgliederD Besteuerung der Verbandstätigkeit1 Allgemeines2 Steuersubjekt2.1 Hauptverein2.2 Regionale Untergliederungen2.3 Tochtergesellschaften3 (Ertrag-)Steuerliche Sphären des Verbands – ein Überblick3.1 Ideeller Bereich3.2 Vermögensverwaltung3.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb3.3.1 Wesen und Steuerfolgen 3.3.2 Dauerverluste3.3.3 Geprägetheorie4 Umsatzsteuer4.1 Berufsverband als Unternehmer4.2 Umsatzsteuerbare Leistungen4.3 Umsatzsteuerpflicht bzw. -befreiung4.4 Bemessungsgrundlage sowie Berechnung4.5 Vorsteuerabzug4.6 Kleinunternehmer4.7 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers5 ABC der steuerlichen Einordnung ausgewählter Bereiche5.1 Aus- und Fortbildung5.1.1 Ertragsteuerliche Einordnung5.1.2 Inanspruchnahme umsatzsteuerlicher Befreiungsvorschriften5.2 Bürogemeinschaft von Berufsverbänden5.3 Geschäftsstelle5.4 Personal-/Sachmittelgestellung5.5 Lobbytätigkeiten5.6 Mitgliedsbeiträge5.7 (Sonder-)Umlagen5.8 Nutzung von Kapitalvermögen5.9 Rechtsschutz/-beratung5.10 Sponsoring 5.10.1 Fehlende Gegenleistung5.10.2 (Geringfügige) Gegenleistung5.10.3 Aktive Gegenleistung5.10.4 Abgrenzungsprobleme bei mehreren Maßnahmen5.11 Verbandsgremien5.11.1 Auslagenersatz 5.11.2 (Pauschale) Aufwandsentschädigungen5.12 Verbandszeitschrift5.13 Vermietung und Verpachtung5.14 Zuschüsse5.15 Sonstige Betätigungen6 Sonderregelung für Parteispenden 7 Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen7.1 Ideeller Bereich/Vermögensverwaltung7.2 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb7.3 Zuordnung von Einnahmen/Ausgaben8 Fiktive Ausschüttung in den ideellen Bereich – Kapitalertragsteuer8.1 Persönlicher Anwendungsbereich8.2 Umfang der Kapitaleinkünfte8.3 Entstehung und Durchführung der Besteuerung9 SteuerveranlagungE Exkurs: Abgrenzung zu gemeinnützigen VereinenF Rechnungslegung 1 Gesetzliche Vorgaben1.1 Vereinsrecht1.2 Handelsrecht1.3 Steuerrecht2 Zwecke der Rechnungslegung 3 Form und Inhalt der Rechnungslegung 3.1 Einnahmen-/Ausgabenrechnung mit Vermögensrechnung3.2 Jahresabschluss3.2.1 Handelsrecht3.2.2 E-Bilanz4 OffenlegungG Satzungsänderung und Änderungen in der Verbandsstruktur1 Satzungsänderung1.1 Zuständigkeit1.2 Beschlussfassung 1.3 Eintragung im Vereinsregister1.4 Satzungsdurchbrechung 2 Ausgründung von Verbandsaktivitäten2.1 Einsatz von Service-Gesellschaften2.1.1 Chancen/Motive und Risiken2.1.2 Vermeidung des Gepräges2.1.3 »Schein«-GmbH2.2 Zivilrechtliche Grundlagen2.2.1 Ausgliederung2.2.2 Sacheinlage oder Sachgründung2.2.3 Verkauf2.3 Steuerliche Auswirkungen der Ausgründung2.3.1 Ausgliederung bzw. Sacheinlage2.3.2 Verkauf2.4 Besteuerung nach der Ausgründung2.4.1 Besteuerung der GmbH2.4.2 Einordnung beim Verband2.4.3 Gewinnausschüttungen2.5 Betriebsaufspaltung2.5.1 Tatbestandsmerkmale2.5.2 Rechtsfolgen 2.6 Leistungen zwischen Verband und Service-Gesellschaft2.6.1 Ertragsteuern2.6.2 Umsatzsteuer3 Verschmelzung3.1 Gründe für eine Verschmelzung3.2 Zivilrechtliche Grundlagen3.2.1 Verschmelzungsvertrag3.2.2 Verschmelzungsbericht 3.2.3 Verschmelzungsprüfung3.2.4 Verschmelzungsbeschluss 3.2.5 Klage gegen den Verschmelzungsbeschluss 3.2.6 Kündigungsrecht3.2.7 Eintragung im Vereinsregister3.3 Umwandlungssteuerrecht 3.3.1 Übertragender Verein3.3.2 Übernehmender Verein3.4 Grunderwerbsteuer 3.5 Umsatzsteuer4 Spaltung5 Formwechsel H Beendigung eines Verbands1 Auflösung1.1 Beschluss der Mitgliederversammlung1.2 Auflösung gemäß Satzung1.3 Wegfall sämtlicher Mitglieder1.4 Rechtsfolgen der Auflösung2 Insolvenz3 Verlust der Rechtsfähigkeit3.1 Verzicht3.2 Entziehung der Rechtsfähigkeit4 Besteuerung4.1 Inanspruchnahme der steuerlichen Begünstigungen4.2 SteuerveranlagungI Steuerliche Außenprüfung1 Begriff und Zweck2 Erscheinungsformen2.1 Außenprüfung mit Vorankündigung2.1.1 Allgemeine Außenprüfung2.1.2 Besondere Außenprüfungen2.2 Außenprüfung ohne Vorankündigung2.2.1 Umsatzsteuer-/Lohnsteuer-/Kassen-Nachschau2.2.2 Steuerfahndung3 PrüfungsablaufJ Anlagen1 Muster1.1 Gründungsprotokoll1.2 Satzung1.3 Registeranmeldung1.4 Einladung zur Mitgliederversammlung1.5 Protokoll einer Mitgliederversammlung1.6 Registeranmeldung SatzungsänderungStichwortverzeichnisDie AutorenArbeitshilfen OnlineHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Haufe Lexware GmbH & Co KG
[6]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-15041-2
Bestell-Nr. 06025-0003
ePub:
ISBN 978-3-648-15042-9
Bestell-Nr. 06025-0101
ePDF:
ISBN 978-3-648-15043-6
Bestell-Nr. 06025-0151
Lutz Engelsing/Olaf Lüke
Praxishandbuch der Berufs- und Wirtschaftsverbände
3. Auflage, August 2021
© 2021 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
Bildnachweis (Cover): © Shanvood, Shutterstock
Produktmanagement: Noé, Bettina
Lektorat: Helmut Haunreiter
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Für Bücher mit Online-Angebot gilt: Die Inhalte auf unserem Online-Angebot stehen für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, zur Verfügung. Einen Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sofern diese Publikation bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten sollte, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
[15]Vorwort zur 3. Auflage
Das Gesellschafts- und Steuerrecht der Berufs- und Wirtschaftsverbände unterliegt einem stetigen Wandel. Neben regelmäßigen Gesetzesänderungen gibt es neue (nationale und europäische) Rechtsprechungen, die für die Praxis relevant sind. Weiterhin gilt, dass die existierende Fachliteratur zu steuerprivilegierten Körperschaften zwar umfangreich ist; sie befasst sich im Wesentlichen jedoch mit gemeinnützigen Organisationen. Das Recht der Berufs- und Wirtschaftsverbände und insbesondere deren
Besteuerung werden entweder nur am Rande gestreift oder sogar vollkommen aus der Betrachtung ausgeklammert.
Nach der erfreulichen Resonanz auf die bisherigen beiden Auflagen gehen wir davon aus, dass dieses Praxishandbuch sowohl den Verantwortlichen in den Verbänden als auch Rechtsberatern und Richtern eine wertvolle Hilfe im Umgang mit dieser Spezialmaterie sein kann. Damit dies auch weiterhin der Fall ist, haben wir das Werk umfassend aktualisiert. Gesetzesänderungen sowie Rechtsprechung und Literatur sind bis einschließlich April 2021 eingearbeitet.
Verlag und Verfasser hoffen weiterhin, mit der vorliegenden Aktualisierung einen praxisnahen Beitrag zur rechtlichen und steuerrechtlichen Behandlung von Berufs- und Wirtschaftsverbänden geleistet zu haben. Hinweise und Anregungen aus der Leserschaft sind stets willkommen.
Wie immer gebührt unser herzlichster Dank dem Verlag und seinen Mitarbeitern, insbesondere Frau Bettina Noé, für das große Engagement und die vielfältige Unterstützung.
Bonn im Juni 2021
Dr. Lutz Engelsing
Dr. Olaf Lüke
[17]Vorwort zur 1. Auflage
Angesichts der umfangreichen rechtlichen und steuerlichen Fachliteratur stellt sich bei jedem neuen Werk die Frage: Muss das denn auch noch sein? Im vorliegenden Fall sind wir der Meinung: ja.
Das Gesellschafts- und Steuerrecht der Berufs- und Wirtschaftsverbände ist ein Spezialgebiet, welches die Praxis vielfach vor schwierige Probleme stellt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Finanzverwaltung wegen der partiellen Steuerfreiheit seit Jahren ihre Prüfungstätigkeit in Bezug auf Berufs- und Wirtschaftsverbände verstärkt.
Die existierende Fachliteratur zu Vereinen ist zwar umfangreich, sie befasst sich im Wesentlichen jedoch mit gemeinnützigen Organisationen. Das Recht der Berufs- und Wirtschaftsverbände und insbesondere deren Besteuerung werden entweder nur am Rande gestreift oder sogar vollkommen aus der Betrachtung ausgeklammert. Bei gegenwärtig rund 12.000 Berufs- und Wirtschaftsverbänden eine erstaunliche Erkenntnis!
Mit diesem Praxishandbuch wird – soweit ersichtlich – die erste Gesamtdarstellung zum Gesellschafts- und Steuerrecht der Berufs- und Wirtschaftsverbände vorgelegt. Sein Aufbau folgt dem Lebenszyklus eines Berufsverbands: von der Gründung über die Wirkungszeit bis ggf. zu seiner Umstrukturierung oder Auflösung.
Als ein Werk von Praktikern für Praktiker soll es den Geschäftsführern und Vorständen von Berufs- und Wirtschaftsverbänden sowie deren Beratern wertvolle Hilfestellung in allen einschlägigen Rechts- und Steuerfragen leisten. Ein besonderes Augenmerk haben wir daher auch auf ein umfassendes Sachregister gelegt.
Verlag und Verfasser hoffen, mit dem vorliegenden Handbuch einen praxisnahen und aktuellen Beitrag zur rechtlichen und steuerrechtlichen Behandlung von Berufs- und Wirtschaftsverbänden geleistet zu haben. Hinweise und Anregungen aus der Leserschaft sind herzlich willkommen.
Unser herzlicher Dank gebührt dem Verlag und seinen Mitarbeitern, insbesondere Frau Elvira Plitt, für das große Engagement und die vielfältige Unterstützung.
Bonn im Januar 2008
Dr. Lutz Engelsing
Dr. Olaf Lüke
[19]Abkürzungsverzeichnis
a. A.anderer Ansichta. F.alte FassungAbb.AbbildungAbs.AbsatzAbschn.AbschnittAEAOAnwendungserlass zur AbgabenordnungAGDie Aktiengesellschaft (Zeitschrift)AktGAktiengesetzAnh.AnhangAOAbgabenordnungArt.ArtikelAufl.AuflageAz.Aktenzeichen BAGBundesarbeitsgerichtBAnzBundesanzeigerBayFinMinBayerisches Staatsministerium der FinanzenBayObLGBayerisches Oberstes LandesgerichtBayObLGZEntscheidungssammlung des Bayerischen Obersten Landesgericht in ZivilsachenBBDer Betriebs-Berater (Zeitschrift)BFHBundesfinanzhofBFH/NVSammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs ab 1950 (Zeitschrift)BgABetrieb gewerblicher ArtBGBBürgerliches GesetzbuchBGBl.BundesgesetzblattBGHBundesgerichtshofBGHZEntscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs in ZivilsachenBMFBundesminister der FinanzenBpOBetriebsprüfungsordnungBR-Drs.Drucksache des Deutschen BundesratsBSGBundessozialgerichtbspw.beispielsweiseBStBl.BundessteuerblattBT-Drs.Drucksache des Deutschen BundestagsBuchst.BuchstabeBVerfGBundesverfassungsgerichtBVerfGEEntscheidungssammlung des BundesverfassungsgerichtsBVerwGBundesverwaltungsgericht[20]bzgl.bezüglichbzw.beziehungsweise d. h.das heißtDBDer Betrieb (Zeitschrift)DStRDeutsches Steuerrecht (Zeitschrift)DStREDeutsches Steuerrecht Entscheidungsdienst (Zeitschrift) e. V.eingetragener VereinErbStGErbschaftsteuer- und SchenkungsteuergesetzEStBDer Ertragsteuerberater (Zeitschrift)EStGEinkommensteuergesetzEStHEinkommensteuer-HinweiseEStREinkommensteuer-Richtlinienetc.et ceteraEUEuropäische UnionEuGHEuropäischer GerichtshofEuGHEEntscheidungen des Europäischen Gerichtshofs f.folgendF.FachFamFGGesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen GerichtsbarkeitFAZFrankfurter Allgemeine Zeitungff.fortfolgendeFGFinanzgerichtFinMin.FinanzministeriumFRFinanz-Rundschau (Zeitschrift) GbRGesellschaft bürgerlichen RechtsGewStGGewerbesteuergesetzGGGrundgesetzggf.gegebenenfallsGmbHGesellschaft mit beschränkter HaftungGmbHGGesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter HaftungGmbHRGmbH-Rundschau (Zeitschrift)GNotKGGerichts- und NotarkostengesetzGrEStGGrunderwerbsteuergesetzGStBGestaltende Steuerberatung (Zeitschrift)GWBGesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen[21]HHinweisHalbs.HalbsatzHFAHauptfachausschussHFRHöchstrichterliche Finanzrechtsprechung (Zeitschrift)HGBHandelsgesetzbuchHHSpHübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur AO und FGO i. S.im Sinnei. V.in VerbindungIDWInstitut der Wirtschaftsprüferinsbes.insbesondereInsOInsolvenzordnung JWJuristische WochenschriftKapErtStKapitalertragsteuerKGKommanditgesellschaftKG KredWGKreditwesengesetzKStGKörperschaftsteuergesetzKStKKörperschaftsteuer-KarteiKStRKörperschaftsteuer-Richtlinien LAGLandesarbeitsgerichtLGLandgerichtLStRLohnsteuerrichtlinien MDRMonatsschrift für Deutsches Rechtm. w. N.mit weiteren NachweisenMio.MillionMoMiGGesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von MissbräuchenMünchKommMünchener Kommentar zum BGBMwStSysRLMehrwertsteuersystemrichtlinie n. F.neue Fassungn. v.nicht veröffentlichtNJWNeue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)NJW-RRNJW-RechtsprechungsreportNr.NummerNRWNordrhein-WestfalenNVNichtveranlagung[22]NVwZNeue Zeitschrift für VerwaltungsrechtNWBNeue Wirtschafts-Briefe (Zeitschrift)NZANeue Zeitschrift für ArbeitsrechtNZGNeue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht OFDOberfinanzdirektionOHGOffene HandelsgesellschaftOLGOberlandesgericht p. a.per annum (jährlich)PublGPublizitätsgesetz RRichtlinieRFHReichsfinanzhofRGReichsgerichtRGZEntscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachenrkr.rechtskräftigRn.RandnummerRPflegerDer Deutsche Rechtspfleger (Zeitschrift)RPflGRechtspflegergesetzRSRechnungslegungsstandardRStBl.ReichssteuerblattRz.Randziffer S.Seites. o.siehe obenSEStEGGesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriftensog.so genannteSolZGSolidaritätszuschlaggesetz 1995StbgDie Steuerberatung (Zeitschrift)StRKSteuerrechtskarteiStuBSteuern und Bilanzen (Zeitschrift) TvöDTarifvertrag des öffentlichen DienstesTz.Textziffer u. a.und andereu. Ä.und Ähnlicheu. E.unseres Erachtensu. U.unter Umständen[23]UmwGUmwandlungsgesetzUmwStGUmwandlungssteuergesetzUStAEUmsatzsteueranwendungserlass (Stand: 10. Februar 2020)UStDVUmsatzsteuerdurchführungsverordnungUStGUmsatzsteuergesetzUStKUmsatzsteuer-Karteiusw.und so weiter v.vomvgl.vergleicheVRVVereinsregisterverordnungVVVermögensverwaltungVZVeranlagungszeitraum wGBwirtschaftlicher GeschäftsbetriebWMWertpapier-Mitteilungen (Zeitschrift) z. B.zum BeispielZGRZeitschrift für Unternehmens- und GesellschaftsrechtZHRZeitschrift für das gesamte Handels- und WirtschaftsrechtZIPZeitschrift für WirtschaftsrechtZRPZeitschrift für RechtspolitikZStVZeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesenzzgl.zuzüglich[25]Literaturverzeichnis
Adrian, Quentin/Engelsing, LutzVerlust der Gemeinnützigkeit bei Insolvenz oder Liquidation? – Fallstricke bei der Auflösung oder Sanierung einer gemeinnützigen Körperschaft, in: NWB 2019, S. 2709–2714.Althoff, Frank/Engelsing, LutzDie Abgrenzung des privaten vom gewerblichen Wertpapierhandel, in: StuB 1999, S. 737–744.Alvermann, JörgSteuerliche Probleme bei Fortbildungsreisen, in: AG 2007, S. 236–239.Alvermann, JörgErtragsbesteuerung der Berufsverbände, in: FR 2006, S. 262–271.Arnold, ArndDie geplante Vereinsrechtsreform – Fortschritt oder Irrweg?, in: DB 2004, S. 2143–2146.Arnold, ArndDer Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Vereinsrechts, in: ZRP 2005, S. 170.Backhaus, Nora/Adrian, QuentinDie Bilanzierung öffentlicher Zuwendungen unter besonderer Berücksichtigung von Fehlbedarfsfinanzierungen – Besonderheiten der Rechnungslegung von Non-Profit-Organisationen, in: NWB 2020, S. 3551–3555.Beuthien, VolkerZweitmitgliedschaft wider Willen?, in: ZGR 1989, S. 255–272.Beuthien, VolkerKünftig alles klar beim nichteingetragenen Verein?, in: NZG 2005, S. 493–495.Bitz, HorstÄnderung der Rechtslage bei der Betriebsaufspaltung, in: DStR 2002, S. 752–754.Bitz, HorstAusschüttungen von Tochter-Kapitalgesellschaften an steuerbefreite Berufsverbände, in: DStR 2003, S. 1519–1521.Bornheim, WolfgangWertpapierhandel oder Vermögensverwaltung, in: Stbg 2002, S. 260–273.Buchna, Johannes/Leichinger, Carina/Seeger, Andreas/Brox, WilhelmGemeinnützigkeit im Steuerrecht, 12. Aufl., Achim 2020.Bunjes, Johann/Geist, ReinoldUmsatzsteuergesetz – Kommentar, 19. Aufl., München 2020.Burret, GiannaSteuerbefreiung für Berufsverbände – Die Bedeutung des BFH-Urteils vom 13.3.2012 – I R 46/11 für die Praxis, in: NWB 2012, S. 2610–2616.Dötsch, Ewald/Patt, Joachim/Pung, Alexandra/Möhlenbrock, RolfUmwandlungssteuerrecht, 7. Aufl., Stuttgart 2012.[26]Dötsch, Ewald/Jost, Werner F./Pung, Alexandra/Witt, GeorgDie Körperschaftsteuer – Kommentar, Stuttgart, 96. Ergänzungslieferung/Juni 2019, Loseblatt.Eggers, WinfriedDie Besteuerung der Berufsverbände – Ein Überblick, in: DStR 2007, S. 461–467.Eggers, WinfriedSchenkungsteuer bei Zuwendungen an Verein, in: DStR 2007, S. 1752–1754.Eggers, WinfriedDie Besteuerung der Wirtschafts- und Berufsverbände, Köln 2008.Engelsing, LutzNeues zur Umsatzsteuerbefreiung einer ehrenamtlichen Tätigkeit, in: NWB 2012, S. 3064–3065.Engelsing, Lutz/Backhaus, NoraKapitalertragsteuer bei Berufsverbänden – Fallgestaltungen für eine vollständige Abstandnahme oder einen reduzierten Kapitalertragsteuerabzug, in: NWB 2014, S. 2847–2851.Engelsing, Lutz/Latsch, VolkerNon-Profit Unternehmen als Seminaranbieter – ertrag- und umsatzsteuerliche Behandlung bei gemeinnützigen Organisationen und Berufsverbänden, in: NWB 2006, F. 7, S. 6715–6722.Engelsing, Lutz/Linnartz, IlonaDokumentationserfordernisse bei Berufsverbänden und ihre steuerlichen Folgen, in: NWB 2003, F. 4, S. 4721–4724.Engelsing, Lutz/Lüke, OlafDie Verschmelzung von Berufsverbänden – formale Anforderungen, Aufdeckung stiller Reserven vermeiden, Verschmelzungsrichtung beachten, in: NWB 2007, F. 18, S. 4409–4416.Engelsing, Lutz/Muth, Jochen-JohannesGewinntransfers an Körperschaften des privaten Rechts – Auslegungsfragen des neuen Einkommenstatbestandes am Beispiel von Berufsverbänden, in: DStR 2003, S. 917–921.Engelsing, Lutz/Rohde, AndreasErtrag- und umsatzsteuerliche Folgen des Sponsorings bei Berufsverbänden und gemeinnützigen Organisationen, in: NWB 2004, F. 4, S. 4811–4814.Engelsing, Lutz/Schmidt, AlexanderPotenzielle Umsatzsteuerpflicht von Tätigkeitsvergütungen bei Vereinen, in: NWB 2012, S. 643–645.Engelsing, Lutz/Schmidt, AlexanderNeues zur Umsatzsteuerbefreiung von Tätigkeitsvergütungen bei Vereinen – Klarstellende Ausführungen der Verwaltung, in: NWB 2013, S. 1474–1476.Engelsing, Lutz/Wassermeyer, SteffenDie Abgrenzung zwischen privater Vermögensverwaltung und gewerblichem Grundstückshandel, in: StuB 2004, S. 433–439.[27]Felix, GüntherSteuerliche Beurteilung der Aufwendungen für Mandatserwerbe an berufsverbandsnahe, gemeinnützige Einrichtungen, in: BB 1982, S. 2171–2176.Hadding, WaltherZu einer geplanten Änderung des Vereinsrechts, in: ZHR 170 (2006) S. 137–166.Haritz, Detlef/Menner, Stefan/Bilitewski, AndreaUmwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., München 2019.Hartmann/MetzenmacherUmsatzsteuergesetz, Kommentar, Berlin 2019, Loseblatt.Hau, Wolfgang/Poseck, RomanBeck’scher Online-Kommentar BGB, 56. Edition, München 2020.Hauptfachausschuss des IDWIDW RS HFA 14: Rechnungslegung von Vereinen, in: IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung, Düsseldorf, Loseblatt.Heckschen, Heribert/Herrler, Sebastian/Münch, ChristofBeck’sches Notar-Handbuch, 7. Auflage, München 2019.Heermann, Peter W.Die geplante Reform des deutschen Vereinsrechts, in: ZHR 170 (2006), S. 247–295.Hübschmann, Walter/Hepp, Ernst/Spitaler, ArminKommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, Köln, 254. Ergänzungslieferung/September 2019, Loseblatt.Hüttemann, RainerWirtschaftliche Betätigung und steuerliche Gemeinnützigkeit, Köln 1991.Immenga, Ulrich/Mestmäcker, Ernst-Joachim Knoop, AnjaWettberwerbsrecht, Bd. 2, Kommentar zum deutschen Kartellrecht, 6. Aufl., München 2020. Gewinnausschüttungen im gemeinnützigen Konzern, in: DStR 2006, S. 1263–1266.Kühner, ChristianDie Steuerbefreiung der Berufsverbände, Münster 2009.Kühner, ChristianUnbeschränkte wirtschaftliche Betätigung für Berufsverbände, in: DStR 2009, S. 1786–1790.Leisner, Walter GeorgEhrenamtliche Tätigkeit und Umsatzsteuerbefreiung, in: NWB 2011, S. 2871–2875.Lex, PeterDie Mehrheitsbeteiligung einer steuerbegünstigten Körperschaft an einer Kapitalgesellschaft – Vermögensverwaltung oder wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb?, in: DB 1997, S. 349–352.Littmann, Eberhard/Bitz, Horst/Pust, HartmutDas Einkommensteuerrecht, Stuttgart, 139. Ergänzungslieferung/Oktober 2019, Loseblatt.Lutter, Marcus (Hrsg.) Meining, SteffenUmwandlungsgesetz: Kommentar, 6. Aufl., Köln 2019. Beteiligungen steuerbefreiter Berufsverbände an Kapitalgesellschaften, in: DStR 2006, S. 352–355.[28]Metzing, Cornelia/Fischer, CarolaStellungnahme der Bundessteuerberaterkammer zum zweiten Entwurfsschreiben des BMF zur E-Bilanz, in: DStR 2011, S. 1583–1585.Möhlenkamp, KarenAnwendung des Sponsoring-Erlasses auf Berufsverbände, in: NWB 2004, S. 2513.Möhlenkamp, KarenVereinsrechtsreform stutzt Nebenzweckprivileg der Vereine, in: DB 2004, S. 2737–2739.Mueller-Thuns, Thomas/Jehke, ChristianGefährdung der Steuerbefreiung von Berufsverbänden gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG durch Beteiligung an Kapitalgesellschaften, in: DStR 2010, S. 905–910.Neu, Norbert/Engelsing LutzDie Besteuerung von Berufsverbänden, in: NWB 2002, F. 4, S. 4685–4692.Neu, Norbert/Engelsing LutzSteuerlicher Handlungsbedarf bei Berufsverbänden bis zum Jahreswechsel, in: NWB 2002, F. 4, S. 4693–4694.Pahlke, ArminGrunderwerbsteuergesetz – Kommentar, 7. Aufl., München 2020.Palandt, Otto Papperitz, Günter/Keller, ManfredBürgerliches Gesetzbuch, 79. Aufl., München 2020. ABC Betriebsprüfung, 4. Aufl., Bonn, 82. Ergänzungslieferung/Januar 2013, Loseblatt.Rau, Günter/Dürrwächter, ErichKommentar zum Umsatzsteuergesetz, Köln, 183. Ergänzungslieferung/September 2019, Loseblatt.Rauscher, Thomas/Krüger, WolfgangMünchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Band 1, §§ 1–354, 6. Aufl., München 2020.Reichert, Bernhard/Schimke, Martin/Dauernheim, JürgenVereins- und Verbandsrecht, 14. Aufl., Köln 2018.Reuter, DieterDie Reform des Vereinsrechts, in: NZG 2005, S. 738–746.Roser, FrankZweifelsfragen bei Wertpapiergeschäften, in: EStB 2004, S. 506–508.Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland (Hrsg.)Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1: Allgemeiner Teil, §§ 1–240, 8. Aufl., München 2018.Sauter, Eugen/Schweyer, Gerhard/Waldner, WolframDer eingetragene Verein, 20. Aufl., München 2016.Schauhoff, StephanHandbuch der Gemeinnützigkeit, 3. Aufl., Bonn 2010.Schießl, Harald/Küpperfahrenberg, JanSteuerliche Haftung der Vorstände von Vereinen und Verbänden – Risiko, Vermeidungsstrategie, Versicherbarkeit, in: DStR 2006, S. 445–450.Schleder, HerbertSteuerrecht der Vereine, 12. Aufl., Herne/Berlin 2019.Schmidt, LudwigEStG – Einkommensteuergesetz Kommentar, 39. Aufl., München 2020.[29]Schmidt, KarstenDie Abgrenzung der beiden Vereinsklassen, Bestandsaufnahme, Kritik, Neuorientierung, in: RPfleger 1972, S. 286–294 und 343–353.Schmidt, KarstenSieben Leitsätze zum Verhältnis zwischen Vereinsrecht und Handelsrecht, in: ZGR 1975, S. 477–486.Segna, UlrichDie wirtschaftliche Betätigung von Idealvereinen im Lichte des Entwurfs zur Änderung des Vereinsrechts, in: RPfleger 2006, S. 449–455.Soergel, Hans TheodorBürgerliches Gesetzbuch: Kommentar, Allgemeiner Teil, §§ 1–103, 13. Aufl., Stuttgart 2000.Söffing, Andreas/Thoma, KarinAusgewählte Beratungsaspekte im Gemeinnützigkeits- und Stiftungsrecht, in: BB 2003, S. 1091–1093.Sorgenfrei, UlrichPrivate Vermögensverwaltung contra gewerblicher Wertpapierhandel, in: FR 1999, S. 61–76.Staudinger, Julius vonKommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Allgemeiner Teil 2, §§ 21–79, Berlin 2006.Stöber, Kurt/Otto, Dirk-UlrichHandbuch zum Vereinsrecht, 12. Aufl., Köln 2021.Streck, Michael Tappe, HenningKörperschaftsteuer-Kommentar, 9. Aufl., München 2018. Das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags, in: NVwZ 2020, 517–521.Thiel, JochenSponsoring im Steuerrecht, in: DB 1998, 842–848.Tipke, Klaus/Kruse, Heinrich WilhelmAbgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Kommentar, Köln, 158. Ergänzungslieferung/November 2019, Loseblatt.Wallenhorst, Rolf/Halaczinsky, RaymondDie Besteuerung gemeinnütziger Vereine, Stiftungen und der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 7. Aufl., München 2017.Weitemeyer, Birgit/Schauhoff, Stephan/Achatz, Markus (Hrsg.)Umsatzsteuerrecht für den Nonprofitsektor – MwStSystRl, deutsches und österreichisches UStG, Köln 2019.[31]AEinführung
[33]1Begriff des Berufsverbands
Eine einheitliche Definition des »Berufsverbands« gibt es nicht. Gesellschaftspolitisch stellt ein Verband eine auf Dauer angelegte Vereinigung von natürlichen oder juristischen Personen mit dem Ziel dar, gemeinsame Interessen in organisierter Weise zu verfolgen bzw. zu vertreten. (Berufs-)Verbände1 zählen – wie auch gemeinnützige Organisationen – regelmäßig zu den Non-Profit-Organisationen. Im allgemeinen Sprachgebrauch finden sich Begriffe wie:
Wirtschaftsverband2FachverbandBerufsverbandInteressenvereinigungGewerkschaftArbeitnehmerverbandArbeitgeberverbandUnternehmerverbandDachverbandSpitzenverbandDie steuerliche Definition von Berufsverbänden ist vom Bundesfinanzhof in ständiger Rechtsprechung festgelegt worden3:
»Berufsverbände sind Vereinigungen von natürlichen Personen oder Unternehmen, die allgemeine, aus der beruflichen oder unternehmerischen Tätigkeit erwachsende ideelle und wirtschaftliche Interessen des Berufsstands oder Wirtschaftszweigs wahrnehmen.«
Diese Definition ist von der Rechtsprechung zuletzt 2018 bestätigt worden4. Gleichgültig ist, ob die Interessenwahrnehmung nur den Mitgliedern oder dem Berufsstand/Wirtschaftszweig insgesamt zugutekommt5. Des Weiteren ist es nicht notwendig, dass die Mitglieder aus derselben Branche stammen. Es reicht vielmehr aus, wenn allgemeine Interessen wirtschaftlicher Art wahrgenommen werden6. Die Finanzverwaltung
[34]hat sich obige Definition in R 5.7 Abs. 1 KStR 2015 zu Eigen gemacht. Auch der EuGH verwendet eine ähnliche Definition für Zwecke der Umsatzsteuer7:
»Eine Einrichtung, die Ziele »de nature syndicale« verfolgt, bezeichnet eine Organisation, deren Hauptziel die Verteidigung der gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder – unabhängig davon, ob es sich dabei um Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Angehöriger freier Berufe oder Personen handelt, die eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit ausüben – und deren Vertretung gegenüber betroffenen Dritten einschließlich staatlicher Stellen ist.«
Auch Zusammenschlüsse von Berufsverbänden, d. h. bspw. Bundes-, Landes-, Dach-, Spitzenverbände, internationale Verbände, sind ebenfalls Berufsverbände im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG8.
Berufsverbände müssen die allgemeinen wirtschaftlichen Belange aller Angehörigen eines Berufsstands oder Wirtschaftszweigs wahrnehmen, nicht nur die besonderen wirtschaftlichen Interessen einzelner Angehöriger einer bestimmten Berufsgruppe oder eines Wirtschaftszweigs. Kein Berufsverband ist somit im Umkehrschluss eine Interessenvertretung, die nur die besonderen geschäftlichen Belange ihrer Mitglieder wahrnimmt – auch wenn sämtliche Mitglieder an einer derartigen Tätigkeit des Verbands interessiert sind9. Wahrgenommen werden müssen aber nicht sämtliche allgemeinen Belange eines Berufsstands oder Wirtschaftszweigs; es reicht aus, wenn zumindest ein einziges wirtschaftliches Interesse wahrgenommen wird (»Ein-Thema-Verband«)10.
Ein eigenständiges Rechtskleid existiert für Berufsverbände nicht; sie bedienen sich jedoch regelmäßig der Rechtsform des rechtsfähigen oder nichtrechtsfähigen Vereins. Denkbar, aber in der Praxis derzeit wohl nicht zu finden, sind auch eine Berufsverbands-GmbH oder andere Rechtsformen.
1 Zur Geschichte der Verbandsbesteuerung, siehe Eggers, Die Besteuerung der Berufs- und Wirtschaftsverbände, S. 9 ff.
2 Zu den Berufsverbänden zählen auch Wirtschaftsverbände; BFH v. 22.7.1952 – I 44/52 U, BStBl. 1952 III, 221.
3 Siehe bereits BFH v. 22.7.1952 – I 44/52 U, BStBl. 1952 III, 221.
4 BFH v. 13.12.2018 – V R 45/17, BFH/NV 2019, 508.
5 BFH v. 7.6.1988 – VIII R 76/85, BStBl. 1989 II, 97.
6 BFH v. 13.3.2012 – I R 46/11, BFH/NV 2012, 1181, vgl. Burret, NWB 2012, 2610 ff.
7 EuGH v. 12.11.1998 – C 149/97 »Institute of the Motor Industry«, HFR 1999, 132.
8 R 5.7 Abs. 1 Satz 3 KStR 2015.
9 So bspw. bei einer Abrechnungsstelle von Apothekeninhabern (BFH v. 26.4.1954 – I 110/53 U, BStBl. 1954 III, 204), einer Güteschutzgemeinschaft (BFH v. 11.8.1972 – III R 114/71, BStBl. 1973 II, 39) oder einem Werbeverband (BFH v. 15.7.1966 – III 179/64, BStBl. 1966 III, 638).
10 BFH v. 4.6.2003 – I R 45/02, DStRE 2003, 1391.
[35]2Abgrenzung zu Berufsvertretungen
Berufsverbände ohne öffentlich-rechtlichen Charakter sind von den Berufsvertretungen abzugrenzen, die als (Zwangs-)Körperschaften des öffentlichen Rechts neben den Mitgliederinteressen staatliche Aufgaben mit hoheitlicher Gewalt wahrnehmen. Hierzu zählen bspw. Kammern bzw. Innungen.
In Kammern sind natürliche oder juristische Personen (Pflicht-)Mitglieder kraft Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe. Etwas anderes gilt für Innungen, die zwar auch Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, deren Mitglieder jedoch freiwillig ein- und auch wieder austreten können.
Im Rahmen der Selbstverwaltung führen die Berufsvertretungen die ihnen staatlich übertragenen Aufgaben eigenständig aus. Hierzu gehören insbesondere die Regelung und Organisation der Berufsausübung. Die Berufsvertretungen bedienen sich dazu wie alle anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften grundsätzlich auch öffentlichrechtlicher Organisations- und Handlungsformen. Sie können daher im Rahmen der ihnen staatlich übertragenen Aufgaben Verwaltungsakte erlassen (z. B. Gebührenbescheid).
Soweit diese Berufsvertretungen als Verbände mit öffentlich-rechtlichem Charakter hoheitliche Tätigkeiten ausüben, unterliegen sie keiner Ertragsbesteuerung. Eine partielle Steuerpflicht begründen sie allenfalls in wirtschaftlichen Betätigungen, die steuerlich als Betrieb gewerblicher Art zu qualifizieren sind11.
Im Gegensatz dazu sind Berufsverbände freiwillige Zusammenschlüsse auf privatrechtlicher Basis, die ihre Tätigkeiten in staatsfreier Selbstverwaltung ausüben.
11 § 1 Abs. 1 Nr. 6 i. V. mit § 4 KStG.
[37]3Aufgaben
Ein Berufsverband vertritt die allgemeinen, den Mitgliedern aus ihrer beruflichen oder unternehmerischen Tätigkeit erwachsenden ideellen und wirtschaftlichen Interessen unter anderem gegenüber den gesetzgeberischen Körperschaften oder den Verwaltungsbehörden. Ebenso soll der Verband die Wünsche seiner Mitglieder als eine gemeinsame Zielsetzung geltend machen und nach Möglichkeit durchsetzen.
Die erzielten Ergebnisse müssen dem Berufsstand oder dem Wirtschaftszweig unabhängig von einer bestehenden Mitgliedschaft zugutekommen. Das Wirken soll im Interesse der Allgemeinheit stehen; insoweit ist ein »Trittbrettfahrer-Verhalten« nicht auszuschließen. Es dürfen nicht ausschließlich die besonderen geschäftlichen Interessen der Mitglieder wahrgenommen werden. Daher muss sich der Berufsverband auf die allgemeine Förderung seiner Mitglieder beschränken, z. B. durch die Schaffung besserer wirtschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Betätigung seiner Mitglieder.
BEISPIEL:
Aufgrund der politischen Einflussnahme eines Berufsverbands verabschiedet der Gesetzgeber einheitliche Richtlinien für die Ausbildung in einem bestimmten Berufszweig.
Der Verband nimmt insoweit auch die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder wahr; Nutznießer der einheitlichen Ausbildungsrichtlinien und des damit verbundenen Qualitätsstandards sind jedoch sämtliche Unternehmen dieses Berufszweigs, unabhängig von ihrer Mitgliedschaft im Verband.
Es hat keine Auswirkung auf die steuerliche Anerkennung als Berufsverband, wenn sich Mitglieder verschiedener, indes verwandter Berufe, oder sogar selbst verschiedener, nicht verwandter Zweige der gewerblichen Wirtschaft (wie z. B. Mitglieder einer Fachgruppe) in einem Verband zusammenschließen12.
Folgende Aufgaben können von einem Berufsverband ganz oder teilweise wahrgenommen werden:
Interessenwahrnehmung bei Gesetzgebung und VerwaltungsbehördenFörderung des Berufsstands bzw. des WirtschaftszweigsWahrung der wirtschaftlichen InteressenBeratung und Unterstützung von Angehörigen des Berufsstands oder Wirtschaftszweigs[38]Information der Mitglieder über Fragen des BerufsrechtsFörderung der Aus-, Fort- und WeiterbildungVeranstaltung von fachbezogenen TagungenEntwicklung, Fortschreibung und Verbreitung von QualitätsstandardsAustausch von ErfahrungenEntlastung der Mitglieder von administrativen AufgabenInformation über Beruf und BerufsverbandHerausgabe von ZeitschriftenPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitErbringen von RechtsschutzleistungenZur besseren Wahrnehmung dieser Aufgaben sind regelmäßig Zusammenschlüsse von regionalen Berufsverbänden auf Landes- und/oder Bundesebene zu beobachten. Die so gebildeten Spitzen- oder Dachverbände können gezielt und mit einer Stimme für die gemeinsamen Interessen des Berufsstands bzw. des Wirtschaftszweigs auftreten.
12 BFH v. 12.7.1955 – I 104/53 U, BStBl. 1955 II, 271; v. 22.7.1952 – I 44/52 U, BStBl. 1952 III, 221.
[39]4Steuerliche Behandlung
Ist ein Berufsverband – wie dies regelmäßig der Fall ist – in der Rechtsform des (nicht-) rechtsfähigen Vereins organisiert, richtet sich seine Besteuerung nach den Grundsätzen für die Vereinsbesteuerung: Der Berufsverband ist dem Grunde nach körperschaftsteuerpflichtig nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Nr. 5 KStG.
Die Inanspruchnahme steuerlicher Begünstigungen richtet sich danach, ob ein Verband von den Finanzbehörden als »Berufsverband im steuerlichen Sinne« (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG) anerkannt wird.
So sind diese Berufsverbände nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG von der Körperschaftsteuer grundsätzlich befreit. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist.Berufsverbände sind ebenso grundsätzlich nicht gewerbesteuerpflichtig. Die Gewerbesteuer knüpft an einen stehenden Gewerbebetrieb an, der bei Berufsverbänden nicht gegeben ist. Nach § 2 Abs. 3 GewStG gilt als Gewerbebetrieb jedoch die Tätigkeit eines Berufsverbands, soweit er einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält.Im Rahmen der Umsatzsteuer gelten für Berufsverbände die allgemeinen Vorschriften. Der Gesetzgeber hat lediglich in § 4 Nr. 22 a) UStG etwaige Vortrags-/Seminareinnahmen der Berufsverbände von der Umsatzsteuer befreit13.Bei den übrigen Steuerarten gelten für Berufsverbände die allgemeinen gesetzlichen Regelungen.Verwendet ein Berufsverband Mittel von mehr als 10 % seiner Einnahmen für die unmittelbare oder mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien14, ist die Steuerbefreiung vollständig nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 Buchst. b) KStG ausgeschlossen.Mitgliedsbeiträge sind unabhängig von dieser steuerlichen Einstufung sowohl von der Ertrags- als auch von der Umsatzbesteuerung ausgenommen. Nach § 8 Abs. 5 KStG bleiben bei Personenvereinigungen für die Ermittlung des Einkommens Beiträge außer Ansatz, die aufgrund der Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder erhoben werden. Aus umsatzsteuerlicher Sicht ist ein Leistungsaustausch nicht gegeben.
[40]Die persönliche Freistellung der Berufsverbände von der (Körperschaft-)Steuerpflicht beruht »auf der gesetzespolitischen Anerkennung ihres Wirkens als eines Wirkens im Interesse der Allgemeinheit«15.
Lässt ein nichtrechtsfähiger Berufsverband sein Vermögen von einer Körperschaft bzw. Personenvereinigung verwalten, kann diese nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 KStG von der Körperschaftsteuer befreit sein. Hierzu muss die Verwaltung des Vermögens des nichtrechtsfähigen Berufsverbands der Hauptzweck sein, ihre Erträge im Wesentlichen aus dieser Vermögensverwaltung herrühren und ausschließlich dem Berufsverband zufließen. Derartige Körperschaften bzw. Personenvereinigungen sind zudem nach § 3 Nr. 10 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Praktische Bedeutung entfalten diese Vorschriften in Bezug auf die Vermögensverwaltungseinrichtungen einiger Gewerkschaften16.
13 Im Zuge der Jahressteuergesetze 2013 sowie 2019 sollten die Umsatzsteuerbefreiungen des § 4 Nr. 21 und Nr. 22 a) UStG neu gefasst und auf sämtliche Unternehmen ausgeweitet werden. Eine Umsetzung erfolgte bisher nicht.
14 Politische Parteien i. S. von § 2 des Parteiengesetzes.
15 BFH v. 29.11.1967 – I 67/65, BStBl. 1968 II, 236.
16 Vgl. Eggers, DStR 2007, S. 461 (462).
[41]BGründung
[43]1Rechtsform
Eine bestimmte Rechtsform ist für Berufsverbände nicht vorgeschrieben. Somit sind als Rechtsform für den Berufsverband grundsätzlich alle zivilrechtlichen Zusammenschlussformen denkbar. Allerdings sind Berufsverbände nicht ohne Grund typischerweise als Verein organisiert, denn der eingetragene Verein bietet die idealen Rahmenbedingungen für einen Berufsverband.
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft und Genossenschaft kommen nur in Betracht, wenn ein Handelsgewerbe betrieben bzw. ein Geschäftsbetrieb unterhalten wird. Dies ist bei einem Berufsverband regelmäßig nicht der Fall.
Im Gegensatz zu anderen Rechtsformen bereitet insbesondere der Ein- und Austritt von Mitgliedern bei einem Verein die geringsten Probleme. Bei einer Aktiengesellschaft oder GmbH muss bspw. zur Aufnahme neuer Gesellschafter eine aufwendige Kapitalerhöhung oder Anteilsabtretung durchgeführt werden. Auch ist der Austritt aus einer Kapitalgesellschaft nicht ohne Weiteres möglich, da sie nur eingeschränkt eigene Anteile halten oder Anteile von Gesellschaftern einziehen kann. Nicht weniger aufwendig stellt sich die Lage bei den Personengesellschaften dar.
In einen Verein hingegen können unbeschränkt viele Mitglieder ein- und wieder austreten, ohne dass dies auf den Bestand des Vereins Einfluss hätte. Zudem gibt es keine gesetzlichen Formvorschriften für den Ein- und Austritt. Mangels einer kapitalmäßigen Beteiligung muss weder beim Eintritt in den Verein eine Einlage geleistet werden, noch muss der Verein dem Ausscheidenden eine Abfindung zahlen.
Weitere Vorteile des Vereins sind die große Flexibilität und Gestaltungsfreiheit. Da nur wenige gesetzliche Vorgaben bestehen und diese überwiegend auch noch durch die Satzung abbedungen werden können, kann sich der Berufsverband mit der Vereinssatzung eine seinen spezifischen Anforderungen entsprechende Grundordnung geben.
Der eingetragene Verein ist somit für die Zwecke eines Berufsverbands prädestiniert. Da in der Praxis fast ausschließlich diese Rechtsform verwandt wird, konzentriert sich die weitere Darstellung auf die Rechtsform des eingetragenen Vereins.
[45]2Zivilrechtliche Grundlagen
Die §§ 21 ff. BGB enthalten die gesetzlichen Regelungen zum Vereinsrecht. Eine Definition des Vereins enthält das Gesetz jedoch nicht. In Anlehnung an die Rechtsprechung des Reichsgerichts17 versteht man unter einem Verein eine auf Dauer angelegte Verbindung einer größeren Anzahl von Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, die nach ihrer Satzung körperschaftlich strukturiert ist. Kennzeichnend für die körperschaftliche Struktur des Vereins ist, dass er einen Namen führt, durch Organe vertreten wird und sein Bestand vom Wechsel der Mitglieder unberührt bleibt. Anders als bei Personengesellschaften werden Beschlüsse im Vereinsrecht grundsätzlich mit Mehrheit gefasst und Fremdorganschaft ist zulässig.
2.1Abgrenzung rechtsfähiger/nichtrechtsfähiger Verein
Das Gesetz unterscheidet zwischen dem rechtsfähigen und dem nichtrechtsfähigen Verein. Nur der rechtsfähige Verein ist eine juristische Person. Er kommt als eingetragener Verein (§ 21 BGB) und als wirtschaftlicher Verein (§ 22 BGB) vor18.
Der nichtrechtsfähige Verein ist ebenso wie der rechtsfähige Verein eine auf Dauer angelegte körperschaftlich strukturierte Verbindung mehrerer Personen zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks. Die körperschaftliche Organisation äußert sich in einem Gesamtnamen, in der Vertretung durch einen Vorstand und in der Unabhängigkeit von einem Wechsel der Mitglieder.19 Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass der nichtrechtsfähige Verein mangels Registereintragung keine juristische Person ist; er wird daher vielfach auch als nicht eingetragener Verein bezeichnet.
Der nichtrechtsfähige Verein ist in § 54 BGB geregelt. Nach dem Wortlaut des § 54 Satz 1 BGB sollen auf ihn die Vorschriften über die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff. BGB) Anwendung finden. Es besteht jedoch seit Langem Einigkeit darüber, dass diese Regelung unzweckmäßig ist. Entgegen dem Gesetzeswortlaut wendet die herrschende Meinung daher die §§ 21 ff. BGB auch auf den nichtrechtsfähigen Verein an – mit Ausnahme der Vorschriften, die die Registereintragung voraussetzen20.
[46]Dem nichtrechtsfähigen Verein wird – ähnlich wie der Gesellschaft bürgerlichen Rechts – von Rechtsprechung und Schrifttum inzwischen die (Teil-)Rechtsfähigkeit zugestanden21. Gemäß § 50 Abs. 2 ZPO ist seine aktive und passive Parteifähigkeit vor Gericht inzwischen sogar gesetzlich anerkannt.
Die Mitglieder des nichtrechtsfähigen Vereins haften – anders als bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts – nicht akzessorisch für die Vereinsschulden22. Die Vertretungsmacht des Vereinsvorstands ist vielmehr auf die Verpflichtung des Vereinsvermögens beschränkt23. Kritisch ist beim nichtrechtsfähigen Verein allerdings die in § 54 Satz 2 BGB normierte Handelndenhaftung. Danach haftet derjenige, der Rechtsgeschäfte im Namen des nichtrechtsfähigen Vereins gegenüber Dritten vornimmt, aus diesen Rechtsgeschäften auch persönlich mit seinem gesamten privaten Vermögen. Der Handelnde haftet unabhängig davon, ob er Vorstands- oder Vereinsmitglied ist und auch unabhängig davon, ob er zur Vertretung des Vereins berechtigt ist.
Berufsverbände sind typischer Weise als rechtsfähige Vereine organisiert. So können sie als juristische Person am Rechtsverkehr teilnehmen und die Handelndenhaftung wird vermieden.
2.2Abgrenzung Idealverein/wirtschaftlicher Verein
Gemäß § 21 BGB erlangt nur ein solcher Verein die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister, »dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist«. Dagegen erlangt der wirtschaftliche Verein gemäß § 22 BGB seine Rechtsfähigkeit durch Hoheitsakt. Hintergrund der Differenzierung ist, dass die §§ 21 ff. BGB auf den sog. Idealverein zugeschnitten sind, also auf einen Verein, der keine wirtschaftliche Betätigung zum Gegenstand hat. Für diese Rechtsform verzichtet das BGB auf gesetzliche Schutzvorschriften zur Sicherung des Rechtsverkehrs und der Gläubiger.
Die staatliche Anerkennung des wirtschaftlichen Vereins soll sicherstellen, dass Vereine, die einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zum Gegenstand haben, die Rechtsfähigkeit nur nach besonderer staatlicher Prüfung erlangen.
[47]Nach diesem Verständnis müsste jede unternehmerische Betätigung den betreffenden Verein zu einem wirtschaftlichen Verein im Sinne von § 22 BGB machen. Das würde in vielen Fällen jedoch zu unerwünschten Ergebnissen24 führen und wurde daher nicht konsequent umgesetzt.25 Vielmehr ist als sog. Nebenzweckprivileg anerkannt, dass eine unternehmerische Betätigung den Status des Idealvereins nicht beeinträchtigt, wenn sie im Vergleich zu seiner ideellen Hauptbetätigung nur eine eindeutig untergeordnete Rolle spielt und Hilfsmittel zum Erreichen des Hauptzecks ist.26
Entscheidend ist also der Hauptzweck des Vereins. Die Hauptbetätigung des Vereins muss eine ideelle Tätigkeit sein. Zudem muss sich die unternehmerische Tätigkeit im Rahmen des Vereinszwecks halten und sich bei natürlicher Betrachtungsweise als ein die ideelle Betätigung ergänzendes und objektiv sinnvolles Mittel zur Förderung des Vereinszwecks darstellen. Die Förderung darf aber nicht ausschließlich in einer von der sonstigen Vereinstätigkeit isolierten Mittelbeschaffung bestehen; es ist vielmehr eine Unterordnung der wirtschaftlichen Tätigkeit unter den ideellen Vereinszweck erforderlich.27
Als Abgrenzungskriterium zwischen einem nicht wirtschaftlichen und einem wirtschaftlichen Verein stellten Rechtsprechung und herrschende Literatur lange Zeit auf das Vorliegen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ab. Die Eintragungsfähigkeit als nicht wirtschaftlicher Verein ging mit einem Verbot der übermäßigen wirtschaftlichen Betätigung einher.28 War der (Haupt-)Zweck29 des Vereins auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, dann lag ein wirtschaftlicher Verein vor. Die Abgrenzung nach dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb spiegelte aber die Vereinswirklichkeit nicht wider. Dies betraf insbesondere die große Anzahl der eingetragenen Vereine im Sozial-, Wohlfahrts- und Bildungswesen. Diese verfolgen ihre ideellen Zwecke unmittelbar durch das entgeltliche Anbieten von Leistung. Nach dem bisherigen Verständnis vom Nebenzweckprivileg wären diese Vereine nicht nach § 21 BGB eintragungsfähig gewesen, denn sie verfügen über keine nennenswerten nichtunternehmerischen Aktivitäten, denen die wirtschaftliche Betätigung gegenübergestellt werden könnte.
Mit der Kita-Rechtsprechung des Kammergerichts Berlin30 kam ab dem Jahr 2016 Bewegung in diese Rechtsfrage. Das Kammergericht sprach verschiedenen Vereinen, [48]darunter insbesondere Trägern von Kindertagesstätten, die Eintragungsfähigkeit als nicht wirtschaftlichen Vereinen ab. Es argumentierte, dass es nicht auf den Zweck, sondern auf die Betätigung des Vereins ankomme und die entgeltliche Betreuung von Kindern unabhängig vom Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu qualifizieren sei. Eine Berufung auf das Nebenzweckprivileg scheide aus, da keine anderweitige, nichtwirtschaftliche Aktivität der betroffenen Vereine zu erkennen sei, hinter die der Betrieb der Kindertagesstätten zurücktrete.31
In seiner Grundsatzentscheidung vom 16.05.2017 stellt der BGH entgegen dem Kammergericht klar, dass auch Vereine mit wirtschaftlicher Betätigung als Idealvereine im Sinne des § 21 BGB eintragungsfähig sein können.32 Der BGH nahm dabei insbesondere Bezug auf die Anerkennung der Vereine als gemeinnützig im Sinne der §§ 51 ff. AO. Der steuerliche Gemeinnützigkeitsstatus kann danach zwar nicht mit der Nichtwirtschaftlichkeit im Sinne des § 21 BGB gleichgesetzt werden. Dem Gemeinnützigkeitsstatus des Vereins kommt aber eine Indizwirkung zu. Eine wirtschaftliche Betätigung eines gemeinnützigen Vereins schadet insofern nicht per se. Der Nichtwirtschaftlichkeit stehen jedoch Vereinszwecke entgegen, die auf Geschäftsgewinne und den wirtschaftlichen Vorteil des Einzelnen ausgelegt sind.33 Ausdruck der Gemeinnützigkeit ist insbesondere das Merkmal der Selbstlosigkeit nach § 55 AO sowie das damit verknüpfte Gewinnausschüttungsverbot. Bei gemeinnützigen Vereinen ist die wirtschaftliche Betätigung gerade nicht der Hauptzweck oder Selbstzweck des Vereins, sondern dem ideellen Hauptzweck zugeordnet. Der Umfang des Geschäftsbetriebs ist demgegenüber unerheblich. Der BGH hebt insofern insbesondere auf das Gewinnausschüttungsverbot ab: Ist der Zweck des Vereins die Auskehr von Gewinnen an die Mitglieder, dann handelt es sich um einen wirtschaftlichen Verein.34
Aufgrund der berufsständischen Zweckrichtung verfolgt ein Berufsverband in erster Linie nichtwirtschaftliche Zwecke. Hierbei handelt es sich um berufsständische Zwecke und nicht um die selbstlose Förderung der Allgemeinheit, sodass der Berufsverband in der Regel nicht gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung ist. Dennoch gibt ihm seine berufsständische und damit nichtwirtschaftliche Zielsetzung das Gepräge, sodass er als Idealverein zu qualifizieren ist. Wirtschaftliche Tätigkeiten lassen sich dann entweder im Rahmen des Nebenzweckprivilegs beim Berufsverband selbst oder – bei einem zu großen Umfang – in einer Tochtergesellschaft (häufig »Service GmbH« genannt) durchführen.35
[49]2.3Gründungsakt
2.3.1Feststellung der Satzung
Die Gründung eines Vereins erfolgt dadurch, dass die Gründer die Vereinssatzung verbindlich festlegen und dem Verein als Mitglied beitreten36. Soll ein Idealverein im Sinne von § 21 BGB gegründet werden, müssen sie sich zudem darüber einig sein, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll (vgl. § 57 BGB). In der Regel erfolgt die Feststellung der Satzung in einer Gründungsversammlung. Rechtlich erforderlich ist dies aber nicht, sodass bspw. auch ein schriftliches Umlaufverfahren möglich ist.
Zur Gründung eines Vereins sind mindestens zwei Personen erforderlich, die mit der Feststellung der Vereinssatzung und ihrem eigenen Eintritt in den Verein das Gründungsgeschäft vollziehen.37. Gemäß §§ 56, 60 BGB kann der Verein jedoch erst dann in das Vereinsregister eingetragen werden, wenn er mindestens sieben Mitglieder hat. Eintragungsfähig wird der Verein also erst, wenn weitere Mitglieder eingetreten sind. In der Regel wird das Gründungsgeschäft aber von mindestens sieben Mitgliedern vollzogen, zumal als weitere Eintragungsvoraussetzung die dem Vereinsregister einzureichende Satzung gemäß § 59 Abs. 3 BGB von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet werden muss.
Neben natürlichen Personen können auch juristische Personen, Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften Gründer bzw. Mitglieder eines Vereins sein, ebenso eine BGB-Gesellschaft und ein nichtrechtsfähiger Verein. Es gilt § 181 BGB, d. h., wer bei der Gründung für mehrere Gründer als Vertreter handelt, muss vom Verbot der Mehrfachvertretung befreit sein.38.
2.3.2Bestellung des ersten Vorstands
Neben der Feststellung der Satzung müssen die Gründer im Gründungsgeschäft noch den ersten Vereinsvorstand bestellen. Dabei ist nach den Bestimmungen der zuvor festgestellten Vereinssatzung vorzugehen.
[50]2.3.3Gründungsprotokoll
Über die Feststellung der Satzung und die Bestellung des ersten Vorstands ist eine Niederschrift anzufertigen, das sog. Gründungsprotokoll. Diese Niederschrift ist von den nach der Satzung für die Protokollierung von Vereinsbeschlüssen zuständigen Personen zu unterzeichnen.
Mit der Beschlussfassung über die Satzung und der Bestellung des Vorstands entsteht der sog. Vorverein. Er ist bis zu seiner Eintragung im Vereinsregister ein nichtrechtsfähiger Verein.
2.3.4Anmeldung zum Vereinsregister
Der erste Vorstand hat den Verein zur Eintragung in das Vereinsregister anzumelden. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat.
Es war lange umstritten, ob diese Anmeldung von sämtlichen Mitgliedern des Vorstands vorgenommen werden muss oder ob es genügt, dass der Vorstand in vertretungsberechtigter Anzahl handelt.39 Seit der Neufassung von § 77 BGB40 ist gesetzlich klargestellt, dass eine Anmeldung durch Vorstandsmitglieder in vertretungsberechtigter Anzahl ausreicht.
Die Anmeldung zum Vereinsregister muss gemäß § 77 Satz 1 BGB in öffentlich beglaubigter Form erfolgen. Für die öffentliche Beglaubigung gilt § 129 BGB. Die Vorstandsmitglieder können sich bei der Anmeldung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Allerdings muss in diesem Fall eine beglaubigte Vollmacht vorgelegt werden.41
Gemäß § 59 Abs. 2 BGB sind der Anmeldung eine Abschrift der Vereinssatzung und eine Abschrift der Urkunde über die Bestellung des Vorstands beizufügen. Die bis 2009 geltende Verpflichtung zur Einreichung von Originalen wurde abgeschafft42. Eine Beglaubigung der Abschriften ist nicht erforderlich. Die Satzung hat die Unterschrift von mindestens sieben Vereinsmitgliedern (nicht notwendig Gründungsmitgliedern) zu tragen. Sie soll ferner den Tag ihrer Errichtung (= Feststellung) nennen. Die Anmel[51]dung ist wahlweise in herkömmlicher (Papier-)Form oder auf elektronischem Wege möglich.
Das Vereinsregister (dort gemäß § 3 Nr. 1a RPflG der Rechtspfleger) prüft zunächst seine örtliche Zuständigkeit und sodann, ob Anmeldung und Satzung in formeller und materieller Hinsicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Das Registergericht prüft insbesondere die Einhaltung der in den §§ 56 bis 59 BGB genannten Eintragungsvoraussetzungen. Da der Verein nur dann in das Vereinsregister eingetragen werden kann, wenn sein Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist43, muss auch dies durch das Vereinsregister überprüft werden. Eine Zweckmäßigkeitsprüfung der statutarischen Bestimmungen findet hingegen nicht statt.
Sind die in §§ 56 bis 59 BGB normierten Anforderungen nicht beachtet, muss das Vereinsregister die Anmeldung zurückzuweisen (§ 60 BGB). In der Regel geht einer Ablehnung der Eintragung eine Zwischenverfügung des Rechtspflegers voraus, mit der den Beteiligten innerhalb einer bestimmten Frist Gelegenheit gegeben wird, das Eintragungshindernis zu beseitigen (§ 382 Abs. 4 FamFG). Wird die Vereinsregistereintragung endgültig abgelehnt, so hat dies durch einen mit Gründen versehenen Beschluss zu erfolgen, der sämtlichen Personen, die die Anmeldung vorgenommen haben, förmlich zuzustellen ist (§§ 38 Abs. 3, 41, 382 Abs. 3 FamFG). Gegen diesen Beschluss kann Beschwerde eingelegt werden (§§ 382 Abs. 3, 58 FamFG). Beschwerdebefugt ist nicht der einzelne Beteiligte, sondern der (Vor-)Verein, der durch seine Vorstandsmitglieder in vertretungsberechtigter Zahl vertreten wird.44
2.3.5Meldung zum Transparenzregister
Seit 2017 besteht für »Vereinigungen« im Sinne des § 20 Abs. 1 S. 1 des Geldwäschegesetzes (GwG) die Pflicht, ihre wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregister zu melden.45 Eingetragene Vereine sind als juristische Personen des Privatrechts Vereinigungen nach § 20 Abs. 1 S. 1 GwG und damit gemäß § 59 Abs. 1 GwG mitteilungspflichtig.
Wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG sind natürliche Personen, die über mehr als 25 % der Kapitalanteile oder der Stimmrechte in juristischen Personen oder eingetragenen Personengesellschaften verfügen oder Kontrolle in vergleichbarer Weise [52]ausüben (§ 3 GwG). Da Vereinsmitglieder keine Kapitalanteile halten, kann wirtschaftlich Berechtigter eines Vereins nur eine natürliche Person sein, die über mehr als 25 % der Stimmrechte in dem Verein verfügt oder auf vergleichbare Weise Kontrolle über den Verein ausübt. Dabei ist es unerheblich, ob die betreffende Person den Tatbestand unmittelbar oder mittelbar verwirklicht. Mittelbare Kontrolle ist gegeben, wenn das Vereinsmitglied, das mehr als 25 % der Stimmen kontrolliert, eine Gesellschaft ist, die ihrerseits von einer natürlichen Person beherrscht wird. Die beherrschende Stellung bei einem Mitgliedsunternehmen kann sich aus der Kapital- oder Stimmenmehrheit oder aus anderen Sachverhalten, wie bspw. einem Beherrschungsvertrag, einer Poolvereinbarung oder auch aus bestimmten Vetorechten ergeben.
Jeder Verein muss klären, ob es bei ihm einen oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte gibt. Der Verein muss die einschlägigen Daten (§ 19 Abs. 1 GwG) des wirtschaftlich Berechtigten einholen, aufbewahren, auf dem aktuellen Stand halten und dem Bundesanzeiger Verlag als registerführender Stelle unverzüglich zur Eintragung in das Transparenzregister mitteilen (§ 20 Abs. 1 GwG).46 Teilt der wirtschaftlich Berechtigte die an das Register zu meldenden Daten nicht von sich aus mit und sind sie dem Verein auch nicht anderweitig bekannt, dann trifft den Verein nach § 20 Abs. 3a GwG eine Nachforschungs- und das Mitglied eine Auskunftspflicht.
In Vereinen kommt ein Stimmanteil von über 25 % nur sehr selten vor. In Betracht kommen neben Vereinen mit nur drei Mitgliedern insbesondere Mehrfachstimmrechte oder Stimmrechtspoolungen. In der Regel hat ein Verein keinen wirtschaftlich Berechtigten. In diesem Fall hat er nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG den sog fiktiv wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu melden. Dies ist der gesetzliche Vertreter; beim Verein also sämtliche Mitglieder des Vorstands i. S. v. § 26 BGB.
Derzeit kommt den Vereinen noch die sog. Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 1 GwG zugute, d. h., die Mitteilung des Vereins an das Transparenzregister kann unterbleiben, wenn sich die relevanten Daten der fiktiv wirtschaftlich Berechtigten (also des Vorstands) aus dem Vereinsregister ergeben. Diese Erleichterung wird zum 01.08.2021 entfallen. Das Transparenzregister wird dadurch zu einem Vollregister ausgebaut, das mittelfristig mit anderen europäischen Transparenzregistern verknüpft werden soll.47 Für den eingetragenen Verein ist eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2023 vorgesehen, bis zu deren Ablauf die Meldung im Transparenzregister zu erfolgen hat. Unterbleibt die Meldung nach Ablauf der Übergangsfrist, droht dem Verein ein Bußgeld.
[53]2.3.6Erlangung der Rechtsfähigkeit
Mit der Feststellung der Satzung und der Bestellung des ersten Vorstands ist der Verein errichtet. Die Rechtsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit als juristische Person selbst Träger von Rechten und Pflichten zu sein, erlangt er jedoch erst mit der Eintragung in das Vereinsregister. Die konstitutive Wirkung der Eintragung gilt selbst dann, wenn der Gründung des Vereins oder dem Registerverfahren schwere Mängel anhaften. Zwischen Gründungsakt und Registereintragung besteht der Verein als sog. Vorverein, bei dem es sich um einen nichtrechtsfähigen Verein handelt.48 Der mit der Eintragung in das Vereinsregister entstehende rechtsfähige Verein ist mit dem Vorverein identisch. Alle Rechte und Pflichten des Vorvereins gehen mit der Registereintragung automatisch auf den eingetragenen Verein über.49 Ist das Vereinsvermögen bei Registereintragung durch vom Vorverein begründete Verbindlichkeiten negativ, ist eine Haftung der Mitglieder für diesen Fehlbetrag umstritten.50 Mit der vorzugswürdigen Meinung haften die Mitglieder eines nicht wirtschaftlich tätigen Vorvereins nicht für dessen Verbindlichkeiten.51 Jedenfalls kann eine Haftung der Mitglieder nicht über deren Anteil am Vereinsvermögen beziehungsweise über die Höhe der fälligen, noch nicht geleisteten baren Beitragszahlungen, hinausgehen.52
In das Vereinsregister werden der Name und der Sitz des Vereins, der Tag der Feststellung der Satzung sowie die Mitglieder des Vorstands eingetragen. Einzutragen ist zudem die Vertretungsmacht der Vorstandsmitglieder.53 Da die Eintragung für den Verein als juristische Person rechtsbegründend ist, wird zudem das Datum der Eintragung auf dem Registerblatt vermerkt.
Der Name, der Sitz des Vereins und der Tag der Eintragung werden in dem von der Landesjustizverwaltung für die Bekanntmachungen des Amtsgerichts bestimmten elektronischen Informations- und Kommunikationssystem bekannt gemacht (§ 66 Abs. 1 BGB). Der Vorstand wird gemäß § 383 Abs. 1 FamFG, § 13 VRV von der Eintragung in Kenntnis gesetzt.
Das Vereinsregister und die vom Verein dort eingereichten Unterlagen kann jedermann bei Gericht kostenfrei einsehen (§ 79 BGB). Die eingetragenen Daten können über das Portal www.handelsregister.de online eingesehen werden.
[54]Mit der Eintragung im Vereinsregister führt der Verein den Namenszusatz »eingetragener Verein« oder »e. V.« (§ 65 BGB). Der Verein ist zur Verwendung dieses Zusatzes verpflichtet. Tritt er im Rechtsverkehr ohne den Zusatz auf, so kann dies nach den Grundsätzen der Rechtsscheinhaftung zu einer persönlichen Haftung der Handelnden führen.54
Die Gerichtskosten für die Eintragung berechnen sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG). Sie sind vom Verein zu tragen. Für die erste Eintragung des Vereins fällt eine Festgebühr von 75 EUR an (§ 55 Abs. 2 GNotKG i. V. m. Nr. 13100 des Kostenverzeichnisses zum GNotKG).
2.4Satzung
Wesentlicher Bestandteil des Gründungsgeschäfts ist die Feststellung der Vereinssatzung. Soll der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden, so ist die schriftliche Abfassung der Satzung zwingend erforderlich (§ 59 Abs. 2 und 3 BGB).
Die grundgesetzlich durch Art. 9 Abs. 1 GG geschützte Vereinsautonomie gibt dem Verein das Recht, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu gestalten sowie sich eine seinen Zwecken entsprechende Organisation zu geben.55 Bei der Ausgestaltung der Satzung genießen die Beteiligten daher sehr weitgehende Gestaltungsfreiheit, denn die meisten vereinsrechtlichen Regelungen des BGB sind dispositiv (§ 40 BGB). Bei der Ausgestaltung gilt es, die Satzung auf die konkreten Bedürfnisse des Berufsverbands, insbesondere seine Mitgliederstruktur, seinen Zweck und sein Betätigungsfeld, abzustimmen.
Zu beachten ist allerdings, dass die §§ 56 bis 598 BGB Vorgaben für den Inhalt der Satzung eines eingetragenen Vereins machen. Danach muss die Satzung zwingend den Vereinszweck, den Namen und den Sitz des Vereins sowie die Feststellung enthalten, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll (§ 57 Abs. 1 BGB). Darüber hinaus »soll« die Satzung nach § 58 BGB Angaben über den Ein- und Austritt der Mitglieder, eine etwaige Beitragspflicht, die Bildung des Vorstands, die Einberufung der Mitgliederversammlung sowie über die Form der Einberufung und die Beurkundung von Mitgliederbeschlüssen enthalten. Die Satzung hat zudem die Angabe des Tages ihrer Errichtung zu enthalten und ist von sieben Mitgliedern zu unterzeichnen (§ 59 Abs. 3 BGB).
Die vom Gesetz getroffene Unterscheidung zwischen dem Mussinhalt (§ 57 BGB) und dem Sollinhalt (§ 58 BGB) der Satzung ist für die Gründung eines Idealvereins ohne Be[55]deutung, denn nach § 60 BGB ist eine Registeranmeldung, die nicht den Anforderungen der §§ 56 bis 59 BGB entspricht, vom Registergericht zurückzuweisen. Es müssen also sowohl die Muss- als auch die Soll-Vorschriften beachtet werden. Die Unterscheidung ist lediglich für bereits eingetragene Vereine relevant, denn nur die Nichtbeachtung einer Muss-Vorschrift führt zur Amtslöschung des Vereins gemäß § 395 FamFG, während ein Verstoß gegen eine Soll-Vorschrift nach erfolgter Registereintragung nicht mehr beanstandet werden kann.
Die Vereinssatzung muss in deutscher Sprache (Hochdeutsch) abgefasst sein.56 Sie ist schriftlich niederzulegen, damit sie unterschrieben werden kann. Eine notarielle Beurkundung oder Beglaubigung ist nicht erforderlich.
Weist die Satzung Regelungslücken oder Unklarheiten auf, so ist sie auszulegen. Sie darf nur nach ihrem objektiven Erklärungswert aus sich heraus und nur einheitlich ausgelegt werden,57 sodass ihrem Wortlaut und Sinnzusammenhang besondere Bedeutung zukommen. Die Auslegung hat sich am Zweck des Vereins und an den Interessen der Mitglieder auszurichten. Auslegungsfähig ist nur das, was in der Satzung erkennbar geregelt ist.58 Umstände außerhalb der Satzung, insbesondere aus der Entstehungsgeschichte, den Motiven der Gründer oder aus der späteren Entwicklung des Vereins dürfen grundsätzlich nicht herangezogen werden, es sei denn, deren Kenntnis kann bei allen Mitgliedern und Organen des Vereins vorausgesetzt werden.59 Sollen die Motive der Gründung oder sonstige Umstände bei der Auslegung Berücksichtigung finden, so empfiehlt es sich, sie in der Satzung in einer Präambel voranzustellen.
Sind einzelne Satzungsbestimmungen nichtig oder undurchführbar, so bleibt die Satzung auch ohne salvatorische Klausel im Übrigen wirksam.60 Etwas anderes gilt nur, wenn der Vereinszweck sitten- oder gesetzeswidrig ist.
Vereinssatzungen unterliegen gemäß §§ 242, 315 BGB der gerichtlichen Inhaltskontrolle.61
[56]2.4.1Name des Vereins
Nach § 57 Abs. 1 BGB muss die Satzung den Namen des Vereins enthalten. Der Name ist die Bezeichnung, unter der der Verein in der Öffentlichkeit auftritt. Die Gründer sind in der Wahl des Vereinsnamens grundsätzlich frei. Die Wahl und das Führen dieses Namens sind Bestandteil der grundgesetzlich geschützten Vereinsfreiheit.62 Oft ist der Name des Vereins an den Vereinszweck angelehnt. Berufsverbände führen üblicherweise im Namen den Bestandteil »Berufsverband«; zwingend ist dies aber nicht. Zulässig ist auch ein Fantasiename. Der Name muss nicht der deutschen Sprache entnommen sein.63 Der Zusatz »eingetragener Verein« bzw. »e. V.« muss jedoch deutsch sein.64 Eine Namensänderung kann nur durch eine Satzungsänderung vorgenommen werden (und wird demzufolge erst mit der Eintragung in das Vereinsregister wirksam).
Der Name des eingetragenen Vereins muss sich von den Namen anderer am selben Ort oder in derselben Gemeinde bestehender eingetragener Vereine deutlich unterscheiden (§ 57 Abs. 2 BGB). Es gilt der Grundsatz der Priorität, d. h., der bereits im Vereinsregister eingetragene Verein ist vorrangig berechtigt, diesen Namen zu führen. Der Name des eingetragenen Vereins genießt den Schutz des § 12 BGB.
Für den Vereinsnamen gilt der Grundsatz der Namenswahrheit. Dieser beinhaltet insbesondere das Irreführungsverbot, d. h. der Vereinsname darf nicht geeignet sein, über die Art, den Zweck, die Größe, die Bedeutung oder über die sonstigen Verhältnisse des Vereins Täuschungen im Rechtsverkehr hervorzurufen. Maßgeblich ist, welche Vorstellungen sich ein durchschnittlicher Angehöriger des betroffenen Verkehrskreises bei verständiger Würdigung machen würde.65 Eine Täuschungsabsicht ist nicht erforderlich. Es gelten entsprechend die zu § 18 Abs. 2 HGB (Firmenwahrheit) entwickelten Grundsätze. Dementsprechend darf der Verein auch nicht mehrere Namen führen.66
Den Namenszusatz »Verband« dürfen sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtlich organisierte Zusammenschlüsse führen. Bei privatrechtlichen Vereinigungen wird diskutiert, unter welchen Voraussetzungen sie sich als Verband bezeichnen können. Mit der Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass die Bezeichnung weder den Eindruck erweckt, der Verein habe eine größere Anzahl von Mitgliedern, noch [57]dass sich in ihm mehrere Vereine zusammengeschlossen hätten.67 Angesichts der inzwischen erreichten Vielzahl auch kleinerer Verbände in allen Bereichen der Gesellschaft spielt die Größe der Vereinigung oder der Zahl ihrer Mitglieder keine Rolle.68
Die Bezeichnung »Fachverband« setzt einen Zusammenschluss von Fachbetrieben oder Fachleuten voraus.69 Die Bezeichnung »Fachverband der Matratzenindustrie« ist auch dann nicht irreführend, wenn der Verein nicht die gesamte Matratzenindustrie repräsentiert.70 Um Irreführungen zu vermeiden, sind ggf. regionale oder fachliche Namenszusätze erforderlich. Eine Dachorganisation kann sich »Gesamtverband«, »Zentralverband« oder »Hauptverband« nennen.71
Der Name des eingetragenen Vereins genießt den Schutz des § 12 BGB.
2.4.2Sitz des Vereins
Gemäß § 57 Abs. 1 BGB muss die Satzung zwingend den Sitz des Vereins nennen. Der Sitz des Vereins ist der Ort, an dem sich seine Verwaltung befindet, es sei denn, in der Satzung ist etwas anderes bestimmt (§ 24 BGB). Zum Vereinssitz kann durch die Satzung grundsätzlich jeder beliebige Ort im Inland (Bundesgebiet) bestimmt werden.72 Der Sitz muss aus dem Vereinsregister ohne Weiteres erkennbar sein, daher sind Bestimmungen, nach denen sich der Sitz bspw. am Wohnort des 1. Vorsitzenden befinden soll, unzulässig.73
Umstritten ist, ob damit auch ein rein fiktiver Sitz zulässig ist, an dem keinerlei Vereinstätigkeit ausgeübt wird. Während manche dies bis zur Grenze des Rechtsmissbrauchs zulassen74, verlangen andere, dass der Verein an seinem Satzungssitz zumindest postalisch erreichbar sein muss.75 Besteht die Vereinsverwaltung an einem anderen Ort als dem in der Satzung angegebenen Sitz, so wird zwischen dem Verwaltungs- und
[58]dem Rechtssitz unterschieden. Der Rechtssitz bestimmt den allgemeinen Gerichtsstand des Vereins und damit auch die Frage, welches Amtsgericht gemäß § 55 BGB für die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister zuständig ist. Der Rechtssitz wird im Vereinsregister eingetragen (§ 64 BGB).
Ein Verein hat nur einen Rechtssitz. Ein statutarischer Doppelsitz ist unzulässig.76
Die Verlegung des Vereinssitzes (Rechtssitzes) kann nur durch eine Satzungsänderung vorgenommen werden und wird demzufolge erst mit der Eintragung in das Vereinsregister wirksam.
2.4.3Absicht zur Eintragung in das Vereinsregister
Gemäß § 57 Abs. 1 BGB muss sich aus der Satzung des Vereins ergeben, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden und damit zum rechtsfähigen Verein werden soll. Ein bestimmter Wortlaut ist nicht vorgeschrieben. Gebräuchliche Formulierungen sind:
»Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.«
»Der Verein erlangt seine Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister.«
»Der Verein ist rechtsfähig gem. § 21 BGB.«
Wird die Satzung nach der Eintragung des Vereins im Vereinsregister geändert, so ist es zulässig, die Bestimmung, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll, wegzulassen; es genügt dann, dass in der neu gefassten Satzung der Vereinsname mit dem inzwischen erworbenen Zusatz »eingetragener Verein« oder »e. V.« angegeben wird.77 Zu empfehlen ist die Formulierung:
»Der Verein ist unter VR … in das Vereinsregister des Amtsgerichts … eingetragen.«





























