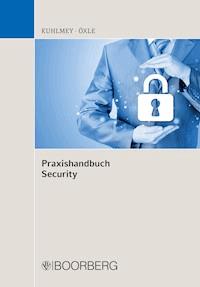
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Richard Boorberg Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Erstes umfassendes Handbuch Das "Praxishandbuch Security" ist das erste umfassende Handbuch für die Aus- und Weiterbildung der Sicherheitsdienste, das alles Wissenswerte zu • Aufgabenfeldern • Einsätzen • Maßnahmen • Meldungen • Daten- und Rechtssicherheit anschaulich erklärt und konkrete Handlungsanweisungen und Entscheidungshilfen gibt. 32 nützliche Checklisten In der Praxis helfen 32 Checklisten unter anderem zu • Arbeitsschutz • Bombendrohungen • Diebstahlanzeige • Streifengang • Verkehrsunfallaufnahme • Brandfall und Notfall • Eigensicherung • Personenbeschreibung • Räumung und Evakuierung • Waffen und Munition bei Fragen und Problemen schnell weiter. Mit Security-Lexikon Das Security-Lexikon - Seculex - erklärt die wichtigsten Begriffe und Definitionen von A wie Abdruckspuren bis Z wie Zuverlässigkeitsprüfung. Besonders empfehlenswert für Mitarbeiter in Sicherheitsdiensten, aber auch für Führungskräfte ohne Sicherheitsausbildung, z.B. Facility Manager und Sicherheitsbeauftragte. Aber auch Mitarbeitern in Berufen mit teilweisem Sicherheitsbezug, z.B. Hausmeistern, Ordnern, Pförtnern, Parkplatzeinweisern und Haushütern, steht mit dem Handbuch ein informatives Nachschlagewerk für Ausbildung und Praxis zur Verfügung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Praxishandbuch Security
Marcel Kuhlmey
Professor für Risiko- und Krisenmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin, Dekan des Fachbereichs Polizei- und Sicherheitsmanagement
Christoph Öxle
Sicherheitsberater und Trainer, Senior Consultant bei einem führenden Dienstleister im Risiko- und Krisenmanagement
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Print ISBN 978-3-415-05192-8 E-ISBN 978-3-415-05546-9
© 2015 Richard Boorberg Verlag
E-Book-Umsetzung: Datagroup int. SRL, Timisoara
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresdenwww.boorberg.de
Vorwort
Die Aufgaben im gewerblichen, betrieblichen und kommunalen Sicherheitsbereich steigen stetig und nehmen in ihrer Komplexität zu. Bis zum heutigen Tage gibt es im Sicherheitsbereich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weder verlässliche, einheitliche Handlungsanweisungen noch detaillierte Hinweise zum kompetenten und zielgerichteten Einschreiten. Gefordert sind kompetente Entscheidungen, gefolgt von der praktischen Fertigkeit, die Maßnahmen ebenso kompetent umzusetzen. Oftmals bleibt nur ein kurzes Zeitfenster zur Umsetzung sinnvoller Maßnahmen.
Mit dem vorliegenden Buch erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sicherheitsbereich praxistaugliche Entscheidungshilfen, Hintergrundinformationen, konkrete Handlungsanweisungen und sofort einsetzbare Checklisten. Einfache Praxistipps sind direkt umsetzbar. Das Buch ist geeignet als ständiger Begleiter im Arbeitsalltag, um den richtigen Hinweis und Rat zu geben. Die einzelnen Kapitel sind ferner optimal zur innerbetrieblichen Weiterbildung und zur Vor- und Nachbereitung von Einsätzen geeignet.
Das Buch berücksichtigt das komplette Spektrum aller Standardmaßnahmen. Dabei stellen die möglichen und zu treffenden Maßnahmen immer eine Auswahl dar, so dass nicht alle Ausführungen abschließend und vollständig sein können. Besonderes Augenmerk liegt auf Bereichen, die in der Praxis häufig zu Problemen führen. Die Erklärungen sind einfach, verständlich und mit anschaulichen Beispielen ergänzt. Da der Umgang mit Fachbegriffen für eine professionelle Arbeit unerlässlich ist, sind im hinteren Teil des Buches wichtige Begriffe einfach und verständlich erklärt.
Die Idee zum Buch entstand bei einer Auditierung. Dabei wollte der Sicherheitsverantwortliche eines Unternehmens zeigen, dass Schutzhunde ständig auf dem Betriebsgelände verfügbar sind. Die Art und Weise, wie in der Sicherheitszentrale per Funk versucht wurde, den Hundeführer in das Sichtfeld einer Überwachungskamera zu lotsen, war nicht erfolgversprechend. Wenn zentrale Grundfertigkeiten, wie die Kommunikation per Funk, fehlen, ist die Diskussion über Sicherheitskonzepte absurd.
In dem nun vorliegenden Buch sind wichtigste Grundlagen einfach erklärt, um grundlegende Maßnahmen professionell umsetzen zu können. Angesprochen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sicherheitsbereich, unabhängig von der jeweiligen Hierachiebene, ebenso auch Personen, die nur am Rande mit Sicherheitsaufgaben betraut sind, wie Pförtner oder Haushüter.
Die Autoren des Buches waren bemüht, den aktuellen Stand auszuwerten und darzulegen. Entscheidungshilfen und Handlungsanweisungen für die Praxis unterliegen jedoch dem stetigen Wandel und leben von ihrer Aktualität. Deshalb sind wir für Verbesserungsvorschläge und Anregungen dankbar, die der Weiterentwicklung des Buches dienen. Gerne nehmen wir diese für weitere Auflagen auf.
Ganz persönlicher Dank gilt Anne Enke, Kathleen Peters, Dirk Stephan, Claus Gerber, Lili Hammler und Hans-Jörn Bury.
Im Juni 2015
Die Autoren
Inhalt
Vorwort
Kapitel A Aufgabenfelder
1. Allgemeines
2. Doorman
3. Ermittlungsdienst
4. Einzelhandel
5. Tor- und Empfangsdienst
6. Interventionsdienst
7. Objektschutz
8. Personenschutz
9. Revier- und Kontrolldienst
10. Schlüsseldienst/Schließdienst
11. Veranstaltungsdienst
12. Werkschutz
13. Geld- und Werttransport
14. Fluggastkontrolle
15. Corporate Security, Compliance, IT-Security
16. Funktionen mit Sicherheitsbezug
Kapitel B Einsatzfälle
1. Dienstanweisungen
1.1 Rechtsstellung des Sicherheitsmitarbeiters
1.2 Allgemeine Dienstanweisung
1.3 Objektbezogene Dienstanweisungen
1.4 Haftung des Sicherheitsunternehmers
2. Alarm
2.1 Vorgehensweise bei Einbruch-Alarmen
2.2 Vorgehensweise bei Überfall-Alarmen
2.3 Vorgehensweise bei Feueralarmen
3. Amoktat
3.1 Anhaltspunkte für eine Amoksituation
3.2 Ablauf einer Amoktat
3.3 Verhaltensweisen während einer Amoktat
4. Arbeitsunfall
5. Bombendrohung
5.1 Androhen von Anschlägen
5.2 Verhalten bei Drohanruf
5.3 Erkennen von USBV (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung)
5.4 Verhalten bei Auffinden sprengstoffverdächtiger Gegenstände
6. Brandschutz
6.1 Die Brandmeldezentrale (BMZ)
6.2 Die optisch-akustische Signalisierung
6.3 Der Feuerwehrschlüsselkasten (FSK)
6.4 Die verschiedenen Brandmelder
7. Dokumentenfälschung
7.1 Fälschungsarten
7.2 Fälschungsmerkmale
7.3 Erkennen von Fälschungen
7.4 Sicherheitsmerkmale des neuen bundesdeutschen Personalausweises
8. Einbruchschutz
9. Erpressungsversuch
9.1 Erstellung des Krisenplans
9.2 Reaktion auf einen Erpressungsversuch
10. Falschgeldverdacht
10.1 Falschgeld erkennen
10.2 Vorgehensweise bei verdächtigem Geld
11. Funkverkehr
11.1 Grundsätze des Funkverkehrs
11.2 Gesprächsbeispiele
11.3 Lautstärke und Verständigung
11.4 Alarm- und Notfallmeldungen
11.5 Kurzmeldungen
11.6 Funktechnik
11.7 Technische Erweiterungen
12. Verbotene Gegenstände und Führen von Waffen
12.1 Taschenmesser
12.2 Schlagstock
12.3 Abwehrsprays
12.4 Verhalten bei der Feststellung von Verstößen
Kapitel C Maßnahmen
1. Absperrung
1.1 Ziel und Anlass der Absperrung
1.2 Grundsätze der Absperrung
1.3 Arten der Absperrung
1.4 Praxistipps
2. Durchsuchung
2.1 Ziel und Anlass der Durchsuchung
2.2 Grundsätze der Durchsuchung
2.3 Praxistipps
2.4 Sonderfall: Sprengstoffverdacht
3. Räumung und Evakuierung
3.1 Ziel und Anlass von Räumung/Evakuierung
3.2 Grundsätze der Räumung/Evakuierung
3.3 Praxistipps
4. Tatortarbeit
4.1 Ziel und Anlass der Tatortarbeit
4.2 Grundsätze
4.3 Praxistipps
5. Befragungen
5.1 Zweck und Ziel von Befragungen
5.2 Fragearten
5.3 Praxishinweise
6. Eigensicherung
6.1 Allgemeines
6.2 Bewährte Verhaltenstipps der Eigensicherung
7. Einweisen
7.1 Menschen Zeichen geben
7.2 Einweisen von Fahrzeugen
7.3 Vorbereiten eines Hubschraubereinsatzes und seine Einweisung
8. Erste Hilfe
8.1 Überblick verschaffen
8.2 Eigensicherung
8.3 Erste Hilfe leisten – medizinisch
8.4 Erste Hilfe leisten – psychologisch
8.5 Praxistipps zur psychologischen Ersten Hilfe
9. Festnahme
9.1 Grundsätzliches Vorgehen bei der Festnahme
9.2 Festnahme in offenbar problemlosen Situationen
9.3 Eigensicherung in einem Raum
9.4 Verfolgung eines Täters
10. Fesselung
10.1 Gefahren beim Fesseln
10.2 Grundsätze des Fesselns
10.3 Metallfesseln
10.4 Einmalhandfesseln
10.5 Klettbandfesseln
10.6 Praxistipps
11. Personen- und Fahrzeugkontrolle
11.1 Ziele und Anlass von Kontrollen
11.2 Adressaten
11.3 Rechtliche Grundlagen
11.4 Grundsätze für Personenkontrollen
11.5 Grundsätze für Fahrzeugkontrollen
12. Löschen
12.1 Maßnahmen
12.2 Löschmittel
12.3 Sonderfall: Brennende Person
12.4 Löschtaktik
12.5 Praxistipps
13. Aufnahme eines Verkehrsunfalls
Kapitel D Informationssicherheit
1. Geheimschutz
1.1 Personeller Geheimschutz
1.2 Arten der Sicherheitsüberprüfung
1.3 Aufbewahrung
2. Sicherheit im Internet
2.1 Sicherheitstipps für Internetnutzer
2.2 Smartphones
2.3 Passwörter
3. Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
4. Grundzüge des Datenschutzrechts
4.1 Anspruch auf Datenschutz
4.2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
4.3 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung (§ 4 BDSG)
4.4 Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 3 a BDSG)
4.5 Beauftragter für den Datenschutz (§ 4 f BDSG)
4.6 Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (§ 6 b BDSG)
Kapitel E Meldungen
1. Fahrzeugbeschreibung
1.1 Insassen
1.2 Kennzeichen
1.3 Fahrzeug
1.4 Praxistipps
2. Fundmeldung
2.1 Auffinden oder Übergabe eines verlorenen Gegenstandes
2.2 Weiterleiten an das Fundbüro
2.3 Aushändigung an den Eigentümer
3. Personenbeschreibung
3.1 Schnelle Personenbeschreibung
3.2 Kategorisierung
3.3 Gesichtsbeschreibung
3.4 Praxistipps
4. Situationsbeschreibung
4.1 Situationsbeschreibung
5. Verlustmeldung
5.1 Inhalte einer Verlustmeldung
5.2 Verlust von amtlichen Ausweisdokumenten
Kapitel F Rechtsgrundlagen
1. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
1.1 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
1.2 DGUV Vorschrift 9 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“
1.3 DGUV Vorschrift 23 „Wach- und Sicherungsdienste“
2. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
2.1 Minderjährige und ihre Verantwortlichkeit (§ 828 BGB)
2.2 Eigentümer, Besitzer und Besitzdiener
2.3 Schadensersatzpflicht
2.4 Rechtfertigungsgründe und Jedermannsrechte
2.5 Schikaneverbot (§ 226 BGB)
3. Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe im StGB
3.1 Notwehr (§ 32 StGB)
3.2 Rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB)
3.3 Entschuldigender Notstand (§ 35 StGB)
4. Vorläufiges Festnahmerecht (§ 127 StPO)
5. Versammlungsrecht
5.1 Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG)
5.2 Rechte und Pflichten des Veranstaltungsleiters
5.3 Pflichten und Eigenschaften der Ordner
5.4 Überblick über das Versammlungsrecht
Kapitel G Gesundheit
1. Drogen und illegale Betäubungsmittel
1.1 Nikotin
1.2 Alkohol
1.3 Cannabis/Marihuana
1.4 Psychostimulanzien
1.5 Ecstasy
1.6 Opiate
1.7 Halluzinogene
1.8 Mischformen
1.9 Neue Formen/Designerdrogen
2. Stress
Checklisten
1. Arbeitsschutz
2. Bombendrohung
3. Diebstahlanzeige
4. Drohbrief
5. Einsatzvorbereitung
6. Einsatzvorbereitung mit Führungsaufgaben
7. Meldungen
8. Risikoanalyse Gebäude
9. Risikoanalyse Personenschutz
10. Streifengang
11. Verkehrsunfallaufnahme
12. Wachbuch
13. Waffenträger im Einsatz
14. Alarmverfolgung
15. Brandfall und Notfall
16. Brandklassen und Löschmittel
17. Dienstanweisung
18. Dienstleistungsnachweis
19. Durchsuchung nach sprengstoffverdächtigen Gegenständen
20. Checkliste Buchstabieralphabet
21. Gefahrenabwehrplan
22. Gefahrgüter und Gefahrstoffe
23. Kontrollen
24. Meldung
25. Fundmeldung
26. Personenbeschreibung
27. Räumung und Evakuierung
28. Sicherheitskonzept für Veranstaltungen
29. Informationsquellen vor Veranstaltungen
30. Veranstaltungsmeldung
31. Verdächtige (Post-)Sendungen
32. Waffen und Munition
Seculex
Stichwortverzeichnis
Autoren und Verlag lehnen jegliche Haftung für allfällige Schäden oder Folgen ab, die sich aus dem Gebrauch oder Missbrauch der hier vorgestellten Informationen ergeben. Insbesondere bei verhaltens-, rechts- und gesundheitsbezogenen Entscheidungen empfehlen wir, grundsätzlich mehrere Informationsquellen zu nutzen und fachkundige Beratung zum Einzelfall einzuholen. Auch bei größter Sorgfalt können einzelne Informationen rechtlich falsch sein oder gesundheitsgefährdende Empfehlungen enthalten.
Kapitel A Aufgabenfelder
1. Allgemeines
In den vergangenen Jahren ist die Bandbreite von Sicherheitsdienstleistungen und somit auch die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich angestiegen.
Im öffentlichen Raum sind weiterhin grundsätzlich die Polizei und das Ordnungsamt für die Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben zuständig. Werden Sicherheitsdienstleister dort z. B. als Citystreife oder Detektive tätig, dürfen sie nur Jedermannsrechte wahrnehmen. Auf Privatbesitz können ihnen weitergehende Rechte zustehen. Einen Auftrag des Besitzers vorausgesetzt, können ihnen als sogenannte Besitzdiener auch nachfolgend beschriebene Aufgaben übertragen werden.
In Bezug auf einige Aufgaben bestehen besondere Regelungen wie beispielsweise für die Fluggastkontrolle. Auch wurden 2013 in der Gewerbeordnung Bestimmungen über die Begleitung von Hochseeschiffen durch Sicherheitsdienstleister ergänzt. Ein Blick auf andere Staaten lässt vermuten, dass in Zukunft weitere Aufgaben hinzukommen werden, hierzu zählt die Begleitung von Schwertransporten, die Verkehrsüberwachung, die Aufnahme von Bagatellunfällen, der Umweltschutz, Feuerwehr, Sanitäts-, Gesundheits- und Rettungsdienste und der Katastrophenschutz. In Teilen Deutschlands gibt es bereits erste Entwicklungen in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr.
2. Doorman
Der Doorman (auch shop guard) wird im Einzelhandel eingesetzt und ist Teil des Sicherheitskonzepts. Er sorgt für die Sicherheit im Geschäft und soll aufgrund seiner diskreten Anwesenheit sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitenden ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Im Rahmen seiner Tätigkeit gehört es auch dazu, Anliegen des Auftraggebers zu erfüllen. Da er jedoch nicht zu dem Verkaufspersonal gehört, muss er keine Beratungs- oder Verkaufsgespräche führen. Sein Auftrag ist der Eigentumsschutz. Sein Auftreten und sein Erscheinungsbild sind die Visitenkarte des Auftraggebers und des eigenen Unternehmens.
Mindestqualifikation:
Der Doorman schützt gewerblich fremdes Eigentum und wird in der Regel mit Ladendetektiven gleichgesetzt. Er muss daher über einen Sachkundenachweis nach § 34a Abs. 1 Satz 6 GewO verfügen.
3. Ermittlungsdienst
Im Rahmen von Ermittlungsdiensten erheben Privatpersonen Beweise – in der Regel für straf- oder zivilrechtliche Verfahren. Ihre Auftraggeber können Privatpersonen oder Unternehmen, aber auch Behörden sein. Im Rahmen ihrer Ermittlungstätigkeit erheben sie Personen- und Sachbeweise, insbesondere durch Nachforschung, Beobachtung, Überwachung, Überprüfung, und sichern diese.
Mindestqualifikation:
Die Bezeichnung Detektiv ist nicht gesetzlich geschützt. Sofern Detektive keine der in § 34a Abs. 1 GewO genannten Aufgaben wahrnehmen, bedürfen sie keiner Erlaubnis. Eine Ausnahme stellt der Kaufhausdetektiv dar, weil er fremdes Eigentum schützt. Dieser muss die Sachkundeprüfung abgelegt haben (siehe unter Einzelhandel).
Zu den Tätigkeitsfeldern der Ermittlungsdienste gehören:
Abwehr von Wirtschaftskriminalität (Lauschangriffe, Sabotage, Know-how-Schutz),
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten wie Untreue, Betrug, Unterschlagung, Diebstahl – auch durch Innentäter,
Personalienfeststellungen/Identitätsüberprüfungen einschließlich Anschriftenermittlung,
Aufklärung von Ehe- und Familienstreitigkeiten,
Sorgerechts- und Unterhaltsangelegenheiten,
Ermittlung von Schuldnern,
Zeugenfeststellungen sowie
Fotodokumentation und Videoüberwachung.
4. Einzelhandel
Im Einzelhandel liegt der Fokus der privaten Sicherheit insbesondere auf dem Bereich des Laden-/Kaufhausdetektives. Ähnlich wie im Rahmen der Ermittlungsdienste besteht seine Aufgabe darin, Personen zu beobachten und zu überwachen. Sofern ein Eigentumsdelikt vorliegt, kann er aufgrund der Jedermannsrechte/Selbsthilferechte eingreifen. Darüber hinaus setzt er für den Auftraggeber das Hausrecht durch.
Mindestqualifikation:
Personen, die im Einzelhandel gewerbsmäßig fremdes Eigentum oder Personen schützen, bedürfen eines Sachkundenachweises nach § 34a Abs. 1 Satz 6 GewO.
5. Tor- und Empfangsdienst
Die Mitarbeiter des Tor- und Empfangsdienstes können je nach Auftrag Einlass- und Zugangskontrollen durchführen, Besucher begrüßen, informieren und im Haus leiten. Hierzu zählen auch die Identitätsprüfung der Besucher sowie deren Anmeldung. In der Regel ist es auch Aufgabe des Empfangsdienstes, die Kommunikationsanlagen zu bedienen, insbesondere den Telefondienst zu übernehmen, und die Anlieferung der Waren zu überwachen.
Im Speziellen obliegt dem Tordienst die Überwachung, Regelung und Kontrolle des gesamten Verkehrs an den Ein- und Ausgängen einer Liegenschaft. Zu dem Verkehr zählen der Personen-, Fahrzeug-, Waren- und Güterverkehr.
Die Tätigkeiten des Tor- und Empfangsdienstes sind zusammenfassend:
Zugangskontrolle von Personen,
Zufahrtskontrolle von Fahrzeugen,
Empfang und Anmeldung von Besuchern,
Dokumentation dieser Ereignisse, inkl. Verwaltung von Berechtigungen und Frachtpapieren,
Bedienung von Schranken.
Mindestqualifikation:
Der Empfangs- und Tordienst dient der Bewachung von Leben und Eigentum des Auftraggebers. Mitarbeiter des Empfangs- und Tordienstes müssen daher einen Unterrichtungsnachweis vorlegen können (§ 34a Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 Nr. 3 GewO).
6. Interventionsdienst
Aufgabe des Interventionsdienstes (auch Alarm- und Interventionsdienst genannt) ist es, rund um die Uhr eingehende Alarme in der Notruf- und Service-Leitstelle nachzuverfolgen und zu kontrollieren. Am Ereignisort überprüft der Interventionsdienst das Objekt, leitet erforderlichenfalls erste Sofortmaßnahmen ein und unterstützt die Polizei.
Mindestqualifikation:
Der Interventionsdienst dient der Bewachung von Leben und Eigentum des Auftraggebers. Mitarbeiter des Interventionsdienstes müssen daher einen Unterrichtungsnachweis vorlegen können (§ 34a Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 Nr. 3 GewO).
7. Objektschutz
Der Objektschutz dient der Abwehr und der Verhinderung von Gefahren, die militärischen oder privaten Objekten selbst sowie den sich darin befindlichen Personen drohen. Dies kann auch den Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Sachen und Informationen umfassen.
Der Objektschutz hat vorwiegend präventiven Charakter. Bei einem Schadensfall soll er das Ausmaß auf ein Minimum reduzieren. Die einzelnen Maßnahmen des Objektschutzes orientieren sich an dem jeweiligen Sicherheitsbedürfnis des Objekts und dem Schutzauftrag. Sie umfassen beispielsweise:
Umfeldmaßnahmen, insbesondere Aufklärung,
Äußere und innere Absperrungen mit Zugangs- und Ausgangskontrollen,
Kontroll- und Streifendienste,
Postendienste,
Pforten- und Empfangsdienste,
Überwachung und Kontrolle von Gefahrenmeldeanlagen,
Dienste in Sicherheits- oder Einsatzzentralen,
Verwaltung der Schließanlage,
Verwaltung des Ausweissystems,
Durchsuchung sowie
Umgang mit technischen Sicherungseinrichtungen, wie z. B. die Bedienung der Alarm- und Videotechnik.
Mindestqualifikation:
Im Rahmen des Objektschutzes wird gewerbsmäßig zumindest Eigentum geschützt, so dass ein Unterrichtungsnachweis vorliegen muss.
8. Personenschutz
Der Personenschutz dient der Abwehr von Angriffen Dritter auf die körperliche Unversehrtheit einer Person (Schutzperson). Zum Personenschutz gehören Tätigkeiten bzw. Fertigkeiten wie beispielsweise
Informationsbeschaffung,
Aufklärung und Observation,
Beobachtung,
Begleitschutz sowie
Umgang mit Einsatzmitteln.
Mindestqualifikation:
Personenschützer müssen rechtlich die Teilnahme am Unterrichtungsverfahren gemäß § 34a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO nachweisen. Da in diesem Unterrichtungsverfahren Personenschutz theoretisch und praktisch nicht unterrichtet wird, sind Mitarbeiter im Personenschutz in der Regel weitergehend ausgebildet.
9. Revier- und Kontrolldienst
Revier- und Kontrolldienst bedeutet die präventive Kontrolle von Objekten sowie deren Umfeldüberwachung. Dies umfasst auch das Erkennen von Bränden, sonstigen Gefahren, Schäden und Störungen sowie ggf. das Treffen erster Gegenmaßnahmen. Die Tätigkeiten des Revier- und Kontrolldienstes sind im Einzelnen:
turnusmäßige Kontrollgänge,
Sonderkontrollgänge im Fall von Meldungen, zum Beispiel bei Einbruchsalarm,
City-Streifen im öffentlichen Raum, um Präsenz zu zeigen,
Beobachten und Melden.
Mindestqualifikation:
Für den Revier- und Kontrolldienst muss die Teilnahme am Unterrichtungsverfahren nach § 34 a GewO nachgewiesen werden. Sofern eine Tätigkeit als Citystreife wahrgenommen wird, gilt dies als Kontrollgang im öffentlichen Raum, so dass ebenso ein Sachkundenachweis nach § 34 a GewO vorliegen muss.
10. Schlüsseldienst/Schließdienst
Der Schlüssel- oder Schließdienst stellt sicher, dass nur autorisierte Personen Zugang zu einem Objekt und Räumen erhalten, während Unbefugten der Zutritt verweigert wird.
Der Dienst ist Teil des Revierdienstes und hat insbesondere folgende Aufgaben:
Bestellen von Schließzylindern und Schlüsseln,
Führung der Schlüsselkartei/-datei und Schlüsselausgabe,
Ausgabe von Schließzylindern,
Führung des Schließplans,
Sichere Aufbewahrung der Schließscheine,
Bearbeitung von Verlustmeldungen (Schlüssel),
Kontrolle des Bestands und des Besitzes von Schlüsseln sowie
Verwaltung von elektronischen Zutrittskontrollsystemen.
Mindestqualifikation:
Für die Wahrnehmung der Tätigkeit muss die Teilnahme am Unterrichtungsverfahren nach § 34 a GewO nachgewiesen worden sein.
11. Veranstaltungsdienst
Der Veranstaltungsdienst soll einen störungsfreien Veranstaltungsablauf gewährleisten sowie die Veranstaltungsteilnehmer und unbeteiligte Dritte schützen. Je nach Art der Veranstaltung (wirtschaftliche, kulturelle, sportliche, kirchliche etc.) können die wahrzunehmenden Tätigkeiten sehr unterschiedlich sein. Beispielhaft sind zu nennen:
Einlasskontrolle und ggf. Überprüfung der mitgeführten Gegenstände,
Kontrolle der Zugangsberechtigung – auch innerhalb des Veranstaltungsgeländes,
Bühnenschutz,
Kassendienst,
Parkplatzbewachung,
Besetzen der Notausgänge,
Freimachen und Freihalten der Not- und Rettungswege,
Schutz der Versorgungseinrichtungen,
Besuchersteuerung,
Intervention im Störungsfall,
Streifentätigkeit im Veranstaltungsbereich und
Schutz von Personen innerhalb der Veranstaltungsstätte.
Mindestqualifikation:
Die Zulassungsvoraussetzungen orientieren sich an der konkret wahrzunehmenden Aufgabe im Veranstaltungsdienst. Keine Bewachungstätigkeit im Sinne des § 34 a GewO liegt bei Hostessendiensten, Kartenabriss im Einlassbereich, Auskunfts- und Informationstätigkeiten, Parkplatzdiensten sowie Bewachungstätigkeiten durch eigene Mitarbeiter vor.
Der Unterrichtungsnachweis nach § 34 a GewO ist hingegen erforderlich für die Wahrnehmung von Tätigkeiten im Einlassbereich, das Besetzen von Notausgängen, im Backstagebereich sowie für Streifen- und Kontrollgänge im Veranstaltungsbereich.
12. Werkschutz
Der Werkschutz ist ein Bestandteil der betrieblichen Gefahrenabwehr und arbeitet mit anderen Organisationseinheiten des Unternehmens zusammen. Er vertritt die Interessen des Unternehmens in Fragen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, der Strafverfolgung sowie der Prävention. Gefahren können beispielsweise ausgehen von bautechnischen Einrichtungen, Produktions- und Betriebsstoffen, Organisationsverschulden, fehlerhaften Verfahren, Fehlverhalten von Menschen, strafbaren Handlungen oder Naturereignissen.
Mindestqualifikation:
Für die Wahrnehmung der Tätigkeit muss die Teilnahme am Unterrichtungsverfahren nach § 34 a GewO nachgewiesen werden.
13. Geld- und Werttransport
Geld- und Werttransporteure sind für die auftragsgemäße und sichere Übernahme und Übergabe von Geld und sonstigen Werten verantwortlich. Hierzu gehört auch die Geldautomatenbefüllung und Geldkommissionierung für Kunden. In der Regel werden speziell gesicherte und/oder gepanzerte Werttransportfahrzeuge eingesetzt.
Mindestqualifikation:
Für die Wahrnehmung der Tätigkeit muss der Nachweis der Teilnahme am Unterrichtungsverfahren nach § 34 a GewO vorliegen.
14. Fluggastkontrolle
Die Fluggastkontrolle ist nach § 5 Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) zulässig, wenn der Sicherheitsbereich eines Flughafens von Dritten betreten wird. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundespolizei, die diese Aufgabe in der Regel privaten Sicherheitsdienstleistern überträgt. Im Rahmen dieser Aufgabe führen die Luftsicherheitsassistenten beispielsweise folgende Tätigkeiten aus:
Personenkontrolle inkl. Leibesvisitationen,
Gepäckkontrolle sowie
Bedienung von Röntgenkontrollgeräten.
Mindestqualifikation:
Die Sicherheitsmitarbeiter bedürfen eines Sachkundenachweises nach § 34 a GewO. Darüber hinaus müssen sie eine Prüfung nach § 5 LufSiG erfolgreich abgelegt haben.
15. Corporate Security, Compliance, IT-Security
Zuvor genannte Aufgabenfelder zählen im Unternehmensumfeld zu Arbeitsfeldern mit physischem Aufgabencharakter, z. B. Überwachung von „Diebstahl“ und „Zutritt“. IT-Security ist ein Aufgabengebiet der IT (Informationstechnologie). Corporate Security und Compliance sind dagegen Fachabteilungen in meist größeren Unternehmensstrukturen. Im Aufgabengebiet Compliance werden Aufgaben wie z. B. Korruption und Geheimnisverrat bearbeitet. Im Feld der Corporate Security werden z. B. strategische Sicherheitsentscheidungen getroffen, z. B. ob und wie die Wertschöpfungskette gegen Störungen durch Kriminalität und Unfälle gesichert wird.
Dezentrale Sicherheitsstrukturen in Unternehmen erfordern zwischen allen Sicherheitsverantwortlichen Kommunikation untereinander, zur Lagebewertung und zum Erkennen konzertierter Angriffe.
Mindestqualifikation:
Es steht den Unternehmen frei, die Stellen mit geeignetem Personal zu besetzen. Im Bereich Corporate Security und Compliance sind juristische, kaufmännische und kriminalistische Qualifikationen gefragt, in der IT-Security IT-Kenntnisse.
16. Funktionen mit Sicherheitsbezug
Nahezu alle beruflichen Tätigkeiten haben einen Sicherheitsbezug. Viele Tätigkeiten weisen einen starken Sicherheitsbezug auf, hierzu zählen beispielsweise
Parkplatzeinweiser
Haushüter
Hausmeister
Kassierer, insbesondere alleine arbeitende Kassierer z. B. in einer Tankstelle
Pförtner und Nachtportiers
Ordner
Was diese Tätigkeiten vereint, ist der Umstand, dass die Auftrag- bzw. Arbeitgeber Sicherheitsaufgaben explizit an diese Mitarbeiter delegieren, z. B. Überwachungsaufgaben und Ausübung des Hausrechts. Dieses Buch richtet sich nicht nur an Sicherheitspersonal, sondern auch an eben genanntes Personal, das nur zum Teil Aufgaben mit Sicherheitsbezug wahrnimmt.
Mindestqualifikation:
Für die hier genannten Tätigkeiten schreibt der Gesetzgeber keinerlei Mindestqualifikationen vor. Ein Graubereich besteht bei Parkplatzeinweisern und Haushütern, da Auftraggeber die wahrzunehmenden Sicherheitsaufgaben bewusst schwächer darstellen können, um die verpflichtende Unterrichtung nach § 34a Gewerbeordnung zu umgehen. Gerichte haben entschieden, dass die Unterrichtung nach § 34 a Gewerbeordnung erst erforderlich ist, wenn für externe Dienstleister die Sicherheitsaufgaben die Hauptleistungen für externe Dienstleister darstellen.
Sicherheitsmitarbeiter im Angestelltenverhältnis des Objektbetreibers brauchen nach aktueller Rechtslage keine Mindestqualifikation, auch wenn die Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben deren Hauptleistung ist.
Kapitel B Einsatzfälle
1. Dienstanweisungen
Der Besitzer oder Eigentümer eines Objektes schließt mit dem Sicherheitsunternehmer einen Werkvertrag über die Bewachung seines Objektes. Grundsätzlich ist der Besitzer/Eigentümer den Mitarbeitern des Sicherheitsunternehmers gegenüber nicht direkt weisungsbefugt. Ausnahmen dazu sind die Anweisungen zu Handlungen in Not- und Katastrophenfällen, die auf einer anderen Rechtsgrundlage beruhen (z. B. Landesfeuerwehrgesetze).
Ein wichtiger und auch rechtlich geforderter Bestandteil der Bewachung sind die . Sie sind vom Auftragnehmer – also vom Sicherheitsunternehmer – zu erstellen und werden dem Sicherheitsmitarbeiter (dieser Begriff bezieht sich auf männliche und weibliche Mitarbeiter/-innen) von seinem Arbeitgeber ausgehändigt. Im Separatwachdienst hat sich die Aufteilung in eine und eine bewährt. Besteht ein Leistungsverzeichnis zum Bewachungsvertrag, so ist die objektbezogene Dienstanweisung die der darin geforderten . Wenn kein Leistungsverzeichnis vorhanden ist, beschreibt der objektbezogene Teil der Dienstanweisungen die vom Sicherheitsunternehmer zu erbringenden Leistungen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























