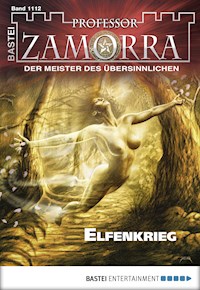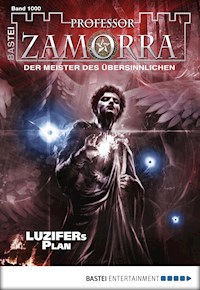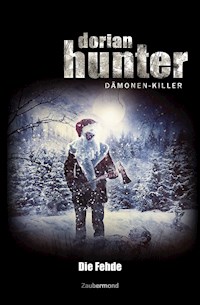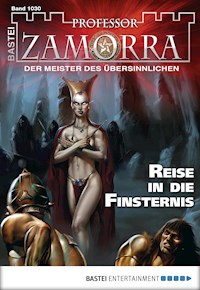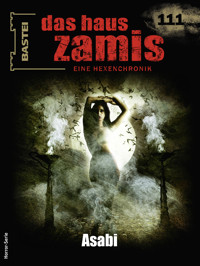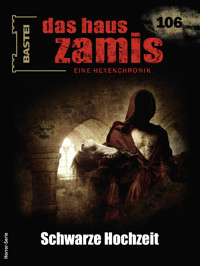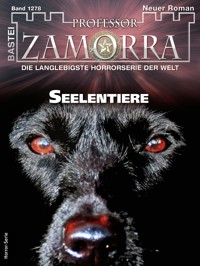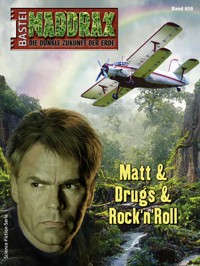1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Schwester Irene betrat den Innenhof des Wohngebäudes. Der Vollmond stand groß und rund über den Gebäuden. Obwohl seit Tagen im ganzen Vatikan gemunkelt wurde, dass ein geheimnisvoller riesiger Schatten für die Morde an den beiden Kardinälen verantwortlich war, verspürte sie keinerlei Angst. Mitten im Hof blieb sie plötzlich stehen. Der Schatten erschien aus dem Nichts. Er huschte über die Hauswand vor ihr und besaß enorme Ausmaße. Bevor Schwester Irene auch nur ein Wort sagen konnte, hüllte der Schatten sie ein. Und tötete sie. Das Brüllen gepeinigter Seelen war das Letzte, was sie in ihrem Leben vernahm ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Vatikan muss sterben
Leserseite
Vorschau
Impressum
Der Vatikanmuss sterben
von Christian Schwarz
Schwester Irene betrat den Innenhof des Wohngebäudes bei den Kasernen der Schweizergarde. Der Vollmond stand groß und rund über den Gebäuden und schickte sein silbernes Licht durch die Engelsfiguren auf dem Dachfirst in das kopfsteingepflasterte Quadrat. Obwohl seit Tagen im ganzen Vatikan gemunkelt wurde, dass ein geheimnisvoller riesiger Schatten für die Morde an den beiden Kardinälen verantwortlich war, verspürte sie keinerlei Angst.
Doch schon im nächsten Moment sollte sich das ändern!
Mitten im Hof blieb sie plötzlich stehen. Hatte sich da nicht gerade etwas bewegt? Nein. Sie atmete auf.
Der Schatten erschien aus dem Nichts. Er huschte über die Hauswand vor ihr und besaß enorme Ausmaße. Bevor Schwester Irene auch nur ein Wort sagen konnte, hüllte der Schatten sie ein. Und tötete sie. Das Brüllen gepeinigter Seelen war das Letzte, was sie in ihrem Leben vernahm.
Aguascalientes, Mexiko
Der Tag der Toten ging in seine Endphase. Die Dunkelheit war längst hereingebrochen. Aus ihr heraus erschien die etwa vierzigjährige hübsche Frau in Jeans und bunter Bluse am oberen Ende der Treppe. Langsam ging sie hinunter. Eine Reihe brennender Kerzen entlang des Geländers tauchte das Treppenhaus in geheimnisvoll flackerndes, warmes Licht. Am unteren Ende stand ein Ofrenda, einer der traditionellen Totenaltäre, die am Tag der Toten in beinahe jedem Haus aufgestellt wurden. Das große Porträtfoto einer lachenden Frau nahm die Mitte ein. Sie ähnelte der Herabschreitenden aufs Haar. Die geheimnisvolle Fremde schaute auf das Foto und kicherte hämisch.
Fröhliches Lachen ertönte. Die Frau öffnete die Tür, hinter der es aufklang, und ging in den Raum hinein.
Hector de la Cruz, seine beiden Söhne und deren Frauen saßen um einen reich gedeckten Tisch und unterhielten sich. Vier Enkelkinder spielten lachend und schreiend zu Füßen der Calavera, einem lebensgroßen Skelett aus Pappmaché, das mit Frauenkleidern und Schmuck behängt war. Einer der Söhne sah die Frau zuerst. Sein Gesicht erstarrte. »M-Mama?«, presste er hervor.
Die anderen Köpfe drehten sich. Schlagartig war es totenstill. Selbst die Kinder erstarrten.
Die Frau lächelte. »Die Reise aus dem Reich der Toten hierher war wirklich lang. Jetzt aber freue ich mich, euch alle gesund und munter wiederzusehen. Darf ich mich zu euch setzen, um die paar Stunden, die mir noch auf Erden bleiben, mit euch zu feiern?«
Hector de la Cruz, ein mittelgroßer Mann mit mächtigem Bauch und imposantem Schnauzbart, war so weiß wie eine gekalkte Wand geworden. Jetzt aber fuhr er von seinem Stuhl hoch. »Was soll der Mist!«, brüllte er mit plötzlich hochrotem Kopf. »Ich finde das gar nicht lustig. Meine liebe Lupita ist seit zwei Jahren verschollen, ich trauere noch immer um sie, und da wagst du es, einfach in ihrer Maske hier aufzutauchen? Wer bist du überhaupt? Für diesen miesen Scherz werde ich dich grün und blau prügeln.«
»Ich bin es tatsächlich, deine Lupita«, erwiderte die Frau mit leiser Stimme und höhnischem Lächeln. »Ich wollte dich noch einmal sehen, weil wir beide noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen haben. Nur deswegen habe ich den weiten Weg aus dem Jenseits auf mich genommen.«
Für einen Moment wurde der Mann unsicher. Dann ballte er wütend die Fäuste. »Red hier keinen Mist. Es gibt keine Geister, die aus dem Jenseits zurückkommen und mit den Lebenden feiern. Hältst du mich für bescheuert, oder was? Dir werde ich's zeigen.« Mit verzerrtem Gesicht stapfte er auf die Frau zu. Als er gerade zuschlagen wollte, verschwand sie vor seinen Augen. Und tauchte am anderen Ende des Zimmers wieder auf. »Und jetzt?«, fragte sie.
Die Kinder schrien entsetzt. Die Erwachsenen waren stumm vor Grauen.
»Euer Vater ist ein gemeiner Mörder«, fuhr die Frau fort, nachdem sie die Kinder mit einer Handbewegung zum Schweigen gebracht hatte. »Die Geschichte, dass ich ein Opfer der Drogenmafia geworden bin, ist eine Lüge. Er selbst hat mich in die Wüste entführt und dort erschossen, weil er frei für seine Geliebte sein wollte.«
Hector de la Cruz fing wie Espenlaub zu zittern an.
»Das ... ist nicht wahr«, stieß er gurgelnd hervor.
»Deine Geliebte heißt Rosa und wohnt in einem Apartment an der Plaza de las tres Centurias«, erwiderte die Frau. »Du wirst noch heute Abend zur Polizei gehen und dich selbst anzeigen, Hector, ist das klar? Und du wirst das Gewehr mitnehmen, mit dem du mich ermordet und das du in einer verlassenen Lagerhalle in Loma Bonita versteckt hast. Wenn du es nicht tust, schicke ich am nächsten Tag der Toten einen guten Bekannten vorbei, der sich deine Seele holen wird.«
Für einen Moment verwandelte sich der Kopf der Frau in eine hässliche Teufelsfratze mit riesigen Hörnern und glutroten Augen, in denen Spiralen rotierten. Dann verschwand sie aus dem Raum.
Direkt vor dem Totenaltar fiel Asmodis wieder aus der Paraspur. In seiner wahren Gestalt lauschte er noch einen Moment lang dem unbeschreiblichen Geschrei, das aus dem Zimmer drang. Seit er sich langsam vom Dämon zum Menschen wandelte, verspürte er immer mal wieder den Drang, Gutes zu tun, indem er zum Beispiel nicht entdeckte Mörder überführte. Und da er kleine Schauspiele liebte, erschien ihm der Tag der Toten als überaus passende Kulisse dafür.
»Und jetzt zum nächsten.« Asmodis kicherte. In Tuxtepec wartete ein Ehepaar auf ihn, das seinen kleinen Sohn immer wieder einem Pädophilenring zur Verfügung gestellt hatte. Bei einem dieser grausamen Verbrechen war das Kind gestorben und wie Müll entsorgt worden. Bis heute behaupteten die Eltern, ihr Junge sei entführt worden. Auch sie würden für ihre Taten geradestehen müssen.
Asmodis drehte sich drei Mal blitzschnell um seine Längsachse und fiel in Tuxtepec aus der Paraspur. In diesem Moment erstarrte er. Ein magischer Impuls erreichte ihn.
Etwas erwachte.
Etwas, das das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse durcheinanderbringen konnte.
Es gefiel Asmodis nicht. »Die Pädophilen müssen warten, das hier ist ungleich wichtiger«, murmelte er.
Und sprang nach Italien.
Rom, im Jahre des Herrn 1044
Wutentbrannt eilte Papst Benedikt der Neunte durch die langen düsteren Verliesgänge des Apostolischen Palastes. Feuchte und Kälte hatten hier, tief unter der Erde, schon seit vielen Jahrhunderten das Regiment übernommen. Rußige Fackeln an den Wänden tauchten die unbehauenen Steinquader in ein geheimnisvolles flackerndes Licht und ließen den Gang vor ihm wie das Tor zur Hölle erscheinen.
Er bog in den Gang ab, in dem links die Zellen für Brandstifter und Verleumder lagen. Die Schreie, die er schon seit geraumer Zeit vernahm, wurden lauter, nun hörte er auch das Gewimmer der frisch Gefolterten. Aus der rechts liegenden Folterkammer stolperte einer der tumben Folterknechte, ein verwachsener Kretin in stinkender Lederkleidung. In den mächtigen Pranken hielt der Mann eine neunschwänzige, mit Widerhaken besetzte Peitsche.
»Was schreist du Drecksack hier ...?«, brüllte er mit seltsam hoher Stimme, unterbrach sich aber abrupt, als er den hohen Gast sah, der ihm hier unten seine Aufwartung machte. »Eure Heiligkeit«, murmelte er und deutete eine Verbeugung an. Da Benedikt hier unten durchaus kein seltener Gast war, hielt sich die Überraschung des Folterknechts in Grenzen.
»Folge mir«, herrschte der Papst den Kerl an, der seiner Meinung nach auch im Pandämonium eine gute Figur abgegeben hätte. Er eilte humpelnd hinter dem Papst her, vorbei am Henkerstübchen und durch den Brunnenraum in den Gang, in dem die Zellen für die speziellen Gefangenen lagen. Benedikt baute sich vor der hintersten Tür auf. »Los, aufmachen«, befahl er.
Der Folterknecht hob den hölzernen Riegel aus der Angel und drückte die schwere quietschende Holztür auf. Mit einer Fackel in der Hand betrat er die Zelle. An der hinteren Wand hing mit ausgestreckten Armen ein nackter Gefangener an zwei Eisenringen. Seine Beine erreichten kaum das schmutzige Stroh. Obwohl er schwach wirkte, musterte er die Eindringlinge mit hasserfüllten brennenden Blicken. Matteo Colombo. Er war ein Vampir, wie nahezu die ganze Colombo-Sippe. Eine am Hals fixierte zweiseitige Gabel, deren Spitzen in Kinn und Brustbein steckten, und die mit unsichtbaren magischen Zeichen bedeckt war, bannte den Blutsauger nicht nur, sie schwächte ihn auch zusehends.
Colombo stieß ein grässliches Stöhnen aus. »Und ich dachte schon, du willst mich hier unten tatsächlich verrecken lassen, Tusculaner«, flüsterte er mit einer Stimme, die Benedikt an einen Raben erinnerte. »Du kommst sicher, um mich freizulassen. Hast du deinen Fehler ... endlich eingesehen?«
»Ich lasse dich gehen, wenn du mir endlich sagst, wer hinter dem Aufstand gegen mich steckt, Colombo«, zischte Benedikt voller Wut. »Ich bin mir sicher, dass die Oktavianer dahinterstecken, unterstützt von euch Colombos. Eure Sippen sind ja schon lange verbündet. Und die Oktavianer haben bereits ganz offen meine Ernennung zum Papst zu hintertreiben versucht. Ich weiß es genau. Aber ich will es aus deinem Munde hören.«
Benedikt riss dem Folterknecht die Fackel aus der Hand, trat damit zwei Schritte auf Colombo zu und stach mit der Fackel in seine Richtung. Der Vampir riss die Augen panisch auf und versuchte den Kopf aus der Reichweite des Feuers zu drehen. »Lass das«, krächzte der Langzahn. »Du tust mir ... unrecht. Es gibt keinen ... keinen Aufstand gegen dich.«
»Ach nein?«, höhnte Benedikt. »Seit Tagen zieht der Mob durch Roms Straßen und fordert ganz offen meine Absetzung. Die Römer nennen mich einen Lüstling und Mörder, sie werfen mir das Feiern ausschweifender Orgien vor und, was schwerer wiegt, Simonie. Auch sagen sie, ich würde nachts mit dem Teufel kommunizieren.«
»Und? Tust du das nicht?«, fragte Colombo mit seinerseits höhnischem Unterton in der Stimme.
Der Folterknecht stieß entsetzte Schreie aus und wollte dem Gefangenen an den Kragen. Benedikt hielt ihn mit einer herrischen Handbewegung zurück. »Auch die meisten römischen Adelsfamilien fordern zwischenzeitlich meine Abdankung. Das weißt du genau.«
»Das träumst du nur«, stieß Colombo hastig hervor.
»Hältst du mich für schwachsinnig?«, brüllte Benedikt ihn an. »Wenn du jetzt nicht gestehst, bist du tot.«
»Es gibt nichts zu gestehen.«
»Dann bring ihn in die Folterkammer, Knecht. Pass aber auf, dass seine Halsgabel dabei nicht verrutscht.«
Der Verwachsene schleppte den geschwächten Vampir in die Folterkammer. Dort stand, neben einem Spanischen Esel, einem Streckrahmen und zahlreichen weiteren Folterinstrumenten, auch ein Judasgerüst. Benedikt hatte dafür gesorgt, dass die eiserne Pyramide, auf die sich die Opfer nackt setzen mussten und dann mit Stricken nach unten gezogen wurden, um den Anus zu spreizen, durch eine Pyramide aus purem Silber ersetzt worden war. Colombo kreischte entsetzt, als er das sah und versuchte sich aus dem eisernen Griff des Folterknechts zu winden. Vergeblich. Aus lauter Verzweiflung zog er die Lippen zurück und präsentierte seine Vampirzähne.
»Jesum Christum!«, kreischte der Verwachsene, stieß Colombo zu Boden, wich zurück, bekreuzigte sich mehrmals und begann den Rosenkranz zu beten.
Der Vampir verzog das Gesicht, Kreuze und Rosenkränze bereiteten ihm zusätzliche Schmerzen.
»Hab keine Angst vor ihm, ich bin bei dir«, beruhigte Benedikt den Folterknecht. »Setze ihn nun auf das Judasgerüst. Ja, er ist ein grausamer, stinkender Dämon, ein Vampir, dem wir hier und jetzt den Garaus machen werden.«
»Ach ja?« Die Todesangst ließ Colombos Stimme noch einmal zu einem Brüllen anschwellen. »Ich bin nicht das einzige Schwarzblut hier im Raum. Der hier ... der vorgibt, Papst zu sein, ist in Wirklichkeit ein Hexer!«
Zitternd starrte der Verwachsene Benedikt an.
Der zog langsam etwas unter seiner Soutane hervor.
Ein goldenes Kreuz!
Benedikt fasste es am unteren Ende und hielt es dem Vampir entgegen.
Colombo quollen fast die Augen über. »Das ... das ist unmöglich. Du kannst kein Kreuz halten, du bist ein Hexer«, stieß er hervor. Dabei bedeckte er die Augen halb mit dem Unterarm.
Der Papst wandte sich an den Folterknecht. »Du siehst, dass mich der Vampir zu Unrecht der Hexerei beschuldigt. Damit hat er endgültig jedes Lebensrecht verwirkt. Wenn man seine schäbige Existenz überhaupt Leben nennen kann.« Blitzschnell beugte sich Benedikt über den Vampir und presste ihm das goldene Kreuz auf die Stirn. Es begann zu zischen, als es sich in das Fleisch hineinbrannte. Colombo stieß ein unmenschliches Gebrüll aus, zuckte wild und verdrehte die Augen.
Immer tiefer brannte sich das Kreuz in den Schädel hinein. Die Stelle begann zu rauchen. Plötzlich schlugen helle Flammen aus dem Schädel. Sie fraßen sich blitzschnell über den gesamten Körper und vernichteten ihn. Für einen Moment schien Colombos Skelett durch die Flammen, vor allem der Totenschädel mit den zwei gewaltigen Eckzähnen im Oberkiefer, dann war es auch schon vorbei. Das Brüllen brach abrupt ab, die Asche des Getöteten rieselte zu Boden.
»Ihr seid ein großer Papst, Eure Heiligkeit«, murmelte der entsetzte Folterknecht. »Ihr habt gerade Satan besiegt.«
Bereits am nächsten Tag machten Benedikts Gegner Ernst. Gedungene Mörder wollten ihn vor dem Petersdom töten. Doch das Schicksal griff zu seinen Gunsten ein und ließ sie entsetzt fliehen. Trotzdem war dies das Zeichen für den Mob, nun ganz offen gegen den Apostolischen Palast zu marschieren, um Benedikt zur Abdankung zu zwingen. Er sah sehr wohl die Oktavier in deren Reihen, auch wenn sie sich zu verstecken versuchten.
Mit Fackeln und Kreuzen klopften sie gegen die Tore des Palastes und brüllten dabei. Der Papst wusste, dass er diese Situation auch nicht mehr mit seinen Zauberkräften beeinflussen konnte. So entfloh er durch weitläufige Geheimgänge und ging nach Venedig. Der Doge von Venedig, Domenico der Erste Contarini, war zwar kein Verbündeter der Tusculaner, Benedikt aber noch mehrere Gefallen schuldig.
Dort würde er zunächst Asyl finden.
Château Montagne, Frankreich
Professor Zamorra musste noch eine Vorlesung vorbereiten, verspürte aber so viel Lust darauf wie ein Werwolf auf die Silberkugel. Im Moment schaute er lieber durch die rundumlaufende Panoramascheibe seines Arbeitszimmers im Nordturm. Die Sonne tauchte die Umgebung in ein warmes Licht und machte Château Montagne zu einem Hort des Friedens.
Nicole lag leicht geschürzt am Swimming Pool und blätterte in einem Modemagazin. Malteser-Joe sägte gerade Bretter auf dem Vorplatz zu, weil er versprochen hatte, eine uralte Tür, die den jahrhundertelangen Kampf gegen den Holzwurm endgültig verloren hatte, zu reparieren. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper und im Schweiße seines Angesichts. Ansonsten sah Zamorra nur noch Butler Thomas, der Joe gerade etwas zu trinken brachte. Seit ein Gutteil der zuletzt zahlreichen Bewohner das Château verlassen hatte, war es wieder stiller geworden.
Trotz seiner Unlust war es aber nicht der Müßiggang, der Zamorra nach draußen starren ließ. Der Meister des Übersinnlichen platzte fast vor Spannung. Er fragte sich schon seit zwei Tagen, was wohl ein leibhaftiger Kardinal samt Gefolge von ihm wollte. Laut Ankündigung würde der demnächst hier auftauchen. Und tatsächlich: Auf der gewundenen Landstraße, die ein Stück die Loire entlangführte und dann anfing, sich in Serpentinen zum Château hoch zu schlängeln, erschien ein schwarzes Auto. Gemächlich zockelte es vor sich hin.
Der Professor ging nach unten und informierte Nicole. »Du solltest dich umgehend züchtig bekleiden«, schob er grinsend hinterher. »Ansonsten kommt unser Besuch noch auf den Gedanken, hier herrsche Sodom und Gonorrhöe.«
»Das heißt doch Sodom und Zamorra, du Dummerchen«, gab Nicole zurück und erhob sich geschmeidig. »Aber du hast recht, chéri. Wir müssen es nicht herausfordern. Sonst werden wir womöglich noch exkommuniziert.« Sie gab ihm einen Kuss und schlüpfte in Hose und Bluse.
Zehn Minuten später rumpelte der schwarze Lada über die Zugbrücke und hielt inmitten des Burghofs. Zamorra und Nicole standen an der Eingangstür zum Haupthaus und beobachteten, nachdem sie Joe gezwungen hatten, in sein Hemd zu schlüpfen, wie dem Auto in würdevoller Umständlichkeit vier schwarz gewandete Herren entstiegen.
»Mensch, chéri, den mit den Hängebacken und dem roten Käppchen kenn ich«, entfuhr es Nicole verblüfft. »Den habe ich neulich im Fernsehen gesehen. Du doch auch. Erinnerst du dich?«
»Äh, nun, nicht wirklich.«
»Halt dich fest. Das ist Kardinalstaatssekretär Brambilla. Mit Vornamen heißt er wie irgendetwas zum Naschen. Nein, nicht die süße Nici. Raffaello, glaube ich.«
Zamorra pfiff leise durch die Zähne. »Der Kardinalstaatssekretär? Das ist der zweitmächtigste Mann im Kirchenstaat.«
»Du bist ja doch noch nicht ganz dement. Das heißt, dass uns soeben der Stellvertreter des Papstes besucht. Atemberaubend.«
Die hohen geistlichen Herren kamen näher. Brambilla schüttelte den Dämonenjägern lächelnd die Hand und übernahm die Vorstellung. Bei seinen Begleitern handelte es sich um Brambillas Sekretär, den deutschen Jesuitenpater Carol Kolmesch, einen sehr gut aussehenden, großgewachsenen, muskulösen Mann mit langen schwarzen Locken, Bischof Pedro Echavez sowie Pater Arthur Mirambo aus dem Kongo. Letzterer arbeitete für Radio Vatikan.
»Und wer ist dieses schwer arbeitende Schäflein dort drüben?«, fragte Kardinal Raffaello Brambilla gütig. »Darf ich den Mann ebenfalls begrüßen, Herr Professor? Ich würde mir auch gerne seine Arbeit ansehen, immerhin war ich in meinem früheren Leben ebenfalls Schreiner und mache das auch heute noch immer mal wieder zu meiner Erbauung.«
»Natürlich. Kommen Sie, Eminenz.« Die Dämonenjäger begleiteten die Gruppe zu Malteser-Joe. »Ich darf Ihnen Gerard Fronton vorstellen, Eminenz«, sagte Zamorra.
»Papperlapapp«, erwiderte Joe und grinste breit. »Alle sagen Malteser-Joe zu mir. Ich weiß eigentlich schon gar nicht mehr, dass ich Gerard Fronton heiße. Sagen Sie also auch Malteser-Joe zu mir, Eure Hoheit.« Er schüttelte die Hand des Kardinalstaatssekretärs, als wollte er sie ihm herausreißen.
Der hielt dagegen und verblüffte Malteser-Joe damit. »Ich würde Eminenz bevorzugen«, erwiderte Brambilla. »Aber nur, wenn's Ihnen nichts ausmacht, Herr Malteser-Joe.« Er sprach ein ausgezeichnetes Französisch mit nur leichtem Akzent.
Zamorra beschloss, das seltsame Gespräch noch ein wenig laufen zu lassen.
»Aber nicht doch«, erwiderte Joe grinsend. »Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. So sagt man doch in Ihren Kreisen, glaube ich. Hm. Sie müssen wirklich ein Mann von starkem Glauben sein, Eminenz. Ich meine, es gehört schon einiges dazu, zu glauben, dass dieser Rostkübel hier noch mehr als zwei Kilometer fährt.«
Brambilla lächelte noch eine Spur gütiger. »Ein inniges Gebet bewirkt viel. In absolut jeder Beziehung. Sie scheinen ja ein großer Witzbold zu sein, Herr Malteser-Joe. Das gefällt mir.«