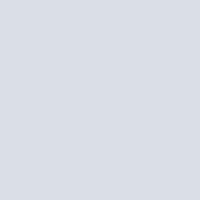9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Konzerne sind immer wieder in Menschenrechtsverletzungen verwickelt, auch deutsche. Sie profitieren von der Ausbeutung der Arbeiter in Textilfabriken in Asien, in Kohlegruben in Südafrika oder beim Bau fragwürdiger Staudammprojekte in Kolumbien. Soziale Errungenschaften sind vergänglich, das erfahren Beschäftigte zuhauf, auch bei uns. Werkverträge, Arbeit auf Abruf und digitale Tagelöhner zeigen, dass Arbeit immer weniger wert ist. Und die Digitalisierung der Wirtschaft wird den Wettbewerb der Beschäftigten um bezahlte Arbeit drastisch verschärfen. Um weniger Jobs werden mehr Menschen konkurrieren. Wenn wir uns nicht wehren, werden Konzerne die Menschenrechte noch öfter mit Füßen treten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
CoverTitelImpressumEinleitungKapitel 1: Wie wir arbeitenTatort TextilfabrikSchlachthaus KaribikEin kurzer Glücksmoment: Schwedische TraumfabrikArbeiten bis zum UmfallenDer Wert der Arbeit: Eine schwierige FrageWenn Arbeitgeberträume wahr werden: Stundenlöhner in EnglandAusbeutung in der deutschen ProvinzOrganisierte VerantwortungslosigkeitSklavenarbeit für FertiggerichteMaschinen ersetzen MenschenTaylorisierung der KopfarbeitDigitale TagelöhnerLuxusgut NormalarbeitsverhältnisKapitel 2: Der Aufstieg der KonzerneAngst bei AmazonGoldene GigantenDas Gesetz des DschungelsMoralhindernis MarktDas Diktat der FinanzkennzifferSchrott vergolden: Schiffe abwrackenAlte Privilegien und neue SonderrechteGeschichte wiederholt sichCorporate Social Responsibility: Schein statt SeinArbeiten für Aktionäre im KnastSinnvolle Jobs verhindernBananenrepublikenGesetze aus KonzernfedernKapitel 3: GewerkschaftenKleine Siege und große NiederlagenWenn die Macht die Seite wechseltTeile und herrscheAnkunft in der GesellschaftSchleichendes Gift für SolidaritätGefährliche GewerkschaftsarbeitArbeiterrechte aushebelnGegenwind in EuropaFügsame Gewerkschaften schaffenGeheimkommando BetriebsratsgründungOffensive mit OrganizernBetriebe kapernKapitel 4: NGOsDer erste große Erfolg: Abschaffung der SklavereiDie Idee der MenschenrechteHelfer für BeschäftigteDer Kampf für MindestlöhneKonzernkritikKonzerne verklagen: Shell, Trafigura und KiKVerkaufsalternativen schaffen: Der faire HandelGefährdung von NGOsKapitel 5: Wie wir regiert werdenDie Entdeckung des SozialenArbeitsstandards für alleWenn Unternehmer Behörden schikanierenDie Zäsur: Der Siegeszug des NeoliberalismusHelfer der KonzerneSchieflage zwischen Konzern- und MenschenrechtenKonzerne regulieren: Eine unendliche GeschichteDie AutomatisierungsdividendeKapitel 6: Was können wir tun?Gleiches Recht für alleAktienrecht anpassenSoziale Mindeststandards einführenUnternehmensabsprachen erlaubenMindestbeteiligung aller ArbeitendenMehr linken Kapitalismus wagenGewerkschaften stärkenVersicherung bei falscher BerufswahlGrundeinkommenNeue Orientierung schaffenAnders einkaufenVerbindlichkeit statt VersprechenMein Dank gilt …LiteraturauswahlBASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Anne Büntig
Umschlaggestaltung: Christiane Hahn, www.christianehahn.de
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-2987-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Einleitung
»Diese Wirtschaft tötet. (…) Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte macht. Als Folge dieser Situation sehen sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen und an den Rand gedrängt: ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann.«
Papst Franziskus1
Als 1944 die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) die Erklärung von Philadelphia verabschiedete, waren sich die beteiligten Staatsmänner, Unternehmer und Arbeitnehmervertreter einig: »Arbeit ist keine Ware.«2 Soziale Gerechtigkeit sollte ein Eckpfeiler der internationalen Rechtsordnung sein und Arbeit nicht nur die Basis für die Würde jedes einzelnen Menschen bilden, sondern auch für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft.
Der Grundkonsens ist verloren gegangen. Arbeit gilt im gegenwärtigen Wirtschaftsmodell lediglich als ein Kostenfaktor, der möglichst gering gehalten werden muss, damit Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern und möglichst hohe Gewinne einfahren. Statt sozialer Gerechtigkeit genießen heute die Freiheiten des Kapital-, Waren- und Dienstleistungsverkehrs höchste Priorität. Die Beteiligung der Beschäftigten an den Früchten der Arbeit ist oft dürftig, viele können mit ihrem Lohn nicht einmal ihre Grundbedürfnisse decken. Wir kennen die Working Poor der USA, die mit ihren Löhnen bei Walmart oder McDonald’s so wenig verdienen, dass sie von der Regierung Lebensmittelgutscheine erhalten. Für die arbeitenden Armen aus den lateinamerikanischen Maquiladoras, afrikanischen Minen und chinesischen Werkbänken fehlen uns ähnlich einschlägige Begriffe. Deren Löhne reichen oft nicht dazu, die Grundbedürf-nisse zu stillen, von einem Leben in Würde ganz zu schweigen.
Die weltweite Arbeitsteilung führt nur theoretisch dazu, dass jeder das produziert und dafür entlohnt wird, was er am besten kann oder wofür die jeweilige Region den ansässigen Menschen die besten Voraussetzungen bietet. Regelmäßig werden in der Arbeitswelt selbst elementare Menschenrechte verletzt, ob das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Vereinigungsfreiheit oder gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wie häufig Menschenrechtsverletzungen in der global verzweigten Wirtschaft geschehen, wissen wir nicht. Darüber führt niemand Buch. Aber man kann sich auf die Suche nach jenen begeben, die Missstände erleben, beschreiben und bekämpfen. Das habe ich getan, und ich bin dabei vielen ungeheuer mutigen und bewundernswerten Menschen begegnet, die allen ein Vorbild sein könnten: Ein Cambridge-Absolvent, der als Menschenrechtsanwalt in Pakistan allen Todesdrohungen zum Trotz für die Rechte von Arbeitern und Armen streitet. Ein ehemaliger Gewerkschafter, der jetzt Chefinspektor der Arbeitsbehörde in El Salvador ist. Der Arbeiter, der sich als Terrorist vor Gericht angeklagt findet, weil er einen Streik mitorganisierte. Die langjährige Leiterin der amerikanischen Behörde gegen Arbeitsrechtsverstöße, die ein gewisses Verständnis für die schwierige Situation von Unternehmen hinsichtlich der Einhaltung von Arbeitsstandards hat. Der asiatische Makler zwischen Textilfabriken und westlichen Modekonzernen, der Missstände in italienischen Fabriken anprangert. Die Gewerkschafter, die Arbeiter bei dem Versandhändler Amazon organisieren. Und schließlich der indische Fabrikant, der auf den Staat hofft, damit seine Beschäftigten endlich so entlohnt werden, dass sie alle ihre Grundbedürfnisse befriedigen können.
Was erwartet die vierzig Millionen Menschen3, die Jahr für Jahr neu auf den globalen Arbeitsmarkt drängen? Welche Folgen haben für die Beschäftigten die Globalisierung der Wirtschaft und die beschleunigte Entwicklung von Robotern und Algorithmen? Um dies herauszufinden, habe ich Arbeitende mit den unterschiedlichsten Berufen in verschiedenen Ländern aufgesucht – sie schildern ihren Alltag und den Wandel der Arbeit: Ein Arbeiter erlebt in der Autofabrik, dass die Wertschöpfung für seine Handgriffe genau erfasst wird. Ein Briefträger beschreibt die ständige Verdichtung seiner Arbeit: Längst berechnen Computerprogramme, welche Wege und Postmengen er in welcher Zeit erledigen soll. Textilarbeiter in El Salvador schildern, welch perfidem Akkordsystem sie ausgesetzt sind, bei dem Arbeitsgruppen systematisch gegeneinander ausgespielt werden. Ein Schiffsabwracker in Pakistan erlebt, wie immer wieder Kollegen tödlich verunglücken, und schildert, dass er nicht einmal einen Schutzhelm tragen darf, wenn er ihn selbst kauft. Streikende Arbeiter bei Amazon bekennen, welch immense Angst sie haben, für höhere Löhne und mehr Mitbestimmung zu kämpfen.
Ängste, dass unserer Gesellschaft bald die Erwerbsarbeit ausgehen würde, scheinen nicht ganz unberechtigt. Die Vorboten sind schon heute zu erleben – die Technologie verändert massiv den Arbeitsalltag. Der europäische Produktionschef von Ford beschreibt, wie neuerdings Maschinen fahrerlos auf dem Werksgelände Material transportieren, der langjährige Chef der Fraunhofer-Gesellschaft für Produktionstechnik entwirft eine neue Weltkarte der Produktionsstandorte. Dank dezentraler und automatischer Kleinstfabriken könne selbst die industrielle Produktion von Massenprodukten wie Textilien oder Schuhen aus Entwicklungsländern in die Industrieländer zurückkehren. Ein englischer Küchenchef hat ersten Robotern das Kochen beigebracht.
Die Alarmzeichen für die Beschäftigten sind unübersehbar: In Entwicklungsländern ersetzen Maschinen bereits Menschen mit geringsten Gehältern, und in den Industrieländern übernehmen Maschinen einfache Dienstleistungstätigkeiten und Kopfarbeiten, deren Wegfall lange Zeit als technisch oder ökonomisch unvorstellbar galt. Ein Ingenieur und Betriebsrat bei den Ford-Werken in Köln spricht von einer »Taylorisierung der Kopfarbeit«, also der Umgestaltung anspruchsvoller Tätigkeiten nach dem Prinzip des Fließbandes. Um die verbleibenden Tätigkeiten für menschliche Gehirne und Hände werden immer mehr Menschen konkurrieren, zu härteren Bedingungen. Denn Tätigkeiten lassen sich ebenfalls dank der Technik immer besser standardisieren, zerteilen und weltweit ausschreiben. So steigt der Druck auf die Arbeitenden, dafür sorgen die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Man braucht kein Prophet zu sein, um vorherzusagen, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit noch weiter zugunsten der Unternehmen verschieben wird, wenn sich gesellschaftlich nichts ändert. Das Nachsehen wird ein großer Teil derjenigen Menschen haben, die auf Erwerbsarbeit angewiesen sind, ob als Lohnarbeiter oder einzelne Selbstständige – und das ist fast jeder von uns. Sozial abgesicherte Jobs werden im Laufe des 21. Jahrhunderts ein rares Gut, wenn sich gesellschaftlich nichts ändert.
Das Kapital hat fraglos die Oberhand über die Gestaltung der Arbeitswelt gewonnen. Und seine Interessen werden vor allem von den großen Anlegern und grenzüberschreitend tätigen Konzernen bestimmt, den großen Gewinnern der vergangenen dreißig Jahre: Die größten Konzerne haben seit 1989 ihre Gewinne mehr als verfünffacht. Die Unternehmen und deren Eigentümer schneiden sich heute ein wesentlich größeres Stück aus dem in Europa und den USA erwirtschafteten Kuchen als noch Ende der 1970er-Jahre. Der Anteil der Arbeitenden ist entsprechend gesunken. Die Antwort auf die Frage, ob sich diese Entwicklung fortsetzt, ist maßgeblich abhängig davon, welche Gegenkräfte es gibt. Da sind die freien Gewerkschaften, traditionell der Anwalt für die Anliegen der Beschäftigten. Sie befinden sich global im Gegenwind und müssen sich mancherorts sogar massiver staatlicher Repressionen erwehren, wie eine Untersuchung von 141 Staaten zeigt: In sechs von zehn dieser Länder gibt es keine Tarifverhandlungen, in sieben von zehn Ländern sind Streiks verboten, und in fast jedem zweiten Land gibt es willkürliche Verhaftungen von Gewerkschaftern. Die Gewerkschaften verlieren aber vor allem auch an Einfluss, weil es immer weniger Menschen für notwendig erachten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die Gewerkschaften versuchen, mit neuen Methoden wieder mehr an Einfluss zu gewinnen.
Ein verhältnismäßig junger Akteur auf der internationalen Bühne in Sachen Arbeitsrechte sind NGOs (nichtstaatliche Organisationen), die seit den 1990er-Jahren ungeahnte Wirkungsmacht entfaltet haben. Sie spielen heute eine maßgebliche Rolle bei der Aufklärung über Missstände in der Arbeitswelt, wie die »Kampagne für Saubere Kleidung« bei der Produktion von Textilien. NGOs versuchen, die globalen Arbeitsverhältnisse maßgeblich zu verbessern, etwa durch den Kampf für existenzsichernde Mindestlöhne oder gegen unfaire Handelsabkommen sowie mit Klagen gegen Konzerne.
Die Staaten waren maßgeblich daran beteiligt, dass sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Konzerne verschieben konnte. Regierungen haben vielerorts die Arbeitsverhältnisse entrechtlicht oder die Wirtschaft grenzenlos liberalisiert. Begonnen hatte der Druck auf die Arbeitsstandards in Entwicklungsländern, heute ist dies auch in alten Industrieländern zu beobachten. In Spanien, Portugal oder Griechenland galten Arbeitsstandards in der Finanz- und Eurokrise eben nicht als Errungenschaft, sondern als Standortnachteil. Regierungen haben den Konzernen auch dabei geholfen, ihre Investitionen verbindlich durch zahlreiche Abkommen abzusichern und mit harten Durchsetzungsmechanismen zu versehen. Dagegen ist die Gewährleistung elementarer Arbeits- und Menschenrechte in der Welt der Wirtschaft erschreckend unverbindlich geblieben.
In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, aus dem europäischen Ausland, aus Nordafrika und dem Mittleren Osten kamen sogar unzählige Menschen hierher, in der Hoffnung auf Arbeit und auf der Suche nach Schutz vor Krieg und Verfolgung. Wer jedoch glaubt, dass die hiesigen Beschäftigten von dem Abwärtstrend nicht tangiert seien, unterliegt einer gefährlichen Illusion. Deutschland gehörte mit der Agenda 2010 sogar zu den Vorreitern beim Abbau von Arbeits- und Sozialstandards in Europa und verdankt seine Wettbewerbsfähigkeit nicht zuletzt auch niedrigen Löhnen bei einem Großteil der Beschäftigten. In Deutschland gilt übrigens bereits jedes vierte Beschäftigungsverhältnis als prekär, also als schlecht bezahlt und unsicher. Unter siebzehn erfassten EU-Ländern gibt es nur in Litauen einen höheren Anteil an Geringverdienern als in Deutschland.4 Weltweit sind sogar drei von vier Beschäftigungsverhältnissen instabil, haben die Betroffenen keine oder nur kurzfristige Arbeitsverträge.5Das Wirtschaftswachstum der zurückliegenden Jahre hat in Deutschland übrigens keinesfalls die Billigjobs beseitigt, und jeder zweite Arbeitnehmer erlebte hierzulande, wie seine Löhne in den vergangenen fünfzehn Jahren an Kaufkraft verloren.6 Obwohl die Wirtschaft brummt, fordern Wirtschaftsvertreter eine Abschaffung des Achtstundentags und Flexibilisierung des Arbeitsalltags.7 Ein weiterer Abbau von Arbeitsstandards ist vorprogrammiert, wenn sich der politische Status quo nicht ändert. Die Nachfrage nach »Made in Germany« wird irgendwann sinken, und dann wird die Debatte über die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standorts wieder auf die Tagesordnung kommen.
Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts hatten sich die Arbeitsbedingungen für die Menschen in den früh industrialisierten Ländern deutlich verbessert, also vor allem in Europa und Nordamerika. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich parallel zum wirtschaftlichen Fortschritt auch andernorts die Verhältnisse in der Arbeitswelt verbessern würden. Tatsächlich hat sich die Situation für einen Teil der Menschen verbessert, vor allem in den Schwellenländern. Gleichzeitig hungern jedoch noch achthundert Millionen weltweit und in den traditionellen Industrieländern befinden sich viele Menschen in einer sozialen Abwärtsspirale. Die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen ist jedoch kein Naturgesetz, und es gibt eine Menge Ansatzpunkte für diejenigen, die handeln wollen – sie sind Thema zum Schluss. So viel sei aber schon verraten: Akzeptable Arbeits- und Sozialstandards und eine angemessene Bezahlung aller Beschäftigten, ob in Entwicklungsländern oder bei uns in Europa, nutzen am Ende des Tages allen Menschen und erhöhen auch den wirtschaftlichen Wohlstand. Sie sind aber nur gemeinsam zu erreichen. Ohne eine grenzüberschreitende Solidarität wird sich die Lage der Arbeitenden verschlechtern. Es reicht nicht, die Verantwortung auf die Politiker, Gewerkschaften oder NGOs abzuschieben, jeder Einzelne ist gefragt.
1 Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, Abschnitt 53.
2 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/documents/normativeinstrument/wcms_193728.pdf.
3ILO: Bericht über Globale Beschäftigung und Soziale Entwicklung. Die dynamische Natur von Arbeitsplätzen, Zusammenfassung, 2015.
4 Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge verdiente im Jahr 2010 knapp ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland weniger als 9,54 Euro brutto pro Stunde, das sind mehr als sieben Millionen Menschen.
5 Zahlen der ILO nach der Welt vom 19.5.15.
6 Marcel Fratzscher, Verteilungskampf. Warum Deutschland immer ungleicher wird, München 2016, S. 11.
7 Vgl. Angriff auf den Achtstundentag, Faz.net vom 19.12.2015.
Kapitel 1: Wie wir arbeiten
»Sich zu Tode zu arbeiten ist die einzig gesellschaftlich anerkannte Form des Selbstmordes.«
Johann Freudenreich, Karikaturist und Gerichtsreporter8
Jeden Tag sterben im Durchschnitt 6.400 Menschen auf der Welt durch einen Unfall am Arbeitsplatz oder an einer berufsbedingten Krankheit. Damit kommen bei der Arbeit mehr Menschen ums Leben als durch Krieg und Terror. Jährlich sind es laut der Internationalen Organisation für Arbeit 2,3 Millionen Menschen.9 Möglicherweise liegt die Zahl sogar noch weit über den offiziellen Angaben, denn die globalen Produktionsnetze sind verästelt und beginnen oder enden oft dort, wo niemand hinschaut. Viele Tote, Verkrüppelte und Verletzte bleiben namenlos und ungezählt. Es sind die verschütteten Arbeiter, die in den Minen im Kongo seltene Metalle aus dem Boden holen, oder die verunglückten Kinder, die auf den Kakaoplantagen in Westafrika arbeiten, oder die Männer, die an den Stränden Asiens Schiffe mit bloßen Händen zerlegen und sich dabei Gliedmaßen abreißen, oder die Jugendlichen, die auf den Mülldeponien Afrikas den Elektroschrott zerlegen und beim Verbrennen des Plastiks hochgiftiges Dioxin einatmen. Für diese und die meisten anderen Toten muss niemand Verantwortung übernehmen. Dafür gäbe es oft auch gar keine gesetzliche Handhabe, geschweige denn jemanden, der klagt. Anders ist dies im Falle des Brandes der Textilfabrik Ali Enterprises, wo die Opfer nicht in der Anonymität blieben.
Angehörige und überlebende Arbeiter haben sich zusammengetan und stellen vor Gerichten die Frage nach der Verantwortung, in Pakistan, aber auch in Deutschland. Denn hier sitzt der Auftraggeber der Unglücksfabrik, der deutsche Textildiscounter KiK. Auf diese Weise werden Anfang und Ende einer der vielen globalen Lieferketten sichtbar.
Unterstützt werden die Betroffenen von der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR. Die Organisation stellte gemeinsam mit medico international im März 2015 in einer Berliner Fabriketage die Klage von vier pakistanischen Opfern des Brandes gegen den Discounter KiK vor. Nach Unglücken bei den fernen Lieferanten unseres Konsums geht es hierzulande meist um Selbstverpflichtungen der Unternehmen, verantwortungsvoll einkaufende Konsumenten und neue Gesetze – aber eine Klage Betroffener aus den Ländern im Süden gegen einen Konzern im Norden wegen der Verhältnisse bei dessen Zulieferer ist etwas Neues. In einem Prozess könnte Rechtsgeschichte geschrieben werden. »Das hat es noch nie gegeben in der Bundesrepublik Deutschland«, sagt Uwe Kekeritz, Entwicklungspolitiker der Grünen bei einem Gespräch in seinem Büro im Deutschen Bundestag. Insofern sei es von höchstem Interesse für »unsere Konzerne«, weil die dann damit rechnen müssten, dass sie ebenfalls belangt werden könnten. Zu Redaktionsschluss Mitte Juni 2016 hatte das Landgericht Dortmund noch keine Entscheidung getroffen.
Anlässe für Klagen gäbe es genug. Denn Konzerne verstoßen regelmäßig gegen Arbeits- und Menschenrechte, was diverse Skandale zeigen, bei denen unter anderem die Menschenrechte auf körperliche Unversehrtheit, Vereinigungsfreiheit oder auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit missachtet werden.10 Einen Hinweis auf das Ausmaß liefert eine Studie der Universität Maastricht. Forscher haben 1.800 öffentlich zugängliche Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen von Unternehmen aus einem Zweijahreszeitraum analysiert. Spitzenreiter mit 511 Beschwerden waren Firmen aus den USA. Dann folgten Großbritannien (198), Kanada (110) und China (94). Firmen aus Deutschland belegten mit 87 Beschwerden Platz fünf in diesem Negativranking. Überproportional betroffen sind Großbritannien und Kanada, weil dort besonders viele Konzerne ihren Sitz haben, die im Bergbau tätig sind. Die Branche war Spitzenreiter bei den von den Forschern erfassten Fällen von Menschenrechtsverletzungen. In jeweils 45 Prozent der Fälle wurde den Konzernen angekreidet, die Rechte von Arbeitnehmern oder von Angehörigen indigener Bevölkerungen verletzt zu haben. In den restlichen Fällen sahen die Beschwerdeführer die Menschenrechte von Verbrauchern verletzt.11
KiK ist übrigens beileibe kein Einzelfall – jede fünfte von den Forschern berücksichtigte Beschwerde betraf den Handel, ein Resultat der verästelten Beschaffungsketten in der globalen Wirtschaft, an deren Anfängen häufig die Menschenrechte verletzt werden, wie bei den Arbeitern, die bei dem KiK-Zulieferer Jeans genäht haben.12
Tatort Textilfabrik
Im Juli 2015 fliege ich nach Pakistan. Als Erstes bin ich dort mit Nasir Mansoor verabredet, dem stellvertretenden Generalsekretär der National Trade Union Federation, eines kleinen Dachverbandes von Gewerkschaften. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Organisation der Kläger. Mansoor führt mich an einen Ort, wo das Unglück bis heute präsent ist, in die Leitzentrale für Krankenwagen der Hilfsorganisation EDHI in Karatschi. Dort nehmen Mitarbeiter Notfälle entgegen und alarmieren einen der Sanitäter, die mit ihren Fahrzeugen über die Stadt verteilt sind, die etwa so groß ist wie das Saarland. Schreckensnachrichten sind hier Alltag. An den Anruf am frühen Abend des 11. September 2012 erinnert sich Muhammad Azeem trotzdem haargenau. Um 18.10 Uhr sei der Alarm eingegangen, die Textilfabrik Ali Enterprises im Stadtviertel Baldia Town No. 2 brenne. Sie schickten drei Krankenwagen los. Als Azeem und seinen Kollegen klar wurde, was für ein Inferno in der Fabrik tobte, alarmierten sie weitere Sanitäter. Und dann hörten sie in der Leitzentrale über Funk das Unfassbare: Viele Arbeiter seien in dem brennenden Gebäude eingeschlossen, es gebe nur einen offenen Notausgang, und fast alle Fenster seien mit Eisenstangen vergittert. Rettungsmannschaften könnten nicht hinein und Arbeiter nicht heraus.
Muhammad Hanif gehörte zu den eingeschlossenen Arbeitern, die verzweifelt an den Eisengittern rüttelten. Nun, fast drei Jahre später, steht Hanif vor der ausgebrannten Ruine, wo er früher gemeinsam mit Hunderten Arbeitern nähte. Mit neun Jahren hätten ihn seine Eltern in eine Fabrik geschickt, erzählt er, weil sie nicht einmal das Geld für seine Schulbücher gehabt hätten. Statt schreiben und lesen lernte er nähen – wie viele hier. Ein bis zwei Monate entfernte er Fäden von den Kleidern – der Job für die Anfänger. Dann wechselte er an die Nähmaschine. Oft habe er die ganze Woche in der Fabrik verbracht, sei erst sonntags früh um drei Uhr nach Hause gegangen, um wenigstens einmal in der Woche auszuschlafen. Montags morgens stand er dann wieder in der Fabrik auf der Matte, um Textilien zu nähen. Den Brand hat er nur um Haaresbreite überlebt, weil es ihm schließlich gemeinsam mit einigen Kollegen gelang, einen Teil der Lüftungsanlage aus der Wand zu reißen. Sie zwängten sich durch das Mauerloch und sprangen ins Freie.
Zwei Tage loderten die Flammen in der Fabrik. Dann bargen die Rettungsmannschaften die Leichen und machten einen grausigen Fund. Im Keller hatte sich das ganze Löschwasser gesammelt und war durch das Feuer erhitzt worden. All die Menschen, die im Untergeschoss Zuflucht gesucht hatten, waren regelrecht gekocht worden. Von den toten Körpern konnte man die Haut abziehen wie einen Socken vom Fuß, erzählt Azeem schaudernd. Einige Tote konnten selbst mit einem DNA-Test nicht identifiziert werden. Die Sanitäter haben sie gemeinsam anonym bestattet. 259 Menschen kamen bei dem schwersten Brand in der Industriegeschichte Pakistans zu Tode.13
Grafik Nordsonne Identiy/ Brot für die Welt
Niemand weiß genau, wie viele Menschen in Karatschi, der größten Industriemetropole des Landes, leben. Schätzungen schwanken zwischen 20 und 23,5 Millionen Einwohnern. Menschen flüchten oft aus dem unsicheren Grenzgebiet zu Afghanistan in die Industriestadt am Meer, in der Hoffnung auf Arbeit und ein friedlicheres Leben. Was einiges aussagt, denn Karatschi gehört selbst zu den gefährlichsten Städten der Welt. Mansoor fährt mit mir in das ursprünglich für Militärangehörige errichtete Viertel Defence. Hier wohnt der Rechtsanwalt Faisal Siddiqi. Beide Männer könnten nicht gegensätzlicher sein: Mansoor, der überzeugte Kommunist, der einem aus scharfen Augen anblickt und traditionelle Kleidung trägt, weite Stoffhosen und lange Hemden. Und Siddiqi, der aus einer vornehmen Familie stammt, in Cambridge studiert hat, an der London School of Economics Vorträge hält und eine gehörige Portion Humor hat. Beide eint der Kampf für bessere Lebensbedingungen der Armen und Arbeiter. Die Reaktion der pakistanischen Gesellschaft auf das schwerste Industrieunglück des Landes schockierte sie gleichermaßen. »Nichts geschah, niemanden interessierte es«, empört sich Siddiqi . Die öffentliche Reaktion nach dem Brand von Ali Enterprises sei so gewesen, als ob fünf Menschen gestorben wären. Der Menschenrechtsanwalt macht dafür die generelle Kultur in Pakistan verantwortlich, die teilweise gegen Arbeiter und generell gegen Arme gerichtet sei. Was ihn besonders empört: Das Feuer allein hätte niemals so viele Menschen getötet. Es gebe schließlich grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, die seit den 1930er-Jahren bekannt seien: Man verschließt die Türen einer Fabrik nicht von außen, man installiert Feuermelder und führt Brandschutzübungen durch. Auslöser war vor mehr als hundert Jahren der Brand der Textilfabrik Triangle Shirtwaist Company in New York. 1911 starben hier 145 Beschäftigte, vor allem junge Mädchen aus europäischen Einwandererfamilien. Die Fabrikbesitzer hatten die Türen verschlossen, um zu verhindern, dass die miserabel entlohnten Arbeiterinnen Waren mitnehmen.14 Deswegen steckten sie in der Falle, als das Feuer ausbrach. Regierungen erließen, zunächst in Europa und Nordamerika, Regeln zum Schutz der Beschäftigten im Brandfall, die heute im Prinzip in vielen anderen Ländern gelten, auch in Pakistan. Hätte man solche Regeln bei Ali Enterprises eingehalten, dann wären möglicherweise dreißig oder vierzig Leute umgekommen, sagt Siddiqi, vielleicht auch fünfzig Leute, »259 Menschen wären niemals getötet worden«.
Menschen machen Fehler, schätzen eine Situation falsch ein oder vergessen abzuschließen. Deswegen lassen sich Gefahren auch beim Wirtschaften nicht völlig ausschließen. Welcher umfassender Schutz jedoch möglich ist, zeigt ein Blick nach Deutschland, dessen ökonomisches Rückgrat bis heute die Industrie ist. Von 1958 bis 2014 sank die Zahl der Arbeitsunfälle je 1.000 Vollzeitbeschäftigte von jährlich 141 auf nur noch 22. Bei der Erwerbsarbeit starben 2013 nur noch 386 Menschen, das sind zwanzig Mal weniger als bei der Hausarbeit, mit 8.675 Unfalltoten.15 Sichere Arbeitsbedingungen sind das Resultat findiger Ingenieure, politischer Vorgaben, von Kontrollen und Anreizmechanismen. Bestes Beispiel ist die gesetzliche Unfallversicherung in Deutschland, welche bei Unfällen von Arbeitnehmern unter anderem für die Kosten der Behandlung aufkommt. Die Höhe des Beitrags, den nur Arbeitgeber zahlen, hängt ab von der Belegschaftsgröße und dem Unfallrisiko. Entsprechend gibt es neben der rechtlichen Verpflichtung auch einen ökonomischen Anreiz für ein Unternehmen zu Verbesserungen.
Was dies praktisch bedeutet, erlebte ich im Jahr 2000 bei einer Reportage über Arbeitssicherheit im Zementwerk von Dyckerhoff in Wiesbaden. Selbstbewusst zeigte ein Betriebsrat vor der Kantine auf eine elektronische Anzeige, die dem Werk eine stolze Bilanz attestierte: Es war seit 1.246 Tagen unfallfrei. Bevor die Firmenleitung das Programm zur Beseitigung von Gefahren eingeleitet hatte, waren auf dem Werksgelände noch vierzehn Arbeiter jährlich verunglückt. Zu viel hatte das Management befunden und gemeinsam mit Betriebsräten und Vertretern der Betriebskrankenkasse die Ursachen analysiert und die Abläufe verbessert. Teilweise waren es ganz einfache Maßnahmen, die halfen, die Arbeit sicherer zu gestalten: So reinigte nun öfter jemand die Werkswege von Gesteinsbrocken, weil sich dort immer wieder Arbeiter den Fuß umgeknickt hatten. Aber das Management investierte auch in die Gesundheit der Arbeiter und schaffte beispielsweise einen Automaten an, der die Zementsäcke auf die individuelle Körpergröße eines Arbeiters anhob, was deren Rücken schonte.16 Bis heute wurde dem Werk wiederholt ein hoher Arbeitsschutz von der Berufsgenossenschaft attestiert.17
Und wenn ein Beschäftigter in Deutschland trotzdem verunglückt, wird er medizinisch hervorragend versorgt, unter anderem in berufsgenossenschaftlichen Kliniken. In der Unfallklinik im bayerischen Murnau erlebte ich 1996, wie einem Verkehrsopfer – erstmals überhaupt weltweit – ein menschliches Kniegelenk eines Verstorbenen transplantiert wurde.18
Aber auch hierzulande liegt einiges im Argen. Gesundheitsgefahren für Arbeitende werden bisweilen heruntergespielt. Deswegen gibt es heute in Deutschland mehr Todesfälle infolge von Asbest als durch Arbeitsunfälle. 1.292 Asbesttote verzeichnet die Statistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für das Jahr 2010, für das die jüngsten Zahlen vorliegen. Erfasst sind nur die anerkannten Fälle von beruflich bedingten Erkrankungen. Seit 1978 gab es demnach mehr als 26.000 Asbesttote in Deutschland. Weltweit sterben jährlich mehr als 100.000 Menschen an den Folgen einer Asbesterkrankung.19 Wie konnte das geschehen? Schon die Griechen hatten den Baustoff in der Antike verwendet, der als Wunderfaser galt, weil er fest, hitze- und säurebeständig ist. Ärzte entdeckten im Jahr 1900 die Gesundheitsgefahren von Asbest und erkannten später, dass dafür die messerscharfen Kristalle des Asbests verantwortlich waren, die Krebs verursachten. Aber die Industrie spielte das Gesundheitsrisiko jahrzehntelang herunter, wollte auf die Geschäfte mit der Wunderfaser nicht verzichten. Asbest wurde weiterhin in großem Ausmaß in Häusern, Fabriken und Büros verbaut, aber auch für Bremsbeläge und Dichtungen bei Autos eingesetzt und fand Verwendung für Getränkefilter oder Zahnpasta. Verboten wurde Asbest in Deutschland erst im Jahr 1993, also mehr als neunzig Jahre, nachdem Ärzte dessen Gefahr für die Gesundheit erkannt hatten. Heute ist der weltweite Handel mit Asbest immer noch erlaubt, und der Baustoff wird vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern weiter verwendet.20
Die Frage nach Gefahren wirtschaftlicher Innovationen stellt sich regelmäßig. Aktuell geht es beispielsweise um die Folgen der Nanotechnologie. Es geht um winzige Partikel, etwas größer als Atome und kleiner als Bakterien, die als neue Wundersubstanz gefeiert werden. Sie stecken schon in Sonnencremes, Autolacken oder regenabweisender Kleidung. Forscher haben beobachtet, dass die Winzlinge durch Zellwände schlüpfen können. In Tierversuchen wanderten Nanopartikel bis in den Zellkern und schädigten dort die Erbinformationen. Womöglich entpuppen sich die Winzlinge als Giftzwerge. Betroffen wären davon auch wieder diejenigen, die die Substanzen herstellen. Selbst bei sorgfältigem und vorausschauendem Handeln lassen sich solche Gefahren neuer wirtschaftlicher Verfahren nicht völlig verhindern. Und oft sind die Einschätzungen auch schwierig und eine Frage der Abwägung, weil es beträchtliche Chancen und Risiken gibt.
Der Großteil der Gefahren für Leib und Leben der Beschäftigten resultiert heute jedoch nicht aus technischen Gefahren, sondern aus den gesellschaftlichen Verhältnissen. So müssen die Menschen vielerorts unter lebensgefährlichen Bedingungen arbeiten, die sich leicht beheben ließen. Aber die Umstände werden nicht geändert, weil dann der Gewinn sinken oder sogar die ganze Produktion unprofitabel würde. Das Leben vieler Arbeitender ist verschwindend wenig wert. Historisch ist das eine Konstante. Verglichen mit vorkapitalistischen Zeiten hat es jedoch eine entscheidende Verbesserung gegeben: Anders als damals ist Sklaverei heute nicht mehr erlaubt.
Schlachthaus Karibik
Einer von vier Menschen lebte im 18. Jahrhundert unfrei, als Sklave auf den Plantagen jenseits des Atlantiks oder in der islamischen Welt, als Kriegsgefangener und Schuldknecht in Afrika, als Leibeigener in Osteuropa oder Landarbeiter in Indien. Wer einen Sklaven sein Eigen nannte, durfte ihn ausbeuten, verprügeln, verkaufen, vergewaltigen und umbringen – alles ungestraft. Sklaven galten rechtlich als Ding, genauso wie ein Pferd oder Pflug. Vom 9. bis zum 19. Jahrhundert wurden schätzungsweise 12,5 Millionen Menschen von Afrika nach Asien und auf Inseln im Indischen Ozean verschleppt; weitere 11 bis 12 Millionen Afrikaner wurden vom 15. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert nach Amerika verschleppt und dort als Sklaven verkauft.21 Sie arbeiteten häufig auf den Zuckerrohrplantagen. In gleißender Hitze mussten sie die messerscharfen Blätter ernten und danach bis tief in die Nacht den Zucker in den Mühlen verarbeiten, eine gefährliche Arbeit, bei der sie sich oft an dem siedenden Wasser verbrühten oder ihre Hände in den Pressen zerquetschten. Die Karibik war ein »Schlachthaus«, schreibt der Autor Adam Hochschild in Sprengt die Ketten. Schließlich bildete sich eine Protestbewegung gegen die Sklaverei, insbesondere in England und den USA. 1807 erklärte das britische Parlament den Sklavenhandel mit britischen und anderen Kolonien für unrechtmäßig und knapp vierzig Jahre später verbot es auch den Besitz von Sklaven. Andere Staaten wie Frankreich folgten, später auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Binnen einer Generation wurde Sklavenhandel und Sklaverei in weiten Teilen der Welt auf Druck einer sozialen Bewegung abgeschafft. »Die Sklaverei«, schreibt der Historiker Jürgen Osterhammel, »wurde nicht beseitigt, weil sie dem wirtschaftlichen Fortschritt im Wege stand, sondern weil sie politisch und moralisch nicht mehr länger zu verteidigen war.«22
Anstelle der gebundenen Arbeit für einen Feudalherren trat im Kapitalismus die freie Arbeit des Lohnarbeiters. Das war ein Akt der Befreiung, weil ein Lohnarbeiter – anders als ein Sklave oder Leibeigener – ein Arbeitsverhältnis »eingehen und kündigen« kann.23 Selbst Karl Marx, der schärfste Kritiker des Kapitalismus, sah in der entstehenden Lohnarbeit einen wichtigen Fortschritt aufgrund des Freiheitsgewinns des Einzelnen. Allerdings brachte die Verbreitung der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die Ende des 15. Jahrhunderts in der Landwirtschaft in Europa eingesetzt hatte, zunächst elendige Bedingungen für die Arbeiter, die fast alle rücksichtslos ausgebeutet wurden.
Die Großgrundbesitzer erhöhten ihre Gewinnmarge, indem sie die Produktionskosten drückten, was nur möglich war, wenn sie Landarbeiter und Pächter gnadenlos ausbeuteten, wie die englischen Landlords in den irischen Kolonien. Die Feudalherren exportierten sogar Getreide, während die eigenen Pächter verhungerten. Das kapitalistische »Prinzip« wurde aus der Landwirtschaft im 18. Jahrhundert dann »auf die technische Produktion übertragen«, schreibt der Ökonom Gerhard Scherhorn. Die Anlagen hätten meist großbürgerlichen Fabrikanten gehört, die von dem Ertrag den abhängigen Arbeitern nur einen kärglichen Teil abgaben und sie ausbeuteten.24 Kinder- und Frauenarbeit, 16-Stunden-Tage und 6-Tage-Woche waren die Regel. Mancher verpflichtete sich sogar vertraglich zu Arbeitsverhältnissen, die denen der Sklaverei ziemlich ähnlich waren. Dazu zählten die chinesischen Kulis, die als Wanderarbeiter auf javanischen Plantagen schufteten. Brutal ausgebeutet wurden die Menschen zu Zeiten des Frühkapitalismus nicht nur in Plantagen, sondern auch in Bergwerken und Fabriken.
Menschen sollten »acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung« haben, forderte der walisische Unternehmer Robert Owen (1771 – 1851). Für die meisten seiner Zeitgenossen galt eine solche Forderung als utopisch. Aber der Achtstundentag wurde zu einer Kernforderung der Arbeiterbewegung, formuliert beim Kongress der Internationalen Arbeiter-Assoziation in Genf 1866. Und bald wurde er verwirklicht. In Deutschland führte die Degussa als erstes Unternehmen 1884 den Achtstundentag ein. Bei der Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Philadelphia 1944 steckten die Delegierten der Weltgemeinschaft sogar das ehrgeizige Ziel, »Arbeit mit menschlichem Antlitz« zu schaffen.25 Selbst dies schien bald in die Realität umsetzbar, angesichts der Fortschritte für Arbeitende vielerorts, ob in den Ländern des real existierenden Sozialismus, teilweise auch in den jungen Ländern, die von den Kolonialmächten in die Unabhängigkeit entlassen worden waren, vor allem jedoch in den westlichen Industrieländern. Der Kapitalismus schien gezähmt, besonders gute Zeiten brachen für die Beschäftigten in Europa und Nordamerika an.
In den 1960er-Jahren konnten sich gewöhnliche Arbeiter und Angestellte einen Lebensstil leisten, der eine Generation zuvor wohlhabenden Bürgern vorbehalten war, mit Auto, Kühlschrank und einer Urlaubsreise ans Mittelmeer. Die Beschäftigten erlebten Jahre von Wohlstand und Sicherheit. Es ging ihnen besser, als sie es jemals für möglich gehalten hätten, und sie hatten allen Grund, mit Zuversicht nach vorn zu blicken: Unumkehrbar schien die humanere Gestaltung der Arbeitswelt. Paradigmatisch ist die Geschichte von einer neuen Autofabrik, die Volvo 1974 im schwedischen Kalmar eröffnete.
Ein kurzer Glücksmoment: Schwedische Traumfabrik
In der Blütezeit des europäischen Wohlfahrtsstaates sollten sich die Menschen nicht mehr dem Takt der Maschinen fügen, sondern die Maschinen wurden an die Bedürfnisse der Menschen angepasst. Das bedeutete eine Revolution in der Arbeitsorganisation, denn Maschinen gaben seit Beginn der Industrialisierung die Arbeitsabläufe in den Fabriken vor, verschärft seit der Einführung des Fließbandes Anfang des 20. Jahrhunderts in den Autowerken von Ford.
Wer am Fließband arbeitet, fühlt sich oft zu einem Automaten degradiert, weil von ihm nur wenige Handgriffe gefordert sind, die er immer und immer wieder auszuüben hat. Der Frust der Beschäftigten über diese monotone Arbeit störte die Unternehmen wenig, solange sie ausreichend Arbeitswillige fanden. Anfang der 1970er-Jahre bestand in einigen europäischen Ländern jedoch Vollbeschäftigung, auch in Schweden, und es gab attraktivere Jobs als am Fließband. Volvo mochte mit durchschnittlich 2.000 D-Mark die höchsten Löhne in der europäischen Automobilindustrie zahlen, die Arbeiter kündigten trotzdem in Scharen. Jeder Dritte verließ jährlich das Unternehmen, und der Krankenstand war dermaßen hoch, dass der Autobauer fünfzehn Prozent mehr Leute einstellen musste, als er für die eigentliche Arbeit brauchte. Eine Umfrage brachte Klarheit über die Ursachen: »Die Leute verlassen uns, weil sie keine Befriedigung in ihrer Arbeit finden«, sagte Volvo-Chef Pehr Gyllenhammar und forderte, man müsse die Industrie dem Menschen anpassen und nicht umgekehrt.26 In den weltweiten Autozentren zwischen Detroit und Turin gab es überall Frust der Arbeiter über das laufende Band, flackerten Streiks auf, gab es sogar Sabotageakte. Bei Volvo zog die Firmenleitung radikale Konsequenzen.
Die Manager und Gewerkschafter entwarfen gemeinsam mit Architekten eine völlig neue Fabrik, ohne Fließband. Sie versuchten, die heimelige Atmosphäre einer Werkstatt auf die Fabrik zu übertragen, indem sie abgegrenzte Werkstattbereiche schufen, in denen Gruppen von fünfzehn bis fünfundzwanzig Leuten Montagearbeiten durchführten. Ihnen richtete sie sogar jeweils einen eigenen Entspannungsraum und eine Sauna ein. Damit möglichst viele Mitarbeiter statt unter grellen Neonröhren im Tageslicht arbeiten konnten, wurde der Bau mit vielen Wänden und Ecken ausgestattet. Volvo zahlte für diese Art Fabrik einen Aufpreis von zehn Prozent.27 Das Experiment hatte den gewünschten Erfolg: Der Autobauer fand nun genügend qualifiziertes Personal, Krankenquote und Kündigungen sanken rapide.
Das Experiment wurde populär und beeinflusste die Industrie und Politik in Europa. So legte die Bundesregierung ein Forschungsprogramm zur »Humanisierung der Arbeit« auf. Die Geschichte von der Fabrik in Kalmar klingt heute fast wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht.
Solche paradiesischen Zustände herrschen heute allenfalls im Silicon Valley oder der City von London und in den boomenden Zentren der globalen Ökonomie. Die Unternehmen statten die begehrten Programmierer und Banker mit komfortabelsten Arbeitsbedingungen und üppigen Gehältern aus. Doch für das Gros der Beschäftigten ist es härter geworden, und viele gehen auf dem Arbeitsmarkt leer aus. Die Frage nach guter Arbeit spielt längst wieder eine untergeordnete Rolle, es geht für die meisten darum, überhaupt eine Arbeit zu haben. Die Verhältnisse haben sich mit der Globalisierung und der technischen Entwicklung drastisch gewandelt und die Schutzrechte der Arbeitnehmer werden löchriger.
Nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Ostblocks und marktwirtschaftlicher Reformen in China strömten rund eine Milliarde Menschen auf den globalen Arbeitsmarkt. Arbeitnehmer aus Polen, Russland, Ungarn und vor allem China konkurrierten nun mit denen des wohlhabenderen Westens. China wurde mit seinen Heerscharen von Arbeitskräften zur Werkbank der Welt. Viele Beschäftigte im Westen gerieten gegenüber den Unternehmen in die Defensive angesichts der tatsächlichen und angedrohten Verlagerung ihrer Jobs in Billiglohnländer. Das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten glich fortan einem Kartenspiel, bei dem ein Spieler in jeder Runde alle Trümpfe in der Hand hält. Entsprechend stieg der Anteil der Eigentümer der Unternehmen am Erwirtschafteten in den entwickelten Industrieländern, und derjenige der Arbeitenden sank drastisch, seit 1980 im Durchschnitt der OECD-Staaten um zehn Prozentpunkte.28 In Deutschland betrug die Lohnquote 2014 noch 67,9 Prozent.29 Viele Beschäftigte mussten sogar Reallohnverluste hinnehmen und mehr arbeiten, um dies zu kompensieren. Besonders krass verlief diese Entwicklung in den USA. Viele Menschen sind dort trotz mehrerer Jobs arm. Working Poor, die arbeitenden Armen, hat sich für sie als Begriff eingeprägt.
Aber auch in Deutschland gilt jedes vierte Beschäftigungsverhältnis als prekär, also gering bezahlt und unsicher. Betroffen sind vor allem Menschen mit Teilzeit-, Minijobs oder Kettenverträgen, also als atypisch bezeichneter Beschäftigungsverhältnisse.30 Auch manche gut Ausgebildete müssen solche Konditionen hinnehmen. Beim Vergleich von 17 EU-Ländern wies nur Litauen einen höheren Anteil an Geringverdienern auf als Deutschland.31 Auch deswegen hat sich Europas größte Volkswirtschaft in der Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit des »World Economic Forum« seit dem Jahr 2005 von Rang 15 auf Rang 4 vorgearbeitet. Vor Deutschland liegen jetzt nur noch die Schweiz, Singapur und die Vereinigten Staaten.32
Weitsichtig war die Prognose des Soziologen Ulrich Beck in den 1990er-Jahren, der von dem »Risikoregime« der Arbeit sprach, das zu einer Auflösung aller »Basisselbstverständlichkeiten im Zentrum der Erwerbsgesellschaft« führen würde.33 Viele Menschen erleben dies hautnah. Viele wissen nicht mehr, ob und wie sie auf ihrem Job oder ihrer Qualifikation eine Zukunft aufbauen können. Jeder ist ein potenzieller Arbeitsloser. Früher ertrugen Arbeitgeber oft Mitarbeiter, die langsamer oder schussliger waren, heute vermeidet man deren Einstellung oder sortiert sie, so bald wie möglich, aus.
Arbeiten bis zum Umfallen
Unternehmensberater und Controller durchforsten ständig die Abläufe auf der Suche nach Effizienzpotenzialen, wie es auf Neudeutsch heißt. Die Arbeit muss immer schneller und mit weniger Personal erledigt werden, immer enger werden die Produktivitätsschrauben angezogen. Das halten sogar kerngesunde Beschäftigte irgendwann nicht mehr aus. So wie Kenichi Uchino. 106 Überstunden innerhalb eines Monats hatte der Dreißigjährige in dem Toyota-Werk Tsutsumi gemacht, dann bekam er einen Herzinfarkt. Das ist nichts Ungewöhnliches in Japan, wo Ärzte für solche plötzlichen Todesfälle gesunder Menschen am Arbeitsplatz sogar einen eigenen Begriff erfunden haben: Karoshi, was so viel bedeutet wie »Arbeiten bis zum Umfallen«. Die Betroffenen sterben gewöhnlich an Gehirnblutung, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Es gibt Karoshi-Ratgeber und Karoshi-Hotlines, und mehr als vierzig Kliniken haben sich in Japan auf Karoshi-Gefährdete spezialisiert, so groß ist der Bedarf.34
Doch Arbeiten bis zum Umfallen ist kein exotisches Phänomen, sondern kommt auch andernorts vor. Und manche Beschäftigte nehmen sich aus lauter Verzweiflung das Leben, wie die Selbstmordserie bei der France Telekom zeigte. Nachdem sich in den Jahren 2008 und 2009 drei Dutzend Mitarbeiter umgebracht hatten, stellte die Gewerbeaufsicht in einem Untersuchungsbericht fest, Unternehmenschef Didier Lombard und andere Topmanager hätten Beschäftigte mit unlauteren Methoden derart unter Druck gesetzt, dass unmittelbare Gefahr für das Leben der Beschäftigten bestand. Außerdem habe das Management die Warnungen von Gewerkschaften, Betriebsärzten und Krankenkassen in den Wind geschlagen.35 Selbst mancher Spitzenmanager sieht keinen anderen Ausweg mehr als den Freitod wie Pierre Wauthier. Der Finanzchef der Zurich-Versicherung schrieb in einem Abschiedsbrief vom Druck des Verwaltungsrates.36 In Deutschland warnen Krankenkassen und Gewerkschaften vor den Folgen des steigenden Arbeitsdrucks. So verzeichnen Krankenkassen einen Anstieg psychosozialer Belastungen bei Beschäftigten in einem »alarmierenden Ausmaß«. Zeitdruck, Störungen des Arbeitsablaufs und ein eingeschränkter Entscheidungsspielraum seien wesentliche Faktoren, die psychische Erkrankungen wie Depressionen begünstigten.37
Innerhalb von einer Generation haben sich die Fehlzeiten am Arbeitsplatz wegen psychischer Erkrankungen, von knapp einem halben Tag im Jahr 1976 auf 2,6 Fehltage im Jahr 2013 verfünffacht. Eine wesentliche Ursache sind Erschöpfungsdepressionen, besser bekannt als Burnout. Darunter leiden, anders als das öffentliche Bild vermuten lässt, übrigens keinesfalls Topmanager besonders häufig, sondern gewöhnliche Beschäftigte, vor allem Callcenter-Agenten und Altenpfleger.38 Das größte Risiko besteht allerdings bei denjenigen, die ihren Job verlieren. Bis zu vierzig Prozent der Hartz-IV-Empfänger sind psychisch krank.39 Fatalerweise haben viele Menschen die Ideologie des immerwährenden Wettbewerbs dermaßen verinnerlicht, dass sie sich allein die Schuld am Verlust ihres Arbeitsplatzes geben und nicht die Verhältnisse dafür verantwortlich machen. Der Druck auf die Beschäftigten wird weiter steigen, durch den Vormarsch der Algorithmen und Roboter sowie eine immer stärkere Globalisierung und die steigende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.
Gut in Erinnerung geblieben ist mir auch die Arbeiterin, die bei der Firma Puky im Akkord Kinderfahrräder und Roller zusammengebaut hatte. Irgendwann konnte sie nicht mehr, ein Arzt wies sie in eine Klinik ein. Als sie sich erholt hatte, bekam sie einen Arbeitsplatz in einer Werkstatt für psychisch Kranke in Wuppertal. Als ich sie dort kennenlernte, schraubte sie dort wieder Puky-Fahrzeuge zusammen. Was für eine Ironie! Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit verfahren diverse Firmen nach dem gleichen Muster und lagern Arbeiten in Behindertenwerkstätten aus.40
Der Wert der Arbeit: Eine schwierige Frage
Eine beliebte Partyfrage: »Und was machen Sie?« Beim geselligen Zusammensein ist die Frage nach der beruflichen Tätigkeit oft ein erster Anknüpfungspunkt für ein Gespräch. Manchmal hat man sogar den Eindruck, es drehe sich heute alles um die Arbeit. Früher war das anders: Unsere Vorfahren assoziierten mit Arbeit Mühsal und Strapazen und keinesfalls Wertschätzung. Die Einstellung zur Arbeit änderte sich in Europa erst gravierend im 17. Jahrhundert, während der Aufklärung und Reformation: Nun sahen die Menschen Arbeit als einen von Gott vorgeschriebenen Selbstzweck des Lebens an. Heute dürfte Gottgefälligkeit als Motivation für die wenigsten Arbeitenden eine Rolle spielen. Aber die Art der Arbeit entscheidet maßgeblich über unseren Platz in der Gesellschaft. Wer einen gut bezahlten Job hat, der kann Urlaub machen und sich interessante Hobbys leisten. Für Sozialprestige sorgen auch spannende Tätigkeiten selbst, sie bieten nicht nur Gesprächsstoff auf einer Party, sondern helfen auch bei einem sinnerfüllten Leben. Im globalen Maßstab sind solche Jobs jedoch ein Luxusgut, das nur wenigen vergönnt ist. Die meisten Menschen arbeiten noch immer aus der blanken Notwendigkeit heraus.
Die technologischen Neuerungen haben meine Arbeitsleistung merklich erhöht. Quelle: Werkheft 01 Digitalisierung der Arbeitswelt, S. 62, Hg. Bundesministeriumfür Arbeit und Soziales.
»Ohne Job muss ich hungern«, sagt schlicht der Näher Muhammad Hanif, als wir uns in Karatschi darüber unterhalten, warum er und die anderen sich eigentlich nicht in der Fabrik Ali Enterprises gegen Missstände zur Wehr gesetzt hatten. Und dann erzählt Hanif von der ganz gewöhnlichen Arbeitsorganisation in seinem Land und ihren verheerenden Konsequenzen. Wie er arbeitet die Mehrheit in den Fabriken als Leiharbeiter. Wer protestiere, den werfe der Arbeitsvermittler raus.
Hanif und seine Frau treffe ich in der Wohnung seiner Eltern. Auf einem einsamen Board stehen ein Teddybär mit rotem Hut und acht kleine Fläschchen Parfüm. Hanif erzählt von seinem Traum, Tänzer zu werden. Stolz berichtet er von dem Auftritt im lokalen Fernsehen gemeinsam mit Amir und Rabar. Barbar Cheif Dance Group nennen sich die drei. Er gibt mir ihre Visitenkarte, alle drei tragen auf dem Foto einen schwarzen Hut wie Michael Jackson, sein großes Vorbild. Wegen der Folgen seiner Rauchvergiftung kommt er heute schnell außer Atem. Sein Traum vom Tanzen ist geplatzt. Das ist aber die geringste Sorge seiner Frau, deren Vater und Onkel bei dem Fabrikbrand ebenfalls umgekommen sind. Alle hier hätten jedes Mal Angst, wenn ihre Angehörigen in die Fabrik gingen, Angst vor einem neuen Unfall. Hanif leidet zeitweise unter Lähmungserscheinungen in Armen und Beinen, trotzdem näht er wieder in Textilfabriken. Nur, wenn ihn seine neuen Kollegen ausdrücklich fragen, erzählt er von dem Brand. Über sein Engagement in der Opfervereinigung und die Klage in Deutschland schweigt er jedoch. Zu groß ist seine Angst, als Unruhestifter zu gelten und seinen Job zu verlieren. Der Willkür von Fabrikanten und Arbeitsverleihern ist übrigens jeder ausgeliefert, der auf einem wenig oder unregulierten Arbeitsmarkt tätig ist.
Bei einem Markt denken die meisten Menschen an einen Wochenmarkt, wo Händler ihre Angebote machen und die Kunden kaufen, wenn sie mit der Qualität und dem Preis einer Ware einverstanden sind. Ihre Entscheidung für einen Kaufvertrag treffen beide Seiten frei. Der Arbeitsmarkt funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten, er ist ein untypischer Markt und durch ein Machtgefälle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern gekennzeichnet. Das beschrieb Adam Smith, der Begründer der Nationalökonomie, schon 1776: »In Auseinandersetzungen können die Unternehmer viel länger durchhalten. Ein Grundbesitzer, Landwirt, Fabrikbetreiber oder Kaufmann könnte auch ohne Arbeiter in der Regel ein oder zwei Jahre von den Vorräten leben, die er bereits angehäuft hat. Viele Arbeiter können sich nicht einmal eine Woche ernähren, wenige würden einen Monat und fast niemand würde ein Jahr durchhalten, wenn sie keine Stelle hätten. Langfristig mag der Arbeiter für den Unternehmer genauso wichtig sein wie der Unternehmer für den Arbeiter; aber diese Abhängigkeit ist nicht so unmittelbar.«41 All diejenigen, die bereit und gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, aber keinen Käufer finden, nannte Marx die »Industrielle Reservearmee«.
Es gibt Konstellationen, in denen ein einzelner Arbeitsuchender für sich gute Bedingungen vereinbaren kann. Aber das ist selten, zumal die Arbeitgeber ein großes Interesse daran haben, Knappheiten bei einzelnen Berufen schnell zu beseitigen. Sie tun eine Menge dafür, dass sich möglichst nie ein Engpass an Bewerbern auftut, damit sie selbst wieder am längeren Hebel sitzen und sich zwischen Kandidaten entscheiden können. Man sollte auch dies im Hinterkopf haben, wenn sich Manager zu Flüchtlingen äußern. »Die meisten Flüchtlinge sind jung, gut ausgebildet und hoch motiviert. Genau solche Leute suchen wir doch«, warb Daimler-Chef Dieter Zetsche, als viele Kriegsflüchtlinge in Deutschland ankamen.42 Daimler gehört zu den Firmen, die sich qualifizierte Flüchtlinge herauspicken können, weil sie begehrte Jobs bieten. Auch andere Firmen werden auf der Suche nach Beschäftigten für einfachere Tätigkeiten fündig, wie beispielsweise die Textilfirma Trigema. Ihr Inhaber Wolfgang Grupp hatte im Februar 2016 bereits einen pakistanischen Flüchtling als Näher eingestellt und erwartet sechs Syrer, die bald in seinem Betrieb anfangen sollen.43 Ein Fabrikant wie Grupp ist aber nicht repräsentativ. Gerade die Textilproduktion, bei der vor allem einfache Tätigkeiten erledigt werden, ist aus Westeuropa längst fast komplett abgewandert.
Niemand sollte auch die ständigen Klagen über einen Ingenieursmangel zu wichtig nehmen. Tatsächlich gibt es hierzulande mehr als 30.000 arbeitslose Ingenieure, und selbst qualifizierter Nachwuchs findet oft keine Stelle. Von einer Strategie der Unternehmer spricht der Statistikprofessor Gerd Bosbach. »Die Arbeitgeber machen eine Kampagne, um mehr Leute ins Studium zu locken, damit sie anschließend aus einem Heer gut Ausgebildeter wählen können.«44