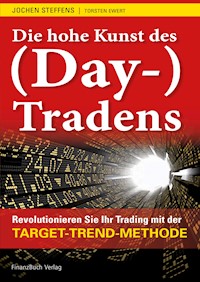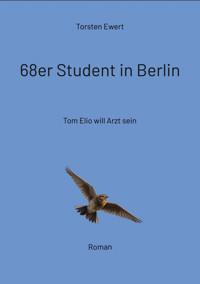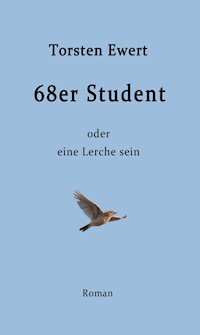3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tom Elio
- Sprache: Deutsch
Tom, ein Kriegskind aus dem Osten versucht sich im kleinbürgerlichen Westdeutschland zurecht zu finden. Doch es zieht ihn in der Zeit des Kalten Krieges, abenteuerlustig nach Berlin. Unverhofft findet er Zugang zur Anatomie und entscheidet sich Medzin zu studieren. Die Psychiatrie in dieser Zeit sucht und findet neue Wege denen Tom sich auf seiner Ausbildung zum Psychiater anschließt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
„Wer etwas sein will,
der muss es auch werden wollen.“
Dr. Torsten Ewert
Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut
Emeritierter Chefarzt
Studium in Berlin
Tätig in Berlin, Essen, Aachen
Wohnhaft in Stolberg (Rheinland)
Für Oliver, der sich gerne auseinandersetzt,
für Jennifer, die das Spielen liebt,
für Tobias, der das Wertvolle schätzt,
für Fabian, der begeistert kommuniziert
und für Ingeborg, die alles zusammenhält.
Torsten Ewert
Psychiater sein
Die Erlebnisse des jungen Peter Quero
Text Copyright © 2014 Torsten Ewert
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-8495-8740-6 (Paperback)
ISBN 978-3-8495-8741-3 (Hardcover)
ISBN 978-3-8495-8742-0 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Die Nacht
Ein Wochenende / Spätsommer 1976
Das Staatsexamen / Winter 1975
Medizinalassistent 1975/76
Uschi und Robert
Montagmorgen
Sommer 1976, Facharztsuche
Montagabend
Jugend / Rheinland
Der Entschluss / Sommer 1968
Berlin 1968
Die Entscheidung / Sommer 1968
Dienstagmorgen
Dienstagabend
Mittwochmorgen
Die Klinik
Mittwochabend
Donnerstagmorgen
Donnerstagabend
Freitagmorgen
Freitagabend
Samstag
Sonntag
Zweiter Montagmorgen
Zweiter Montagabend
Zweiter Dienstagmorgen
Zweiter Dienstagabend
Zweiter Mittwochmorgen
Zweiter Mittwochabend
Zweiter Donnerstagmorgen
Zweiter Donnerstagabend
Zweiter Freitagmorgen
Zweiter Freitagabend
Zweiter Samstag
Zweiter Sonntag
Dritter Montagmorgen
Dritter Montagabend
Dritter Dienstagmorgen
Dritter Dienstagabend
Dritter Mittwochmorgen
Dritter Mittwochabend
Dritter Donnerstagmorgen
Dritter Donnerstagabend
Dritter Freitagmorgen
Dritter Freitagabend
Dritter Samstag
Dritter Sonntag
Vierter Montag
Vierter Dienstag
Vierter Mittwoch
Vierter Donnerstag
Vierter Freitag
Vierter Samstag
Vierter Sonntag
Fünfter Montag
Fünfter Dienstagmorgen
Fünfter Dienstagabend
Fünfter Mittwochmorgen
Fünfter Mittwochabend
Fünfter Donnerstagmorgen
Fünfter Donnerstagabend
Fünfter Freitag
Fünfter Samstag
Fünfter Sonntag
Sechster Montag
Ende
Die Nacht
In dieser bewegenden Nacht war Dr. Peter Quero, ein junger Psychiater, der in früherer Zeit Irrenarzt geheißen und diese Bezeichnung auch nicht als abfällig empfunden hätte, seinem Beruf zweifellos gerecht geworden. Er hatte die erstaunlichsten Erlebnisse und absonderlichsten Handlungen von Menschen erfahren, die einzig und allein ihrer abenteuerlichen Phantasie entsprungen waren, aus einem leidvollen Kummer, einer überschießenden Laune, einem erworbenen Unverstand heraus. Eine verrückte Welt voll absoluter Gewissheit und unfehlbaren Glaubens, die faszinierend und aufregend, mitunter sogar erheiternd, in der Regel aber verzweifelt, traurig, beklemmend und erschreckend war. Wie von ihm erwartet, hatte er zugehört, gehandelt, dem Irrsinn die Stirn geboten, dabei einen klaren Kopf behalten.
Gleich zu Beginn seines Dienstes wurde ihm der 18jährige Stefan L. vorgestellt. Schweißnasse Haare umrahmten in verfilzter Lockenpracht ein leichenblasses, knochenbetontes Gesicht, dessen blutleere Lippen stockend Satzfetzen von sich gaben. Gedanken schlugen in akrobatischen Verrenkungen Purzelbäume, liefen ins Leere, wurden schweigend weiterverfolgt, auf Nachfragen wieder aufgegriffen, um sich erneut zu verlieren. Geduldig hörte Quero zu, lenkte vorsichtig das Gespräch, dass Stefan allerdings mit sich allein zu führen gedachte, was interessierte ihn die Vernunft einer korrigierenden Erklärung. Er war sich seiner sicher, sein Erleben unerschütterlich, hörte es ja überall, das Zischeln und Murmeln, einen unverständlichen Dialog in einer fremden Sprache außerirdischer Wesen, die sich im Raume tummelten und von seinem Körper längst Besitz ergriffen hatten, sich seiner Gedanken bemächtigten und ihn zerstören wollten. Warum noch Auskunft geben wie er hieß, wie alt er war und wo er wohnte, da längst ein anderer aus ihm geworden war, keines eigenen Willens mehr fähig, ausgeliefert einer fremden Macht und ihren Befehlen.
Seit Tagen beobachtete der begleitende Vater eine zunehmende Wesensänderung des Sohnes mit geheimnisvollem Umherschauen, lauerndem Verhalten und suchendem Kramen. Feindselige Blicke erschütterten ihn und die Angst, gefangen genommen zu werden. Nicht ganz grundlos wie es schien, da er nächtens die metallenen Sterne von parkenden Autos der Nachbarn abgerissen hatte, in der Meinung, dass es Funkantennen von Fremdlinge seien. Verärgert hatte der Vater, ein hagerer, asketischer Mann mit scharfgeschnittenen Gesichtszügen, die Strenge und Autorität vermitteln, den Sohn zur Rede gestellt und dessen unangemessenes Grinsen gerügt, wo er sich doch zutiefst hätte schämen sollen. Dann waren sie gemeinsam herumgezogen, um die Betroffenen zu finden, sich zu entschuldigen und den Schaden zu erstatten, aus Angst vor Verruf, Schande und Scham. Doch ein unverhofft vorbeifahrender Polizeiwagen im Einsatz, mit heulendem Martinshorn und Blaulicht machte die begonnene Mission komplett zunichte, denn Stefan erlebte Dämone, die ihn umheulten und Blitze in seinen Körper schleuderten. Ein wildes Zucken und Winden bemächtigte sich seiner und Flucht schien ihm die letzte Rettung. Nur mit Mühe und kräftigem Zupacken schaffte es der Vater, den Rasenden unter Kontrolle und nach Hause zu bringen. Doch es gelang keine Beruhigung des panisch Getriebenen und nach Rücksprache mit dem Arzt und um wenig Aufsehen zu erregen, erfolgte die eigenhändige Einweisung in die Psychiatrie. Verunsichert, für ihn nicht fassbar, außerstande das Geschehen zu begreifen, verfolgte der Vater stehend vom Ende des Raumes das vorsichtige Fragen des Arztes und die gequälten, oft im Nichts sich verlierenden Antworten seines Sohnes, ohnmächtig, mit einem entschiedenen Machtwort Klarheit zu schaffen.
Quero versuchte, so gut es ihm gelang, dem Vater das Verhalten des Sohnes zu erklären: „Eine Psychose liegt vor. Die Diagnose stützt sich auf die Symptome: abnorme Erlebnisweisen, abnormer Ausdruck, Störungen des Denkens, Fühlen und Wollens, akustische Halluzinationen, Ichstörungen, Wahn. Stefan fühlt sich leiblich beeinflusst, leidet unter Gedankenentzug, Gedankenabreissen, ist geplagt von seinen Wahnwahrnehmungen, bedarf der Behandlung.
Mechanisch und fassungslos nickte der Vater, nur wenig drang zu ihm durch. Stefan selber wollte rein gar nichts verstehen, lebte in seiner Welt, was interessierte ihn die Realität. Nur die Angst und die nervenzerreißende Anspannung, die ihn quälte, verlangten nach Hilfe. Quero sollte sie ihm nehmen, das war der Grund für ihn zu bleiben.
Brigitte, die nächtliche Stationsschwester wurde verständigt, ein Bett zu beschaffen. Ein gebrochener, erschöpfter Vater verabschiedete sich, schaute Quero nicht in die Augen, seine Lippen zitterten. Ein halblaut gemurmeltes „Auf Wiedersehen” war sicherlich ganz und gar nicht nicht in seinem Sinne und dennoch würde er nicht darum herumkommen. Davor graute ihm.
Bekümmert schaute ihm Quero nach. Brigitte, um ihn aufzumuntern und abzulenken, bot einen frisch gekochten Kaffee an, dazu schokoladenüberzogene Pfefferminzplätzchen, die Nacht war noch lang. Es belebte Peter und erfrischte ihn, ebenso Brigittes Anblick mit dem langen geschmeidigen, blonden Haar, das von einem Seitenscheitel geteilt ihr ebenes Gesicht umrahmte, über die Schultern, am Ende gelockt, bis auf die Brust fiel. Quero würde ihr als einzige, die heute Nacht zusammen mit ihm Dienst tat, ganz sicherlich nicht den Vorwurf machen, die Haare nicht zu einem gewohnheitsmäßigen Knoten oder mit einem Haarband gebändigt zu haben. Auch das dezente Make-up gefiel ihm.
Vertrauensselig unterhielt sie ihn. Ihr Partner und sie hätten eine neue, größere Wohnung bezogen, diese eigenhändig, total poppig renoviert. Eine Einweihungsparty würde demnächst steigen, seine Einladung sei hiermit vorab schon einmal ausgesprochen. Der Freund habe sich außerdem seinen lang gehegten Traum erfüllt, ein nagelneues schwarzes Auto der Golfklasse gekauft, mit einem Automatikgetriebe, „…denn er ist einarmig.”
Quero war betroffen, fing sich, Brigittes letzte Aussage hatte ihn berührt, vor allem deren fast beiläufige Selbstverständlichkeit, vorgetragen ohne Scheu. Ihr machte die Behinderung des Partners nichts aus, Stefans Vater musste noch lernen, derartiges zu akzeptieren.
„Das schwarze Auto, klingt nach schwarzem Ritter, kann aber auch Trauer bedeuten. Wie verlor er seinen Arm?”
Noch bevor Brigitte antworten konnte, schrillte das Telefon, eine Neuaufnahme wurde gemeldet.
Ein handfester Ehekrach hatte der Pförtner beiläufig verlauten lassen, und die laute bassige Stimme eines Mannes sowie die erregthochschwingende einer Frau waren bereits vom Flur her unüberhörbar. Brigitte eilte ihnen entgegen, führte sie ins Aufnahmezimmer, geräuschvoll schlug die Tür zu.
„Das kann ja heiter werden”, ahnungsvoll-neugierig machte sich Quero auf den Weg. Der Patient, ein freundlich aufgeregter Pykniker mit breitrundem Gesicht war durchaus guter, ja sogar gehobener Laune. Leutselig nahm er den Arzt in Augenschein und bedachte ihn mit einem Wortschwall: „Endlich ein vernünftiger Mensch…, Himmel Herrgott, lass doch das Gezerre Elfriede…, was soll der Blödsinn mich hierher zu bringen…, ich brauche weder Ruhe noch eine Schlaftablette, höchstens einen Drink oder zwei. Einem Jäger wie mir ist Schlaf fremd, ich verbringe, wenn es sein muss, die ganze Nacht auf dem Hochsitz… Lass uns ein wenig Pokern mein Freund, als Einsatz Bares oder Gold. Ich bin Zahnarzt, der Gottfried, nenne mich ruhig Goldzahn…. Eine einladende Bar ist das hier nun gerade nicht, da gibt es bessere Orte…, komm schlag ein, dann lass uns gehen.”
Die Ehefrau, klein und pummelig, ein wütendes Energiebündel, hätte es besser unterlassen, seiner ausfahrenden zum Gruß gebotenen Hand Einhalt zu gebieten. Denn indem sie dieser in die Quere kam, benutzte Gottfried die Gelegenheit, mit ein wenig mehr an Kraftaufwand die Gattin ärgerlich beiseite zu schubsen. Diese taumelte, fing sich und wutschnaubend brach es aus ihr heraus: „Schluss jetzt mit dem irrsinnigen Reden und Benehmen, merkst du denn gar nicht, wie lächerlich du dich machst?” In bebender Entrüstung wandte sie sich Quero zu: „Seit zwei Tagen, besser gesagt Nächten geht das nun so, von einer Bar in die andere, kein Casino oder Spieltisch ist vor ihm sicher, und in den Puff will er gehen, ich soll mitkommen, zugucken. Stellen sie sich das vor. Zum Heulen ist mir zumute. Gewiss, er ist ein geselliger Mensch, ich gönne ihm Spaß und Freude, aber das geht entschieden zu weit. Er ist Zahnarzt, ein sensibler Beruf, die Patienten erwarten Fingerspitzengefühl und jetzt dieser ungehobelte, vulgäre Ton, das prahlerische, aufdringliche Benehmen. Einige Patienten haben sich bereits aus dem Staub gemacht, und es fehlt nicht viel, ich auch.” Zornesfalten meißelten sich in ihre Stirn, ihr Mund war nur noch ein rasiermesserscharfer Strich, ihre Augen zeigten kalte Entschlossenheit und hart herrschte sie ihren Ehemann an: „Du hast die Wahl, entweder du bleibst hier, oder ich lasse mich scheiden.”
Quero hatte keinen Zweifel an dieser kompromisslose Entschlossenheit. Jegliches anfängliches verständnisvolle, ja sogar heitere Entgegenkommen, geboren aus der bestehenden Situationskomik heraus, wurde von der offenkundigen brutalen Sinnlosigkeit der Situation erstickt, nötigte zu entschlossenem Handeln. Sie hatte Recht, auch Quero würde bei erwarteter seriöser Behandlung im Zahnarztstuhl und statt dessen erlebter frivol-fröhlichen Enthemmung und Taktlosigkeit umgehend die Flucht ergreifen.
„Ich kenne da eine gute Zigarrenlounge…”, versuchte der selbst ernannte Goldzahn vorsichtiger geworden und mit unsicherem Blick wieder Boden gut zu machen und vor allem Queros Komplizenschaft zu gewinnen. Der furiose Auftritt seiner Gattin hatte ihn nicht unberührt gelassen, beeindruckt war er zurückgewichen.
Dies war die Chance für Quero, den Augenblick zu nutzen, keine törichten Äußerungen und kein eheliches Kriegsgeschrei mehr zu dulden, vielmehr die Wogen glätten und Brücken bauen. Zunächst schien es ihm angebracht, eine kollegiale Verbundenheit herstellen, an das ärztliche Ehrgefühl zu appellieren und die verpflichtende medizinische Ethik zu betonen, danach in pastoraler Würde an das Gelübde der Ehe erinnern.
„Lieber Kollege, von Arzt zu Arzt, wir sind dem Wohle der Patienten verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, darum ist es mehr als wünschenswert und erforderlich, diszipliniert und engagiert seine Arbeit zu tätigen und nicht durch Liederlichkeit und Ausschweifungen zu gefährden. Auch in der Ehe gelten Regeln, Nachsicht und Toleranz miteinander zu haben, sich in respektvoller Achtung zueinander zu verhalten, Nachsicht zu zeigen. In aller Ruhe sollte jetzt ein jeder für sich nachdenken, wie die nächste Zeit rechtschaffen und sinnvoll gestaltet werden kann.”
Seinem Gegenüber schlug er die Aufnahme vor, dessen Ehefrau den häuslichen Heimgang und wünschte ihnen letztendlich ohne weiteres Federlesen: „Eine angenehme Nacht und ein vertrauensvolles Wiedersehen am nächsten Tag.”
Beeindruckt oder vielmehr von einem plötzlich gegen sich selber gerichteten Schuldgefühl berührt und der aufkeimenden Ernüchterung womöglich über das Ziel hinausgeschossen zu sein, schmolzen die protzig-prollig, lautstark und hemmungslosen Äußerungen des durchaus Hochgestimmten dahin. In einem letzten Aufbegehren zitierte er: „“Ohne Wein und ohne Weiber, hol der Teufel unsere Leiber“”, und gab nach, „heute bin ich ihr Gast, aber morgen lade ich sie ein. Handschlag!”
Diesmal fuhr die Gattin nicht dazwischen. Erschöpft, so gut es ging gefasst, wünschte sie ihrem Mann und Quero „Eine gute Nacht” und verließ gesenkten Hauptes die Station, nachdem sie ihrem Mann einen letzten verzweifelten Blick zugeworfen hatte. Dieser folgte verunsichert Brigitte und ließ sich ein Nachtlager herrichten.
Quero benötigte weitere von Brigitte dargebotene Pfefferminzplätzchen mit Schokoladenüberzug und diesmal dazu einen starken Tee.
Schwester Brigitte zeigte sich belustigt beeindruckt: „Ich bin ja schon des öfteren von Männern eingeladen worden, aber noch nie in ein Bordell”, und nach kurzem Zögern und mit einem schelmischen Augenzwinkern platzte es aus ihr heraus, „aber warum nicht, allerdings nur um den Horizont gemeinsamen Erlebens zu erweitern.”
„Im Horizontalen?”, Quero tauchte das Plätzchen in den Tee, ein aromatischer Geruch erfüllte den Raum, „Verführerisch. Auf welche Ideen manch einer kommt.”
„Ich habe sie nur aufgegriffen.”
Auf Gedanken ganz anderer Art war Elisabeth A. gekommen und die trug ihr Sohn vor, zweifellos ein Dandy mit Blazer und Goldkettchen, dessen Gehabe einer spätpubertären Profilierung entsprach, statt altersentsprechender Männlichkeit.
„Um Himmelswillen kümmern sie sich um meine Mutter. Sehen sie doch diesen trostlosen Verfall der einstmaligen Grande Dame zur grauen Betschwester.”
Theatralisch hob er beide Hände, stieß das Wort Mutter mit gespitzten Lippen aus und legte los. In den letzten Tagen hätte sie ihn mit einem endlosen, nervtötenden Gejammer in die Verzweiflung getrieben, aber jetzt noch viel schlimmer, unnahbar in ein Schneckenhaus zurückgezogen, ohne Rede und Antwort zu stehen und still vor sich hin zu starren, als wäre er Luft. Dabei brauche er dringen ihre Hilfe, „…und die verweigert sie mir!” Seine Stimme überschlug sich: „Sie ist paranoid, zweifellos! Ich kann es beweisen!” Was anderes wären diese unsinnigen, ständig wiederholten Selbstbezichtigungen krank zu sein und zu versagen, im Haushalt, in ihren Beziehungen und vor allem ihm gegenüber, den sie in egoistischer Gleichgültigkeit vernachlässigt hätte.
„Das mag ja sein, stört mich aber überhaupt nicht und vor allem nicht im Augenblick. Sie ist alt, ja, aber nicht krank wie sie behauptet, lässt eine Heerschar von Ärzten für ihre Gesundheit sorgen. Verarmen könne sie gar nicht bei dem hinterlassenen Vermögen des verstorbenen Vaters, auch wenn es ihr dieser bigotte Antiquar durch den Verkauf seiner Heiligenbildchen von Himmel und Hölle, dem Jüngsten Gericht und den Ikonen aus der Tasche ziehe, anstatt es…”, eine grün-gelbliche Galligkeit verfärbte sein Gesicht, „in ihren leiblichen Sohn zu investieren.”
Früher, wenn Geldnöte ihn schon mal plagten, und sie ihm Vorwürfe machte, nicht ordentlich zu wirtschaften und zu sehr dem Luxus zu frönen, hätten sie sich noch immer einigen können. Aber diesmal komme er überhaupt nicht mehr an sie heran, müsse sich diese blödsinnigen Verarmungs- und Versündigungsideen anhören und zuletzt ihr beharrliches Schweigen ertragen. „Zweifellos sind ihr die religiösen Motive in den Kopf gestiegen, die heilige Jungfrau und die grinsenden Teufelsfratzen. Alles Hirngespinste, während die wahren Teufel, meine Gläubiger, gegenwärtig und leibhaftig sind, mir die Daumenschrauben ansetzen, das Blut aussaugen.”
Versündigen könne sie sich lediglich an ihm, wenn sie das dringend benötigte Geld nicht herausrücke. „Die nehmen mich wahrlich in die Zange, und sie lässt mich im Stich.” Empört schnaubte er durch die Nase, blies die eingefallenen hohlen Wangen auf, lies die angestaute Luft ab. „Zuerst habe ich gedacht, sie will mich nur ein wenig zappeln lassen, aber dann wurde mir klar, dass sie krankhaft verbohrt ist, keinerlei Argumenten zugänglich, deshalb habe ich sie hierher gebracht”, und drohend-verzweifelt, „sie müssen sie auf andere Gedanken bringen und zwar rasch, sonst bin ich erledigt.” Aufgeregt ruckte sein schmaler Kopf auf langem Hals gockelhaft hin und her, hackte nach seiner Mutter, die in traurig-umflorter Versunkenheit leise vor sich hinmurmelte.
Quero beugte sich vor, um besser zu hören. „Mea culpa, mea maxima culpa…”, und: „Maria, du bist gebenedeit unter den Weibern…”
Sinnlos mit der sich selbst Kasteienden kommunizieren zu wollen. Sie konnte in diesem Zustand ihrem Sohn nicht helfen. Ihr Kind hatte über die Stränge geschlagen, dafür musste er und sie jetzt büßen.
„Ihre Mutter leidet unzweifelhaft unter einer schweren endogenen Depression mit Wahnideen. Sie ist suicidgefährdet und in ihrem jetzigen Zustand unfähig, angemessen zu reagieren. Ich werde mich ihre Mutter kümmern.”
„Und ich, was wird aus mir?” Ein verzweifeltes Augenpaar, welches seinen Höhlen zu entweichen drohte, starrte Quero an.
„Selbstverständlich können sie ihr Gesellschaft leisten.”
„Und wer bezahlt meine Schulden?”
„Sie werden etwas Geduld haben müssen.”
„Die meine Gläubiger nicht haben. Ich kann mir den Strick nehmen.”
„Ein Grund mehr hier zu bleiben.”
„So ein Quatsch!”
Was blieb Quero zu tun? Sich einarbeiten in eine langjährige, schwierige und komplexe Familientragödie, die die Mutter nicht mehr aushielt, in die Psychose flüchtete und den Sohn ins Unglück mitriss.
Die alternde Henne, sie legte dem jungen Gockel keine goldenen Eier mehr, wie sehr er auch krähte und mit den Flügeln schlug, am Ende nur noch erlahmen konnte, um seinen Kopf fürchten musste.
Und wenn ein Hahn kräht, stimmt schon bald der nächste ein, der vor Schwester Brigitte balzte und nach einem Arzt gierte. „Diese Kopfschmerzen, das muss ein Tumor sein, Aspirin, das ist lächerlich, ich brauche Gewissheit.”
Brigittes Stereotypes: „Warten sie, der Doktor kommt gleich”, bewirkte ein ärgerliches Aufbrausen, „nicht gleich, sofort, und das meine ich ernst Schwesterchen, bevor mein Kopf platzt.”
„Warum nicht, arroganter Kerl”, dachte Brigitte, „eine Schönheit geht dabei nicht verloren. Das Schwesterchen wird nicht nach deiner Pfeife tanzen.” Verächtlich bot sie dem vierschrötigen Mann mit dem kantigem Gesicht, den abstehenden Ohren und Bürstenhaarschnitt Paroli, wehrte sich seiner pfeilharten Blicke: „Der Doktor kommt so schnell er kann.” Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss.
Doch der Aufgebrachte war nicht bereit zu harren. Jetzt erst recht und durch die Trostlosigkeit des geweißten Raumes verstärkt, begann sein Gemüt hochzukochen. Er riss die Tür auf, erstürmte den Gang, suchte die Konfrontation: „Ich lass mich nicht abspeisen. Wo ist der Doktor?”
Dieser, vom lauten Geräuschpegel alarmiert, erschien im Flur, musste aufpassen, nicht umgerempelt zu werden, wurde ins Visier genommen.
„Na endlich, ich nehme an, sie sind der Arzt, tun sie etwas für mich.”
„Ja gerne.”
„Handeln sie!”
Brigitte zog mit abweisendem Gesicht die Schultern hoch und erklärte lapidar: „Er hat Kopfschmerzen.”
„Wie rasend und unerträglich.”
„Schlagartig wie mit der Keule?”, Quero ärztliches Interesse war geweckt, vielleicht eine akute, lebensbedrohliche aneurysmatische Hirnblutung?
„Nein, seit Tagen, aber es wird immer schlimmer, hoffentlich kein Tumor.”
„Schauen wir mal, Schwester Brigitte wird sie ins Untersuchungszimmer bringen, sie legen dort die Oberbekleidung ab, und dann komme ich sie untersuchuen.”
Quero kannte den bisherigen Verlauf nicht. Sein jovialer Ton, seine gelassene Haltung, ein vertrauliches Nicken Brigitte zugeworfen und der Versuch sich zu entfernen, wurden als verschwörerische Hinhaltetaktik erfasst. In einem Tobsuchtsanfall wurde nicht nur die Menschenwürde, sondern vor allem die Würde eines Patienten beschworen, der sich nicht länger hinhalten lasse, augenblicklich die Untersuchung wünschte, die Diagnose und eine Therapie. „Dazu sind sie als Arzt verpflichtet”.
„Schluss jetzt, ich komme sobald sie sich beruhigt haben, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, lassen sie die Drohungen und das Geschrei.”
Das entschlossenes Machtwort zeigte Wirkung, widerwillig grollend fügte sich der Gescholtene und folgte Brigitte, die hochnäsig voranschritt: „Sie haben gehört was der Doktor sagte.”
Die Untersuchung war unauffällig, keine Nackensteife, kein Fieber, der Augenhintergrund unauffällig.
„Alles auf den ersten Blick soweit gut, ich verschreibe ihnen Paracetamol.”
Kaum ausgesprochen fuhr der Patient in die Höhe und brüllte. „Das ist alles? Sie wollen mich mit harmlosen Medikamenten abspeisen? Sie sind ja noch schlimmer als diese impertinente Krankenschwester, die schlug wenigstens noch Aspirin vor. Ich will wissen, ob ich einen Tumor im Kopf habe und wie man den behandelt.”
„Um Mitternacht?”
„Ja, auch um Mitternacht. Ich mache sie für alles verantwortlich.”
„Suchen sie morgen den Hausarzt oder einen Spezialisten auf.”
Weiter kam Quero nicht. „Nein, den Rechtsanwalt! Sie hören von mir!”
Der Rahmen hielt der knallend zugepfefferten Tür stand. Eine erschrockene Brigitte erschien. „Alles in Ordnung Doc?”
„Ja, nur eine psychopathische Gemütsverpuffung aufgrund der Unfähigkeit einer adäquaten emotionalen Steuerung, die sich einer Sozialisierung widersetzt und Erziehung, moralischen Ansprüchen sowie Gesetzen trotzt.”
„Und uns das Leben mit Wutausbrüchen schwer macht”.
„Da hilft nur, gelassene Selbstbeherrschung zu zeigen.”
Quero hatte gut reden, mag sein, dass er über eine entsprechende Fähigkeit verfügte, nicht aber das junge Mädchen, das ohne viel Federlesen zu machen, kurzentschlossen aus dem Fenster sprang, als ihr der Freund die Trennung verkündete. Eine Aggression gegen sich selber, aus dem Affekt heraus, mit der unbewussten Absicht ihn mit einem schlechten Gewissen zu bestrafen.
Einer Polizeistreife waren die beiden aufgefallen, als sie am Straßenrand kauerten und einander umschlungen hielten, das Mädchen verweint, mit blutverschmierten Schrammen im Gesicht und den Armen, zerrissener Kleidung und barfuß, der Junge im Schock, entsetzt und wortkarg.
Auf den zweiten Stock zeigte er, wo der Lichtschein aus dem weit geöffneten Fenster drang und auf das dichte übermannshohe Rhododendrongebüsch. Dort heraus hatte er sie befreit. Wenn auch wackelig auf den Beinen, konnte sie alles bewegen, ein paar Schritte tätigen und die Arme heben. Eine psychologische Betreuung erschien im Moment das einzig Wahre.
Brigitte nahm sich des Mädchen, Quero des Jungen an. Er erfuhr weniges, aber Wesentliches, vom Mädchen dann, dass es ihr leid täte, sie schämte sich wegen der Unannehmlichkeiten, die sie bereitete.
„Die spielen keine Rolle, Hauptsache sie sind am Leben.”
Auch sie schien nach und nach zu dieser Einsicht zu kommen. Ihrem Freund wurde gestattet neben ihrem Bett, solange er wollte, Platz zu nehmen und Händchen zu halten. Ein rührendes Bild.
Brigitte schüttelte den Kopf: „Könnte mir nicht passieren, dummes Ding, damit muss man fertig werden.”
Leider wird nicht jeder mit den Widerwärtigkeiten des Lebens fertig, ist triebhaft oder zwanghaft veranlagt und schadet sich selber. So endete die Reise einer alleinstehenden Dame mittleren Alters nicht, wie im vollmundig gerühmten Programmheft vorgesehen, am Golf von Neapel, auf Capri oder Ischia mit Aussicht auf den Vesuv und der Besichtigung von Pompeji, sondern in der umsorgenden Station der Psychiatrie, wohin sie ein genervter Taxifahrer und eine besorgte Nachbarin brachten. Gemeinsam mit dieser hatte Frau Dorothea K. sorgsam ihren Koffer gepackt und die Reiseunterlagen mit allen Vouchern in der eigens dafür angeschafften mehrfächrigen, rosaroten, ledernen Handtasche nach einem wohldurchdachten Plan eingeordnet. Die Vorfreude war riesig, seit Tagen gab es keinen anderen Gesprächsstoff mehr und pünktlich stand das Taxi bereit, zum Start einer exakt geplanten Reise, mit Treffen der Reisegruppe am Flughafen. Noch nie hatte Frau K. eine derart große Reise unternommen. Mit „Glückliche Reise” und „was soll schon schiefgehen”, wurde sie von der Nachbarin verabschiedet.
„Alles”, wie ein verärgerter Taxifahrer später berichtete.
Sie waren kaum losgefahren und in ein kleines Schwätzchen verwickelt, als die Dame in ihrer Handtasche zu wühlen begann.
„Anhalten!”, befahl sie und gemeinsam suchten sie nach dem Flugticket. „Ich habe es zuletzt der Nachbarin gezeigt, es muss noch in der Wohnung sein.”
Rückfahrt. In der Wohnung war es nicht, sondern zwischen zwei Vouchern.
„Jetzt aber Gas gegeben.”
„Anhalten!”, kam nach kurzer Wegstrecke erneut der Befehl, „ich vergaß die Wohnung abzuschließen.” Rückkehr. Die Wohnung war abgeschlossen.
Erneut Gasgeben, wahrscheinlich zu viel, der Fahrgast erbrach, sackte bewusstlos in sich zusammen, ein säuerlicher Geruch verpestete die Luft. Das scharfe Abbremsen verursachte beinahe einen Auffahrunfall, eine Hupe wütete. Verzweiflung ergriff den Taxifahrer. Am Erbrochenen, soviel wusste er, konnte man ersticken, doch die Betroffene lebte, über und über besudelt wie das Polster.
„Nach Hause”, bat sie flehentlich, und er kam ihrem Wunsch nach, forderte sein Geld, einen höheren Betrag für die Reinigung, doch die völlig Hilflose war unfähig zu reagieren.
„Ins Krankenhaus”, entschied die resolute Nachbarin, „alles weitere kann dort geregelt werden.”
Schwester Brigitte nahm die Personalien auf, Habseligkeiten und Gepäck in Empfang, säubert die Patientin und brachte sie zu Bett. Quero versuchte ein Gespräch, doch aus bebenden Lippen kamen nur Wortfetzen. Er verordnete ein Schlafmittel. Kopfschüttelnd und fassungslos entfernte sich der Taxifahrer.
Diesem entgegen näherten sich zwei in neonorangenen Westen gekleidete Feuerwehrleute, die auf einer fahrbaren Liege eine vergnügt dreinschauende, in einen Morgenmantel gekleidete Greisin hereinfuhren und zu Protokoll gaben, dass sie das Weibchen in gekonnter Weise aus ihrer Wohnung befreit hatten, indem sie kurzerhand die Tür einschlugen. Es war auch höchste Zeit gewesen, um den sich stauenden Wassermassen freien Ablauf zu gewähren, die aus einer überfließenden Badewanne stammten und bereits als muntere Rinnsale im Treppenhaus die Mieter in Alarmstimmung versetzt hatten, nicht aber die Verursacherin, die verwundert in den Pfützen herumtapste. Erheitert begrüßte sie Quero mit Hänschen und dass sie sich freue, ihn wiederzusehen. Alles was sie bräuchte, wären ein Paar Hausschuhe, sie könnte doch nicht mit nackten Füßen herumlaufen. Ihren Namen hatten die Feuerwehrleute der Türklingel entnommen, die Nachbarn erzählten von einem entfernt lebenden Sohn, die Polizei wäre dabei ihn aufzuspüren. Als sie erfuhr, dass Quero ihr behandelnde Arzt sei, bat sie ihn hocherfreut, doch einmal ihre Beine anzusehen, wegen einer bestehenden offenen Wunde. Die Enttäuschung war groß, als dieser nur einen kurzen Blick auf ihre dünnen Unterschenkelchen warf und Brigitte die Arbeit der Aufnahme übertrug. Entsprechend beklagte die Alte sich bitterlich bei dieser und verwechselte sie mit ihrer Tochter.
Quero schenkte sich ein großes Glas Sprudel ein und verfocht die These, einmal das Spektrum der Psychiatrie durch die Generationen versorgt zu haben. Brigitte hörte ihm aufmerksam zu, fand es spannend, keineswegs langweilig. „So geht der Dienst im Nu herum.” Dem vermochte Quro nicht zuzustimmen, er hätte gern nach regulärem Tagesdienst, nachfolgendem Nachtdienst und nochmals kommenden Tagesdienst zwischendurch gern ein wenig geschlafen, „sich in die Horizontale begeben.” Eine Aussage, die Brigitte ein verschmitztes Lächeln entlockte.
Doch sein Wunsch blieb noch unerfüllt, der nächste Zugang kam. Ein paar gutgelaunte Sanitäter, die sich des breiten Grinsens nicht enthalten konnten, schoben einen rotbackigen, knollennasigen, wild um sich blickenden etwa fünfzigjährigen Mann auf einem Sitzwagen herein, begleitet von einer wütenden, überforderten Ehefrau, die ihn statt zu beruhigen, lauthals aufforderte, endlich mit dem Quatsch aufzuhören.
„Er ist Gastwirt, dem Alkohol gegenüber nicht abgeneigt und und dabei sage ich ihm immer, trink nicht so viel. Nicht das er trunken erscheint, nein, das ist es ja gerade, sie merken es ihm nicht an. Nach getaner Arbeit schläft er wie ein Stein, aber heute, heute Nacht, das war der Horror. Hören sie sich das einmal an, sie glauben es kaum, ich jedenfalls nicht.”
Quero erschien ihr wie eine Rettung. Entgeistert starrte sie ihn aus tabakgezeichnetem, faltigem und erschlaffen Gesicht an, einem anderen Laster verfallen.
Der Gescholtene rollte mit den Augen, sein Schnauzbart bebte, in fassungsloser Ergebenheit krallte er sich im Stuhl fest, blickte immer mal wieder scheu um sich, schüttelte den Kopf und legte los: „Die Wölfe, diese Biester, ich habe sie gesehen und ihr Heulen gehört. Heute ist Vollmond.”
„Unsinn”, unterbrach ihn wütend die Gattin, „vielleicht ein paar rollige Katzen und ein liebestoller Kater, die da rumgefaucht haben. Wölfe, seit wann gibt es Wölfe in unserer Gegend?”
„Ich habe aber mit meinen eigenen Augen gesehen, wie sie am Fenster vorbeihuschen, hörte ihr Kratzten an den Wänden, ihren Versuch einzudringen.”
„Und wissen sie was er gemacht hat?”, fuhr sie dazwischen, „im Keller eine Axt geholt. Da bin ich aus Angst vor ihm und seinem Wahnsinn hinausgerannt und habe die Feuerwehr gerufen. Über die Feuerwehrmänner hat er sich gefreut, wollte mit ihnen gemeinsam die Wölfe vertreiben.”
Die anwesenden Feuerwehrleute grinsten. „Keine Wölfe.”
„Sicherlich eine Alkoholhalluzinose, lebhaftes szenisches Erleben, Akoasmen, die psychotische Erlebniswelt eines Alkoholikers”, erklärte Quero, stellte an Brigitte die Frage nach einem Männerbett und verabschiedete die Ehefrau, „das Einzige was ich uns beiden und ihrem Mann nach ereignisreichem Geschehen im Augenblick wünsche ist ein wenig geruhsamer Schlaf. Morgen sehen wir weiter.”
Die verwunderte Begriffsstutzigkeit der Frau verflüchtigte sich rasch.
„Sie behalten ihn hier?”
„Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Gute Nacht.”
Dr. Peter Qwero bekam sie, wenigstens für den Rest der Nacht. Nicht sofort war an ein Einschlafen zu denken, dazu war er zu aufgewühlt. Aber nach und nach überkam ihn das beruhigende Gefühl, hingebungsvoll und allen seinen Möglichkeiten entsprechend gehandelt zu haben, Menschen gegenüber, deren Verhalten inadäquat oder überzogen war, aus einer Trauer, Verzweiflung oder Verwirrung heraus, die sich ängstlich, grundlos heiter, depressiv, aggressiv, verzweifelt, gequält, ratlos und erregt verhielten, einschließlich deren Begleitern und Angehörige. Noch einmal gingen ihm die Diagnosen durch den Kopf. Ein wahnhafter Psychotiker, ein antriebsgesteigerter Maniker, eine jammerige Depressive, ein explosibler Psychopath, eine liebeskranke Suicidale, eine gequälte Zwanghafte, eine senile Demente und ein halluzinierender Alkoholiker. Langsam erloschen ihre Bilder vor seinen Augen, ein letzter Tanz der irrenden, verwirrten Geister, die größer und kleiner wurden, ineinander verschmolzen, zu einem wurden, er selber. Allen hatte er seine ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt, Verständnis für ihre Wahrnehmungen, Empfindungen, Probleme und Nöte gezeigt, mit Wort und Tat geholfen, Medikamente verabreicht, versucht ihnen gerecht zu werden, in seiner Bestimmung als Arzt gehandelt, jetzt brauchten sie ihn nicht mehr. Der Schlaf konnte kommen, beruhigen, vergessen machen.
Bereits früh weckte ihn ein Eimergeklapper und das notorischschimpfende Gemurmel der Putzfrau Johanna über die Pflegers, die Flegels, welche sie für grobschlächtige Kerle hielt, Kraftprotze, die besser in der Fabrik oder bei der Müllabfuhr aufgehoben wären, anstatt im Krankenhaus überall ihren Dreck zu verbreiten. „Eine Krankenschwester tut so etwas nicht, die räumt und putzt selber alles weg, und ich hätte nicht so viel zu tun.”
Das Laster und der Schnaps hatten sie ausgehöhlt. Die Klinik duldete ihr einen letzten Halt. Mit penibler Langsamkeit, mit sich und Erinnerungsfetzen beschäftigt, putzte sie jeden Vormittag den Korridor. Queros Morgengruß schreckte sie auf, ihr eingefallenes, lappiges Gesicht erstrahlte kurz wie ein angerissenes Streichholz, ein freudiges „Guten Morgen, Herr Doktor” straffte ihre Züge, dann versank sie wieder in die Armut nicht mehr vorhandener Freuden.
Routiniert brachte Qwero die Ereignisse der Nacht zu Protokoll, das oberste Blatt für den Ärztlichen Direktor, bevor es in die Akte ging, der Durchschlag diente ihm als Gedächtnisskript. Gewiss, die Fülle seelischer Variationen in dieser Nacht waren vielfältig gewesen, wenn auch nicht absolut ungewöhnlich für einen Psychiater, der sich im nächtlichen Dienst einer Großstadt befand, deren irrende und verwirrte Geister die Nacht durchstreiften.
Die Morgenvisite war angesagt. Schwester Annemarie erwartete ihn schon, Brigitte hatte ihr ausführlich berichtet. „Ganze Arbeit Herr Doktor”.
Es folgte im Wesentlichen ein Erkunden über den Schlaf, das Wohlbefinden und die Medikamentenverträglichkeit, erhobene Befunde und Labordaten wurden bewertet und Therapiegespräche festgelegt. Annemarie, eine herrische Mitvierzigerin, schob gewissenhaft den Visitenwagen, reichte die Krankenakte und kritzelte Anordnungen in ihr Merkheftchen, um sie später zu übertragen und auszuführen. Ein geschäftiges, gut eingespieltes Zeremoniell, welches mit einer Tasse Kaffee im Stationszimmer belohnt wurde und in einem Allerweltsgespräch endete.
Dann bat Quero zum ersten Gespräch mit der jungen Suicidalen, um ihr seelisches Empfinden, die Not, welche diesen Schritt bedingt hatte, zu erkunden und zu fragen, ob sie sich von ihrer Handlung distanzieren könne. Das einigende Ergebnis war, ein paar Tage mit der Aufarbeitung des Geschehens zu verbringen und den Freund hinzuzuziehen.
In der Mittagskonferenz, im wissenschaftlichen Kreuzfeuer von Terminologie, Diagnose und Therapie seiner ausgeruhten Vorgesetzten, die jedes gesprochene Wort zerpflückten und das niedergeschriebene auf die Briefwaage legten, referierte Quero vor den versammelten, mitunter gleichgültigen Assistenzarztkollegen die Ereignisse der Nacht. In Anbetracht der intensiven Inanspruchnahme wurde ihm zunehmend durch interessiertes Zuhören und wohlwollendes Nicken Anerkennung für seine Leistung vermittelt, wobei im Stillen jeder froh war, selber von diesem Dienst verschont worden zu sein. Diesmal hatte es halt ihn erwischt. Die feststellende Bemerkung des Chefarztes, dass es auch ruhigere Dienste gäbe, konnte als Lob aufgefasst werden.
Mit dem Oberarzt wurden am Nachmittag die einzelnen Patienten konsultiert, Entscheidungen getroffen und Therapiepläne entworfen. Als letztes widmete sich Quero fürsorglichen und aufgeregten Angehörigen und versprach sowohl ihnen als auch seinen Patienten, ausführlich am nächsten Tag wieder zur Verfügung zu stehen.
Dr. Peter Queros Einsatz war beendet, 32 Stunden Klinikaufenthalt vorbei, und die abgegebene Verantwortung als diensthabenener Psychiater demonstrierte sein am Haken baumelnder Kittel.
„Ganz einfach abhängen.”
Er betrachtete sich ausgiebig im Spiegelbild und stellte lediglich einen Zug melancholischer Nachdenklichkeit fest, unzweifelhaft hervorgerufen durch die bewegenden nächtlichen Erlebnisse. Die turbulente Nacht hatte ihn nicht gezeichnet und die erkennbaren Bartstoppeln des Kinnes im oval sich verjüngenden Gesicht mit der kräftigen Nase nicht altern lassen, sondern unterstrichen eher noch eine energische Standhaftigkeit und Maskulinität, ebenso wie die hohe Stirn, aus der er das volle, dunkelblonde Haar scheitelte, während das helle Blau der Augen diesen Eindruck wiederum milderte. Den leicht gebeugten Nacken, der von einer unbeachteten Vernachlässigung seiner Haltung und der zunehmenden sitzenden Tätigkeit herrühren mochte, korrigierte er im seitlichen Bild, indem er die Brust herausdrückte und den Kopf anhob.
Nein, ein Narzisst war er nicht, nur sehr selbstbewusst, auch als Psychiater. Er liebte es in den Gesichtern seiner Patienten zu lesen, Gedanken und Gefühle zu erahnen, die sich hinter den dunklen Pupillen, umgeben von der buntschimmernden Iris im unschuldigen Weiß des Augapfels, in der Tiefe der Gehirne verbargen und als Reflex im Antlitz widerspiegelten. Sehr rasch erfasste er Kummer, Ärger und Enttäuschungen, die einen Lebensentwurf verbitterten.
Ausgestattet mit genügend Selbstbewusstsein, charakterlicher Stärke und freundlicher Empathie, fiel es ihm nicht schwer, das Vertrauen seiner Patienten zu erwerben, sich ihrer gestörten, gequälten, gespaltenen, überzogenen Persönlichkeiten anzunehmen, seine Hilfe anzubieten. Zwar war es nicht immer möglich alle Erwartungen zu erfüllen, Erfolge zu verbuchen, jede Therapie zu Ende führen, aber stets verfolgte er das Ziel, seinen Patienten die Möglichkeit und die Kraft zu geben, wieder zu sich zu finden, die Maske abzulegen, hinter der sie sich verbargen, die Panzerung zu sprengen, die sie einschnürte, den Widerstand aufzugeben, der sie lähmte, die Rolle fallen zu lassen, die nicht zu ihnen passte. Sie sollten wieder selbständig in der Lage sein, ihre Ängste und Probleme zu meistern, frei von Beeinflussungen, Zwängen und Behinderungen. Wie ein Maler, der im stillen Atelier mit seiner schöpferischen Kraft aus einer noch unfertigen Skizze ein in sich geschlossenes Bild erschafft, sah er als Arzt seine Bestimmung, einen neuen Menschen zu formen, welcher in Gegenwart und Zukunft durch die erfahrene Behandlung wieder in sich ruhen und bestehen konnte. Dann war die Zeit gekommen, sich in gegenseitiger Freundschaft und Anerkennung voneinander zu verabschieden.
Für heute genug. Er zog die geliebte hellbraune Wildlederjacke an, tastete prüfend nach Portemonnaie und Schlüsselbund, ergriff die antiquierte lederne Arztasche, sein ganzer Stolz, warf die Tür des Arztzimmers hinter sich zu und trat mit federndem Schritt, erworben in sportlicher Aktivität, zügig ins Freie, wo ihn wohltuend die frische Luft umfing, die ihm die Klinikräume verwehrt hatten. Der verbleibende Abend gehörte ihm, der jetzt ungezwungenen und ohne Planung vertrödelt werden konnte. Zum Abendbrot gereichte ein Brot vom Bäcker und Tatar vom Metzger, zur allgemeinen Information die Tageszeitung, einschließlich der Kommentare des schwatzhaften, glatzköpfigen Büdchenbesitzers, vor allem zum Wetter.
Sein momentaner in lässiger Gleichgültigkeit und sorgloser Freude bestehender Zustand, der sich mehr mit dem Blick nach innen beschäftigte als der Umgebung zugewandt, ließ ihn fast mit Evelyn, der adretten und ihm wohlbekannten Krankenschwester, zusammenstoßen, die plötzlich unverhofft vor ihm stand, als habe sie ihn erwartet. Sicherlich war er ihr schon eine Weile aufgefallen, denn ihr Blick galt nur ihm. Ihr hübsches puppenhaftes Gesicht, von dunklem, vollem Haar einnehmend geschmückt, drückte zu seiner Verwunderung, mit rundem Mund und andachtsvoll geöffneten Augen, ein ehrfürchtiges Ergriffensein aus, im Gegensatz zu ihrer ansonsten ungezwungenen und legeren Art, und dann platzte es in ehrlicher, direkter und ungeschminkter Bewunderung aus ihr heraus: „Genauso stelle ich mir einen Doktor vor.“
Ein unsicheres Lächeln huschte über sein Gesicht. Wie hatte wohl ein Doktor in Zivil auszusehen? Vielleicht machte es auch nur die Arzttasche. Er fühlte sich geschmeichelt, geehrt, wollte sich bedanken, überlegte ein Kompliment. „Und ich mir eine „Gesunde Schwester“.“ Sie strahlte.
So tragen wir unsere Vorstellungen im Kopf, bis sie lebendig vor uns stehen.
Er war stolz auf sich, stand in der Blüte seiner Jahre, füllte sie aus.
Die Altbauwohnung, die er gemietet hatte, im dritten Stock und dem Volkspark Hasenheide zugewandt, mit der hohen verzierten Stuckdecke und dem zurückgelassenen alten verschlungenem Kronleuchter im Wohnzimmer, den ein Dutzend elektrische Kerzen und eine Unmenge vielfältiger geschliffener Gläser zierten, entsprachen seinem Hang nach altehrwürdigem Ambiente, ebenso wie die Einlegearbeiten der Holztüren, die gemaserten Holzdielen und das lichtdurchflutete Bad mit der metallen Emaillewanne auf gusseisernen Füßen. Das Mobiliar war mehr willkürlich aus Nachlässen zusammengewürfelt, im Großen und Ganzen praktisch und bequem, allerdings wenig detailverliebt. Ihm fehlte der Sinn fürs Zusammenpassende.
Der Lärm des Verkehrs von der vielbefahrenen Straße war hier zwar noch zu vernehmen, aber gedämpft. Er konnte ihn auch vollkommen ausschalten und sich vollkommen in seinen Gedanken verlieren. Insbesondere gelang ihm dies beim Betrachten der riesigen Weide im Hinterhof, deren silbrige Blätter sich in melancholischer Ergebenheit, die sich gelegentlich auf ihn übertrug, dem Boden entgegenneigten. Ganz im Gegensatz dazu erinnerte ihn, trotz ihrer Winzigkeit, die immer mal wieder am Balkongitter erscheinenden munteren Meisen mit quirliger Lebendigkeit und wirbelnden Flügelschlag an die fröhliche Wildheit des Lebens.
Zerstreut und verschlafen gestaltete er den den Abend, legte ein paar Platten auf: Cat Stevens „Wild World“, „The Best of Steppenwolf“, Simon and Garfunkel „Bridge Over Troubled Water“, Supertramp „Dreamer“, Pink Floyd „Animals“, Donavan „Catch The Wind“, wurde allmählich wieder munterer, durchblätterte nach der Tageszeitung den „Spiegel“ (Bild am Montag) und ein Exemplar der hauchdünnen „Peking Post“, bis ihm langweilig wurde. Eine Buchlektüre erschien vielversprechender. Hemmingways „Fiesta“ fiel ihm in die Hand. Wie lechzten dessen Protagonisten nach Alkohol und gierten nach männlicher Selbstbehauptung, die sie im Stierkampf bestätigt fanden. Es belebte auch Queros Phantasie und den Wunsch, einmal selber die Sanfermines, das alljährliche Volksfest in Pamplona zu besuchen, den Encierro mit den wagemutigen Läufern vor den heranstürmenden Bullen und den Stierkampf zu erleben. Eine tollkühne, gefährliche Auseinandersetzung, bei welcher der voyeuristische Zuschauer sich hingerissen als Aficionado begnügte und die bewunderte, die sich den wilden Stieren entgegenstellten. Bewegt legte er das Buch aus der Hand, sah sich plötzlich selber als Torero, unerschrocken im Kampf gegen die Neurosen und Psychosen, geführt in der Klinik, seine Arena.
Jetzt, keiner Verantwortung mehr unterworfen, war es ein überragendes Gefühl sich einfach hinzugeben, dem Schicksal, dem Zufall eines Augenblickes, einer spontane Fügung oder momentanen Laune, nicht mehr nach dem wie, wo, was und warum zu fragen und Antworten darauf zu finden. Die möglichen Gefahren der Untiefen im dahinschnellenden Strom des allgemeinen Lebens, die dem Ahnungslosen immer und überall auflauerten, interessierten ihn nicht. Er hatte keine Angst vor irgendetwas oder irgendjemand.
Das Wichtigste im Augenblick, das freie Wochenende, lag vor ihm.
Ein Wochenende / Spätsommer 1976
Peter frönte im fast menschenleeren, baumbestandenen, schattigen Gartenlokal, in das hinein die Sonne Bündel gleißenden Lichtes schickte, der Atmosphäre eines verträumt verschlafenen, sommerlichen Sonntagnachmittags. Mit sich und der Welt zufrieden kam es nur darauf an, die Lage des Gartenstuhles so zu wählen, dass die Sonnenstrahlen seinen Körper erfassten, während der Kopf im Schatten verblieb. Um in dieser angenehmen Stellung zu verbleiben, musste gelegentlich die Position verändert werden, ein Akt, der trotz der Schläfrigkeit des Tages daran erinnerte, dass der Wunsch einer Zeitlosigkeit Illusion war. Dennoch schien sie ihm an diesem Tag fast Wirklichkeit geworden, verstärkt durch den Anblick und die Ruhe mächtiger, durch keinen Windhauch bewegter Bäume der ihm gegenüberliegenden Hasenheide, die sich als gewaltige grüne Lunge für die Arbeiterviertel Kreuzberg und Neukölln ausbreitete, heute jedoch den Tieren überlassen nicht im Geringsten den Namen eines Volksparkes verdiente. Auch auf der vom Werktagsverkehr so gänzlich befreiten Straße, über der die Luft still flimmerte, lag eine besänftigende Stille, und der ansonsten belebte U-Bahnschacht Südstern zählte keine Menschenseele. Im Gegensatz zum überwiegenden Rest der heimischen Bevölkerung nutzte er den heutigen Tag nicht, um der gewohnten zur Routine gewordenen alltäglichen Anwesenheit einmal bei strahlendem Wetter zu entfliehen. Die alles ergreifende Stille und der unwirkliche Anblick der entvölkerten Stadt waren ihm hingebungsvolles Glücksgefühl genug. Wie die von ihren Bewohnern verlassenen Häuser verharrte auch er in ausgeglichener Geduld auf deren Rückkehr und hatte die Gewissheit, dass noch heute in den Abendstunden zum Ausklang des sonnigen Tages und zur Beruhigung der erhitzten Gemüter eine letzte geruhsame Feierlaune einkehren würde, auf die die Kellnerin, um ihr Portemonnaie zu füllen, so sehnlichst wartete.
Bei jedem Atemzug spannte sich das enganliegende taillierte Seidenhemd über dem Brustkorb und die silbrig glänzende Gürtelschnalle blinkte hell im Sonnenlicht. Die länger gewordenen, gescheitelten Haare hatte er hinter die Ohren verbannt und seinen bislang kurz gehaltenen Vollbart endgültig dem Sommer geopfert. Eine selbstversunkene Verliebtheit bemächtigte sich seiner, und die Einzige, die hierzu befähigt und eine Rückmeldung über sein Äußeres hätte geben können, da ihm ein Spiegel nicht zur Verfügung stand, war die adrette junge Bedienung, die gelegentlich müßig gelangweilt eine Zigarette rauchte. Um sie nicht direkt mit seiner Person zu konfrontieren, könnte er ein Gespräch derart beginnen, ob sie auch aus Kreuzberg sei und im Gegenzug dazu ihr berichten, in welchem der hohen schnurgeraden, aneinandergereihten Straßenhäusern seine Wohnung war. Nicht mehr wie zu seiner Studentenzeit in einem der Hinterhöfe, sondern nach vorne heraus, von einem wuchtigen Balkon geschmückt, dessen geschwungenes, eisernes Geländer mit den zierenden Ornamenten diesen Mietskasernen die ihnen innewohnende Trostlosigkeit nahmen.
Die wohltuend empfundene Faulheit und durch die Sonne begünstigte Trägheit hielten ihn jedoch von jeglichen aktiven Vorhaben ab. Genüsslich erinnerte er sich, der Prophezeiung des vierschrötigen Taxifahrers Kurt getrotzt zu haben, als dieser Peters damalige lauthals verkündete Begeisterung, glücklich in Kreuzberg zu leben, als allgemeine Belustigung ansah und nicht wissen wollte, wie schnell diese prahlerische Behauptung nach akademischer Ausbildung keinen Wert mehr besaß.
„Ich bleibe für immer und ewig hier, aber ihr Studenten seid irgendwann aus dem Proletenviertel wieder verschwunden.“
Nein, Peter nicht, zugegebenermaßen seine langjährige Studentenbude im Hinterhof, kein Bad, Toilette auf halber Treppe und ein immer zu Unzeiten warmer Kachelofen war passé, nur noch nostalgische Erinnerung. Der Wechsel von der dunkle Seite des Mondes in die helle sonnenbeschienene war vollzogen, als er es sich leisten konnte, nach dem bestandenen Staatsexamen erstmals Geld verdiente.
Das Staatsexamen / Winter 1975
Als Peter die mächtige steinerne Freitreppe hinunterstieg, fiel ihm mit jeder Stufe, die er nahm, eine Last von annähernd deren Gewicht von den Schultern. Ein plötzliches Glücksgefühl erzeugte eine frostige Gänsehaut, lud seine Haare elektrisch auf und sein Herz begann wie wild zu schlagen. Er griff nach dem glattpolierten Treppenlauf, um nicht zu taumeln und hielt den Kontakt. Unten angekommen, löste er zögernd, aber dann entschlossen die Hand und hatte in diesem Moment endgültig die Nabelschnur zur Alma Mater durchtrennt. Wie um sich zu überzeugen, warf er die Hände in die Luft, spürte seine ungestüme Kraft, stürmte durch die Eingangstür und sprang in einem Satz die Stufen des Portals hinunter, ins Freie. Die universitären Strukturen lagen hinter ihm.
Gierig atmete er die frische Luft ein und stieß sie mit einen langgezogenen Schrei wieder aus, wie ein Neugeborener, der das Licht der Welt erblickt. Die Zukunft lag hoffnungsvoll vor ihm. Sein Körper entspannte sich, die Enge des geschlossenen Raumes lag hinter ihm, vor ihm die Allee, die in ein Reich voller phantastischer Vorstellungen hinausführte.
Mit dem heutigen Tag ging ein sechsjähriges Studium zu Ende, eine Zeit voller gedanklichen Reichtums, Wissensakkumulation und Erkenntnissen. Ein Lebensabschnitt, den er geliebt und der ihn ausgefüllt hatte, geborgen im Schoß der Universität und dem abschließenden Zwang der Examensgeburt, begleitet von den anstrengenden Wehen akademischer Prüfungen. Die akademischen Hebammen waren Vergangenheit. Ein frisch geborener Mediziner schaute ins gleißende Licht der höher steigenden Sonne, das beständig an Intensität gewann. Ein vollkommen neuer Lebensabschnitt lag vor ihm. Die dickleibigen mit Wissen gespickten Fachbücher auf seinem Schreibtisch, die sich bis auf Augenhöhe stapelten, ihm die freie Sicht versperrten und um den Schreibtisch herum auf dem Fußboden gruppiert waren, teilweise aufgeschlagen, an wichtigen Stellen markiert, würde er in einem letzten Akt würdevoller Zuneigung dem Regal anvertrauen und ihnen noch einmal anerkennend über den Buchrücken streicheln, in ergebener Freundschaft.
Lautes Zurufen riss ihn aus seinen Träumen, holte ihn zurück in die Gegenwart. Deutlich erklang sein Name: „Peter, Peter, warte, warte!“
Normas helle und Holgers dunkle, rauchige Stimme mischten sich, und er staunte, wie er sie im Moment seiner hingebungsvollen Ergriffenheit vergessen konnte. Norma hatte ihn eingeholt, ergriff seinen Arm. „Komm, ein Foto, eine Erinnerung!“
Er blickte in ihr erhitztes, gerötetes Gesicht, welches ihm erstmals sei langem wieder glücklich schien, befreit vom Joch des monatelangen Staatsexamens, für dessen würdevolle Ernsthaftigkeit sie sich in eine weiße Bluse und ein schwarzes Kostüm, würdig ansprechend gekleidet hatte, jetzt durch einen hellen, offenen Wintermantel ungenügend bedeckt. Die langen schwarzen Haare umrahmten ein blasses, von starken Wangenknochen geprägtes ernstes, edles Gesicht, die rehbraunen Augen funkelten vor Erregung. Sie hängte sich bei Peter ein. „Lauf nicht fort, schnell ein Bild zur Erinnerung, Holger hat schon alles vorbereitet.“
Vergnügt lächelnd, von schmächtiger Statur, mit einem ungebändigten Kraushaar stand dieser, beide Hände tief in den Manteltaschen vergraben, vor dem Portal des langgezogenen, roten, mit Efeu bewachsenen Backsteinbaues aus der Gründerzeit, dem Hauptgebäude der Psychiatrischen Anstalten, inmitten eines Parkes, in welchem verschlungene Wege zu weiteren Häusern, viele im Wald verborgen, führten und Insassen beherbergte, die hier fernab der realen Welt in einem Eigenleben verharrten. Holger, dessen energisches Selbstbewusstsein Peter immer bewundert hatte, außer wenn es in eine unangebrachte Sturheit umschlug, kam ihnen jetzt gestikulierend entgegen. Trotz des vollständig zugeknöpften Mantels und des langen, wollenen, weißen Schals, einmal um den Hals geschlungen, war es ihm anzusehen, dass er fror. Ein Umstand, der ihn jedoch nicht irritierte. Er deutete auf einen Portalsockel, hakte sich an der noch freien Seite von Norma ein, so dass diese in die Mitte kam und bugsierte die beiden in Stellung. Sein herzhaftes Lachen animierte zum Mitlachen.
„Selbstauslöser, dort drüber steht die Kamera, eben hat es Klick gemacht, garantiert kein gestelltes Bild. Kommt und lasst uns die Irrenanstalt verlassen.“
Übermütig wurde Peter an die Schultern genommen, geschüttelt und anerkennend auf die Schulter geklopft: „Tolle Prüfung, kauziger Typ, Mann ist der in Fahrt gekommen.“
„Deinen Enthusiasmus, den du Peter zukommen lässt, hätte ich nach der Prüfung gerne auch mir gegenüber gewünscht, zu mir hast du nur „gut gemacht“ geäußert“, maulte Norma verdrießlich, „deine Leidenschaft zu mir ging sowieso mit jeder weiteren Prüfung ein Stück bergab. Ich glaube, du wirst froh sein, wenn ich zu meinen Eltern abreise.“
„Mitnichten!“ Holgers Antwort kam schnell und prompt, „Ich werde dir folgen.“
Mit einem Hoffnungsschimmer in den Augen blickte ihn Norma sehnsüchtig an. Sie hing an ihm.
Holger griff sein Thema wieder auf: „Genial, wie du den in Stimmung gebracht hast, ansonsten als bösartig verschrien, schmeißt er uns die guten Noten jetzt nur so hinterher. Hat leider keine große Bedeutung mehr für die Gesamtnote. Die Psychiatrie und Neurologie sind nur ein Appendix der Gesamtprüfung mit einfacher Multiplikation.“
„Du mit deinem analytischen Verstand musst immer zu allem deinen sachlichen Kommentar abgeben, anstatt dich heute nur ganz einfach zu freuen, dass wir das Staatsexamen bestanden haben.“ Trotzig blickte Norma Holger an, der aber nicht auf sie einging, sondern seinen Gedankengang fortsetzte. „In der Prüfungsordnung und im Allgemeinen nur ein kleines Fach, aber für mich nimmt es den Stellenwert wie ein großes ein. Was ist bedeutungsvoller als das Gehirn?“
„Kann jedoch nicht allein existieren, taugt nur im Verbund des menschlichen Körpers, und für dich zählt anscheinend nur das Denken, die Intelligenz, die Vernunft. Aber wenn für dich das Gehirn bedeutungsvoll ist, so musst du wenigstens anerkennen, dass dort auch das gefühlsmäßige Erleben beheimatet ist, welches bei dir zur Zeit zu kurz kommt.“
Peter kannte diese und ähnliche Diskussionen aus letzterer Vergangenheit, anfangs noch zaghaft geführt, aber zunehmend augenfälliger. Partei wollte er nicht ergreifen, schritt stattdessen in die Allee hinein. Hier in dieser Anstalt hatten in der Vergangenheit altehrwürdige Irrenärzte, wie sie sich früher nannten, eine kleine verschworen Gemeinde, sich ihrer Irren angenommen, sie hier verwahrt und auch mit ihnen gelebt. Heute nannten sie sich Ärzte für Neurologie und Psychiatrie, wohnten entfernt und waren stolz darauf, über wirksame Möglichkeiten der medikamentösen Therapie zu verfügen.
Der ihn prüfende Professor Ernst Ganglier war tatsächlich ein schrulliger Typ gewesen. Fast ein Fossil aus alter Zeit, im grauen Anzug, grauhaarig, mit tiefen Gesichtsfurchen, aber lebhafter Mimik und wissbegierigen Augen. Im Verlauf der Prüfung hatte sich gezeigt, doch nicht so verstaubt zu sein, wie er aussah, sondern auch durchaus Anteilnahme zeigen konnte.
„Eine heterogene Gruppe“, war seine Meinung nach eingehender Musterung der drei. Zu groß war der Unterschied in ihrer Kleidung, Gestik und Verhalten. Norma in schwarzweiß, ruhig, fast demütig, Holger bunt und zappelig, Peter gleichmütig, mit altmodischem Jackett und gefasst.
Ganglier war ein paarmal mit forschem Schritt im Zimmer auf- und abgegangen, ohne sie aus den Augen zu lassen, hatte sie dann aufgefordert, auf den Stühlen vor seinem riesigen Schreibtisch Platz zu nehmen und es sich selber in einem Lehnstuhl bequem gemacht, indem er zusätzlich die Beine auf einem Schemel ausstreckte.
„Im jahrelangen Umgang mit Menschen geübt, versuche ich immer mir zunächst vom rein Äußeren her, ein Urteil zu bilden, bevor ich aus der Unterhaltung meine Rückschlüsse ziehe. Sie haben meine Neugier geweckt. Ein Arzt stellt eine Persönlichkeit dar, gepaart mit Wissen. Heute geht es aber mehr um ihr Wissen, die Persönlichkeit kommt noch.“
Bedeutungsvoll blickte er um sich. Peter hatte das Gefühl einer obrigkeitsgeführten Anhörung mit diffamierenden Vorurteilen, spürte eine Beklemmung, die ihn wütend machte, Holger neben ihm machte ebenfalls ein missbilligendes Gesicht, und Norma schien in ihrem Stuhl immer kleiner zu werden. In dieser aufkommenden unheilvollen Atmosphäre richtete Ganglier mit fester Stimme die Frage an Peter: „Nach James Parkinson wurde eine Krankheit benannt. Was können sie darüber berichten?“
Schlagartig waren alle hellwach und auf das Thema konzentriert.
Volltreffer! Die Lektüre vom gestrigen Abend, „James Parkinson“ von Norbert J. Pies, einer der „Piesacker“. Peter sammelte sich, zögerte, aber nur um die Spannung zu steigern, während die Blicke aller auf ihm ruhten. Zunächst langsam, dann schnell und sicher arbeitete er sich durchs Thema.
„James Parkinson war der Erstbeschreiber dieser nach ihm benannten Erkrankung. 1817, sieben Jahre vor seinem Tod, er wurde 69 Jahre alt, erschien sein „Essay on the Shaking Palsy“, die Schüttellähmung, deren Auffälligkeiten er nach der Beobachtung an sechs Patienten, von denen er nur einen genauer untersuchte, beschrieb.
Die Symptome Tremor, Akinese und zusätzlich der Rigor sind die Trias, die das Krankheitsbild umreißen, wobei am auffälligsten der Tremor, das Zittern ist, häufig zunächst einseitig. Die Akinese beschreibt die vornübergebeugte Haltung mit der eingebundenen Motorik und dem maskenhaft erstarrten Gesicht, der Rigor den wächsernen zahnradförmigen Widerstand der Muskulatur. Die Füße kleben am Boden, das Gangbild ist kleinschrittig, haftend, umdrehen nur mit mehreren Zwischenschritten möglich, das Schriftbild verkümmert mikrographisch, jeder Schwung geht verloren, die Arme kleben am Körper und einmal angestoßen zum Laufen wird der Kranke zum Perpetuum mobile, den erst das Hindernis, eine Wand, ein Baum bremst. Der Speichelfluss und der Salbenglanz des Gesichtes offenbaren zusätzlich den bedauernswerten Zustand, welcher nur noch übertroffen wird von der allmählich einsetzenden geistigen Verkümmerung, gepaart mit einer häufig noch vor Krankheitsbeginn beginnenden Depression. Die Steifigkeit in der Nacht mit der Unfähigkeit sich kaum oder nicht umdrehen zu können, macht diese zur Qual und nur noch flüsternd kann sich der Kranke verständlich machen. Diese Symptome, die zu Beginn der Erkrankung nur gering ausgeprägt und nicht immer sofort zu erkennen sind, bestimmen die Diagnose. Sie ist klinisch zu treffen, das heißt durch die Untersuchung. Es ist keine Lähmung, es besteht nur der Eindruck, hervorgerufen durch die krankheitsbedingte Eingebundenheit der Körpermuskulatur. Wissenschaftlich lautet die Beschreibung der Krankheit „Extrapyramidales Syndrom vom akinetisch-rigiden Typ“, aber das wissen nur die Fachleute.“
Ganglier nickte anerkennend, und Peter fuhr rasch fort.
„70 Jahre nach der Erstbeschreibung verwendete der berühmte französische Neurologe Jean-Martin Charcot erstmals das Eponym „Parkinsonsche Erkrankung“ und verhalf Parkinson zum Weltruhm. Es ist selten, dass eine Krankheit ausschließlich unter einem persönlichen Namen bekannt ist. Parkinson selber hatte seiner Arbeit keinen allzu großen Stellenwert beigemessen. Eine Ironie der Geschichte.“
Eine zunehmende Ergriffenheit bemächtigte sich Ganglier, der sich im Glanz und Ruhm dieses berühmten Irrenarztes zu reflektieren schien, rasch jedoch fing.
„Und die Therapie?“
Auch jetzt konnte Peter mithalten.
„Die Erkenntnis unter anderem des Wiener Neurologen Walther Birkmayer, dass der Parkinsonschen Erkrankung ein biochemisches Defizit des körpereignen Neurotransmitters Dopamin zugrunde liegt, das im kranken Gehirn nicht mehr im notwendigen Ausmaß durch den Untergang von Nervenzellen in der substantia nigra produziert wird, aber als Medikament durch den Trick einer Vorstufe, Levodopamin, welche die Blut-Hirnschranke zu passieren vermag, ersetzt werden kann, lindert die klinischen Symptome der Kranken. Mehrmals am Tag aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit eingenommen, befreit es den Kranken aus seiner zitternden Fesselung und verhilft ihm wieder zu verbesserten koordinierten Bewegungen.“
Ganglier hatte sich in einem Anflug von Zustimmung und Freude über eine therapeutische Effizienz in seinem Sessel aufgerichtet und seine Füße vom Schemel genommen, war aber sitzengeblieben.
„Noch eine Frage, diesmal aus der Psychiatrie, was versteht Freud unter Traumdeutung?“
Auf Peters Oberlippe bildeten sich leichte Schweißperlen. Eine spontane Leere durchflutete sein Gehirn, dann riss er sich zusammen. Wie wild wirbelte es durch sein Gehirn, das „Ich“ und das „Es“ und dazu noch ein „Über-Ich“. Die schlummernden Triebe, deren Kontrolle durch das Ich und darüber noch das Über-Ich mit seinen moralischen Zwängen, entstanden aus der Tradition von Generationen. Bloß nicht in diesem theoretischen Denkansatz straucheln, untergehen, den kleinstmöglichen Nenner suchen. Ganglier ist Psychiater, kein Psychoanalytiker, auch wenn er vorgibt, etwas davon zu verstehen.
„Freud geht davon aus, dass der Traum als vollgültiges psychisches Phänomen einen Sinn hat und zwar den einer Wunscherfüllung. Zum Beispiel, wenn ich davon träume im Examen zu glänzen, da ich der Meinung bin, sehr viel gelernt zu haben, wach aber sehr schnell meine Lücken erkenne und rasch wieder zu den Büchern greife.“
Ein verschmitztes Lächeln glättete Gangliers faltiges Gesicht und noch bevor eine weitere Frage ihn verunsichern konnte, fuhr Peter fort:
„Der Traum ist die verkleidete Erfüllung eines unterdrückten, verdrängten Wunsches und wird dadurch nach Freud zum Hüter unseres Schlafes. Die meisten Träume sind jedoch derart entstellt, dass der zugrundeliegende Wunsch erst mittels einer analytischen Traumdeutung zu entschlüsseln ist.“
Das Herz schlug ihm bis zum Halse, ein kaum wahrnehmbares erschöpftes Schweigen folgte und Ganglier hatte gutgelaunt ein Einsehen. „Danke, das genügt, bitte nicht noch die Biographie von Freud.“
„Geschafft!“ Peter lehnte sich erleichtert zurück, während Normas Haltung sich straffte. Sie schlug sich wacker, kämpfte, Holger danach mit lässiger Eleganz, verfügte er doch über das sicherste Fachwissen.
Zum Schluss der Prüfung war Ganglier gutgelaunt aufgestanden und hatte sich überaus zufrieden gezeigt. „Eine heterogene Gruppe erbringt eine exzellente homogene Leistung, gratuliere, sie waren allesamt sehr gut. Es hat mir Spaß gemacht, sie zu prüfen.“
Spaß hatten die Drei beileibe nicht empfunden, auch nicht vermitteln wollen. Eine aufkeimende Wut ging in dem Gefühl einer ungeheuren Erleichterung unter. Beglückt, von einer beengenden Anspannung befreit und sich selber zum eigenen Beweis verkündete Norma aufgeregt, dass dies ihre letzte Prüfung gewesen war. Neugierig interessiert griff Ganglier das Thema auf, frug nach ihren Berufswünschen und gab ihnen leutselig mit auf den Weg, sich nicht dem Fach der Nervenheilkunde, dem spannendsten und interessantesten der Medizin, zu verschließen. Seine Hände gestikulierten begeistert, bevor er die ihrigen zum Abschied schüttelte.
Niemand war zu ihrer Begrüßung erschienen, Holgers Eltern lebten begütert ein sonniges Rentnerdasein auf Mallorca. Sie schämten sich seiner extravaganten Art. Norma war deutschstämmige Amerikanerin aus Pennsylvania. Ihre Eltern erwarteten sie alsbald in Pittsburgh, und Peters Eltern waren ungenügend informiert. Sie würden alles noch rechtzeitig genug erfahren.
Ein halbes Jahr, solange kannte Peter Holger und Norma, die beiden sich als Studenten seit Jahren. Ein eiserner Wille hatte sie geprägt, das Staatsexamen zu bestehen. Über ein Dutzend Prüfungen lagen hinter ihnen. In dieser Zeit war eine wechselvolle Beziehung aus Zuneigung, Selbstbehauptung und Enttäuschungen entstanden. Sie hatten nach jeder bestandenen Prüfung ausgiebig miteinander gefeiert, waren sich zwischendurch aus dem Weg gegangen, aber immer die festgelegten Stunden des gemeinsamen Lernens eingehalten, ja sogar gerne gehabt. Und jetzt das Aus. Ein jeder hatte individuelle Wünsche. Der Beruf würde sie trennen. Norma wollte Kinderärztin werden, Holger schwärmte für die Psychiatrie, und Peter reichte es vorläufig zu wissen, dass ihm die medizinische Welt offenstand. Dass sie gemeinsam an einem Krankenhaus oder an einem Ort würden arbeiten können, war unwahrscheinlich. Norma würde bald abreisen, vermied es, darüber zu sprechen. Die Tränen schossen ihr dann in die Augen.
An der Pforte der Anstalt, die letzten Meter waren sie schweigend, nachdenklich gegangen, sahen sie sich fragend, fast hilflos an an, wussten einen Moment nicht, was miteinander anfangen. Es gab keine verpflichtende Klammer mehr, ein jeder war sich selber überlassen.
„Ich werde jetzt eine Woche im Bett zu verbringen“, verkündete Norma.
„Auf einer einsamen Insel mit dir“, schloss sich Holger an, „und dann mache ich das amerikanische Staatsexamen, um dir zu folgen, du wirst es ja in den Staaten machen. Mal sehen ob Amerika mir eine Alternative bietet.“
Norma warf ihm einen ironischen Blick zu: „Beeil dich, damit du nicht zu viel vergisst.“
In Peter kam Feierlaune auf, des weiteren ein momentaner Heißhunger und der Gedanke an ein belohnendes gemeinsames Mahl: „Ich kenne da ein sehr gutes bürgerliches Lokal, „Zur Kesselschmiede“, die haben das beste Eisbein weit und breit, mit original Berliner Erbspüree und dazu ein ordentliches Bier. Meine Einladung an euch steht, schon mal als Vorgriff auf meinen Geburtstag. Das erste Abschnitt unseres Lebens geht vorbei, wahrscheinlich die beste Zeit. Was gibt es Schöneres als die Freiheit des Studentenlebens, die Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Verpflichtungen, die großartige Meinungsfreiheit, die Hingabe an Utopien und die Möglichkeit nach eigenem Ermessen das Leben zu gestalten? Nur der Studienplan war ein Muss. Jetzt wird es ernst. Gönnen wir uns etwas zum Abschied.“
Sein Vorschlag wurde mit Begeisterung aufgenommen, und versetzte sie in eine freudige Hochstimmung, bestimmt vom Lebenstrieb der körperlichen Erhaltung.
Die folgenden Tage verspürte Peter eine anhaltende, eigenartige innere Leere, wie ein Fall ins Bodenlose. Dennoch war dieses Gefühl nicht unangenehm, eher wie das einer Feder, die durch die Luft nach unten taumelt, nicht zu Schaden kommt. Immer wieder trägt sie ein Windstoß nach oben. Ein sorgloser einsamer Tanz, der keines Publikums bedarf, sich ganz allein gewidmet ist.
Der noch nicht vertraute Müßiggang irritierte ihn. Er kramte in seinem Haushalt, sortierte Papiere und Briefe, überflog sie noch einmal, ohne wirklich darauf einzugehen. Möbel wurden verschoben, neu gerichtet, ergaben deshalb keinen wesentlich besseren Sinn, aber alles sah ein wenig anders aus. Das ein oder andere Buch lud zum Schmökern ein, er achtete neben dem Inhalt auf Stil, Sprache, Wortschatz, assoziierte dieses mit seinen Fähigkeiten, zog Rückschlüsse auf die Autoren, die sie geschrieben hatten, versetzte sich in deren Gedankenwelt und wie sie gelebt haben mochten, der geniale Dichterfürst, der elegante Bourgeois, der philosophische Denker, der abstrakte Intellektuelle, der lässige Bohème, der lebenshungrige Abenteurer, der radikale Ideologe, der konkrete Politiker. Ein Jeder offenbarte sich dem begierigen, neugierigen, staunenden Leser. Teilweise den Medien, Erzählungen und Diskussionen entnommen, erinnerte er ihrer Biographien, durchspielte ihre Lebensumstände, stellte sich vor, einer der ihren zu sein, identifizierte sich mit ihnen. Es kam ihm nicht darauf an, wie sie wirklich ihr Leben gemeistert hatten, sondern es reichte ihm, sich vorzustellen, wie sie gelebt haben mochten. Passagen aus ihren Büchern wurden dann vor seinen Augen lebendig, beflügelten seine Phantasie.
Mit der Musik verhielt es sich ähnlich, obwohl er ihr weniger verbunden war, hörte provozierende, aufrüttelnde, grelle, fetzige, sanfte und nachdenkliche Lieder, lauschte den Jazzkapellen und genoss die Klassiker.
Der bedächtig zuhörende, gemütlich dreinblickende Bankangestellte der Stadtsparkasse, der ihm aus dicken Brillengläsern freundlich zublinzelte, stellte kaum Fragen auf Peters Bitte nach einem Kleinkredit, verhehlte nicht seine Bewunderung für den jungen Arzt aus, trug die Personalien in ein Formular ein, bestimmte einen Zinssatz und Rückzahlungsmodalitäten, die Peter gleichgültig waren, und begleitete ihn zur Kasse, wo er wohlwollend nickte, als der Kassierer die Scheine vorzählte und in einem Briefumschlag aushändigte. Peter hatte das Gefühl, dem heimischen Kolonialwarenhändler ein gutes Geschäft beschert zu haben und sich selber einen guten Einkauf. Das Geld tief in der Hosentasche verborgen und im festen Griff seiner Hand machte er sich auf den Weg, es wieder auszugeben.
Der Automobilverkäufer war um einiges eloquenter, redete und gestikulierte viel, und als Peter Interesse an einem dem Aussehen nach guterhaltenen, dunkelgrünen Opel Rekord bekundete, vertrat er die Meinung, dass dieser das Angebot des Monats wäre. Nach einigem Feilschen einigten sie sich auf einen Preis, der vom Verkäufer mit einem wegwerfenden Geste bedacht, von Peter wohl als grenzenlose Güte angesehen werden sollte, das Auto fast geschenkt zu bekommen. Allerdings verzichtete er darauf, sich zu bedanken. Und als der Händler das Bargeld annahm, gewann sein Gesicht den zufriedenen Ausdruck eines Mannes, der nun wieder in der Lage war, seine Familie für die nächste Zeit über Wasser zu halten.