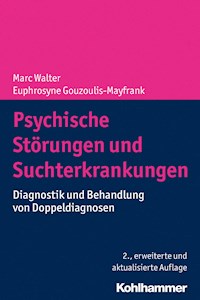
Psychische Störungen und Suchterkrankungen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch behandelt systematisch und umfassend die häufig auftretenden Komorbiditäten von Suchterkrankungen mit anderen psychischen Störungen. Aus psychiatrisch-psychotherapeutischer sowie suchttherapeutischer Perspektive werden die Besonderheiten des gemeinsamen Auftretens und das spezielle therapeutische Vorgehen nach aktuellen evidenzbasierten Studienergebnissen ausgeführt. Eine exakte Anamnese unter Berücksichtigung der Zeitabfolge des Auftretens der verschiedenen Symptome und Beschwerden ist essenziell. Sie ermöglicht erst eine korrekte Diagnose und ist die Basis für die Behandlungsplanung. Das Werk bietet praxisorientierte Lösungen für die häufigen Probleme der Diagnostik und Therapie von "Doppeldiagnosen" und den Umgang mit häufig als herausfordernd erlebten Patienten im klinischen Versorgungsalltag. Die 2. Auflage ist vollständig aktualisiert, zudem sind zwei neue Kapitel zu den wichtigen Themen Diagnostik/Klassifikation sowie Medikamentenabhängigkeit ergänzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Herausgeber, die Herausgeberin
Prof. Dr. med. Marc Walter, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Medizinstudium in Göttingen und Berlin. Assistenzarzt an der Medizinischen Klinik der Charité in Berlin und an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel. Forschungsaufenthalt an der Harvard Medical School in Boston. Gegenwärtig Chefarzt und stv. Direktor, UPK Basel und Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Basel. Forschungsschwerpunkte sind Suchtmedizin, Persönlichkeitsstörungen und Psychotherapie.
Prof. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, MHBA, Ärztin für Neurologie und Psychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie. Medizinstudium in Mainz, Weiterbildung an den Universitätskliniken Freiburg und Aachen. Habilitation am Universitätsklinikum Aachen, 2003 bis 2008 C3-Professur für experimentelle Psychiatrie am Universitätsklinikum Köln. Seit 2008 Ärztliche Direktorin der LVR-Klinik Köln, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu Köln und Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 2016 Direktorin des LVR-Instituts für Versorgungsforschung.
Marc Walter Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank (Hrsg.)
Psychische Störungen und Suchterkrankungen
Diagnostik und Behandlung von Doppeldiagnosen
2., erweiterte und aktualisierte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
2., erweiterte und aktualisierte Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-035049-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-035050-2
epub: ISBN 978-3-17-035052-6
mobi: ISBN 978-3-17-035053-3
Herausgeber- und Autorenverzeichnis
Die Herausgeberin, der Herausgeber
Prof. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, MHBA
LVR-Klinik Köln, Fachklinik für Psychiatrie und PsychotherapieAkademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu Kölnund LVR-Institut für VersorgungsforschungWilhelm-Griesinger-Str. 23, D-51109 Köln
Prof. Dr. med. Marc Walter
Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) BaselWilhelm Klein-Str. 27, CH-4002 Basel
Die Autorinnen und Autoren
Prof. Dr. med. Anil Batra
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie TübingenCalwer Str. 14, D-72076 Tübingen
Prof. Dr. med. Stefan Bleich
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und PsychotherapieMedizinische Hochschule HannoverCarl-Neuberg-Str. 1, D-30625 Hannover
Prof. Dr. med. Stefan Borgwardt
Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) BaselWilhelm Klein-Str. 27, CH-4002 Basel
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. h.c. Dipl.-Psych. Dipl.-Soz. Gerhard Dammann, MBA
Psychiatrische Dienste ThurgauAkademisches Lehrkrankenhaus der PMU SalzburgPsychiatrische Klinik MünsterlingenSeeblickstr. 3, CH-8596 Münsterlingen
Dr. phil. Kenneth M. Dürsteler
Zentrum für AbhängigkeitserkrankungenUniversitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) BaselWilhelm Klein-Str. 27, CH-4002 Basel
Prof. Dr. med. Dr. disc. pol. Andreas G. Franke, M.A.
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)Seckenheimer Landstr. 16, D-68163 Mannheim
Dipl.-Psych. Johanna Grundmann
Klinik für Psychiatrie und PsychotherapieUniversitätsklinikum Hamburg-EppendorfZentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS)Martinistr. 52, D-20246 Hamburg
Prof. Dr. med. Thomas Hillemacher
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapieder Paracelsus Medizinischen Privatuniversität am Klinikum NürnbergProf.-Ernst-Nathan-Str. 1, D-90419 Nürnberg
Dr. med. Maria Hofecker Fallahpour
Spalenring 160, CH-4055 Basel
Prof. Dr. phil. Franz Moggi, EMBA
Universitäre Psychiatrische Dienste BernUniversitätsklinik für Psychiatrie und PsychotherapieBolligenstr. 111, CH-3000 Bern 60
Priv.-Doz. Dr. phil. Sylvie Petitjean
Zentrum für AbhängigkeitserkrankungenUniversitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) BaselWilhelm Klein-Str. 27, CH-4002 Basel
Prof. Dr. med., MPH Ingo Schäfer
Klinik für Psychiatrie und PsychotherapieUniversitätsklinikum Hamburg-EppendorfZentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS)Martinistr. 52, D-20246 Hamburg
Prof. Dr. med. Michael Soyka
Medical Park ChiemseeblickRasthausstr. 25, D-83233 BernauundKlinik für Psychotarie und PsychotherapieKlinikum der Universität MünchenNußbaumstr. 7, D-80336 München
Prof. Dr. Dipl.-Psych. Christina Stadler
Universitäre Psychiatrische Kliniken BaselKinder- und Jugendpsychiatrische KlinikSchaffhauserrheinweg 55, CH-4058 Basel
Prof. Dr. rer.nat. Rolf-Dieter Stieglitz
Fakultät für PsychologieUniversität BaselMissionsstr. 62a, CH-4055 Basel
Priv.-Doz. Dr. med. Rudolf Stohler
Praxis AquilaBahnhofplatz 1, CH-4133 Pratteln
Priv.-Doz. Dr. med. Bert T. te Wildt
LWL-Universitätsklinik für Psychosomatische Medizinund Psychotherapie, Ruhr-Universität BochumAlexandrinenstr. 1–3, D-44791 Bochum
Dr. rer. biol. hum. Dipl.-Psych. Andrija Vukic´evic´
Psychotherapeutische PraxisMarktstr. 51/52, D-30159 Hannover
Prof. Dr. med. Gerhard A. Wiesbeck
Zentrum für AbhängigkeitserkrankungenUniversitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) BaselWilhelm Klein-Str. 27, CH-4002 Basel
Dr. med. Dipl.-Psych. Johannes Wrege
Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) BaselWilhelm Klein-Str. 27, CH-4002 Basel
Inhalt
Herausgeber- und Autorenverzeichnis
Vorwort
Vorwort zur 2. Auflage
Teil I Grundlagen
1 Psychiatrische Klassifikationssysteme und Komorbidität
Rolf-Dieter Stieglitz
1.1 Einleitung
1.2 Historische Anmerkungen
1.3 Das Komorbiditätsprinzip in den aktuellen Klassifikationssystemen
1.4 Erhebungsinstrumente von Komorbidität
1.5 Zusammenfassung
2 Theoretische Modelle zur Komorbidität psychischer Störungen und Sucht
Franz Moggi
2.1 Einleitung
2.2 Modelle von spezifischen Komorbiditäten
2.3 Zusammenfassung
3 Psychodynamische Aspekte der Komorbidität
Gerhard Dammann
3.1 Einleitung
3.2 Die Bedeutung von komorbiden Störungen und von Doppeldiagnosen
3.3 Narzissmus und Abhängigkeitserkrankungen
3.4 Aspekte der psychodynamischen Diagnostik
3.5 Gegenübertragungsreaktionen
3.6 Implikationen für die psychodynamische Psychotherapie
3.7 Zusammenfassung
4 Neuropsychiatrische Grundlagen der Komorbidität
Johannes Wrege und Stefan Borgwardt
4.1 Einleitung
4.2 Grundlagen von Bildgebungsmethoden in der Neuropsychiatrie
4.3 Epigenetik und Neuropsychiatrie
4.4 Bildgebungsbefunde spezifischer neuropsychiatrischer Krankheitsbilder und Sucht
4.5 Impulsivität als Endophänotyp neuropsychiatrischer Erkrankungen
4.6 Zusammenfassung
5 Therapeutische Grundprinzipien bei Doppeldiagnosen
Kenneth M. Dürsteler und Gerhard A. Wiesbeck
5.1 Einleitung
5.2 Integrativer Behandlungsansatz
5.3 Grundsätze und Komponenten der integrativen Behandlung
5.4 Beziehungsaufbau und -gestaltung
5.5 Diagnostik und individuelle Behandlungsplanung
5.6 Störungsspezifische integrative Therapieprogramme
5.7 Integration der Pharmakotherapie
5.8 Zusammenfassung
6 Medikamentöse Rückfallprophylaxe bei Doppeldiagnosen
Gerhard A. Wiesbeck und Kenneth M. Dürsteler
6.1 Einleitung
6.2 Acamprosat
6.3 Naltrexon
6.4 Disulfiram
6.5 Bupropion
6.6 Vareniclin
6.7 Nalmefen
6.8 Zusammenfassung
Teil II Psychische Störungen und komorbide Suchterkrankungen
7 Psychotische Störungen und komorbide Suchterkrankungen
Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
7.1 Einleitung
7.2 Epidemiologie
7.3 Modelle für die Komorbidität
7.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
7.5 Therapie
7.6 Fazit für die Praxis
8 Affektive und Angststörungen und komorbide Suchterkrankungen
Michael Soyka
8.1 Einleitung
8.2 Epidemiologie
8.3 Modelle für die Komorbidität
8.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
8.5 Therapie
8.6 Fazit für die Praxis
9 Posttraumatische Belastungsstörung und komorbide Suchterkrankungen
Johanna Grundmann und Ingo Schäfer
9.1 Einleitung
9.2 Epidemiologie
9.3 Modelle für die Komorbidität
9.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
9.5 Therapie
9.6 Fazit für die Praxis
10 ADHS und komorbide Suchterkrankungen
Christina Stadler, Maria Hofecker Fallahpour und Rolf-Dieter Stieglitz
10.1 Einleitung
10.2 Epidemiologie
10.3 Modelle für die Komorbidität
10.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
10.5 Therapie
10.6 Fazit für die Praxis
11 Persönlichkeitsstörungen und komorbide Suchterkrankungen
Marc Walter
11.1 Einleitung
11.2 Epidemiologie
11.3 Modelle für die Komorbidität
11.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
11.5 Therapie
11.6 Fazit für die Praxis
Teil III Suchterkrankungen und komorbide psychische Störungen
12 Alkoholabhängigkeit und komorbide psychische Störungen
Thomas Hillemacher und Stefan Bleich
12.1 Einleitung
12.2 Epidemiologie
12.3 Modelle für die Komorbidität
12.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
12.5 Therapie
12.6 Fazit für die Praxis
13 Tabakabhängigkeit und komorbide psychische Störungen
Anil Batra
13.1 Einleitung
13.2 Epidemiologie
13.3 Modelle für die Komorbidität
13.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
13.5 Therapie
13.6 Fazit für die Praxis
14 Stimulanzienabhängigkeit und komorbide psychische Störungen
Sylvie Petitjean
14.1 Einleitung
14.2 Epidemiologie
14.3 Modelle für die Komorbidität
14.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
14.5 Therapie
14.6 Fazit für die Praxis
15 Opiatabhängigkeit und komorbide psychische Störungen
Rudolf Stohler
15.1 Einleitung
15.2 Epidemiologie
15.3 Modelle für die Komorbidität
15.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
15.5 Therapie
15.6 Fazit für die Praxis
16 Cannabisabhängigkeit und komorbide psychische Störungen
Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
16.1 Einleitung
16.2 Epidemiologie
16.3 Modelle für die Komorbidität
16.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
16.5 Therapie
16.6 Fazit für die Praxis
17 Medikamentenabhängigkeit und komorbide psychische Störungen
Michael Soyka und Andreas Franke
17.1 Einleitung
17.2 Epidemiologie
17.3 Modelle für die Komorbidität
17.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
17.5 Therapie
17.6 Fazit für die Praxis
18 Medienabhängigkeit und komorbide psychische Störungen
Bert T. te Wildt und Andrija Vukic´evic´
18.1 Einleitung
18.2 Epidemiologie
18.3 Modelle für die Komorbidität
18.4 Klinische Charakteristika und Verlauf
18.5 Therapie
18.6 Fazit für die Praxis
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Dieses Buch richtet sich an alle Berufsgruppen, die in der Klinik oder Praxis mit psychischen Störungen und Suchterkrankungen konfrontiert sind. Es ist aber auch für interessierte Laien geschrieben, die sich intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen möchten.
Viele unserer Patientinnen und Patienten leiden neben ihrer psychischen Problematik auch an Suchtproblemen. Manche trinken Alkohol, um Stresssymptome zu bekämpfen oder besser einschlafen zu können, oder sie rauchen Cannabis, um Unruhe und Ängste zu minimieren. Bei anderen Patientinnen und Patienten triggern die Drogen immer wieder psychiatrische Symptome, so etwa bei Menschen mit Psychose und Cannabis- oder Stimulanzienkonsum. Nicht selten fallen erstmals in einer Suchtbehandlung weitere psychische Störungen auf; beispielsweise wenn eine Patientin während eines Drogen- oder Medikamentenentzuges frühere traumatische Ereignisse erinnert, oder Beziehungsprobleme wieder relevant werden. Diese Komorbidität – das gemeinsame Auftreten einer Suchterkrankung und einer psychischen Störung – wird häufig als Doppeldiagnose, im englischen Sprachgebrauch dual diagnosis oder dual disorder, bezeichnet.
Die Zusammenhänge zwischen der Sucht und den komorbiden psychischen Störungen sind komplex und keinesfalls unidirektional zu verstehen. Warum ist es aber überhaupt wichtig beide Störungsbilder zu kennen und korrekt zu diagnostizieren? Einfach gesagt, weil die Therapie häufig eine andere ist. Verglichen mit Suchtpatienten ohne weitere komorbide Störungen brauchen Patientinnen und Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung oder etwa mit einer posttraumatischen Belastungsstörung einen anderen Umgang und komplexere psychotherapeutische Angebote, um von der Behandlung profitieren zu können. Die erforderliche Integration der Therapieansätze für die verschiedenen Störungskomponenten ist nicht einfach, und so wurden Patienten mit Doppeldiagnosen früher in der Regel traditionell nach einem sequentiellen Modell behandelt. In den letzten Jahren wurden mehrere integrierte Behandlungskonzepte und -programme für Patienten mit Doppeldiagnosen entwickelt und teilweise bereits erfolgreich evaluiert. Diese Programme finden heute zunehmend Eingang in die Regelversorgung.
Ziel des vorliegenden Buches ist es, häufig auftretende Komorbiditäten von Suchterkrankungen und psychischen Störungen sowie ihre wechselseitigen Erscheinungsformen in Epidemiologie, Ätiologie, Verlauf und Behandlung darzustellen. Dabei sollen »beide Seiten« berücksichtigt werden – die häufigen Komorbiditäten und ihre spezifischen Merkmale und ihre Behandlung sollen sowohl aus der Perspektive der psychiatrischen Erkrankung als auch aus der Perspektive der Suchtproblematik beschrieben werden.
Das Buch ist in einen einführenden allgemeinen und einen speziellen Teil untergliedert. Im ersten allgemeinen Teil (Teil I) werden Grundlagen der Komorbidität wie theoretische Modelle, psychodynamische Aspekte, neuropsychiatrische Grundlagen und therapeutische Grundprinzipien dargestellt. Der spezielle Teil widmet sich nacheinander bestimmten psychischen Störungen mit komorbid auftretenden Suchterkrankungen (Teil II) und Suchterkrankungen mit häufig komorbid vorkommenden psychischen Störungen (Teil III).
Wir freuen uns, dass wir namhafte Experten dafür gewinnen konnten, den neuesten Wissensstand zu der Thematik der Doppeldiagnosen für eine interdisziplinäre Leserschaft zusammenzutragen. Wir glauben, dass es uns gelungen ist, mit dem vorliegenden Buch einen gut fundierten und ausgewogenen Überblick über diesen zunehmend wichtigen Bereich zu präsentieren und wir hoffen, dass das Buch bei den Lesern auf Interesse und Zustimmung stößt.
Basel und Köln, im Oktober 2013
PD Dr. med. Marc Walter und
Prof. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
Vorwort zur 2. Auflage
Wir freuen uns, dass die erste Auflage unseres Buches zu Komorbidität und Doppeldiagnosen gut angenommen wurde und auf Interesse stieß. Nunmehr können wir hiermit eine zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage vorlegen.
Die Gliederung in einen allgemeinen, einführenden Abschnitt (Teil I) und zwei störungsspezifische Abschnitte wird in der 2. Auflage beibehalten.
Die störungsspezifischen Abschnitte fokussieren zunächst auf spezifische psychische Störungen mit ihren jeweiligen komorbiden Suchterkrankungen (Teil II) und nachfolgend auf spezifische Suchterkrankungen mit ihren jeweiligen komorbiden psychischen Störungen (Teil III). Diese Betrachtungsweise der Doppeldiagnosen trägt unseres Erachtens dazu bei, dass die komorbide Problematik individuell in Abhängigkeit von der klinisch führenden Diagnose berücksichtigt wird, und nicht nach klinischem oder wissenschaftlichem Schwerpunkt der Kliniker und Autoren.
Erfreulicherweise konnten wir für die 2. Auflage wieder alle Autoren dazu gewinnen, ihren Beitrag zu aktualisieren und auf den neusten Stand der Wissenschaft zu bringen.
Zwei neue Kapitel wurden zudem ergänzt: Ein Einleitungskapitel zur Komorbidität in den psychiatrischen Klassifikationssystemen von Prof. Rolf-Dieter Stieglitz (Kap. 1) sowie ein Kapitel zu der zunehmend wichtiger werdenden Medikamentenabhängigkeit und ihren komorbiden psychischen Störungen von Prof. Michael Soyka und Prof. Andreas Franke (Kap. 17).
Unser Buch ist wissenschaftlich fundiert, aber für die Praxis gedacht. Es soll einen umfassenden Überblick über Diagnostik und Behandlung von Doppeldiagnosen bieten. Es beschreibt Phänomene, die in der klinischen Versorgung unserer Patientinnen und Patienten zum Alltag gehören.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Gewinn beim Lesen.
Basel und Köln, im Juli 2019
Prof. Dr. med. Marc Walter und
Prof. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
Teil I Grundlagen
1 Psychiatrische Klassifikationssysteme und Komorbidität
Rolf-Dieter Stieglitz
1.1 Einleitung
Ein wesentliches Kennzeichen aktueller Klassifikationssysteme stellt das Komorbiditätsprinzip dar. Komorbidität (engl.: comorbidity) bedeutet allgemein das gemeinsame Auftreten verschiedener psychischer Störungen bei einer Person. Im ICD-10 Lexikon finden sich folgende Erläuterungen dazu (WHO 2002, S. 77):
»Eine Erweiterung der diagnostischen Möglichkeiten bietet das Prinzip der Komorbidität. Hierdurch werden in vielen Fällen die Schwere der Erkrankung, der ungünstige Krankheitsverlauf, das Erfordernis besonderer therapeutischer Interventionen, die schlechteren Behandlungsresultate und die ungünstigere Prognose klarer deutlich. So lässt sich die Vielfalt des klinischen Bildes durch mehrere Diagnosen besser beschreiben, was häufig vernachlässigt wird. Dabei gilt der Grundsatz: So viele Diagnosen wie nötig, aber nicht mehr als erforderlich!«
Als komorbide Diagnosen werden somit Diagnosen bezeichnet, die gleichzeitig bei einem Patienten vorliegen (z. B. eine Angst- und eine Persönlichkeitsstörung).
Ein Spezialfall von Komorbidität stellen duale Diagnosen oderDoppeldiagnosen dar (vgl. Moggi & Donati 2004), von denen man dann spricht, wenn eine Störung durch psychotrope Substanzen mit einer anderen psychischen Störung gemeinsam auftritt (z. B. schizophrene Störung). Eine Zusammenstellung weiterer in diesem Kontext oft verwendeter Begriffe findet sich bei Stieglitz und Volz (2007).
1.2 Historische Anmerkungen
Das Komorbiditätsprinzip stellt eine Abkehr von früher dominierenden diagnostischen Hierarchieregeln dar, die vor allem mit dem Namen Karl Jaspers verbunden sind (vgl. hierzu Garcia 1987). Die Jaspers’sche Schichtenregel bezeichnet eine Vorgehensweise im diagnostischen Prozess, wonach psychische Erkrankungen in sog. Schichten angeordnet sind (von organischen Störungen über affektive Störungen bis hin zu den Neurosen; Jaspers 1973). Jede »tieferliegende« Erkrankung kann das Erscheinungsbild der darüberliegenden annehmen. Die eigentliche Diagnose muss anhand der tieferliegenden Erkrankung erfolgen. So wird angenommen, dass z. B. organische Störungen zeitweilig wie schizophrene Störungen aussehen können und daher eine organische Störung zu diagnostizieren sei. Als Begründung für die Einführung dieser Regel findet man verschiedene Argumente:
• Identifizierung der wichtigsten Diagnose für Behandlung und Therapie,
• Identifizierung derjenigen Diagnose mit der sparsamsten Erklärung der Phänomenologie,
• Hilfe im differentialdiagnostischen Prozess,
• Identifizierung von sog. »reinen« Fällen.
Die ICD-9 orientierte sich zwar wesentlich an hierarchischen Prinzipen der Diagnostik. Es fanden sich hier jedoch bereits erste Hinweise, wie bei jenen Patienten zu verfahren sei, die eine komplexere Symptomatik aufweisen:
»(…) wenn angebracht, mehrere Diagnosen aufgezeichnet werden. In Abhängigkeit vom Zwecke der Diagnosensammlung sollten Regeln für die Vorrangigkeit aufgestellt werden, um die Reihenfolge festzulegen, in der die Diagnosen dokumentiert werden sollen. Hierarchische Regeln (…) sind für psychiatrische Diagnosen meist zufriedenstellend« (Degkwitz et al. 1980, S. 14).
Mit der Einführung des DSM-III wurden erstmals psychische Störungen in einem Klassifikationssystem mittels operationaler Kriterien definiert (vgl. im Überblick Stieglitz 2008). Auch wenn im DSM-III nicht mehr explizit auf die Schichtenregel Bezug genommen wurde, so finden sich auch dort noch klinische Regeln, die implizit Hierarchien postulieren. Bei ca. 60 % der Störungen sind derartige diagnostische Hierarchieanweisungen bzw. diagnostische Ausschlussregeln zu erkennen (z. B. »nicht Folge einer …«, »nicht durch …«). Zwei Prinzipien wurden der Formulierung dieser Regeln zugrunde gelegt:
1. Wenn eine organische Störung die Symptome erklären kann, kann man nicht eine andere Diagnose stellen, die dieselben Symptome beinhaltet (z. B. eine organische bedingte Angststörung schließt eine komorbide Diagnose einer Panikstörung aus).
2. Wenn eine umfassende (pervasive) Störung (z. B. eine mit einem weiten Spektrum an Symptomen) Symptome hat, die sich mit Symptomen einer weniger umfassenden Störung überlappen (z. B. Schizophrenie versus Schizophrenie und dysthyme Störung).
Im DSM-III findet sich jedoch unter Rubrik »Mehrfachdiagnosen auf Achse I und Achse II« der Hinweis, dass bei Bedarf Mehrfachdiagnosen zu stellen sind, um den aktuellen Zustand zu beschreiben. Als Beispiel wird ein Patient genannt, der neben einer substanzinduzierten Störung auch eine affektive Störung haben kann. Es können mehrere Diagnosen in derselben Klasse bestehen (z. B. typische Depression und Dysthymie), wärend sich in anderen Klassen Subtypen ausschließen (z. B. bei den schizophrenen Störungen).
Für die Aufgabe des Hierarchieprinzips und Etablierung des Komorbiditätsprinzips in den aktuellen Klassifikationssystemen finden sich verschiedene Argumente. Von verschiedenen Autoren (z. B. van Praag 1993) wird die Ansicht vertreten, dass die Psychiatrie durch die Anwendung hierarchischer Prinzipien wenig Gewinn gehabt hat, da sie
• mit einem Verlust an Informationen über den Patienten einhergehen,
• einen Verlust an therapeutischen Möglichkeiten beinhalten, da wenig Evidenz besteht, dass »niedrigere« Syndrome verschwinden, wenn »höhere« Syndrome erfolgreich behandelt werden,
• einen Verlust an Validierungsmöglichkeiten bedeuten, insbesondere der biologischen Forschung. (Beispiel: Wie kann man biologische Ergebnisse in der Schizophrenie interpretieren, wenn bei bestimmten Patienten die Koexistenz einer depressiven Störung besteht, bei anderen nicht?)
Empirische Studien haben zudem belegen können, dass es für die Hierarchisierung oft keine ausreichende Begründung gibt. So haben verschiedene Arbeiten zeigen können, dass bestimmte Störungen überzufällig häufig gemeinsam miteinander auftreten, d. h. unter Umständen nicht zufällig kovariieren. Zu nennen sind hierbei insbesondere Schizophrenie und substanzbedingte Störungen, Angst- und Persönlichkeitsstörungen oder depressive und Angststörungen. Insbesondere Persönlichkeitsstörungen sowie substanzbedingte Störungen haben sehr häufig den Status von komorbiden Störungen über alle anderen Störungsgruppen hinweg.
Zu den allgemeinen Neuerungen im DSM-III-R zählte die Relativierung bestimmter diagnostischer Hierarchieregeln. Im Unterschied zum DSM-III wurden in vielen Bereichen die hierarchischen Vorschriften weitgehend aufgehoben (z. B. Angststörungen) und mussten dem Konzept der Komorbidität weichen. Dieses galt zudem nicht nur für den Querschnittsbefund, sondern auch für die gesamte Lebensspanne des Patienten. Allein aufgrund dieser Entwicklung ergab sich eine deutliche Zunahme potentieller Komorbiditäten. Auch die stringentere Definition der Störungen durch deren Operationalisierungen trägt hierzu bei.
Vom DSM-III-R zum DSM-IV gab es keine grundlegenden Änderungen. Das Komorbiditätsprinzip wurde weiter explizit favorisiert, wenngleich sich weiterhin Hinweise auf den Ausschluss anderer Diagnosen bzw. Hinweise auf Differentialdiagnosen finden, die umschrieben wurden durch Formulierungen wie »die Kriterien für … waren niemals erfüllt« oder »kann nicht besser durch … erklärt werden«.
Bei Störungsbildern, die die Kriterien für mehr als eine Störung erfüllen, sollten auch mehrere Diagnosen vergeben werden. Es werden jedoch auch Situationen genannt, in denen diagnostische Hierarchien gebildet werden, um multiple Diagnosen zu vermeiden (u. a. psychische Störungen, die durch medizinische Krankheitsfaktoren oder Substanzwirkungen erklärbar sind). Die Dokumentation kann im multiaxialen System erfolgen resp. durch einfache Auflistung. Dabei gilt die Regel, so viele gleichzeitig vorhandene psychische Störungen, medizinische Krankheitsfaktoren und andere Faktoren, die für die Versorgung und Behandlung wichtig sind, zu erfassen. Die Hauptdiagnose bzw. der Konsultationsgrund sollte an erster Stelle stehen.
1.3 Das Komorbiditätsprinzip in den aktuellen Klassifikationssystemen
In Forschung und Praxis sind gegenwärtig die ICD-10 und das DSM-IV/DSM-5 dominierend. Die ICD-10 stellt das Klassifikationssystem der World Health Organization (WHO) dar und ist für die Mitgliedsländer verbindlich, wogegen das DSM-5 als nationales System der American Psychiatric Association (APA) in der Praxis einen begrenzten Einfluss hat, jedoch in der Forschung klar dominant ist.
Im DSM-5 besteht das Komorbiditätskonzept unverändert weiter, das multiaxiale System wurde jedoch aufgegeben. Es finden sich zwar keine expliziten Ausführungen zu deren Anwendung, jedoch sind bei allen psychischen Störungen jeweils Unterabschnitte zur Komorbidität enthalten.
In die ICD-10 wurde das Konzept der Komorbidität erstmals explizit eingefügt und stellt eines der wichtigstes konzeptuellen Neuerungen gegenüber der ICD-9 dar (WHO 2002). In den Klinisch-diagnostischen Leitlinien (1. Auflage, Dilling et al. 1991, S. 20) findet sich unter der Überschrift »Verschlüsselung von mehr als einer Diagnose« die generelle Regel, so viele Diagnosen zu verschlüsseln, wie für die Beschreibung des klinischen Bildes notwendig sind. Folgende weitere Empfehlungen finden sich:
• Es sollte zwischen einer Hauptdiagnose sowie Neben- bzw. Zusatzdiagnosen unterschieden werden.
• Priorität hat die Diagnose mit der größten aktuellen Bedeutung (meist die Störung, die zur Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Institution oder Einrichtung geführt hat).
• Unter Berücksichtigung der Vorgeschichte kann jedoch unter anderen Bedingungen die wichtigste Diagnose die Lebenszeitdiagnose sein. (Beispiel: Patient mit einer schizophrenen Störung, der aktuell mit einer Angstsymptomatik erscheint.)
• Bei Unklarheit bezüglich der Reihenfolge der Störungen sollten diese in der numerischen Reihenfolge aufgeführt werden.
Weiterhin findet sich in der ICD-10 der explizite Hinweis, auch die anderen Kapitel der ICD-10 zur Verschlüsselung heranzuziehen (z. B. Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems, G). Dennoch gibt es auch in der ICD-10 wie im DSM-IV eine Reihe von Ausschlusskriterien bzw. auszuschließende Diagnosen.
Ebenfalls wie im DSM-5 besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Verschlüsselung von Diagnosen aus verschiedenen Abschnitten (z. B. Panikstörung und depressive Episode) oder innerhalb eines Abschnitts (z. B. depressive Episode und Dysthymie). Bei anderen Abschnitten ist jedoch eine Komorbidität von Subtypen nicht möglich (z. B. Schizophrenie).
In einigen Abschnitten wird jedoch vom Prinzip der Komorbidität abgewichen, indem übergeordnete Einheiten geschaffen wurden. Folgende Beispiele seien exemplarisch genannt:
• Abschnitt F1 »Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen«: Hier gibt es die Kodierung F19 »Störungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum sonstiger psychotroper Substanzen«, die dann zu wählen ist, wenn ein Patient verschiedene Substanzen konsumiert.
• Abschnitt F4 »Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen«: Hier gibt es unter den anderen Angststörungen eine Störungsgruppe F41.2 »Angst und depressive Störung, gemischt«, die dann zu diagnostizieren ist, wenn Angst und Depression gleichzeitig vorliegen, jedoch der Schweregrad nicht rechtfertigt, beide Diagnosen zu stellen.
• Abschnitt F6 »Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen«: Die Kodierung F61 »kombinierte Persönlichkeitsstörung« ist dann zu wählen, wenn mehrere Störungen vorliegen, jedoch kein vorherrschendes Symptombild einer spezifischen Persönlichkeitsstörung besteht.
Im Unterschied zum DSM-5 verfügt die ICD-10 über verschiedene Versionen, wobei die Unterscheidung zwischen den klinisch-diagnostischen Leitlinien und den Kriterien für Forschung und Praxis wichtig ist (vgl. im Überblick hierzu Stieglitz 2008). Erstere sind, was die Symptom- und Zeitkriterien betrifft, z. T. weniger präzise, ermöglichen damit zwar eine flexiblere Anwendung, bedeuten im Hinblick auf Komorbidität auch eher die Möglichkeit, komorbide Störungen zu diagnostizieren.
Abschließend noch einige Anmerkungen zum aktuellen Stand der ICD-11. Die vorläufige Version der ICD-11 wurde im Juni 2018 publiziert, in der WHO-Vollversammlung im Mai 2019 verabschiedet und soll 2022 offiziell in den Mitgliedsländern eingeführt werden. Gegenüber der ICD-10 wird es in der ICD-11 einige grundlegende Änderungen geben. Dies betrifft verschiedene Aspekte wie
• die Neustrukturierung der Abschnitte in Anlehnung an das DSM-5,
• die Aufgabe des alphanumerischen Systems (z. B. statt F20.x für schizophrene Störungen jetzt 6A20),
• die Aufnahme einiger neuer Störungen (z. B. komplexe PTSD).
Eine gegenüber ICD-10 und DSM-5 deutliche Veränderung wird im Bereich der Persönlichkeitsstörungen stattfinden. Die Diagnostik erfolgt in einem dreistufigen Prozess: Prüfung der allgemeinen Kriterien – Bestimmung des Schwergrades – Bestimmung der Präsentation der Persönlichkeitsproblematik. Das Komorbiditätsprinzip wird unverändert beibehalten werden.
1.4 Erhebungsinstrumente von Komorbidität
Der diagnostische Prozess wird durch eine Reihe von Fehlerquellen beeinflusst (Spitzer & Fleiß 1974). Bezogen auf die Diagnosenebene sind dies vor allem die Kriterien- und Informationsvarianz. Erste beinhaltet die unterschiedliche Anwendung von diagnostischen Kriterien zur Diagnosestellung, was durch die Operationalisierung von Störungen in ICD-10 und DSM-5 reduziert werden konnte. Letztere umfasst den Prozess der Informationserhebung zur Beurteilung der Kriterien, d. h. beinhaltet das Problem, dass Untersucher unterschiedliche Fragen im Hinblick auf die zu bewertenden Kriterien stellen. In traditioneller Weise wird die Diagnosestellung im Anschluss an ein klinisches Interview vorgenommen. In diesem Gespräch versucht der Untersucher, im Hinblick auf ein bestimmtes Klassifikationssystem Fragen in eigenen Worten zu formulieren, um Informationen für seine Diagnosestellung zu erhalten. Zahlreiche Studien haben zeigen können, dass die Interrater-Reliabilität solcher klinischer Interviews erfahrungsgemäß eher gering ist. Im Kontext von ICD-10 und damals noch DSM-III/DSM-IV wurde daher versucht, geeignete Untersuchungsinstrumente als Hilfsmittel zur Diagnosenstellung zu entwickeln. Insbesondere von Seiten der WHO wurde diese Strategie mit Beginn der Entwicklung der ICD-10 konsequent verfolgt, so dass heute eine Reihe von Instrumenten zu unterschiedlichen Bereichen psychischer Beeinträchtigungen vorliegen (vgl. im Überblick Stieglitz et al. 2001; Stieglitz & Freyberger 2017). Heute stehen folgende Gruppen diagnostischer Hilfsmittel zur Verfügung: Checklisten sowie strukturierte und standardisierte Interviews. Vor dem Einsatz dieser z. T. aufwendigen Instrumente bietet sich als erster Schritt der Einsatz von Screeningverfahren an, wenn der Verdacht auf das Vorliegen einer oder mehrerer psychischer Störung(en) besteht.
1.4.1 Screeningfragebögen
Beim Screening handelt es sich in der Regel um einfache, d. h. schnell und ökonomisch einsetzbare Selbstbeurteilungsverfahren. Diese können dem Untersucher erste wichtige Hinweise auf die Art der Störung liefern, deren genaue Prüfung dann z. B. durch Interviews erfolgen sollte. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten (vgl. Stieglitz & Volz 2007). Besonders zu erwähnen sind Screeningfragebögen in Anlehnung an ein Klassifikationssystem. Am bekanntesten sind die Screeningfragebögen zum DIA-X (Wittchen & Pfister 1987, s. a. nachfolgender Abschnitt). Diese liegen in drei Versionen vor. In der allgemeinsten Fassung werden Screeningfragen zu allen im DIA-X erfassbaren Störungen gestellt. Zusätzlich gibt es zwei differenzierte Versionen für den Depressions- und Angstbereich. Werden die aufgeführten Fragen positiv bewertet, müssen die entsprechenden Module des Interviews geprüft werden. Beispielfragen aus dem allgemeinen Screeningbogen finden sich in der Tabelle (Tab. 1.1).
Tab. 1.1: Screeningfragen aus dem allgemeinen Screeningfragebogen (SSQ) des DIA-X (Beispiele; Wittchen & Pfister 1997)
Da eine Diagnose nie aufgrund der Ergebnisse eines Screeningverfahrens gestellt werden darf, muss im Anschluss daran ein differenziertes diagnostisches Verfahren eingesetzt werden. Die nachfolgend vorzustellenden Verfahrensgruppen haben sich dabei bewährt (vgl. auch Stieglitz 2008 sowie Strauss & Schumacher 2005).
1.4.2 Checklisten
Die sog. Check- oder Merkmalslisten stellen die einfachste Form an Hilfsmitteln zur Unterstützung der Diagnosestellung dar. Sie beinhalten in der Regel nur die für die einzelnen diagnostischen Kategorien enthaltenen Kriterien. Dem Diagnostiker bleibt es bei den Checklisten selbst überlassen, wie er Fragen stellt, um an die notwendigen Informationen zu kommen, und wie er die Antworten des Patienten kodiert (Problem »Informationsvarianz«). Der Gesamtablauf der Informationserhebung liegt dabei in den Händen des Untersuchers selbst. In den nachfolgenden Tabellen finden sich Beispiele für deutschsprachige Verfahren (Gesamtbereich Tab. 1.2 bzw. Teilbereich Persönlichkeitsstörungen Tab. 1.3).
Auf ein gewichtiges Problem, das nicht nur die Checklisten betrifft, sondern ebenso die Klassifikationssysteme selbst, sei kurz hingewiesen: das Fehlen eines umfassenden Glossars zu den Symptomen (Problem: Erhöhung der Beobachtungs- und Interpretationsvarianz; Spitzer & Fleiss 1974). Die aktuellen Klassifikationssysteme umfassen mehrere hundert allein psychopathologische Begriffe. Blashfield und Fuller (1996) schätzen die Anzahl diagnostischer Kriterien in DSM-IV auf ca. 1.500 (!), wobei die Mehrzahl Symptomkriterien sind. Das z. B. vom DSM-5 angebotene Glossar deckt nur einen Teil ab. In der ICD-10 selbst finden sich direkt keine Kriteriendefinitionen, sondern lediglich im ergänzend zur Verfügung stehenden Lexikon (WHO 2002). Zwar sprechen einige psychopathologische Begriffe für sich (z. B. Konzentrationsstörungen), jedoch ein Großteil
VerfahrenAbk.VerfasserArtKlassifikationssystem
Tab. 1.2: Checklisten, strukturierte und standardisierte Interviews zur klassifikatorischen Diagnostik
lässt viel Interpretationsspielraum zu (z. B. Depersonalisation), was einen Einfluss auf die Beurteilung hat. Das Hauptproblem bezüglich der Checklisten stellt jedoch die bereits erwähnte Informationsvarianz dar, d. h. die unterschiedliche Art, Informationen zu erheben. Die zuverlässige Anwendung von Checklisten im Hinblick auf Komorbidität setzt zudem folgendes voraus:
• umfangreiche Kenntnisse des Manuals,
• darauf basierend die Ableitung von zuverlässigen Hypothesen über das Vorliegen von Störungen,
• deren Überprüfung dann mittels der ausgewählten Checklisten erfolgen muss.
1.4.3 Interviews
Klinische Interviews (vgl. auch Wittchen et al. 2001) sind zielgerichtete menschliche Interaktionen zwischen zwei Personen (Befrager und Befragtem) mit dem Ziel der Informationssammlung über die verschiedenen Aspekte des Erlebens und Verhaltens des Befragten. Im Hinblick auf die Klassifikationssysteme bedeutet dies die Bereitstellung von Befragungsstrategien zur Informationssammlung zu den in Diagnosensystemen enthaltenen Kriterien (Symptom-, Zeit- und Verlaufskriterien; Ein- und Ausschlusskriterien). Hinsichtlich des Grades der Strukturierung des Informationserhebungsprozesses unterscheidet man zwischen strukturierten und standardisierten Interviews. StrukturierteInterviews geben eine systematische
VerfahrenAbk.VerfasserArtKlassifikationssystem
Tab. 1.3: Checklisten und strukturierte Interviews zur klassifikatorischen Diagnostik: Teilbereiche
Gliederung des Prozesses der Informationssammlung vor. Die Exploration durch die Diagnostiker wird erleichtert durch die Vorgabe von vorformulierten Fragen (Einstiegs- und Zusatzfragen). Die Bewertung und Gewichtung der Antworten des Patienten bleibt in der Regel dem Untersucher überlassen (klinisches Urteil), wenngleich zum Teil Ratinganweisungen mit angegeben werden, um dieses Urteil zu erleichtern. Demgegenüber sind bei den standardisierten Interviews alle Ebenen des diagnostischen Prozesses sowie alle Elemente der Informationserhebung genau festgelegt, d. h. der Ablauf der Untersuchung, die Art der Reihenfolge der Fragen, die Kodierung der Antworten bis hin zu der meist computerisierten Diagnosestellung. In den Tabellen (Tab. 1.2 und Tab. 1.3) finden sich die gegenwärtig in deutschsprachigen Versionen verfügbaren Instrumente.
Bezüglich der Erfassung von komorbiden Störungen muss vorab auf folgenden wichtigen Punkt hingewiesen werden: Will man das Gesamtspektrum möglicher komorbider psychischer Störungen berücksichtigen, so sind immer zwei Instrumente notwendig, da der Bereich der Persönlichkeitsstörungen immer separat erfasst werden muss.
Strukturierte Interviews
Als das weltweit am häufigsten eingesetzte Instrument kann das Strukturierte Klinische Interview für DSM-IV (SKID) angesehen werden. Es ermöglicht die Erfassung von sog. Achse-I- und Achse-II-Störungen (d. h. separat psychische Störungen und Persönlichkeitsstörungen) nach DSM-IV. Erfasst werden die wichtigsten Achse-I-Störungen (u. a. Affektive Störungen, Angststörungen) sowie alle Achse-II-Störungen. Beide können unabhängig voneinander eingesetzt werden. Für DSM-5 sind deutschsprachige Adaptationen in Vorbereitung.
Zu den Instrumenten, die ein weites Spektrum von Störungen abzubilden erlauben, zählen auch die Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN). Es handelt sich dabei um eines der offiziellen Instrumente der WHO, das über viele Jahre hinweg entwickelt worden ist, und basiert auf dem klassischen »Present State Examination« (PSE-9) von Wing, Cooper und Sartorius, aus dessen Arbeitsgruppe heraus auch dieses Instrument entwickelt wurde. Das SCAN besteht aus einer Standarderhebung (PSE-10; Teil I: nicht-psychotische Symptome und Screening für Teil II; Teil II: Psychotische Symptome und Verhaltensbeurteilung) sowie wahlweisen Erhebungen (z. B. der Clinical History Schedule (CHS), die eine differenzierte Erfassung der klinischen und sozialen Vorgeschichte erlaubt, z. B. soziale Rollenerfüllung, soziale Behinderungen). Darüber hinaus werden für die Bereiche, in denen keine Diagnosestellung möglich ist, sogenannte Zusatzmodule empfohlen (z. B. International Personality Disorder Examination, IPDE für Persönlichkeitsstörungen, Tab. 1.3).
Im deutschsprachigen Bereich häufig eingesetzt wird auch das Diagnostische Interview bei Psychischen Störungen (DIPS). Es ist an DSM-IV orientiert und umfasst 8 Sektionen. Im Gegensatz zu den anderen Verfahren werden über die reine Symptomerfassung auch therapierelevante Informationen mit erhoben.
Aus das Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) deckt ein weites Spektrum an Störungen ab, ist jedoch weniger komplex und einfacher in der Anwendung. Es ist ebenfalls auf Deutsch verfügbar und ermöglicht Diagnosen nach DSM-IV und ICD-10. Es umfasst 16 Sektionen.
Zur Gruppe der strukturierten Interviews gehören auch noch drei weitere Verfahren, die jeweils spezifische Teilbereiche abbilden. So fokussiert das International Personality Disorder Examination (IPDE), wie das Strukturierte Klinisches Interview für DSM-IV Achse II. Persönlichkeitsstörungen (SKID-II), nur auf den Bereich der Persönlichkeitsstörungen, ein weiteres auf den Bereich dementieller Störungen: das Strukturierte Interview zur Diagnostik einer Demenz vom Alzheimer Typ und … (SIDAM).
Standardisierte Interviews
Auf der Ebene der standardisierten Interviews liegt das Composite International Diagnostic Interview (CIDI) vor. Es handelt sich dabei um ein modular aufgebautes Interview, bestehend aus einer Basisversion und sogenannten Zusatzmodulen (z. B. antisoziale Persönlichkeitsstörungen). Auch das CIDI ist eines der offiziellen Instrumente der WHO zur Diagnostik nach ICD-10. Es wurde bisher hauptsächlich in epidemiologischen Studien eingesetzt und in diesem Kontext auch entwickelt, ist jedoch gleichfalls in der Praxis anwendbar. Aufgrund des maximal möglichen Grades der Standardisierung ist es auch von klinisch unerfahrenen Untersuchern benutzbar. Ein wesentliches Kennzeichen des CIDI ist das genau festgelegte diagnostische Vorgehen bei jedem Kriterium. Es muss jeweils festgestellt werden, ob das entsprechende Symptom tatsächlich von psychiatrischer Relevanz ist und nicht z. B. auf Medikamente, Drogen, Alkohol oder körperliche Erkrankungen oder Verletzungen zurückzuführen ist. Als eine Weiterentwicklung wie Erweiterung um modulare Bausteine kann das Expertensystem zur Diagnostik Psychischer Störungen (DIA-X) von Wittchen und Pfister (1997) angesehen werden. Es besteht aus folgenden Hauptkomponenten: drei Screeningfragebögen (s. o.) zu psychischen Störungen allgemein (DIA-SSQ), zu Angst (DIA-ASQ) und zu Depression (DIA-DSQ), dem standardisierten Interview (DIA-X Interview), das als Paper-Pencil-Version sowie in computerisierter Form vorliegt (Querschnitts- und Längsschnittsymptomatik). Vor allem die computergestützte Interviewführung kann als eigentliche Innovation des Systems angesehen werden (Vorteile: geringer Trainingsaufwand, Reduktion der Fehlerquote auf Seiten des Untersuchers).
Nach Zimmerman (2003) sollten auch in der klinischen Routine möglichst diagnostische Verfahren eingesetzt werden, da sich z. B. mittels diagnostischer Interviews deutlich mehr komorbide Störungen diagnostizieren lassen. Bezüglich der einzelnen Verfahrensgruppen ist auf folgende Punkte hinzuweisen. Zu den Vorteilen der Erfassung psychischer Störungen mittels Checklisten zählt insbesondere, dass die in ihnen enthaltenen Kriterien die größte Ähnlichkeit zu denen der diagnostischen Kategorien aufweisen (oft wörtlich übernommen), sowie die prinzipielle Möglichkeit, fast alle Störungsgruppen abzubilden. Als problematisch anzusehen ist, dass die Kenntnis des jeweiligen Diagnosensystems vorausgesetzt werden muss, ebenso klinische Erfahrung. Auch das bereits erwähnte Problem der Informationsvarianz bleibt bestehen. Die Notwendigkeit eines hypothesengesteuerten Vorgehens stellt eine weitere Schwierigkeit dar, da aus Zeitgründen nicht alle Checklisten überprüft werden können. Zu den Vorteilen der Interviews zählt insbesondere die Reduktion der Informationsvarianz und damit verbunden eine Erhöhung der Reliabilität, bei den standardisierten Interviews zudem die Reduktion der Beobachtungsvarianz durch die Vorgabe von Beurteilungskriterien für die Bewertung der Aussagen der Patienten. Als nachteilig anzusehen ist der oft hohe Zeitaufwand, das Training wie die Durchführung betreffend.
1.5 Zusammenfassung
Seit Einführung des Komorbiditätsprinzips in die psychiatrische Diagnostik sind eine Vielzahl neuer Erkenntnisse bezüglich der Epidemiologie, des Verlaufs und der Behandlung psychischer Störungen zu verzeichnen. Das allgemeine Ergebnis und konsistente Fazit dieser Studien ist meist, dass es sich bei der Komorbidität nicht um die Ausnahme, sondern um die Regel zu handeln scheint.
Die Forschung hat zudem angeregt, Modellvorstellungen zur Komorbidität zu entwickeln (vgl. Wittchen & Vossen 1995). Diese ermöglichen es, Entstehungsbedingungen und den Verlauf einer oder mehrerer psychischer Störungen einer empirischen Überprüfung zu unterziehen und damit wesentlich zum Verständnis der Störungen und ihrer Entstehungsbedingungen beizutragen.
Im klinischen Alltag hat dieses Konzept vor allem in den letzten 30 Jahren seit Einführung der ICD-10 zudem eine neue Sichtweise etabliert. Bereits Angst hat 1994 auf die hohe Praxisrelevanz von Komorbidität hingewiesen: Komorbidität ist häufig, beinhaltet schwerere Erkrankungen und meist auch eine schlechtere Prognose sowie ungünstigere therapeutische Resultate und größere Anforderungen an die Behandlung (z. B. hinsichtlich der Medikation: Komedikation, Interaktion der Substanzen). Der Einsatz diagnostischer Instrumente reduziert das Risiko, komorbide Störungen zu übersehen.
Theoretisch wie klinisch stellt der Komorbiditätsgedanke somit ein sinnvolles Prinzip dar. Aufgrund des gegenwärtigen Wissensstands über psychische Störungen kann es sogar als ein notwendiges Prinzip angesehen werden. Ihm kommt eine wesentliche Bedeutung sowohl hinsichtlich des theoretischen Verständnisses psychischer Störungen als auch deren Behandlung zu.
Man kann somit abschließend sicherlich Angst (1994, S. 48) auch heute noch zustimmen, »(…) dass Komorbidität nicht einfach Sand im Getriebe, oder diagnostische Verunreinigungen darstellt, sondern einen Ansatz für fruchtbare empirische Forschung mit grosser theoretischer und praktischer Relevanz bilden kann und wird«.
Literatur
Angst J (1994) Das Komorbiditätsprinzip in der psychiatrischen Diagnostik. In: Dilling H, Schulte-Markwort E, Freyberger HJ (Hrsg.) Von der ICD-9 zur ICD-10. Huber: Bern. S. 41–48.
Blashfield RK, Fuller AK (1996) Predicting the DSM-IV. J Nerv Ment Dis 184:4–7.
Degkwitz R, Helmchen H, Kockott G, Mombour (Hrsg.) (1980). Diagnoseschlüssel und Glossar psychiatrischer Krankheiten. Deutsche Ausgabe der ICD-9, Kapitel V. Berlin: Springer.
Dilling H, Mombour W, Schmidt MH (1991) Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V(F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. Bern: Huber.
Garcia C (1987) Die Schichtenregel als Grundsatz der Psychopathologie. Nervenarzt 58: 589–594.
Jaspers K (1973) Allgemeine Psychopathologie. 9. Aufl. Berlin: Springer.
Moggi F, Donati R (2004) Psychische Störungen und Sucht: Doppeldiagnosen. Göttingen: Hogrefe.
Praag HM van (1993) Diagnosis, the rate-limiting factor of biological depression research. Biol Psychiatry 28:197–206.
Spitzer RL, Fleiss JL (1974) A: re-analysis of the reliability of psychiatric diagnosis. Brit J Psychiat 125:341–347.
Stieglitz RD (2008) Diagnostik und Klassifikation psychischer Störungen. Göttingen: Hogrefe.
Stieglitz RD, Volz HP (2007) Komorbidität bei psychischen Störungen. Bremen: Uni-Med.
Stieglitz RD, Freyberger HJ (2017) Störungsübergreifende Verfahren in der Psychotherapie. In: Stieglitz RD, Freyberger HJ (Hrsg.) Diagnostik in der Psychotherapie. Stuttgart: Kohlhammer. S. 31–38.
Stieglitz RD, Baumann U, Freyberger HJ (Hrsg.) (2001) Psychodiagnostik in Klinischer Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie. Stuttgart: Thieme.
Strauss B, Schumacher J (Hrsg.) (2005) Klinische Interviews und Ratingskalen. Göttingen: Hogrefe.
Vollmoeller W (2004) Wie sicher ist die Wahrnehmung von Patienten? In: Vollmoeller W (Hrsg.) Grenzwertige psychische Störungen. Thieme: Stuttgart. S. 1–9.
WHO (2002) Lexikon zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen. Bern: Huber.
Wittchen HU, Freyberger HJ, Stieglitz RD (2001) Interviews. In: Stieglitz RD, Baumann U, Freyberger HJ (Hrsg.) (2001) Psychodiagnostik in Klinischer Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie. Stuttgart: Thieme. S. 107–117.
Wittchen HU, Pfister H (1997) DIA-X Interview. Frankfurt/M.: Swets & Zeitlinger.
Wittchen HU, Vossen A (1995) Implikationen von Komorbidität bei Angststörungen. Ein kritischer Überblick. Verhaltenstherapie 5:120–133.
Zimmerman M (2003) What should the standard of care for psychiatric diagnostic evaluations be? J Nerv Ment Dis 191:281–286.
2 Theoretische Modelle zur Komorbidität psychischer Störungen und Sucht
Franz Moggi
2.1 Einleitung
Während in der Literatur eine Fülle mehr oder weniger empirisch fundierter Theorien zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Störungen durch Substanzkonsum und von psychischen Störungen vorliegen, gibt es trotz knapp dreißigjähriger Forschung dazu erst einige empirisch fundierte Ätiologiemodelle zu Doppeldiagnosen (DD), worunter die Komorbidität psychischer Störung und Sucht verstanden wird. Alle Störungsmodelle zu DD sind Konzepte, die beschreiben, ob und – falls ja – wie eine Störung A mit einer zweiten Störung B in einer direkt kausalen (uni- oder bidirektionale Kausalität) Beziehung steht, ob beide Störungen auf einen oder mehrere gemeinsame Faktoren zurückgeführt werden können oder ob es sich um eine einzige Störung (Entitätsmodell) handelt. Bei unidirektionalen Kausalmodellen wird meistens von primärer Störung und sekundärerStörung gesprochen, um mindestens eine zeitliche wenn nicht kausale Beziehung zwischen den beiden Störungen auszudrücken.
Abb. 2.1: Drei Typen von Komorbiditätsmodellen bei Doppeldiagnosen (modifiziert nach Moggi 2007, S. 84, Abdruck mit freundlicher Genehmigung)
Diese Übersicht wird in Anlehnung an diese drei Modelltypen von Komorbidität aufgebaut, wobei aus Platzgründen nur diejenigen Modelle vorgestellt werden, die genügend empirische Grundlagen aufweisen. Nach den Modellen gemeinsamerFaktoren sind hohe Komorbiditätsraten das Ergebnis von Risikofaktoren, die von der psychischen Störung und der Störung durch Substanzkonsum (SSK) geteilt werden (z. B. genetische Belastung). Modelle sekundärer SSK schlagen vor, dass die psychische Störung (PS) die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine SSK zu entwickeln. Modelle sekundärer psychischer Erkrankungen besagen das Gegenteil. Bidirektionale Modelle stellen die Hypothese auf, dass beide Störungen die Vulnerabilität für die jeweils andere Störung erhöhen. Im klinischen Alltag wird am häufigsten die sogenannte Selbstmedikationshypothese als Erklärungsmodell herangezogen, wonach Patienten primär unter einer psychischen Störung leiden, woraufhin sie zur Bewältigung der psychischen Symptome derart Suchtmittel konsumieren, dass sie mit der Zeit eine sekundäre SSK entwickeln (Khantzian 1997). In der Forschung werden aber weit mehr Modelle untersucht und diskutiert. Auf Störungen ohne Substanzbezug bzw. abhängige Verhaltensweisen wie Glückspiel wird in diesem Kapitel nicht eingegangen.
2.2 Modelle von spezifischen Komorbiditäten
Die Komorbiditätsmodelle sind mit verschiedenen Forschungsansätzen untersucht worden, wobei deren Ergebnisse sich nicht immer ergänzen, sondern auch widersprechen. Wichtige Beiträge lieferten Familien- und Vererbungsstudien, experimentelle Laborstudien, aber auch epidemiologische und klinische Quer- und Längsschnittstudien, auf die in diesem Kapitel aus Platzgründen zwar nur zusammenfassend aber zu den spezifischen Komorbiditäten doch im Sinne einer Übersicht eingegangen wird. In den letzten Jahren scheinen jedoch weniger Forschungsergebnisse zu Ätiologiemodellen publiziert worden zu sein.
2.2.1 Schizophrenie und Sucht
Epidemiologische Studien mit repräsentativen Bevölkerungsstichproben zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen Schizophrenie und SSK. Die Lebenszeitprävalenz liegt bei 47 % und das Risiko, bei einer Schizophrenie irgendwann auch unter einer SSK zu leiden bzw. umgekehrt bei einer SSK unter einer Schizophrenie zu leiden, liegt bei 4,6 % (Regier et al. 1990). Ätiologiemodelle zur Komorbidität von Psychose bzw. Schizophrenie und Sucht sind zahlreich und in der Komorbiditätsforschung am häufigsten untersucht. Es wurden Modelle aus allen drei Modelltypen, also unidirektionale und bidirektionale Modelle sowie Modelle gemeinsamer Faktoren formuliert.
Lange Zeit war die Selbstmedikationshypothese das vorherrschende Ätiologiemodell zur sekundären SSK (Khantzian 1997). Der Suchtmittelkonsum wird dabei als gezielt symptomspezifische, dysfunktionale Bewältigung der Schizophrenie angesehen (z. B. Beruhigungsmittel gegen Halluzinationen, Anspannung und Angstzustände). Die Selbstmedikationshypothese fand allerdings wenig empirische Unterstützung (Mueser, Brunette & Drake 2007). Abgelöst wurde es durch die sogenannten Affektregulationsmodelle, wonach Personen mit psychischen Störungen ihre negativen Emotionen im Sinne einer generalisierten und maladaptiven Bewältigungsstrategie wiederkehrend mit Suchtmitteln positiv zu verändern versuchen, sodass die Entwicklung einer SSK begünstigt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob die unerwünschten emotionalen Zustände Symptome einer psychischen Störung sind oder durch andere Bedingungen wie bestimmte Persönlichkeitsmerkmale (z. B. Neurotizismus, Impulsivität), psychosozialen Stress, Ressourcen- und Copingdefizite oder durch substanzbedingte Entzugserscheinungen zustande kommen (Blanchard et al. 2000). Die Social-Drift-Hypothese wiederum geht davon aus, dass sich Personen mit einer Schizophrenie zunehmend in sozialen Randgruppen aufhalten, in deren Lebensraum Alkohol- und Drogenkonsum alltäglich und ein integrierendes Element darstellt.
Aus der Vielzahl der vorgeschlagenen Ätiologiemodelle zur primären Psychose bzw. sekundären SSK findet jedoch das Sensitivitätsmodell einige empirische Bestätigung (Mueser et al. 2007). Dieses Modell geht aus den Vulnerabilitäts-Stress-Modellen hervor. Danach interagiert eine psychobiologische Vulnerabilität für Psychose, die aus einer Kombination genetischer Faktoren und früher Umweltereignisse (z. B. Trauma während des Geburtsvorgangs) entstanden ist, so mit Belastungsfaktoren der persönlichen Umwelt, dass eine Psychose ausgelöst werden kann. Das Modell setzt keine SSK als Störung, sondern nur das Vorhandensein einer Vulnerabilität für eine Psychose voraus. Dem Suchtmittel wird dabei die Funktion eines Stressors zugewiesen. Diese biologische Sensitivität kann bei Personen mit Vulnerabilität für Schizophrenie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, bereits bei relativ kleinen Suchtmittelmengen psychotische Symptome bis hin zur floriden Psychose zu erleben und mit der Zeit sekundär eine Substanzstörung zu entwickeln.
Die Modelle sekundärerPsychose dagegen stellen die Wirkungen von Cannabis, Halluzinogenen und Stimulanzien, deren unmittelbare Wirkungen Ähnlichkeiten mit floriden Psychosen aufweisen, ins Zentrum. In prospektiv-epidemiologischen Studien haben sich die Hinweise verdichtet, dass insbesondere Cannabiskonsum in der Ätiologie psychotischer Erkrankungen eine wichtige Rolle zu spielen scheint (Gage et al. 2016). Es wurde nicht nur ein Dosis-, sondern auch ein Alterseffekt gefunden. Bei Personen mit frühem Beginn (Jugendalter) und starkem Cannabiskonsum bricht eine Psychose eher bzw. früher aus als bei Personen ohne bzw. mit geringem Cannabiskonsum mit Beginn im Erwachsenenalter. Dabei wird angenommen, dass Cannabis, insbesondere dessen aktiver Bestandteil Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC), mit einer bestehenden Vulnerabilität für eine Psychose mit negativer Wirkung interagiert, während Cannabidiol (CBD) eher positive Wirkung auf eine Psychose entfaltet (Murray et al. 2017). Mit dieser Annahme wird allerdings die Abgrenzung zum Sensitivitätsmodell unscharf, so dass letztlich nicht von einer sekundären Psychose gesprochen werden kann. In einer jüngst erschienenen, methodisch ausgezeichneten Übersichtsarbeit kommen Hoch und Mitautoren jedoch zum Schluss, dass die kausale Bedeutung von Cannabiskonsum für die Entstehung psychotischer Störungen bislang nicht als geklärt betrachtet werden kann (Hoch et al. 2019).
Der letzte Modelltyp sind die Gemeinsame-Faktoren-Modelle, wonach auf der Grundlage epidemiologischer, genetischer und neurobiologischer Befunde die Annahme vertreten wird, dass bei Personen mit Psychose eine gemeinsame Vulnerabilität für Substanzkonsumstörungen vorliege. Im Modell der primärenAbhängigkeitserkrankung wird angenommen, dass für Schizophrenie bekannte genetische Risikofaktoren (z. B. Störungen des Catecholaminmetabolismus) oder frühkindliche Traumata (z. B. ventral-hippocampaler Insult) zu Dysfunktionen im mesocorticolimbischen Belohnungssystem im Sinne eines gestörten Dopaminhaushalts führen können. Dieser verleitet den Adoleszenten bereits vor Ausbruch der Psychose zu stärkerem Substanzkonsum als ein Adoleszenter ohne entsprechende Prädisposition. Der erhöhte Substanzkonsum wiederum kann zum einen den Beginn einer Psychose auslösen und zum anderen zur Entwicklung einer SSK beitragen. Auch wenn kein Substanzkonsum vor Beginn der Psychose vorliegt, sagt dieses Modell voraus, dass die Dysfunktion im Dopaminhaushalt des mesocorticolimbischen Systems zur erhöhten Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer SSK auch nach Ausbruch einer Psychose wesentlich beiträgt (Khokhar et al. 2018).
Keines der Ätiologiemodelle kann das ganze Spektrum der Komorbidität von Schizophrenie und Sucht erklären. Es gibt einerseits vielversprechende Modelle (z. B. Sensitivitätsmodell) und andererseits Hypothesen, deren empirische Grundlage dünn ist (z. B. Social-Drift-Hypothese). Ob Untergruppen von Patienten identifiziert werden können, für die einzelne Modelle zutreffen, bleibt weiterhin zu untersuchen. Zudem könnten die Wirkmechanismen verschiedener Modelle bei ein und derselben Person am Werk sein.
2.2.2 Angststörungen und Sucht
Epidemiologische Studien mit repräsentativen Stichproben ergaben signifikante Zusammenhänge zwischen Angststörungen und SSK. Die National Comorbidity Survey z. B. zeigte, dass rund 41 % aller Personen mit einer Angststörung im Verlauf ihres Lebens irgendeine SSK entwickeln (Kessler et al. 1996). Rund 74 % der Männer und 85 % der Frauen gaben an, dass sie vor der SSK bereits unter einer Angststörung gelitten hätten (ebd.). Ein erstes von der Familienforschung und neurobiologischen Forschung untersuchtes, aber empirisch kaum bestätigtes Erklärungsmodell stellt gemeinsame, zu beiden Störungen prädisponierende genetische und andere biologische Bedingungen sowie Umweltbedingungen wie beispielsweise anhaltende Belastungen (z. B. Kindesmisshandlung innerhalb der Kernfamilie) in den Mittelpunkt (Modell der gemeinsamenFaktoren (Brady & Sinha 2005).
Die meisten empirischen Befunde zeigen jedoch, dass Angststörungen und SSK kausal zur Entwicklung der jeweils anderen Störung beitragen können, wobei Merkmale aus dem Angstspektrum (z. B. Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal) und bereits manifeste Angststörungen deutlich häufiger der SSK vorauszugehen scheinen. Lernprozesse scheinen dabei wichtig für die Entwicklung dieser Komorbiditätsform zu sein. Der Konsum bestimmter Suchtmittel (z. B. Alkohol, Benzodiazepine) verringert kurzfristig Stress- und Angstzustände bzw. Angstsymptome (Stress-/Angstreduktions-Hypothese) und bringt dadurch im Sinne einer negativen Verstärkung positive Erwartungen an das Suchtmittel hervor (Erwartungsbildung), die zum anhaltenden Suchtmittelkonsum beitragen können (Selbstmedikationshypothese bzw. Affektregulationsmodell). Anhaltender und zunehmender Suchtmittelkonsum (Toleranzentwicklung) seinerseits kann direkt zum Auftreten neuer Angstzustände (Angstinduktionshypothese) oder zur Verstärkung bestehender Angstsymptome führen. Langfristig kann es wegen der Toleranzentwicklung nicht nur zur Suchtmittelabhängigkeit (sekundärer SSK) kommen, sondern auch indirekt über deren Folgen zur Entstehung anhaltend negativer Emotionalität, einschließlich Angststörungen (sekundäre Angststörung) oder zur Aufrechterhaltung bestehender Angstsymptome und -störungen, die ihrerseits wiederum mit Suchtmitteln bekämpft werden, wie es auch im Brain DiseaseModell auf neurobiologischer Ebene heute recht gut beschrieben wird (Volkow et al. 2016). Sich gegenseitig fördernd schaukeln sich so Angststörung und die SSK in einer Art Teufelskreis auf (Abb. 2.2, »feed-forward cycle« oder bidirektionales Modell) (Anker et al. 2017; Kushner et al. 2000; Moggi 2007). Zu beachten ist, dass akute Intoxikation oder akuter und verlängerter Entzug von bestimmten Suchtmitteln ebenfalls vorübergehend Angstsymptome auslösen können, die jedoch nach Tagen bis Wochen unbehandelt abklingen. Sie sind deshalb nicht als DD, sondern als substanzinduzierteAngst zu bezeichnen (Schuckit 2006).
Abb. 2.2: Komplexes Teufelskreismodell der Interaktionen von Angst- und Substanzstörung (nach Moggi 2007, S. 91, Abdruck mit freundlicher Genehmigung)
Das Teufelskreismodell der Komorbidität von Angststörungen und SSK ist wissenschaftlich weiter zu verfolgen, denn es integriert empirisch gut belegte Teilprozesse zu einem umfassenden Entstehungsmodell. Es gilt zu prüfen, ob das Modell nicht nur bei Alkohol und Benzodiazepinen, sondern auch bei anderen Substanzen empirisch gestützt werden kann. Kaum untersucht sind mögliche Unterschiede zwischen verschiedenen Angststörungen.
2.2.3 Posttraumatische Belastungsstörung
Die Erfahrung traumatischer Ereignisse (z. B. Naturkatastrophen, sexuelle Misshandlungen im Kindes- oder Erwachsenenalter, physische Gewalt, Kriegsgeschehen) korrelieren mit erhöhtem Substanzkonsum. Objektive Merkmale wie Schwere des Traumas (z. B. Vergewaltigung) hängen mit dem Ausmaß des Alkoholkonsums zusammen, der am stärksten ist, wenn eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) vorliegt (Stewart 1996). Wie bei allen Komorbiditätsmodellen zu Angststörungen wird bei der PTBS die Selbstmedikationshypothese herangezogen, wonach Suchtmittelkonsum der Reduktion von PTBS-Symptomen dient. Umgekehrt kann Suchtmittelkonsum dazu führen, dass sich Personen eher in Situationen begeben, welche die Gefahr eines traumatischen Ereignisses erhöhen (Risikohypothese, Chilcoat & Breslau 1998). SSK kann zur Entwicklung einer PTBS beitragen, indem er das Erregungs- und Angstniveau erhöht, sodass nach traumatischen Ereignissen oder Belastungen im Zusammenhang mit dem Konsum (z. B. Trennung vom Lebenspartner) eher eine PTBS entwickelt wird (Vulnerabilitätshypothese, Kushner et al. 2000). Suchtmittelkonsum oder SSK können einerseits eine bestehende PTBS aufrechterhalten oder verschlimmern, indem sie die Person an der kognitiv-emotionalen Verarbeitung des Traumas hindern (Herman 1992), während sie andererseits die Intensität beharrlichen Wiedererlebens kurz nach dem Trauma und vor einer PTBS verringern können (McFarlane 1998). Epidemiologische und klinische Studien zum zeitlichen Muster von PTBS und SSK zeigen mehrheitlich, dass eine PTBS deutlich häufiger einer SSK vorausgeht als umgekehrt (Lieb & Isensee 2007). Die Befunde untermauern stärker die Selbstmedikationsthese, während die Risiko- und Vulnerabilitäts-Hypothese weniger empirische Unterstützung erfährt. Kaum untersucht sind Gemeinsame-Faktoren-Modelle (z. B. Sartor et al. 2011 zur Genetik).
Von den meisten Autoren wird ein Ätiologiemodell eines fehlgeleiteten Selbstmedikationsversuchs mit bidirektionalen Anteilen zur Erklärung der Komorbidität von PTBS und SSK vorgeschlagen. Trauma bzw. PTBS gehen dem SSK meist voraus, sodass Selbstmedikation im Sinne einer Erleichterung von PTBS-Symptomen (v. a. erhöhtes Erregungsniveau und Wiedererleben) als initiale Motivation für Suchtmittelkonsum oder dessen Steigerung am wahrscheinlichsten ist. Anhaltender Suchtmittelkonsum kann zur Verstärkung von PTBS-Symptomen beitragen und negative emotionale Zustände fördern. Ihnen wird mit höherem Suchtmittelkonsum begegnet, sodass es später zur Entwicklung einer SSK kommen kann (Teufelskreismodell, Moggi 2007). Jüngst werden vermehrt Zusammenhänge zwischen Symptomen oder Symptomgruppen der PTBS mit denjenigen der SSK wie z. B. Konsumhäufigkeit, -menge oder -folgen untersucht, um abgrenzbare Muster zu identifizieren, die differenzielle Entwicklungsprozesse von Selbstmedikation nahelegen. So konnten Claycomb Erwin und Kollegen (2017) in einer Querschnittstudie mit einer großen, traumaexponierten US-Veteranenstichprobe zeigen, dass internalisierende Symptome der PTSB wie Anhedonie, erhöhtes dysphorisches Erregungsniveau und anhaltend negativer Affekt signifikant mit dem Schweregrad der Konsequenzen von Alkoholkonsumstörungen, nicht aber mit der Ausprägung des Alkoholkonsums zusammenhängen. Dass externalisierende PTBS-Symptome (z. B. Ärgerneigung) und Merkmale der Alkoholkonsumstörung nicht korrelieren, sehen die Autoren als Bestätigung der Selbstmedikationshypothese an. Allerdings fehlt es bis heute an Längsschnittuntersuchungen, die zumindest die zeitlichen Entwicklungslinien, d. h. wenigstens ein Kriterium von Kausalität, beschreiben könnten.
2.2.4 Affektive Störungen und Sucht
Auch zur Erklärung der Komorbidität von affektiven Erkrankungen und SSK werden mehrere Ätiologiemodelle diskutiert: Affektive Erkrankungen verursachen SSK (z. B. Selbstmedikationshypothese bzw. sekundärer SSK oder auch Affektregulationsmodelle), SSK verursacht die affektive Erkrankung (z. B. substanzinduzierte oder sekundäre Störung), affektive Störungen und SSK bedingen sich gegenseitig (bidirektionales Modell) oder ein dritter Faktor verursacht beide Störungen (Modell der gemeinsamen Faktoren).
Depression
Epidemiologische Untersuchungen mit repräsentativen Bevölkerungsstichproben ergaben zwar einen erhöhten Zusammenhang zwischen Depression und pathologischem Suchtmittelkonsum, aber kein eindeutiges zeitliches Muster zwischen den beiden Störungen, sodass verschiedene und komplexe Wirkungszusammenhänge anzunehmen sind. Die National Comorbidity Survey zeigte, dass rund 27 % aller Personen mit einer Depression im Verlauf ihres Lebens irgendeine SSK entwickeln (Kessler et al. 1996). In repräsentativen epidemiologischen Studien berichten rund 42 % der Männer und rund 53 % der Frauen mit dieser Komorbidität, dass ihrer SSK depressive Symptome oder Depressionen vorausgegangen seien (Lieb & Isensee 2007). Die Ergebnisse von Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien legen keine gemeinsame Ätiologie von Depression und SSK nahe (Swendsen & Merikangas 2000).
Subklinische Symptome einer Depression und negative Emotionalität können das Risiko zur Entwicklung eines sekundären SSK erhöhen. Als Erklärung stellen Baker und Mitarbeiter in ihrer Übersichtsarbeit zum Affektverarbeitungsmodell negativer Verstärkung mit Stress assoziierte negative Affekte als Motiv für Substanzkonsum ins Zentrum (Baker et al. 2004). Als Erklärung zur Entwicklung einer SSK bei Depression wird in Anlehnung an die Modelle zu Angststörungen und Sucht das umfassende Teufelskreismodell herangezogen (Kap. 2.2.2 Angststörungen und Sucht). Für die Erklärung der erhöhten Rückfallgefahr bei Depression und SSK gehen die Autoren in ihrem Affektregulationsmodell davon aus, dass Individuen mit SSK in wiederkehrenden Phasen von Konsum, Entzug und Abstinenz unbewusst interozeptive Hinweisreize für negative Affekte erkennen lernen. Mit Entzugssymptomen assoziierte negative Affekte werden durch erneuten Suchtmittelkonsum beendet, sodass der Konsum negativ verstärkt wird. Stressbedingungen aktivieren negative, einschließlich depressive Affekte, lassen sie je nach Belastungsausmaß bewusst werden und schränken gleichzeitig die kognitive Verarbeitung und damit die bewusste Verhaltenskontrolle so stark ein, dass automatisiertes Rückfallverhalten auftreten kann mit entsprechender negativer Verstärkung durch den Wegfall negativer Affekte. Substanzbezogenes Rückfallgeschehen und anhaltender Suchtmittelkonsum würde so betrachtet schließlich die Remission bzw. Behandlung der Depression verhindern. Es lassen sich Parallelen zwischen dem Affektregulationsmodell und Brain Disease Modell ziehen, in dem die neurobiologischen Prozesse der Entwicklung und Aufrechterhaltung von SSK im Zusammenhang mit negativer Emotionalität beschrieben werden (Volkow et al. 2016).
Dagegen rufen Intoxikation und anhaltender Konsum von Alkohol und anderen Sedativa (z. B. Benzodiazepine) auch direkt depressive Zustände hervor, die zwar in der Regel unter Abstinenz nach zwei, spätestens vier Wochen ohne Behandlung remittieren (substanzinduzierte Depression), jedoch in einigen Fällen auch persistieren können und als sekundäre Depression zu diagnostizieren sind. Des Weiteren treten als Konsequenz von SSK Folgen wie organische Erkrankungen, Arbeitsplatzverlust oder Trennung vom Lebenspartner auf und verursachen so indirekt eine sekundäre Depression, die trotz Abstinenz persistiert und behandelt werden muss (Schuckit 2006). Ergebnisse der National Comorbidity Survey Replication Studie zeigen, dass nicht nur Störungen durch Alkoholkonsum, sondern auch Störungen durch Drogenkonsum mit Beginn im jungen Erwachsenenalter die Wahrscheinlichkeit einer Depression um das bis zu 4.6-fache erhöhen können (Kenneson et al. 2013).
Bei Depression und Sucht wird das Modell der gemeinsamen Faktoren empirisch am wenigsten gestützt. Dagegen scheinen verschiedene unidirektionale, möglicherweise auch komplexe Wechselwirkungsmodelle Gültigkeit zu haben. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, ein integratives Ätiologiemodell für diese Komorbiditätsform vorzustellen.
Bipolar affektive Störungen
In repräsentativen Bevölkerungsstichproben zur Lebenszeitprävalenz weisen rund 61 % aller Personen mit der Hauptdiagnose einer Bipolar-I-Störung und 48 % aller Personen mit einer Bipolar-II-Störung auch irgendwann irgendeine SSK auf (Regier et al. 1990). Umgekehrt lassen sich bei Personen mit der Hauptdiagnose einer Alkoholabhängigkeit nur rund 13 % mit Bipolar Affektiven Störungen (BAS) und bei Personen mit einer Drogenabhängigkeit nur 26 % mit einer BAS finden (Kessler et al. 1994). Bei 71 % der Fälle geht mindestens eine manische Episode der SSK voraus (Kessler et al. 1996).
Wie bei anderen Psychosen wird bei BAS einerseits die Selbstmedikationshypothese, also die Selbstbehandlung der affektiven Symptome mit Alkohol und/oder Drogen, als Erklärungsversuch ins Zentrum gerückt. Tatsächlich geben Suchtmittel konsumierende Jugendliche mit einer BAS im Vergleich zu Jugendlichen ohne BAS eher an, dass sie Substanzen konsumieren, um ihre Affekte zu regulieren (Lorberg et al. 2010). Andererseits wurde auf der Grundlage neurobiologischer Studien das Modell der primärenAbhängigkeit in die Diskussion eingeführt, wonach Personen mit einer psychotischen Erkrankung eine Disposition für Abhängigkeitserkrankung hätten (Kap. 2.2.1; Khokhar et al. 2018). Unter dem gleichen Modelltyp der primären Abhängigkeit wird auch die Hypothese formuliert, dass der Konsum und Entzug von Alkohol und anderen Suchtmitteln dieselben Neurotransmittersysteme (z. B. Serotonin, Dopamin) beeinflusst, die für die Entstehung von BAS verantwortlich sind. Auf dieser neurobiologischen Grundlage kann eine SSK sowohl Entstehung als auch Verlauf von BAS initiieren bzw. beeinflussen (Preuss 2006).
Wie bei Depression und Sucht konnte für BAS bisher kein allgemein gültiges Ätiologiemodell formuliert werden. Selbstmedikationsthese, Affektregulationsmodell und zwei Hypothesen unter dem Begriff der primären Abhängigkeit (Disposition zur Abhängigkeitsentwicklung bei BAS und Dysfunktion gemeinsamer Neurotransmittersysteme als Folge von SSK) bleiben so nebeneinander stehen.
2.2.5 Persönlichkeitsstörungen und Sucht
Der häufigste und am besten empirisch gestützte Modelltyp bei Persönlichkeitsstörungen und Sucht sind unidirektionale Kausalmodelle, in denen die Persönlichkeitsstörung als primäre und die SSK als sekundäre Störung angesehen wird. Die umgekehrte Variante des letzten Modelltyps ist kaum Forschungsgegenstand gewesen. Dagegen wurden Modelle der gemeinsamen Faktoren





























