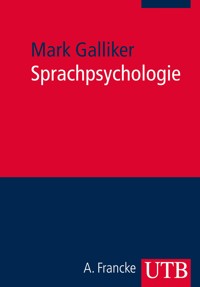Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Lehrbuch werden zwei grundlegende Bereiche der Psychologie vereinigt und übersichtlich behandelt. Die Emotions- und Motivationspsychologie wird in die wichtigsten Paradigmen aufgegliedert (u. a. Evolutionstheorie und Ausdruckslehre, Psychoanalyse, Behaviorismus, Humanistische Psychologie, Kulturhistorische Schule, Kognitive Psychologie, Kommunikationspsychologie). Bei jedem Paradigma werden verschiedene theoretische Ansätze einiger Wissenschaftler in komprimierter Form dargestellt und besprochen. Die einzelnen Theorien werden jeweils unter dem Blickwinkel (neuro-)psychologischer Plastizität betrachtet. Sie werden mit Abbildungen von Modellen und Erfahrungsbeispielen illustriert und auf ihre Anwendungsmöglichkeiten in therapeutischer sowie alltagspsychologischer Hinsicht hin befragt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In diesem Lehrbuch werden zwei grundlegende Bereiche der Psychologie vereinigt und übersichtlich behandelt. Die Emotions- und Motivationspsychologie wird in die wichtigsten Paradigmen aufgegliedert (u. a. Evolutionstheorie und Ausdruckslehre, Psychoanalyse, Behaviorismus, Humanistische Psychologie, Kulturhistorische Schule, Kognitive Psychologie, Kommunikationspsychologie). Bei jedem Paradigma werden verschiedene theoretische Ansätze einiger Wissenschaftler in komprimierter Form dargestellt und besprochen. Die einzelnen Theorien werden jeweils unter dem Blickwinkel (neuro-)psychologischer Plastizität betrachtet. Sie werden mit Abbildungen von Modellen und Erfahrungsbeispielen illustriert und auf ihre Anwendungsmöglichkeiten in therapeutischer sowie alltagspsychologischer Hinsicht hin befragt.
Professor Dr. Mark Galliker ist Hochschullehrer für Psychologie an der Universität Bern und Psychotherapeut FSP.
Mark Galliker
Psychologie der Gefühle und Bedürfnisse
Theorien, Erfahrungen, Kompetenzen
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrofilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2009 Alle Rechte vorbehalten © 2009 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-020874-2
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-022716-3
epub:
978-3-17-028144-8
mobi:
978-3-17-028145-5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungen
Einleitung
1 Emotionstheorien zentraler Vorgänge
1.1 Lokalisationstheorie
1.2 Lateralisierungstheorie
1.3 Modell des dreieinigen Gehirns
2 Emotionstheorien peripherer Vorgänge
2.1 Ereignis-Körperreaktion-Emotions-Theorie
2.2 Die Drei-Faktoren-Theorie
2.3 Differentielle Emotionstheorie
3 Evolutionäre Emotions-, Instinkt- und Prägungstheorie
3.1 Die ausdruckspsychologische Theorie
3.2 Instinkttheorie
3.3 Das sequentielle Emotionsmodell
3.4 Das Prägungskonzept emotionaler Bindung
4 Psychoanalytische Trieb- und Entwicklungstheorien
4.1 Das Triebkonzept
4.2 Identität und Lebenszyklus
4.3 Entwicklungskonzept der Individuation
4.4 Das Konzept des Begehrens
5 Behavioristische Trieb- und Emotionstheorien
5.1 Die klassisch-behavioristische Theorie der Emotionen
5.2 Die formal-behavioristische Triebtheorie
5.3 Die neobehavioristische Zwei-Stufen-Theorie
6 Kontextbezogene Motivationstheorien
6.1 Das topologische Konfliktmodell
6.2 Das Konzept Leistungsmotivation
6.3 Das Risikowahl-Modell
6.4 Das Selbstbewertungsmodell
7 Humanistische Bedürfnis- und Emotionstheorien
7.1 Pyramidenmodell der Bedürfnisse
7.2 Erfahrungs- und Wahrnehmungstheorie der Gefühle
7.3 Das Experiencing-Focusing-Konzept
7.4 Prozess-Experienzielle Emotionstheorie
7.5 Prozess-Erlebnisorientierte Emotionstheorie
8 Kontextuelle-kommunikative Emotionstheorien
8.1 Theorie der Basisemotionen und Darbietungsregeln
8.2 Theorie emotionaler Handlungsbereitschaft
8.3 Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation
9 Naturhistorisch-gesellschaftliche Motivierungstheorien
9.1 Theorie materieller und ideeller Bedürfnisse und Interessen
9.2 Kulturhistorische Theorie der Bedürfnisse
9.3 Kritisch-psychologische Motivationstheorie
10 Kognitive Emotionstheorien
10.1 Die klassische kognitiv-evaluative Emotionstheorie
10.2 Motivational-relationale Emotionstheorie
10.3 Motivational-attributionale Emotionstheorie
10.4 Die gegenstandsbezogene Emotionstheorie
10.5 Das integrative Emotionsmodell
Fazit
Literaturverzeichnis
Personenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Im Rahmen der akademischen Psychologie wurden Gefühle und Bedürfnisse relativ selten unabhängig von der Vernunft betrachtet und auch nicht oft miteinander behandelt oder gemeinsam untersucht. Emotion (emovere: erschüttern, aufwühlen) und Motivation (motivum: Bewegung) sind jedoch nicht voneinander unabhängige Phänomene, wie oft angenommen wurde. Häufig wurde die Motivation nur als jene Kraft betrachtet, welche mit dem Verhalten auch die Emotion bedingt, doch die Emotion kann auch als Erregung verstanden werden, welche der Motivation vorangeht oder diese mehr oder weniger bewusst „wahrnimmt“ und derselben wiederum vorausgesetzt wird. Demnach könnten Emotionen motivierende Eigenschaften annehmen, so wie sich Motivationen emotional auswirken.
Die vorliegende Emotions- und Motivationspsychologie bezieht sich auf die bekanntesten Theorien in diesem Gebiet. Sie werden nach ihren wichtigsten Voraussetzungen i. S. unterschiedlicher Paradigmen angeordnet, wobei auch Verhältnisse der Theorien untereinander berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt liegt auf den neueren Emotions- und/oder Motivationstheorien, gestreift werden aber auch einige ältere Ansätze, die hinsichtlich der aktuellen Theorien aufschlussreich sind.
Von jeder Theorie erhält man das, was man aus ihrem Blickwinkel zu beobachten vermag; was aber nicht heißt, dass man Phänomene, die aus einer bestimmten theoretischen Perspektive erkannt wurden, nur durch dieselben darstellen kann und sie nicht manchmal auch, wenngleich keineswegs immer, im Rahmen anderer Theorien neu auffassen könnte. Andererseits sollen die verschiedenen Theorien in der vorliegenden Arbeit nicht unterschiedslos vorgestellt werden, sondern so weit wie möglich formal und inhaltlich geordnet. Auf diese Weise werden auch Entwicklungen sichtbar sowie wissenschaftliche Beurteilungen und Bewertungen möglich.
In der vorliegenden Arbeit wurden die editorischen Angaben auf das Nötigste beschränkt. Nach dem Namen der Autoren oder Autorinnen folgt an erster Stelle das Jahr, in dem ein Werk zum ersten Mal erschienen ist. Falls es sich bei der im Text berücksichtigten Ausgabe nicht um eine Erstausgabe handelt, folgt an zweiter Stelle das Jahr, in dem die vorliegende Ausgabe publiziert worden ist.
Bei den verwendeten Abbildungen handelt es sich i. d. R. um Darstellungen der besprochenen Theorien oder Modelle. Sie wurden der im Text angeführten Literatur der Autoren und Autorinnen entnommen, manchmal vereinfacht oder den Erfordernissen des vorliegenden Textes angepasst. Einige Illustrationen wurden neu erstellt, um komplexere schriftliche Darstellungen zu veranschaulichen. Die Erfahrungsbeispiele wurden ebenfalls der Literatur entnommen oder stammen aus der eigenen Sammlung. Sie wurden jeweils unkenntlich gemacht hinsichtlich Personen, Zeit und Ort.
Herzlich bedanken möchte ich mich bei Heiner Hofer, der sich am Skript, das diesem Buch voranging, mit Rat und Tat beteiligt hatte, und bei Beat Meier, der einige Kapitel des vorliegenden Buches konstruktiv kritisierte. Werner Zimmermann verdanke ich die Gestaltung der Grafiken. Ohne seine kompetente Mithilfe hätte das Buch wohl kaum je erscheinen können. Bedanken möchte ich mich auch bei Daniel Weimer, mit dem ich mich regelmäßig über die psychoanalytische Theorie und andere therapeutisch relevante Theorien austauschen konnte, und bei Margot Klein, die das Manuskript durchgelesen und überprüft hat. Schließlich möchte ich mich bei den Studierenden der Universität Bern bedanken, die sich im Rahmen der Lehrveranstaltung Emotion und Motivation des Bachelorstudiums mit dem Vorlesungsskript, das eine erste Grundlage des vorliegenden Buches war, eingehend auseinandergesetzt haben und mit zahlreichen Rückmeldungen viel zur Anschaulichkeit und Verständlichkeit der theoretischen Darstellungen sowie zum Alltags- und Praxisbezug der Theorien beigetragen haben.
Januar 2009
Mark Galliker
Abkürzungen
AAM:
Angeborener Auslösemechanismus
ANS:
Autonomes Nervensystem
Bw:
Bewusstsein
EEG:
Elektroenzephalogramm (Elektro-Enzephalo-Gramm)
EMDR:
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
GPT:
Gesprächspychotherapie
JACFEE:
Japanese and Caucasion Facial Expression of Emotions
KVT:
Kognitive Verhaltenstherapie
NS:
Nervensystem
PA:
Psychoanalyse
PEP:
Process-Experiential Psychotherapy
PET:
Positronen-Emissions-Tomograph
PNS:
Peripheres Nervensystem
PRIMES:
Primary Motivational Emotional System
PZA:
Personzentrierter Ansatz
TAT:
Thematischer Auffassungs-Test
TZI:
Themenzentrierte Interaktion
Ubw:
Unterbewusstsein
Vbw:
Vorbewusstsein
VT:
Verhaltenstherapie
ZNS:
Zentrales Nervensystem
Einleitung
Viele Menschen sind unsicher im Umgang mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen. Sie erhalten bis heute erstaunlich wenig Hilfestellung bei der Bewältigung dieser komplexen Aufgabe. Einige Lehren, die uns im Verlaufe der Sozialisation zuteilwurden und die wir später teilweise auch aus eigenen Lebenserfahrungen ziehen konnten, sind ebenso alt wie widersprüchlich. Beispielsweise lernten wir, auf unser Herz zu hören, unseren Gefühlen zu trauen und sie auch auszudrücken; andererseits wurden wir dazu gebracht, nicht allzu emotional zu sein, uns jederzeit zu kontrollieren und uns gut zu überlegen, welche Gefühle wir anderen Menschen zeigen.
Es gibt eine Vielzahl von Gefühlen, von denen wir einleitend nur einige wenige herausheben wollen. Im Assoziationsexperiment reagieren Personen auf das Wort Gefühl in der Mehrzahl der Fälle mit dem Wort Liebe. Auch in repräsentativen Umfragen und in Befragungen von Studierenden, welche Gefühle sie denn am meisten interessieren, steht Liebe an erster Stelle – gefolgt von Hass, Wut, Glück und Trauer.
Liebe ist die zwischenmenschlich verbindende Emotion. Evolutionspsychologisch betrachtet ist sie der Anreiz weiblicher und männlicher Lebewesen zur Vereinigung und Fortpflanzung sowie zur Aufrechterhaltung der Beziehung mit dem Geschlechtspartner und damit auch zum Schutz des Nachwuchses. Der Liebe kommt in verschiedenen Bereichen (z. B. Christentum, Belletristik) eine wichtige, ja zentrale Bedeutung zu. Ins Bedeutungsfeld der Liebe gehören auch Zuneigung, Verliebtheit, Zärtlichkeit, Geborgenheit, Intimität und Leidenschaft, aber auch Nächstenliebe, Verpflichtung und Abhängigkeit. Liebe wird oft als Lebenssinn und als Aufregendstes, ja Beglückendstes oder Schönstes des Lebens betrachtet, doch kann sie sich auch mit anderen Gefühlen vermischen, beispielsweise mit der Angst vor Einsamkeit oder gar mit Hass.
Beim Hass handelt es sich um den Gegenpol der Liebe. Häufig ist er mit Liebe verbunden oder gar verschmolzen, was gewöhnlich als Ambivalenz bezeichnet wird. Hass scheint eine spezifisch menschliche Emotion zu sein, die nicht unbedingt mit der phylogenetisch vermittelten Aggression und ihren evolutionspsychologischen Funktionen gekoppelt ist, sondern vielmehr auf Verletzung durch geliebte oder ehemals geliebte Bezugspersonen oder Mitmenschen zurückgeht. Hass ist ein zwischenmenschlich dissoziierendes Gefühl, das in verschiedener Intensität auftritt und von Abneigung, Ablehnung, Feindschaft bis hin zu Vernichtungswünschen reichen kann. Häufig geht es in der Alltagspsychologie sowie in der wissenschaftlichen Psychologie um die Frage, wie Hass, die enttäuschte Zuwendung, eingedämmt und kontrolliert werden kann.
Bei der Wut handelt es sich um eine heftige Erregung, die entsteht, wenn eine Person in ihrem Handlungsablauf auf sog. Sachzwänge oder unvorhergesehene oder ungerechtfertigte Hindernisse, Begrenzungen, Schutzmaßnahmen usw. einer anderen Person stößt. Die Wut informiert sie, dass ihre Grenze überschritten wurde, dass sie verletzt worden ist. Nachbarkonzepte der Wut sind Hass, Ärger und Aggression (Mees, 1992). Hass ist als Gegenspieler der Liebe am stärksten negativ konnotiert, während Aggression ein wissenschaftlich neutraler Begriff ist und auch im Alltag weniger abwertend verwendet wird. Aggressive Impulse können durch Frustrationen ausgelöst werden und, wenn für diese andere Personen verantwortlich gemacht werden, in Wut umschlagen. Diese heftige Reaktion kann bei einem Angriff zwar lebenserhaltend sein; sie könnte sich aber angesichts befürchteter Verluste auch destruktiv auswirken.
Aristoteles (384–322 v.Chr.) konstatierte nach erfahrenem Unrecht Beruhigung durch Vergeltung, »denn Rache nimmt (herben Menschen) den Zorn, weil sie anstelle der Unlust ein Lustgefühl vermittelt« (Aristoteles, undat., 2006, S. 109). Epiktet (50–138 n. Chr.) wies dann aber darauf hin, dass ein Wutanfall aufgrund eines Übels, das einem widerfahren ist, sich auch negativ auswirken könnte: »Wenn du zornig wirst, so bedenke, dass dir nicht nur dieses Übel widerfahren ist, sondern dass du auch deine Neigung zum Zorne verstärkt hast« (Schmidt, 1984, S. 74). Jedoch kann sich Ärger, der nicht ausagiert, sondern in sich hineingefressen wird, auch negativ auswirken. Entweder bricht die unterdrückte Wut irgendwann in destruktiver Art und Weise am falschen Ort wieder hervor oder sie breitet sich quasi im Untergrund aus und kommt früher oder später in Form von psychosomatischen Störungen oder Depressionen wieder zum Vorschein. Als sinnvolle Bewältigungsformen werden häufig Versprachlichungen der Wut zwischen Ausagieren und Verleugnen diskutiert, wobei zu berücksichtigen ist, dass mit ihnen auch Gefühle der Verletzung oder der Machtlosigkeit überdeckt werden können (Greenberg, 2001, 2006).
Wut wird oft nicht ausgedrückt, weil Konsequenzen befürchtet werden. Furcht ist die Emotion angesichts einer bestimmten Gefahr in einer alltäglichen Situation, die sich evolutionsbiologisch als emotionale Reaktion auf ein Gefahrensignal mit unmittelbar folgendem Fluchtverhalten auswirkt. Diese Emotion sorgt dafür, dass Lebewesen flüchten, noch bevor sie genau erkennen, worin die Bedrohung wirklich besteht. Demgegenüber wird die Angst eher als existentielles beklemmendes Befinden ohne unmittelbare externe Gefahr verstanden. Irrationale Ängste vor bestimmten Objekten (z. B. vor Tieren wie Spinnen oder vor technischen Errungenschaften wie Aufzügen oder PCs) werden als Phobie bezeichnet. Während Wut auch Empowerment bedeuten kann und mit der Handlungstendenz nach vorn gerichtet ist, verleitet Furcht dazu, sich zurückzuziehen und/oder sich im übertragenen oder auch im eigentlichen Sinne zusammenzuziehen. Als Bewältigungsformen der Furcht werden Analysen der objektbezogenen Emotion, Differenzierungen von Gefahr und Unschädlichkeit und/oder Gewöhnungen an den Auslöser i. S. einer Desensibilisierung durchgeführt, während bei der Angst die Rückbesinnung auf den gewöhnlichen Alltag und die Rückkehr zu all seinen konkreten Problemstellungen angestrebt wird.
Das Gefühl von Glück wird im Unterschied zum Angstgefühl als positives Gefühl erlebt. Es handelt sich um ein umfassendes, die allgemeine Lebenssituation betreffendes Lebensgefühl tiefen Wohlbefindens und Zufriedenheit oder um ein Gefühl, das mehr mit günstigen Umständen oder einer erfreulichen Fügung in Verbindung gebracht wird. Entsprechend wird Glück eher ruhig und harmonisch über längere Zeit gleichbleibend erlebt oder aber plötzlich überschwänglich einsetzend und dann weniger schnell wieder abflauend.
Freude ist ein Glücksgefühl, das mit Lebendigkeit und Vitalität verbunden wird. Sie wird als angenehmes, warmes, offenes Wohlbefinden erlebt. Wenn eine Person dieses »Jubelgefühl« empfindet, fühlt sie sich sorgenfrei, leicht, entspannt und gleichzeitig mit der Person, aufgrund derer oder mit der sie sich freut, oder mit einem Objekt der Freude (z. B. einem Geschenk) verbunden. Freude ist i. d. R. in der Liebe enthalten. Allerdings kann auch Stolz Freude beinhalten, und auch Schadenfreude ist eine Freude, die aber mit Geringschätzung assoziiert wird. »Wie kann man sich häufiger freuen?« oder »Ist es Menschen möglich, glücklich zu werden?«, das sind Fragen, mit denen sich die Psychologie lange Zeit nicht beschäftigt hat. In der modernen Psychologie stoßen sie jedoch auf zunehmendes Interesse und werden infolgedessen in der einen oder anderen Form auch im vorliegenden Buch berücksichtigt.
Trauer ist ein qualvoller Gemütszustand nach einem Unglück oder einem Verlust. Dieses Gefühl teilt einer Person mit, dass sie etwas Wichtiges verloren hat, benachteiligt worden ist oder ein wichtiges Ziel nicht erreicht hat. Es ist leidvoll bis hin zum Schmerz, ein Stück von sich selbst verloren zu haben. Dieses Gefühl äußert sich oft zunächst nur als leichtes Brennen hinter den Augen; sofern es dort überhaupt (auf-)gespürt wird, bewegt es sich manchmal den Körper hinunter bis in den Magen hinein. Wenn ein Mensch in Trauer ist, kommt er sich häufig sehr klein vor und denkt »Ich bin jetzt ganz allein« oder »Ich gebe jetzt auf; es bringt ja sowieso alles nichts«. Seufzen ist ein emotionaler Ausdruck der Trauer, der in gewisser Hinsicht erleichtert. Gleichzeitig deutet dieser Ausdruck darauf hin, dass die Trauer unterdrückt wird; jedenfalls nicht weitergehend verbalisiert und womöglich exploriert wird. Häufige Begleiterscheinungen der Trauer sind mehr oder weniger ausgeprägte Hilfsappelle an andere Menschen und an die Gemeinschaft. So finden sich neben individuellen Verarbeitungen (sog. Trauerarbeit) auch die Begleitung durch Angehörige, institutionelle Unterstützungsangebote sowie kulturelle Hilfestellungen (u. a. Trauerriten). Trauer kann mit Wut zusammenhängen – enger als oft angenommen wird. Beispiel: Wird ein Kind von seiner Mutter getrennt, reagiert es häufig zunächst wütend, gefolgt von Trauer über den Verlust (oder zuweilen auch umgekehrt).
Es wäre illusorisch anzunehmen, dass der Oberbegriff aller Gefühle und Empfindungen, nämlich der Begriff Emotion, überall gleich verstanden wird. Das Gegenteil ist der Fall – und zwar nicht nur im Alltag, sondern auch in der Wissenschaft. Die Bedeutungen dieses Begriffs variieren nicht nur von einem wissenschaftlichen Paradigma zum anderen (z. B. vom behavioristischen zum kognitionspsychologischen Paradigma), sondern oft auch innerhalb ein und derselben psychologischen Richtung und zwar fast von Theorie zu Theorie und manchmal sogar von Wissenschaftler zu Wissenschaftler (einen Überblick über die verschiedenen Definitionen der Emotion bei rund 100 verschiedenen Wissenschaftlern geben Kleinginna & Kleinginna, 1981).
Wenn man sich von der Vielfalt der Begrifflichkeit nicht beirren lassen möchte, sollte man sich um eine Sprachregelung bemühen, die zunächst noch möglichst wenig theoriegeleitet ist, beim alltagssprachlichen Verständnis der Emotions- und Motivationsbegriffe ansetzt und zumindest die wichtigsten Unterschiede im Untersuchungsbereich von Emotion und Motivation auslegt. In der vorliegenden Arbeit werden die beiden Begriffe miteinander behandelt, sodass bei einer gemeinsamen Behandlung derselben sowie ihrer Neben- und Unterbegriffe immer auch die Gefahr besteht, sie zu vermengen, wenn nicht rechtzeitig eine erste Sprachregelung erfolgt. Mit der folgenden vorläufigen Bestimmung der wichtigsten Begriffe soll jedoch nicht versucht werden, ein einheitliches Begriffssystem zu schaffen oder auch nur vorzubereiten. In der Emotions- und Motivationspsychologie existieren diverse Paradigmen, die Konzepte nahelegen, die auch bei gleichen Signifikanten ungleiche Signifikate haben und den Gegenstandsbereich verschieden ausdifferenzieren. Lehrbücher, die diesen Sachverhalt ignorieren, befinden sich auf dem Holzweg, denn sie tun so, als ob es sich beim vorliegenden Forschungsgegenstand um ein einheitliches Gebiet handeln würde, das nur i. S. eines Paradigmas – heute meistens jenem der kognitiven Psychologie – untersucht werden könnte und unterschlagen dabei Differenzen vom Stand der Forschung sowie vom Gegenstand her. Mit den nachfolgend angeführten ersten Begriffsbestimmungen sollen aber unnötige Unklarheiten aus dem Weg geräumt und die Verständlichkeit der Darstellung erhöht werden. Zugleich kann der Forschungsgegenstand begrenzt und der Geltungsbereich phänomenologisch vorstrukturiert werden; jedenfalls so weit wie es die meisten wissenschaftlichen Theorien erlauben.
Emotion ist die umfassende Bezeichnung für den inneren Aspekt des Erlebens. Es handelt sich um eine seelische Erregung (auch Gemütserregung genannt), die aber nicht unbedingt bewusst zur Kenntnis genommen wird. Im Unterschied zur Emotion ist das Gefühl immer eine bewusste seelische Regung. Eine Person ist in eine Angelegenheit involviert, wodurch sich »etwas« auch in ihrem Körper und Bewusstsein regt. Mit dieser Regung wird i. d. R. auch eine persönliche Stellungnahme ausgedrückt. Gefühle, die eine Person zulässt, in ihr hochkommen und sie für etwas einnehmen lässt, die sie nicht von vornherein abblockt oder schon vorher zu vermeiden sucht, folgen einem natürlichen Rhythmus; sie entstehen und vergehen, schwellen an und verblassen wieder. Beim Gefühl wird also – abhebend von der allgemeineren Emotion – der Aspekt der subjektiven Wahrnehmbarkeit hervorgehoben. Es handelt sich nur um einen Aspekt der Emotion, nämlich um jenen des erlebten oder subjektiven Fühlens.
Ein Affekt ist eine starke seelische Erregung, die i. d. R. als unmittelbare Reaktion auf einen Stimulus bzw. auf eine wahrgenommene Reizsituation erfolgt. Der meistens nur kurze Zeit wirksame Affekt hat i. U. zu dem Gefühl den Beiklang des Unkontrollierbaren und Heftigen. Der mittel- oder längerfristig andauernde Zustand des Gefühls wird Stimmung genannt. Die Stimmung ist ein Hintergrundgefühl, das nicht durch einen genau bestimmbaren externen Reiz ausgelöst wird. Bei der Empfindung handelt es sich um eine genau bestimmbare Reaktion auf einen spezifischen Reiz, der unmittelbar registriert und körperlich umgesetzt wird. Die Empfindung ist das bei der Einwirkung eines Reizes auf ein Sinnesorgan eintretende körperliche Erlebnis und als solches i. d. R. durch Dauer, Intensität und Qualität genau bestimmt.
Motivation ist die umfassende Bezeichnung für das Ensemble der Beweggründe, die das menschliche Handeln hinsichtlich Inhalt, Richtung und Intensität beeinflussen. Demgegenüber handelt es sich beim Willen um ein Streben, das über eine Entscheidung zum Handeln führt und dieses Handeln womöglich bis zum Abschluss desselben in Gang hält. Interesse ist die besondere Aufmerksamkeit, die eine Person einer anderen Person oder einem Gegenstand aufgrund eines entsprechenden Bedürfnisses schenkt. Der Instinkt ist die bei einem Organismus angenommene ererbte Fähigkeit, in bestimmten Situationen ein nicht bewusst gelenktes, aber richtiges lebens- und arterhaltendes Verhalten zu zeigen.
Bedürfnis wird enger gefasst als Motivation und zwar als ein körperlich in Erscheinung tretender Mangel bezüglich eines Gutes, das zum Leben notwendig ist. Das Verlangen ist das, was zum Leben subjektiv angestrebt wird bzw. das, was zur Behebung des Mangelzustandes (bzw. Bedürfnisses) eingefordert wird. Das Begehren ist ein ausgeprägtes Verlangen nach etwas, das zum Leben benötigt und dessen Erfüllung Genuss bereiten wird. Wie bei der Begierde handelt es sich um den mit der Vorstellung eines Zieles verbundenen Antrieb. Mit dem Trieb ist ausschließlich der innere Antrieb gemeint, der auf die Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse abzielt.
In der vorliegenden Arbeit werden vor dem Hintergrund der angesprochenen Gefühle und Bedürfnisse eine Reihe von Fragen gestellt und mithilfe der vorliegenden Theorien und vorhandenen Erfahrungen so weit wie möglich beantwortet. Einige der elementarsten Fragen sollen zur Illustration an dieser Stelle angeführt werden:
Für was sind Emotionen gut?
Wie finden wir einen Zugang zu ihnen?
Können uns Gefühle etwas mitteilen?
Was tragen sie zum Denken bei?
Wie können störende Emotionen kontrolliert werden?
Wie werden Bedürfnisse erkannt?
Wie werden Bedürfnisse zum Ausdruck gebracht?
Lassen sich Gefühle durch andere Gefühle beeinflussen, verändern und/oder ersetzen?
Diese Fragen und eine Reihe weiterer Fragen werden in der vorliegenden Arbeit behandelt und so weit wie möglich beantwortet, auf dass bei den Lesern und Leserinnen ein Bild von Emotion und Motivation entsteht, das es ermöglicht, Emotion und Motivation besser zu handhaben und zu organisieren. Dabei wird die Vielfalt der Antworten berücksichtigt, welche die bestehenden psychologischen Theorien anbieten. Dieselben werden nach Richtungen und Paradigmen gruppiert und in komprimierter Form präsentiert.
Im Bereich des Verhaltens, der Emotionalität sowie der Motivation sind Erklärungen i. S. linearer Kausalität nicht ausreichend. Ebenso wie die Auswirkungen von Voraussetzungen sollten Rückwirkungen und nötigenfalls auch ganze Serien entsprechender Kreisläufe berücksichtigt werden, sodass dieser Prozess auch von einem bestimmten (Zwischen-)Ergebnis her aufgerollt und betrachtet werden kann. Die Beachtung des Ergebnisses eines ursprünglich spontanen Vorgangs wird zur neuen Voraussetzung der Fortsetzung des Vorgangs. Der in der humanistischen Psychologie zentrale Begriff »Be-achtung« ist immer schon Rückschau und zugleich Vorschau oder Rücksicht und Vorsicht. Beachtung rollt das Geschehen quasi von hinten her wieder auf. Es ist nicht in erster Linie eine »Wenn-Dann-Beziehung«, sondern eine »So-dass-Beziehung«. Im Zusammenhang betrachtet, wird jedes Moment als bedingt und bedingend verstanden. Jeweils wieder neu Vorgegebenes wird manuell und/oder kommunikativ umgestaltet. Es wird beachtet und aufgrund dieser »Wahrnehmung« weiter behandelt. Beispielsweise werden vorhandene Emotionen mit anderen Emotionen »übermalt« – bildlich gesprochen mit mehr oder weniger Wasser und anderen Farben. Dabei lässt sich natürlich Schwarz weniger gut übermalen als Gelb oder Hellblau.
Bei dem skizzierten methodologischen Verhältnis handelt es sich zwar in einem gewissen Sinne ebenfalls um einen kausalen Zusammenhang, aber um einen solchen, an der die Person beteiligt ist – eine Person, die ihr weiteres Verhalten aufgrund vorliegender Begebenheiten eben oft begründet vollzieht. Sie setzt sich in einer bestimmten Richtung in Bewegung i. S. ihres (Hinter-)Grundes. Dieser »Beweggrund« ist die Motivation, wissenschaftstheoretisch ausgedrückt. Das skizzierte Verhältnis lässt sich als Selbstwirksamkeit eines Subjekts und längerfristig gesehen als Selbstentwicklung desselben verstehen. Wo dasselbe ausgeschlossen wird (wie z. B. bei einigen naturwissenschaftlichen Ansätzen), muss auch vom Motivationskonzept abstrahiert werden. Wo es angenommen oder unterstellt wird, können direkte Verhaltenskonsequenzen notwendigerweise nur einen Aspekt der Motivation bilden, ausgenommen jene Fälle, bei denen sich die Wahrnehmung und Bewertung des Subjekts ausdrücklich auf die unmittelbaren Folgen des Verhaltens bezieht und mit diesen das weitere Verhalten begründet. Allerdings ist der entsprechende Prozess i. d. R. nicht von Anfang an zugänglich. Meistens wird er erst allmählich bewusst. Sicherlich ist aber die Bewusstwerdung nicht das größte Problem. Schwieriger scheint die Umsetzung von Erkenntnissen in einem primär unwillkürlichen Prozess zu sein.
Der angedeutete wissenschaftstheoretische Ansatz hat auch einen wissenschaftlichen Inhalt, nämlich persönliche Formbarkeit, Gestaltung, Plastizitat. Gerade im Bereich der Emotionen fällt dieser Ansatz von alters her in Betracht: Bereits Aristoteles wies in der Nikomachischen Ethik darauf hin, wie i. U. zum Bereich der Sinneswahrnehmung in den handwerklichen, künstlerischen und sittlichen Bereichen gelernt wird: »Denn was man erst lernen muß, bevor man es ausführen kann, das lernt man, indem man es ausführt: Baumeister wird man, indem man baut, und Kitharakünstler, indem man das Instrument spielt. So werden wir auch gerecht, indem wir gerecht handeln, besonnen, indem wir besonnen, und tapfer, indem wir tapfer handeln« (undat., 2006, S. 34 f). Aus »wiederholten Einzelhandlungen« gehen »feste Grundhaltungen« hervor (ebd., S. 68). Das heißt, die Gewöhnung verfestigt sich schließlich im Menschen und wird zur »zweiten Natur« in ihm; zu einer Natur, die oft als eigentliche Natur verkannt wurde. Gemäß dem Autor erhält das Konzept der Kompetenz erst seinen vollen Sinn »in der Zurückführung auf das Wirken«, wobei das »entscheidende Moment im Wirksamwerden (liegt)« (ebd., S. 264).
Aristoteles erkannte, dass dieses Wirken durch die zugehörige Lust intensiviert wird. Wer der Baukunst mit Lust ergeben sei, mache entsprechende Fortschritte in diesem, seinem eigensten Bereich. Die intensivierende Lust, die wesentlich dem Intensivierten zugeordnet sei, könne aber auch eine andere Tätigkeit stören. Beispielsweise werde ein begeisterter Flötenspieler einer philosophischen Diskussion nicht mehr richtig folgen, falls Flötenmusik an sein Ohr gelange und er nun dieser Musik seine Aufmerksamkeit schenke. »Das lustvollere Tun verdrängt das andere, und wenn der Unterschied an Lustgehalt sehr groß ist, dann um so entschiedener, so dass man das minder Angenehme sogar aufgibt« (ebd., S. 282). Demnach kann Unlust durch Lust vertrieben werden und zwar durch die der Unlust entgegengesetzte Lust oder auch durch eine beliebige andere Lust, wenn sie nur stark genug ist. Allerdings sieht Aristoteles hierin v. a. den Grund für die Entwicklung eines schlechten Charakters oder von Suchtverhalten, wenn beispielsweise außer an sinnlicher Lust an nichts anderem mehr Vergnügen gefunden werde.
Epikur (341–270 v. Chr.) wies darauf hin, dass eine Person die Folgen jeder Handlung in Rechnung stellen und dabei abwägen könne, ob sie mehr Lust oder Unlust bereiten würde, um dann beispielsweise kurzfristig Schmerzen in Kauf zu nehmen, um längerfristig größere Lust zu erreichen. Eines der Mittel, die Epikur zur Verfügung standen, um Schmerzen zu überwinden oder wenigstens zu lindern, war deren Kompensation durch Lust: »Man sollte versuchen, den Schmerz durch gleichzeitige Lustempfindungen in anderen Bereichen aufzuwiegen oder zu übertönen, und zwar nicht nur durch gegenwärtige Lust (z. B. wenn jemand seinen Kopfschmerz bei schöner Musik zu vergessen trachtete), sondern auch durch die Erwartung künftiger oder die Erinnerung vergangener Freuden« (Hossenfelder, 1996, S. 169).
Der britische Philosoph Hume (1711–1776), wissenschaftstheoretisch gesehen der Urvater des modernen Empirismus und der empirischen Psychologie, unterschied zwischen direkten und indirekten Affekten. Letztere seien mit einer Vorstellung assoziierte Affekte. Sie könnten direkten Affekten neue Stärke verleihen und das Begehren vergrößern. Allerdings würden sie aber nicht einfach dem Geist folgen, seien sie doch träger und nach eigenen Gesetzmäßigkeiten wandelbar. Affekte könnten ineinander übergehen, sich wechselseitig verstärken und in einigen Fällen ihre Auslöser wiederum selbst erzeugen. Hume nahm also eine eigene Dynamik der Affekte mit der Möglichkeit der Abkopplung vom äußeren Reizen als zentrale Determinante an. Damit wurde auch die Formbarkeit von Vorstellungen und letztlich den ihnen zugrundeliegenden Sinneseindrücken thematisch sowie methodologisch möglich. Nach dem Autor kann sich aber kein Mensch etwas vorstellen, das er nicht schon früher durch äußere oder innere Sinne empfunden hat. Demnach sind Vorstellungen immer schon einem vorausgehenden Eindruck oder einer Empfindung nachgebildet. Als solche stehen sie allerdings den Menschen jederzeit zur Verfügung, wenngleich in einem weniger lebhaften Sinne als die unmittelbaren Sinneseindrücke. Mit anderen Worten: Vorstellungen erlauben es, frühere Sinneseindrücke zu »wiederholen« und in abgeschwächter Weise zu handhaben bzw. mit ihnen aktuelle Emotionen zu modifizieren und zu modellieren. Beispielsweise kann sich eine Person vorstellen, dass sie bald Schmerz verspüren wird, wenn sie sich wieder gleich verhalten würde, wie bei einer früheren Gelegenheit. Andererseits könnte die Person auch eine Vorstellung früheren Glücks in die momentan weniger glückliche Situation einbringen.
Seit Lamarck (1744–1829) und in einem heute noch wissenschaftlich vertretenen Sinne seit Darwin (1809–1882) wurde in der Biologie die Veränderbarkeit und Formbarkeit neben der Konstanz der Phänomene beachtet und der Plastizität schließlich die Priorität eingeräumt. In der modernen Neurobiologie wurde schließlich auch der Plastizitat des Nervensystems große Bedeutung beigemessen: »Unsere Experimente an der Aplysia zeigen (…), dass die Plastizität des Nervensystems – die Fähigkeit der Nervenzellen, die Stärke und sogar die Anzahl der Synapsen zu verändern – der Mechanismus ist, der Lernen und Langzeitgedächtnis zugrunde liegt. Da nun jeder Mensch in einer anderen Umgebung aufwächst und unterschiedliche Erfahrungen macht, besitzt das Gehirn jedes Menschen eine einzigartige Architektur. Sogar eineiige Zwillinge mit identischen Genen haben auf Grund unterschiedlicher Lebenserfahrungen verschiedene Gehirne« (Kandel, 2006, S. 240).
Selbst wenn die Problematik der Plastizität nur biologisch betrachtet wird, scheint sie einen größeren Bereich der Varianz menschlichen Verhaltens erklären zu können als die Gene, die aber als solche in einem breiteren Sinne verwertbar zu sein scheinen. Zwar werden sich im Verlaufe des Lebens Verfestigungen ergeben und manches wird zur »zweiten Natur« werden, doch auch im Alter bleibt durchaus noch eine gewisse Plastizität erhalten (Lehr, 2003). Lebenslange Plastizität scheint heute nicht nur neurologisch, sondern auch psychologisch erklärbar zu sein (vgl. u. a. Perrig-Chiello et al., 1997).
Auch im vorliegenden Buch soll das subjektive Wohlbefinden der Person unter gegebenen Lebensverhältnissen im Zentrum der Betrachtung stehen. Ein wesentlicher Teil der Arbeit befasst sich besonders mit dem theoretisch sowie praktisch relevanten Problem der Plastizität der Gefühle und Bedürfnisse, wobei neben den modernen Konzepten auch ältere Konzepte berücksichtigt werden, die inhaltlich und/oder formal einen ähnlichen Charakter aufweisen und sich in diesem Bereich nach wie vor als relevant erweisen könnten, wenngleich die bestehenden Theorien und Modelle im emotionalen und motivationalen Bereich nicht i. S. der Plastizität formuliert sind und meistens als einfache Flussdiagramme dargestellt werden, häufig sogar ohne die Möglichkeit einer einfachen Rückwirkung oder Rückmeldung.
Im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit wird der alten Frage nachgegangen, ob und allenfalls wo Emotionen im zentralen Nervensystem lokalisierbar sind. Wenn Emotionen zentralneural gesteuert sind, müssten sie auch vom Zentrum aus gedacht formbar sein und zwar nicht nur medizinisch durch Medikamente, sondern auch psychologisch. Letzteres könnte etwa dadurch geschehen, dass Emotionen bewusst zur Kenntnis genommen und die entsprechenden Gefühle im Bewusstsein umgeformt würden (z. B. durch Phantasietätigkeit). Entsprechende Veränderungen müssten sich allerdings auch physiologisch auswirken (z. B. Veränderung der Herzkohärenz).
Im zweiten Kapitel stellt sich die Frage, ob über die Wahrnehmung körperlicher Veränderungen und Empfindungen Gefühle geformt und verformt werden können. Ist etwa die Mimik nur Endergebnis der Emotionen oder kommt ihr bei Entstehung derselben eine größere Bedeutung zu? Sind Atmung oder Puls nur physiologische Begleiterscheinungen der Emotionen, oder sind sie wesentlich an deren Konstitution beteiligt, sodass sie auch hinsichtlich der Modifikation der Emotionen von Bedeutung sind?
Im dritten Kapitel wird untersucht, ob und, wenn ja, wie sich Emotionen und Bedürfnisse im Verlaufe der Evolution verändern. Naturgeschichtlich orientierte Forscher sind der festen Überzeugung, dass die Entstehung und Veränderung von Emotionen und Bedürfnisse nur unter Rückgriff auf die Entwicklung der Arten zu verstehen sind. Sie stellen die Frage nach den Reproduktionsvorteilen, die angeborenes emotionales Ausdrucksverhalten der Art und dem Individuum bietet. Dabei stellt sich die Frage, ob die Erhaltung der Art und die Erhaltung des individuellen Lebens nicht auch ein »Ziel« ist, das die Organe und ihre Funktionen beherrscht. Ist bevorteiltes angeborenes Verhalten in der Ontogenese gleichwohl formbar? Haben im Humanbereich Instinkte und Prägungen einen ebenso definitiven Charakter wie im infrahumanen Bereich?
Im vierten Kapitel wird das Triebleben aus psychoanalytischer Sicht betrachtet. Wie kommen die für die Menschen wichtigsten Bedürfnisse und Gefühle (insbesondere Liebe und Hass) psychodynamisch zustande? Wie werden sie im Verlaufe der Entwicklung auf verschiedene Objekte (Personen und Gegenstände) verteilt und wie verändern sie sich dabei? Lassen sie sich rückblickend erneut verwandeln und, wenn ja, wie? In der Psychoanalyse erfolgen die wichtigsten Veränderungen nicht bewusst, sondern unbewusst über die sog. primären Prozesse, die im Wesentlichen durch unwillkürliche Verschiebungen und Verdichtungen erfolgen. Handelt es sich hierbei um Umformungen, die gegebenenfalls auch kreativ ausgestaltet werden könnten?
Im fünften Kapitel werden Triebe und Emotionen so weit untersucht, wie sie durch körperliches Verhalten ausweisbar sind. Die Konditionierung ist die wichtigste Möglichkeit der Veränderung innerhalb des behavioristischen Paradigmas. Es können nicht nur unbedingte Reize durch bedingte, ursprünglich neutrale ersetzt werden, sondern es ergibt sich auch die Möglichkeit der Reaktionssubstitution. Bei den auf die klassischen behavioristischen Ansätzen folgenden behavioristischen Ansätzen (insbesondere operante Konditionierung) und neobehavioristischen Ansätzen (insbesondere Kombination von klassischer Konditionierung und instrumenteller Konditionierung) werden Verhaltensweisen und entsprechende Emotionen auch bestimmten Annäherungen und Ausformungen unterzogen (sog. Shaping).
Im sechsten Kapitel wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Motivation durch die Person und den Kontext, in dem dieselbe agiert, modifizierbar ist. Insbesondere stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Motivation auf die Performance hat. Dabei kann es sich nicht nur um einen Impuls handeln wie etwa beim Anstoß einer Billardkugel. Es stellt sich die Frage, welche Rolle der Rückmeldung zukommt. Beispiele solcher Rückmeldungen sind die Leistungsbeurteilung und die Selbsteinschätzung. Inwieweit vermögen sie die Motivation umzuformen? Dabei stellen sich weitere Fragen: Warum wurde bisher in der Psychologie Motivation meistens auf Leistungsmotivation reduziert? Oder auch die mehr wissenschaftstheoretisch relevante Frage: Erübrigt sich mit einem umfassenden Konzept der Bekräftigung nicht auch ein breit gefasstes Motivationskonzept?
Im siebten Kapitel wird die Plastizität der Emotionen und Bedürfnisse aus der Perspektive der Humanistischen Psychologie betrachtet. Besondere Bedeutung kommt dabei der Beachtung und Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu. Das humanistische Paradigma weist über die Anreiz- und Homöostasemodelle psychoanalytischer und behavioristischer Prägung hinaus und misst dem Erleben von Gefühlen sowie der Kreativität besondere Bedeutung zu. Wesentlich ist die Beachtung der Empfindungen sowie deren Symbolisierung, um zu einer ansonsten unwillkürlichen Veränderung zu gelangen (sog. Shift).
Im achten Kapitel wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Emotionen einer Person angesichts des kulturellen und des engeren sozialen Kontextes, in dem dieselben ausgedrückt werden, adaptiert und geregelt werden bzw. welche Auswirkungen die Beachtung der Kommunikationspartner und deren Rückmeldungen haben. Man kann annehmen, dass Akteure, die, ohne mögliche Verhaltenskonsequenzen zu berücksichtigen, nur angenehme Emotionen zu erreichen und unangenehme Emotionen zu vermeiden suchen, früher oder später scheitern.
Im neunten Kapitel wird der Frage nachgegangen, ob und wenn ja: wie spezifisch menschliche Bedürfnisse durch Tätigkeiten, durch die Arbeit und in einem weiteren Sinne durch die Produktion sich konstituieren, formen und weiterentwickeln. Trifft es tatsächlich zu, dass Personen ihre Bedürfnisse selber schaffen? Einzeln oder mit anderen zusammen, unvermittelt oder vermittelt über ihre je besonderen Voraussetzungen? Es stellt sich auch die Frage, wie sich das emotionale Befinden in einer Gesellschaft verändert, in der die für den Menschen gerade auch in psychologischer Hinsicht wesentliche Arbeit nicht mehr selbstverständlich ist.
Im zehnten Kapitel wird das kognitive Paradigma behandelt, das die mehr als zwei Tausend Jahre alte Annahme beinhaltet, dass nicht die Dinge als solche die Menschen beunruhigen, sondern die Vorstellungen von diesen Dingen und dass Emotionen über Vorstellungen und Gedanken verändert werden können. Demnach besteht die Aufgabe der Menschen darin, die Inhalte ihres Bewusstseins in einem positiven Sinne zu gestalten und zu ihrem Besten zu verwenden. Doch würde dies nicht bedeuten, dass Probleme im Bereich von Emotion und Motivation ausschließlich oder zumindest in erster Linie zentral zu behandeln wären und andere Aspekte wie z. B. jene der Gegenständlichkeit und der Arbeit nur von sekundärer Bedeutung wären?
1 Emotionstheorien zentraler Vorgänge
Die ersten Emotionstheorien, die zur Zeit der Entstehung der modernen Naturwissenschaften (und insbesondere der Neurophysiologie) entwickelt wurden, bezogen den Gegenstand ihrer Bemühungen entweder auf das zentrale Nervensystem oder auf das periphere Nervensystem. Die Wissenschaftler der ersten Gruppe, die sogenannten Zentralisten, beschäftigten sich mit den neurophysiologischen Korrelaten der Emotionen im Zentralen Nervensystem. Zu ihren Zielsetzungen gehörte es, den »Sitz« der Emotionen im Gehirn zu finden. Die erwartete »Entdeckung« stellte sich nicht ein. Die Forschungsarbeiten erbrachten zwar erste Befunde, doch diese betrafen lange Zeit mehr Wortbilder als Emotionen. Gelang es den Forschern schließlich doch noch das Zentrum der Emotionen im Gehirn zu lokalisieren?
Unter dem Nervensystem (NS) wird die Gesamtheit der Zellen verstanden, die zur Entstehung und Weiterleitung von Erregung spezialisiert sind. Das NS wird topographisch in das zentrale Nervensystem (ZNS) und das periphere Nervensystem (PNZ) unterteilt. Dabei bilden zahlreiche zwischengeschaltete Nervenzellen (Interneurone) komplexe neuronale Schaltkreise. Das ZNS setzt sich aus dem Gehirn und dem Rückenmark zusammen. Im Rückenmark leiten aufsteigende Bahnen Nervenimpulse aus der Peripherie zum Gehirn und absteigende Bahnen leiten Impulse vom Gehirn zu den ausführenden Organen (bzw. Erfolgsorganen) an der Peripherie zurück, wobei bestimmte Teile des NS tätig sind, ohne dass die Menschen etwas davon merken. Das periphere Nervensystem (PNS) besteht aus willkürlich und einem unwillkürlich tätigen Teil. Beim unwillkürlich tätigen Teil handelt es sich um das autonome Nervensystem (ANS), das auch vegetatives Nervensystem (VNS) genannt wird.
1.1 Lokalisationstheorie
Ausgangspunkte
Der im Jahre 1758 in Wien geborene Gall, ein studierter Mediziner und Anatom, behauptete schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dass menschliche Stärken, Potentiale, Fähigkeiten oder »Vermögen« in besonderen und voneinander abgegrenzten Gehirnarealen lokalisiert seien. Galls phrenologische Karten stellten einen Versuch dar, menschliche Kräfte i. S. der damals noch weit verbreiteten Vermögenspsychologie auf das Gehirn zu projizieren. Später wurde der Versuch unternommen, anhand von Beobachtungen der Veränderung menschlicher Verhaltensweisen nach Hirnverletzungen Funktionen der Hirnrinde zu bestimmen. Die klinische Beobachtung und wissenschaftliche Erforschung der Folgeerscheinungen derartiger Verletzungen begann aber erst mit den Forschungsarbeiten eines französischen Naturwissenschaftlers, nämlich mit dem Anatomen BROCA.
Theorie
Broca (1861) beschrieb das Gehirn eines Patienten, der schon mehrere Jahre in der Salpêtrière in Paris lag. Dieser Patient hatte schwere motorische Sprachstörungen, ja, er konnte faktisch nicht mehr sprechen.
Beispiel
Der von Broca untersuchte Patient hatte vom Krankenpersonal den Spitznamen »Tan« erhalten. Das lag daran, dass dieser Patient nur noch eine Silbe aussprechen konnte. Es handelte sich um die Silbe »Tan«.
Broca nahm nach dem Tod des Patienten Tan eine Autopsie vor und stellte fest, dass die linke Seite des Kortex im hinteren Drittel der Stirnhirnwindung zerstört war. Er schloss daraus, dass die linke Großhirnhälfte jener Bereich des Gehirns sein müsse, der auf die Sprachproduktion spezialisiert ist. Weiterhin nahm Broca die Spezifikation vor, dass die motorische Komponente des Sprechens mit dem hinteren Drittel der unteren Schläfenwindung verbunden sei. Er betrachtete diese Region als das Zentrum motorischer Wortbilder. Eine Verletzung dieses Zentrums führe zu einem typischen Verlust der Sprachäußerungen. Dieser Verlust wurde später als Aphasie bezeichnet. Die vom Forscher für die höheren Sprachfunktionen lokalisierte linke Hemisphäre des Gehirns erwies sich für Rechtshänder als die dominierende; eine Präzisierung, auf die Broca bereits selbst schon hingewiesen hatte (Broca, 1878).
Empirie
Broca entwickelte die Forschungsmethode der Untersuchung örtlicher Hirnverletzungen. Aus den Folgeerscheinungen dieser Verletzungen wurde die psychische Funktion erschlossen. Wernicke (1874) überprüfte die Untersuchungen von Broca, und seine Untersuchungen bestätigten im Wesentlichen Brocas Befund einer Beziehung zwischen der Schädigung der linken Großhirnhälfte und Sprachstörungen. Allerdings handelte es sich bei den von Wernicke beschriebenen zehn Fällen um Verletzungen des hinteren Drittels der oberen Schläfenwindung (Gyrus temporalis superior). Diese Verletzungen ergaben ein ähnlich klares Krankheitsbild wie bei Broca, jedoch war es dem von Broca registrierten Phänomen auf der gemeinsamen Grundlage einer Sprachstörung geradezu entgegengesetzt. Während es sich bei den Patienten von Broca um eine Läsion der Fähigkeit zur Verbalisierung und Symbolisierung handelte, war bei Wernickes Patienten die Fähigkeit beeinträchtigt, Sprechäußerungen zu verstehen.
Des Weiteren überlegte sich Wernicke die Folgen einer Verletzung des Gyrus temporalis superior, der Verbindung zwischen rechter und linker Hirnhälfte. Dabei würden, so seine Überlegung, die beiden Sprachzentren zwar ungestört bleiben, die unterbrochene Verbindung zwischen den beiden Zentren müsste aber sicherlich andere Konsequenzen nach sich ziehen. Der Autor prognostizierte, dass Patienten mit Schädigungen an dieser Verbindungsstelle im Gehirn sicherlich nichts Vorgesagtes repetieren könnten, obgleich sie sich weiterhin sprachlich ausdrücken und nach wie vor über Sprachverständnis verfügen würden. Diese theoretisch abgeleitete Prognose begründete Wernicke wie folgt: Die Trennung der beiden Sprachzentren hält den Teil des Gehirns, der darauf spezialisiert ist, die von außen hereinkommende Sprache zu verstehen (die heutige Wernicke-Region) davon ab, irgendeine Information an den Teil des Großhirns weiterzuleiten, der für die Produktion von Sprache zuständig ist (die heutige Broca-Region). Als später Patienten gefunden wurden, die an dem genannten Syndrom litten (heute als Konduktions-Aphasie bezeichnet), konnte sich diese Hypothese bewähren.
Abb. 1: Sprachzentren nach Broca und Wernicke
Der Gyrus temporalis superior ist die Stelle, an der das Wernicke-Sprachzentrum mit dem Broca-Sprachzentrum verbunden ist. Wird der Gyrus temporalis superior verletzt, können keine Informationen mehr zwischen den beiden Zentren vermittelt werden, was genau bestimmbare Konsequenzen hat. So ist es erwartungsgemäß nicht mehr möglich, gehörte Wörter zu wiederholen.
Kritik
Brocas Untersuchungen bezogen sich auf eine Gruppe von Patienten mit Verletzungen an ganz bestimmten Stellen des Gehirns. Die Nachfolger von Broca befassten sich dann meistens ebenfalls mit der linken Hirnhälfte. Lange Zeit fehlten nicht nur Befunde über die rechte Hemisphäre, sondern auch solche, die sich nicht ausschließlich auf intellektuelle Aspekte der Sprachproduktion und des Sprachverstehens bezogen. Sprache hat nicht nur mit Verstand und Vernunft, sondern auch mit Gefühl zu tun.
Wissenschaftliche Nachwirkungen
Brocas und Wernickes theoretische Lokalisierungen lösten bei den damaligen Neurologen einen beispiellosen Enthusiasmus aus. Mit großem Aufwand suchten sie nach Belegen weiterer Lokalisationen komplexer psychischer Vorgänge. Allerdings wurden zur rechten Hemisphäre des Gehirns vorerst kaum Ergebnisse eingebracht, wahrscheinlich, weil nach Unfällen ausschließlich oder jedenfalls fast nur Personen mit offensichtlichen körperlichen Verletzungen oder offensichtlichen Sprechstörungen behandelt wurden.
Diese Situation verbesserte sich erst mit den Untersuchungen Sperrys (1968), der ein neues Verfahren für die genaue Funktionsanalyse entwickeln sollte (s. u.). Dessen ungeachtet muteten sich die Neurologen schon früh zu, funktionale Karten des Kortex zu erstellen. Ihrer Meinung nach war die Frage nach dem funktionellen Aufbau des Gehirns in absehbarer Zeit größtenteils beantwortet, was sich jedoch später als Trugschluss herausstellen sollte (vgl. u. a. Lurija, 1973, 1996). So wird heute angenommen, dass bei dem für die Psychologie aufschlussreichen inneren Sprechen u. a. eine Aktivierung der Broca- und Wernicke-Regionen erfolgt. Die Vorgänge des Arbeitsgedächtnisses werden in den lateralen präfrontalen Kortexregionen lokalisiert, die freilich bei ihrer Aktivierung auch mit anderen (mitunter sensorischen) Kortexregionen kooperieren (vgl. u. a. auch Damasio, 2002).
1.2 Lateralisierungstheorie
Ausgangspunkte
Nach den grundlegenden Erkenntnissen von Broca (1878) und Wernicke (1894) stellten sich Wissenschaftler, darunter DAVID-SON die Frage, ob neben dem Sprachvermögen auch den Emotionen im Kortex ein besonderer Platz zukommt und, wenn ja, wo die Emotionen im Kortex zu verorten sind. Dem damaligen Stand der Wissenschaft entsprechend mussten sie sich allerdings auf die Frage beschränken, ob Emotionen in der rechten oder linken Hemisphäre des Gehirns zu lokalisieren sind.
Theorie
Davidson (1993) stellte die bisherigen Forschungsergebnisse zur Lokalisation von Emotionen zusammenfassend dar. Aufgrund dieser Arbeit behauptet er, dass die emotionale Wertigkeit bzw. Valenz lateralisiert bzw. auf eine Seite des Gehirns verlagert ist. Eine erste einfache Hypothese des Autors lautete wie folgt: Emotionen sind in der rechten Hemisphäre angesiedelt. Offenbar hatten ihn dazu Beobachtungen des Verhaltens von Patienten mit Verletzungen der rechten Hirnhälfte veranlasst. Obwohl ihre sprachlichen Kompetenzen intakt waren, reagierten sie unverhältnismäßig emotional auf ihre neue Situation, während Brocas Patienten, deren sprachliche Kompetenzen gestört waren, sich im Übrigen meistens relativ wohl fühlten oder zumindest den Anschein erweckten, sich recht wohl zu fühlen.
Davidson formulierte noch eine zweite, komplexere Hypothese, eine Alternativhypothese: In der rechten Hemisphäre sind eher negative Emotionen lokalisiert, während in der linken Hemisphäre eher positive Emotionen lokalisiert sind. Begründung: Patienten mit Verletzungen der linken Hirnhälfte waren ausgeglichener und zeigten weniger negative Emotionen als jene, deren rechte Hirnhälfte verletzt war (u. a. Neigung zu Jähzorn und zu Persönlichkeitsveränderungen). Der erste Fall der negativen Emotionen führt i. d. R. zu Vermeidungsverhalten; der zweite Fall der positiven Emotionen zu Annäherungsverhalten. Offenbar verursachten die Patienten der ersten Gruppe eher Probleme im Umgang mit anderen Menschen, während sich die der zweiten Gruppe trotz ihres Leidens freundlich verhielten und für die Behandlung dankbar waren.
Das Gefühlsleben war aber oft auch gestört, wenn nur eine Hirnhälfte beschädigt war. Patienten, die ein Schlag am linken Vorderhirn getroffen hatte, versanken häufig in Depressionen, während ein Blutgerinnsel im rechten Vorderhirn zu einer andauernden Fröhlichkeit verbunden mit einem Realitätsverlust führen konnte.
Es stellte sich die Frage, ob die rechte Hirnhälfte auch hinsichtlich der Kommunikation von Interesse ist. Im Unterschied zu der auf der linken Seite angesiedelten Sprachkompetenz könnte das Geschehen auf der rechten Seite vielleicht auch etwas zur Kommunikation mittels Gesten oder der Bewegung anderer Körperteile beitragen. Demnach würden verschiedene Kanäle der Kommunikation bestehen und es könnte erklärt werden, dass die Botschaft des einen Kanals zuweilen jener des andern widerspricht.
Methode
Die Hirnforscher interessierten sich für den Effekt, den die Durchtrennung der Brücke zwischen linker und rechter Hirnhälfte mit sich bringt. Lange Zeit war es jedoch nicht legitim Operationen am Großhirn durchzuführen, nur um herauszufinden, wie dieses arbeitet. Ab den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts betrachteten dann aber einige Wissenschaftler bei Patienten mit schweren epileptischen Leiden die Durchtrennung des Corpus callosum, der Brücke zwischen den beiden Großhirnhälften, sogar als hilfreich; nämlich i. d. S., dass der Eingriff den Patienten eine annähernd normale Lebensführung versprach. Anscheinend wurde durch diesen Eingriff die Übertragung der Anfälle von einer Hemisphäre des Gehirns auf die andere unterbrochen und dadurch deren Ausbreitung verhindert.
Aufgrund der Anatomie des visuellen Systems des Menschen ist jedes Auge zur Hälfte mit der anderen Hirnhälfte verbunden. Die Schläfenseite des rechten Auges projiziert ein Bild in die linke Hirnhemisphäre und umgekehrt. Bei intakter Brücke zwischen den beiden Hirnhälften ist somit das ganze Gesichtsfeld zugänglich. Erst die Durchtrennung der Brücke bewirkt, dass das rechte Gesichtsfeld nur mit der linken Hirnhälfte und das linke nur mit der rechten registriert wird.
Abb. 2: Visuelles System beim Menschen
Wenn Versuchspersonen mit durchschnittenem Corpus callosum (Split-Brain-Patienten) ihren Blick auf einen zentralen Punkt richten, gelangen nur die Informationen, die auf das rechte Gesichtsfeld projiziert werden zur linken Großhirnhälfte (und umgekehrt). Bei den anderen Versuchspersonen teilt die eine Hemisphäre ihre Informationen der anderen mit, indem sie diese über die Brücke sendet.
Sperry und Mitarbeiter entwickelten auf der Basis dieser klinischen Beobachtung sowie der anatomischen Voraussetzungen der visuellen Wahrnehmung eine spezielle experimentelle Einrichtung, mit der sie demonstrieren konnten, dass mit dem chirurgischen Eingriff nicht nur das Gehirn in zwei Teile aufgespaltet wurde, sondern sich in der Folge auch die psychischen Funktionen aufteilten. Auf einem Bildschirm wurden dem Patienten optische Reize (Gegenstände oder Wörter mit entsprechender Bedeutung) präsentiert und zwar entweder auf seiner rechten oder linken Seite. Bei diesem sog. Split-Brain-Experiment fixiert die Versuchsperson mit ihren Augen die Mitte des Bildschirms (s. Abb. 3). Beim vorliegenden Beispiel wird das Wort »Schlüssel« auf der linken Seite präsentiert und ausschließlich auf der rechten Hirnhälfte registriert. Die Versuchsperson antwortet jedoch mit »Ring«, weil nur dieses Wort im Sprachzentrum der linken Hirnhälfte wahrnehmbar ist. Demgegenüber vermag die rechte Hirnhälfte die linke Hand anzuleiten, sodass der Schlüssel ergriffen werden kann. Probanden mit intakter Großhirnbrücke erkennen unter den gegebenen Voraussetzungen das Wort »Schlüsselring«. Um zu verhindern, dass der Patient seine Augen einfach hin- und herbewegte und so das optische Material dennoch in beide Großhirnhälften aufnehmen konnte, wurden die Reize nur sehr kurze Zeit dargeboten (< 1/10 sec.). Außerdem erhielten die Patienten die Anweisung, sich auf den Mittelpunkt der Präsentation zu konzentrieren. Wenn eine am Versuch beteiligte Person ihren Blick auf diesen zentralen Punkt richtete, erreichten Informationen, die auf das rechte Gesichtsfeld projiziert wurden, tatsächlich nur die linke Hirnhälfte und Informationen, die auf das linke Wahrnehmungsfeld projiziert wurden, effektiv nur die rechte Hirnhälfte.
Wenn auf der linken Seite des Bildschirms beispielsweise das Wort »Schlüssel« und auf der rechten Seite das Wort »Ring« erschien, erreichte »Schlüssel« unter den genannten Bedingungen ausschließlich die rechte Hemisphäre und »Ring« ausschließlich die linke Hemisphäre des Gehirns. Während Versuchspersonen mit intakter Großhirnbrücke mitteilten, sie würden das Wort »Schlüsselring« erkennen, konnten Split-Brain-Patienten nur das auf der rechten Seite präsentierte Wort »Ring« wahrnehmen. Offenbar hatten sie das Wort »Schlüssel« gar nicht bemerkt. Die festgestellte Differenz zwischen gewöhnlichen Versuchspersonen und Split-Brain-Patienten ließ sich darauf zurückführen, dass die Sprachfähigkeit gewöhnlich auf der linken Seite des Gehirns lokalisiert wurde. Wurde der Übergang zwischen den beiden Hälften unterbrochen, wusste offenbar die eine Seite nicht, was in der anderen geschah (Sperry, 1968).
Abb. 3: Versuchsanordnung beim Split-Brain-Experiment
Empirie
Gazzaniga (1988) führte ein Experiment mit einem Film durch, in dem ein Darsteller in ein Feuer geworfen wird. Der Film wurde auf die linke Seite eines »Split-Brain«-Patienten projiziert, sodass die Inhalte nur in die rechte Hemisphäre weiter geleitet wurden. Der nach dem Inhalt des Films befragte Patient war nicht in der Lage, den wahrgenommenen Inhalt wiederzugeben, stattdessen begann er unruhig zu werden und sich unwohl zu fühlen. Mit anderen Worten: Er reagierte ausschließlich emotional. Dieser Befund lässt sich also dahingehend interpretieren, dass der Film zwar die der rechten Gehirnhemisphäre des Patienten entsprechenden emotionalen Reaktionen ausgelöst hat, es aber dem Patienten nicht möglich war, den Film inhaltlich zu erfassen, da der Zugang zur linken Hälfte des Gehirns fehlte.
Auch Davidson führte zusammen mit Mitarbeitern oder Kollegen Untersuchungen zu den Funktionen der beiden Hirnhälften durch. Säuglinge, die bei der Trennung von ihrer Mutter weinten, wurden mit Säuglingen verglichen, bei denen dies nicht der Fall war. Befund der Baseline-Messung vor der Trennung: Nicht weinende Säuglinge wiesen mehr links- und weniger rechtsseitige Aktivierungen auf als weinende Säuglinge (Davidson & Fox, 1989). Das Ergebnis einer drei Jahre später durchgeführten Fragebogen-Untersuchung entsprach diesem Befund. Personen mit einer relativ starken linksseitigen präfrontalen Aktivierung berichteten mehr positive und weniger negative Erlebnisse als Personen mit einer relativ starken rechtsseitigen Aktivierung (Tomarken et al., 1992).
In einer weiteren Untersuchung zeigten Davidson und Mitarbeiter Probanden Filme über Operationen am offenen Herzen, die zuvor dazu aufgefordert worden waren, ihre Gefühle entweder bewusst zu reduzieren oder zu verstärken. Nach der Präsentation des Filmes konfrontierte man die Probanden plötzlich mit einem lauten Geräusch. Dabei wurden die Aktivitäten des Stirnhirns mit Elektroden gemessen. Probanden, deren linke Hirnhälfte besonders aktiv war, ließen sich kaum aus der Ruhe bringen, während Probanden, deren Stirnhirn vor allem auf der rechten Seite aktiv war, ihre Erregung nicht stoppen (u. a. Flattern der Lider, Weinen) konnten. Die Probanden der zweiten Gruppe ließen sich noch mehrere Sekunden nach dem Film aus der Ruhe bringen (u. a. heftiges Flattern der Lider). Es war ihnen offenbar nicht gelungen, ihre Erregung zu kontrollieren. Davidson geht davon aus, dass die Kontrolle der Emotionen eine Angelegenheit von einigen wenigen Augenblicken ist. Demnach sollte es möglich sein, negative Emotionen sofort (innerhalb von Zehntelsekunden) oder jedenfalls nach sehr kurzer Zeit (einigen Sekunden) als unangemessen zu erkennen. Andernfalls entwickeln diese Emotionen eine Eigendynamik, sodass eine spätere Beruhigung und Kontrolle ungleich schwerer fällt (Davidson et al., 1990).
Die meisten Befunde der ersten empirischen Untersuchungen sprachen zwar für eine Lokalisierung der Emotionen auf der rechten Hemisphäre. Weiterhin Unklarheit bestand aber über die in der rechten Hemisphäre des Gehirns lokalisierten psychischen Funktionen. Es wurden v. a. negative Emotionen festgestellt; über positive Emotionen bestand weiterhin Unklarheit. Nach diesen ersten experimentellen Untersuchungen wusste man noch nichts Näheres über die emotionalen Reaktionen, die gegebenenfalls mit der rechten Hemisphäre in Verbindung standen.
Nach den ersten wenig ergiebigen empirischen Untersuchungen wurden negative und positive Emotionen einer EEG-Analyse unterzogen und registriert, in welchen Hemisphären sich Aktivitätserhöhungen ergaben. Hierbei zeigte sich, dass beispielsweise Ekelepisoden in der rechten und Freudeepisoden in der linken Hälfte lokalisiert waren. Erwartungsgemäß führten negative Affekte zu Vermeidungsverhalten, während positive Affekte Annäherung ermöglichten. Zugleich konnte die erste einfache Hypothese falsifiziert werden (vgl. Davidson, 1993).
Im Weiteren wurde vorgeschlagen, die linke Hemisphäre mit sog. prosozialen Emotionen und die rechte Hemisphäre mit so genannten egoistischen Emotionen zu verbinden (Buck, 1999). Davidson (1993) konnte diesen allgemein formulierten Zusammenhang teilweise belegen, indem er dreijährige Kinder nach ihrem Verhalten in eine gehemmte oder eine nicht-gehemmte Gruppe unterteilte und sie beim Spielen plötzlich mit einem Roboter und später mit einer fremden Person konfrontierte. Wichtigstes Ergebnis der Untersuchung: Die Kinder der gehemmten Gruppe wiesen eine schwächere linkshemisphärische EEG-Aktivität auf als die Kinder der nicht-gehemmten Gruppe. Im Weiteren zeigte sich zumindest bei gesunden Personen, dass im Unterschied zur Übernahme der Perspektive einer anderen Person die Einnahme der Selbstperspektive bestimmte Regionen der rechten Hemisphäre des Gehirns aktivierte (Vogeley et al., 2003).
Wissenschaftliche Nachwirkungen
Seit Bard (1928) stellte man sich immer wieder die Frage nach den neurobiologischen Voraussetzungen hinsichtlich einzelner Emotionen. Die Forscher wollten sich nicht mehr mit einer groben »Hirngeographie« i. S. einer Unterteilung nach rechts und links und hinten und vorne zufriedengeben, sondern versuchten mehr über das eigentliche neurologische Substrat psychischer Funktionen zu erfahren. Hierbei leistete Papez Pionierarbeit.
Papez (1937) entwickelte eine Theorie, mit der erstmals versucht wurde, das Entstehen von Emotionen neurofunktional zu erklären. In psychologischer Hinsicht unterschied er v. a. zwischen einem Gedankenstrom und einem Gefühlsstrom. Er stellte sich die Frage, in welchem Verhältnis Gedanken- und Gefühlsstrom stehen und welche Rolle dabei das limbische System spielt, zu dem Bereiche wie der Gyrus cinguli, die Amygdala und der Hippocampus gehören. Während Papez den Gefühlsstrom als Weiterleitung sensorischer Informationen zum Hypothalamus betrachtete, meinte er den Gedankenstrom im sensorischen Kortex zu erkennen. Bei dem von ihm erkannten Kreis handelt es sich um eine Neuronenkette vom Hippocampus über den Gyrus cinguli zurück zum Hippocampus (zum Aufbau des Gehirns s. Abb. 4). Mit der Schließung des Kreises ergeben sich Änderungen im AN. In der sog. Papez-Schleife werden Bedeutungen und Gedächtnisinhalte mit Emotionen angereichert, wodurch der Ausdruck der Gefühle erfolgt. Insbesondere wenn im Gyrus cinguli Signale aus dem sensorischen Kortex und dem Hypothalamus integriert werden, kommt es zum emotionalisierten Erleben. Obwohl nur ein kleiner Teil der Fasern aus dem Hippocampus zu diesem zurückkehrt, ist die Schleife bündig. Der Neuronenkreis dient der Aufrechterhaltung von rezenten Gedächtnisinhalten, wodurch das Primär- in das Sekundär-, respektive Tertiärgedächtnis befördert wird. Ausfälle einzelner Glieder des Papez-Kreises bewirken eine anterograde Amnesie, bei der bei intaktem Langzeitgedächtnis die Merkfähigkeit neuer Bewusstseinsinhalte gestört ist. Ein Patient, der an epileptischen Anfällen litt und dem beidseitig große Teile der Temporallappen entfernt worden waren, worunter sich auch der Hippocampus befand, konnte sich zwar noch recht gut an Dinge erinnern, die sich vor der Operation ereignet hatten, war aber nicht mehr dazu in der Lage sich an irgendetwas zu erinnern, das nach der Operation stattfand (Kolb & Wishaw, 1996). Der Hippocampus scheint bei der Speicherung von Gedächtnisinhalten und der oft mehrjährigen Gedächtniskonsolidierung unverzichtbar zu sein. Es handelt sich um eine Hirnregion, die bei der funktional verstandenen kategorialen und hierarchischen Organisation maßgebend ist (vgl. u. a. Lina, Osana & Tsien, 2006). Die von Papez angenommenen Verbindungen bewährten sich zwar bei diversen anatomischen Untersuchungen, jedoch kommt ihnen heute in psychologischer Hinsicht nicht mehr der gleiche Stellenwert zu, den ihnen der Autor ursprünglich gab (vgl. u. a. LeDoux, 1996).
Heute geht man davon aus, dass jede Aktivierung eines Schaltkreises eine Stärkung der beteiligten Verbindungen erlaubt und dementsprechend in der Zukunft eine leichtere Aktivierung, während eine seltene oder fehlende Nutzung die künftige Zugänglichkeit erschwert oder unmöglich macht (»Use it, or lose it«-Prinzip). Nach dem Prinzip »Cells that fire together, wire together« (der sog. Hebb’schen Regel) wird durch die gleichzeitige Aktivität von miteinander verbundenen Neuronen deren Verbindung gestärkt (Hebb, 1949). So zeigte sich bei Londoner Taxifahrern, dass sich im Laufe ihrer Berufstätigkeit Teile des Hippocampus im Vergleich zur übrigen Bevölkerung vergrößerten (Maguire et al., 2000). Aus einer weiteren Untersuchung ging hervor, dass sich Musiker und Nicht-Musiker im Volumen der grauen Substanz des Gehirns in auditorischer, visuell-räumlicher sowie motorischer Hinsicht voneinander unterscheiden (Gaser & Schlaug, 2003). Aufgrund von Erfahrung kann sich das Gehirn in strukturaler sowie funktionaler Hinsicht verändern, was auch als Neuroplastizität bezeichnet wird (vgl. u. a. Pascal-Leone et al., 2005). Diese Veränderungen ergeben sich durch Beschäftigungen oder auch durch Gedanken, was bedeutet, dass sich das Gehirn durch seine eigene Tätigkeit verändern kann (Doidge, 2007).
Im Kontext der Humanistischen Psychologie und der Positiven Psychologie wird sich die Frage stellen, ob es auch so etwas wie eine Plastizität des affektiven Stils gibt. Hierbei wird insbesondere zwischen Erfahrungen positiver und negativer Emotionen unterschieden werden. Führt ein »Teufelskreis« negativer Emotionen gleichermaßen ins Unglück und in die Depression wie ein »Engelskreis« positiver Emotionen ins Glück und ins Wohlbefinden? Dauern negative Emotionen wie beispielsweise Schmerzreize längere Zeit an, produziert der Körper vermutlich vermehrt einen Nervenwachstumsfaktor (Eiweißstoff), der das Rückenmark sensibilisiert und dadurch verändert. Sonst lahmliegende Synapsen werden aktiviert, durch aussprießende Nervenfasern kommen neue Verbindungen zustande und plötzlich gelangen Reize ins Gehirn, die vorher unterdrückt wurden (Zens & Jurna, 2001). Durch die permanenten Impulse verändert sich das Nervengeflecht; das heißt, eine Art Schmerzgedächtnis entsteht. Hingegen verändern positive Emotionen wie Zärtlichkeit oder Dankbarkeit nicht nur die psychische Befindlichkeit i. S. von Wohlbefinden, sondern auch die Physiologie des Organismus, indem beispielsweise einfach und schnell Herzkohärenz erreicht wird (McCraty & Atkinson, 1995). Zudem kann man annehmen, dass entsprechende Plastizitätsprozesse sich nicht unbedingt ausschließen, sich kompetitiv auswirken und zu positiven Ergebnissen führen (vgl. Diener, F. Sandvik & Pavol, 1991).
Die meisten Forscher und Forscherinnen gehen inzwischen davon aus, dass sich beide Hirnhälften mit Emotionen beschäftigen und nicht – wie ursprünglich angenommen – nur die von der linken beherrschte rechte Hälfte. Hierbei wird aber folgende Differenzierung vorgenommen: Bei angenehmen Gefühlen sei mehr die linke Hälfte und bei unangenehmen Gefühlen mehr die rechte Hälfte aktiv. Als Beleg hierfür werden Personen mit schweren Depressionen angeführt, die ihren düsteren Vorstellungen keine Erinnerungen an positive Lebensereignisse entgegensetzen. Bildgebende Verfahren mit der Technik der Computertomographie weisen darauf hin, dass die Regionen im Bereich des linken frontalen Kortex zu den Hirnregionen gehören, die bei einer Depression unteraktiviert sind, wodurch die Kontrolle negativer Emotionen herabgesetzt wird und die Zielstrebigkeit nachlässt (vgl. u. a. Schachter, 2001).
Bei negativen sowie bei positiven Emotionen sind viele Regionen im Gehirn gleichzeitig beteiligt. Es gibt im Kopf weder ein »Lustzentrum« noch ein »Schmerzzentrum«. Allerdings kann das limbische System (s. u.) als »Gefühlszentrum« bezeichnet werden, in dem die Bewertung erfolgt, ob eine Empfindung behaglich oder unbehaglich, positiv oder negativ ist. Es gibt aber viele weitere Stellen im Gehirn, die an der Entstehung der Gefühle beteiligt sind. Bereits das Rückenmark »entscheidet«, ob ein Reiz von der Peripherie überhaupt ins Zentrum weitergeleitet wird oder nicht. Demnach kann man zwar keine Zentren für positive und negative Emotionen im Gehirn annehmen, wohl aber entsprechende Muster.
Allerdings zeigen die Aufnahmen von glücklichen und unglücklichen Menschen nicht einfach gegensätzliche Muster. Es ist nicht so, dass Hirnareale, die in angenehmen Situationen aufleuchten, in unangenehmen verschwinden und umgekehrt. Angenehme und unangenehme Gefühle scheinen ihre eigenen Hirnschaltungen zu haben. Diese arbeiten zwar oft miteinander; sie können aber auch nebeneinander und gegeneinander arbeiten. Positive und negative Gefühle scheinen im Kortex von unterschiedlichen Systemen erzeugt zu werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die beiden Systeme unabhängig voneinander sind; sie scheinen vielmehr so miteinander verbunden zu sein, dass ein gutes Gefühl ein schlechtes auszulöschen vermag und umgekehrt. Hier gilt es jedoch anzumerken, dass bisher noch zu wenig erforscht wurde, auf welche Weise das linke Stirnhirn negativen Emotionen entgegenwirkt und positiven Gefühlen Vorschub zu leisten vermag. Man kann aber annehmen, dass das Stirnhirn so eingerichtet ist, dass es negative Emotionen kontrolliert. Vermutlich geben die mandelförmigen Zentren der Amygdala, die gewöhnlich Wut, Ekel oder Angst auslösen, hemmende Impulse ab. Dieser Vorgang wäre dann eine Art Rückmeldung, dass der »Warnruf« des betreffenden negativen Gefühls inzwischen im Stirnhirn angekommen ist und nun nicht mehr benötigt wird. Es stellt sich die Frage, ob dieser natürliche »Aus-Schalter« negativer Emotionen bewusstseinsfähig ist und auch in der alltäglichen oder therapeutischen Praxis verwendet werden könnte.
Praktische Auswirkungen
Nach den ersten Forschungsergebnissen wurden die beiden Hirnhälften noch übergeneralisierend nach Funktionen und Inhalten unterschieden (Links: Sprache, Vernunft, Steuerung, Analyse bzw. Lesen und Schreiben, Logik, Mathematik. Rechts: Gestik, Parallel-Verarbeitung, Tiefenwahrnehmung und Mustererkenntnis bzw. Rhythmik, Kreativität, Synthese). Die meisten Psychologen hielten jedoch schon bald diese Spezialisierung oder ähnliche Ausgestaltungen der beiden Großhirnhälften für übertrieben und vertraten eher die Meinung, dass diverse Aufgaben von beiden Hirnhälften übernommen werden könnten (s. o.).