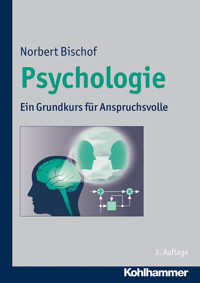
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
This textbook has been received enthusiastically. "Bischof introduces to the primary questions, theories and insights of the field. Not restricting himself to presenting the generally acknowledged facts in form of a textbook, he critically challenges current knowledge. He scrutinizes the state of knowledge and explains why certain ideas have prevailed. Additionally he show links and connections and draws the attention to elements that still need clarification. For students of psychology an essential read in addition to the usual standart litrerature." (EKZ)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1175
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus Zuschriften von Studierenden
'...gerne nutze ich die Gelegenheit, mich für Ihre Vorlesung zu bedanken. Je mehr Arbeiten ich im Laufe meines Studiums schreibe, desto hilfreicher sind die Ideen, die ich aus dieser Vorlesung mitgenommen habe.' (Dominik L.)
'Ihre Vorlesung hat mich und zahlreiche Kommilitonen sehr fasziniert. Wir haben jede Woche leidenschaftlich über die von Ihnen aufgeworfenen Fragen diskutiert.' (Henning B.)
'...mir ist es ein großes Bedürfnis, mich bei Ihnen für diese wertvolle Vorlesung zu bedanken. Sie hat mich nicht nur außerordentlich motiviert, sondern auch mein Bewusstsein (was das Fach Psychologie anbelangt, aber auch darüber hinaus) geschärft und erweitert.' (Julia Q.)
'Ihre Vorlesung hat mich inspiriert. Ich möchte sie als wegweisend für meine Sicht der Psychologie bezeichnen. Sie haben mehrmals Bedenken geäußert, dass die Inhalte für Erstsemester zu schwer zu verstehen sind. Zu schwer fand ich sie nicht - aber im Positiven sehr anspruchsvoll.' (Sebastian S.)
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Norbert Bischof lehrte Allgemeine Psychologie am CalTech, Pasadena und den Universitäten Zürich und München. Er ist Mitglied der Leopoldina und Träger des Deutschen Psychologiepreises.
Norbert Bischof
Psychologie
Ein Grundkurs für Anspruchsvolle
3. Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
3. Auflage 2014 Alle Rechte vorbehalten © 2008/2009/2014 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: ISBN 978-3-17-023997-5
E-Book-Formate
pdf:
ISBN 978-3-17-023998-2
epub:
ISBN 978-3-17-023999-9
mobi:
ISBN 978-3-17-024000-1
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einstimmung
1 Wissenschaft und Kennerschaft
1.1 Das öffentliche Geheimnis
1.1.1 Warten auf den Knoten
1.1.2 Denn was innen, das ist außen
1.1.3 Was kann man »einfach sehen«?
1.2 Drei fragwürdige Voraussetzungen
1.2.1 Die kontraintuitive Voreinstellung
1.2.2 Die experimentelle Voreinstellung
1.2.3 Die konstruktivistische Voreinstellung
1.3 Das anthropozentrische Handicap
1.3.1 Existentielle Betroffenheit
1.3.2 Die Suche nach dem archimedischen Punkt
1.3.3 Am Ende des Rundgangs
Erster Themenkreis: Leib und Seele
2 Vom Dualismus zur Identität
2.1 Philosophiegeschichtliche Hintergründe
2.1.1 Was bedeutet »Seele«?
2.1.2 Dualismus und Wechselwirkungslehre
2.1.3 Psychophysischer Parallelismus und Identitätslehre
2.2 Terminologische Präzisierungen
2.2.1 Phänomenale und funktionale Erkenntnishaltung
2.2.2 Psychisch und physisch, seelisch und leiblich
2.2.3 Der »psychische Apparat« und das Unbewusste
2.2.4 Inkommensurable Räume
2.3 Drei Rahmensätze zum psychophysischen Verhältnis
2.3.1 Das phänomenologische Postulat
2.3.2 Das neuronale Postulat
2.3.3 Das Isomorphiepostulat
2.4 Die scheinbare Unvereinbarkeit der Rahmensätze
2.4.1 Der elementenpsychologische Ausweg
2.4.2 Der ganzheitspsychologische Ausweg
2.4.3 Der gestalttheoretische Ausweg
3 Psychologie und Hirnforschung
3.1 Auf dem Weg zu einer Theorie des Gehirns
3.1.1 Ein viel beachtetes Manifest
3.1.2 Transport und Verarbeitung
3.1.3 What the frog's eye tells the frog's brain
3.1.4 Abbildung von Raum auf Raum
3.2 Das Problem der Elementarphänomene
3.2.1 Unzerlegbarkeit und Unausgedehntheit
3.2.2 Subspezifische Phänomene
3.2.3 Symbolismus und Konnektionismus
3.2.4 »Frequency freaks« und »Feature creatures«
3.3 Offene Fragen
3.3.1 Das Bindungsproblem
3.3.2 Die Debatte um die Willensfreiheit
3.3.3 Das Paradox des »Jetzt«
3.3.4 Wieso Bewusstsein?
Zweiter Themenkreis: Wirklichkeit und Wahrheit
4 Erkenntnistheoretische Fragen
4.1 Wirklichkeit
4.1.1 Erster Sinn von »Wirklichkeit«: Das Objektive
4.1.2 Zweiter Sinn von »Wirklichkeit«: Das Unvermittelte
4.1.3 Dritter Sinn von »Wirklichkeit«: Das Angetroffene
4.1.4 Vierter Sinn von »Wirklichkeit«: Das Ernstzunehmende
4.2 Wahrheit
4.2.1 Evidenz und Veridikalität
4.2.2 Kant und der Konstruktivismus
4.2.3 Hegel und der metaphysische Idealismus
4.2.4 Heidegger und der naive Realismus
4.2.5 Lorenz und die evolutionäre Erkenntnistheorie
4.3 Kategorien
4.3.1 Module der Reizverarbeitung
4.3.2 Gestaltgesetze
4.3.3 Anschauliche Kausalität
4.3.4 Diachrone Identität
4.3.5 Die Rebellion des Dinges an sich
5 Semantik und Information
5.1 Finale Systeme
5.1.1 Was ist ein Signal?
5.1.2 Bedeutung und Finalität
5.1.3 Die Fehlbarkeit finaler Systeme
5.1.4 Information
5.2 Kognition und Intention
5.2.1 Nachrichten und Befehle
5.2.2 Die semantische Komplementarität
5.2.3 Das sogenannte Interaktionsparadox
5.2.4 Die Semantik der Emotionen
5.2.5 Die kartesische Kontamination
5.3 Die Evolution der Veridikalität
5.3.1 Die Motorik als Engpass
5.3.2 Die Sensorik als Engpass
5.3.3 Die Bedingung der multipolaren Valenz
5.4 Die Grenzen der Veridikalität
5.4.1 Sozialer »Werkzeuggebrauch«
5.4.2 Nützliche Fiktionen
5.4.3 Ortho-, Para- und Metakosmos
Dritter Themenkreis: Anlage und Umwelt
6 Nature – Nurture
6.1 Die dualistische Erblast
6.1.1 Die »universelle Verhaltensgleichung«
6.1.2 »Biologisch« und »sozial«
6.1.3 »Drive« und »Habit«
6.1.4 »Triebe« und »Motive«
6.1.5 Die Entsorgung eines »Scheinproblems«
6.2 Die drei Segmente der Umwelt
6.2.1 Präformismus
6.2.2 Alimentation, Stimulation und Selektion
6.2.3 Die Semantik der Stimulation
6.3 Die Rolle der Selektion
6.3.1 Darwin, Lamarck und Driesch
6.3.2 Zwei Typen von Selektion
6.3.3 Die angeborene Umwelt
6.4 Interaktionen
6.4.1 Die Auflösung der Lorenz-Lehrman-Kontroverse
6.4.2 Alimentative Stimulation
6.4.3 Die Trennbarkeit von Alimentation und Selektion
7 Entwicklung
7.1 Terminologische Vorklärungen
7.1.1 Drei Formen von »Genese«
7.1.2 Der Bedeutungshof des Entwicklungsbegriffs
7.1.3 Entwicklung als Reifung
7.1.4 Konvergente und divergente Verläufe
7.1.5 Entwicklung als Historie
7.2 Stilwandel der Entwicklungspsychologie
7.2.1 »Endogenistische« und »exogenistische« Theorien
7.2.2 Die Wende zur Dialektik
7.2.3 Die »interaktionistische« Synthese
7.2.4 Die Auflösung in die »Lebensspanne«
7.3 Das Konzept des Adaptationsdrucks
7.3.1 Der Alimentationsdruck
7.3.2 Selbsterhaltung und Fortpflanzungserfolg
7.3.3 Der Stimulationsdruck
7.3.4 Entwicklung und Adaptation
7.3.5 Lernen, Reifung und Prägung
7.4 Ideologische Streitpunkte
7.4.1 Die varianzanalytische Fassung des Anlage-Umwelt-Problems
7.4.2 Kovarianz und Interaktion
7.4.3 Plastizität als Nullhypothese
7.4.4 Das Theorem der obligatorischen Genokopie
Vierter Themenkreis: Aristoteles und Galilei
8 Naturphilosophische Leitbilder
8.1 Kurt Lewins Kritik
8.1.1 Die Warnung vor Aristoteles
8.1.2 Abstraktive Klassifikation
8.1.3 Abgestufte Gesetzlichkeit
8.1.4 Historisch-geographische Betrachtungsweise
8.1.5 Wertbegriffe
8.2 Der Paradigmenwechsel der Renaissance
8.2.1 Primäre und sekundäre Sinnesqualitäten
8.2.2 Prägnanz
8.2.3 Entelechie
8.2.4 Stoff und Form
8.2.5 Gestalt und Struktur
8.3 Homogenisierende Reduktion
8.3.1 Reduktion und Reduktionismus
8.3.2 Abbau von Struktur
8.3.3 Nomologische und qualitative Reduktion
8.3.4 Exemplarische Forschung
8.4 Idee und Erfahrung
8.4.1 Heuristische Prinzipien
8.4.2 Der Bruch der entelechialen Klammer
8.4.3 Sphärenklänge
8.4.4 Harmonieerwartungen in der Physik
9 Galileische Psychologie
9.1 Physikalistische Ansätze in der Psychologie
9.1.1 Nomologische Reduktion
9.1.2 Qualitative Reduktion
9.1.3 Die Ratte am Scheideweg
9.1.4 Ästhetische Heuristik
9.1.5 Der Sonderfall der Gestalttheorie
9.2 Schwächen der Galileischen Psychologie
9.2.1 Was den Menschen zum Menschen macht
9.2.2 Das Fehlverhalten der Organismen
9.2.3 Klassisches Vermeidungslernen
9.2.4 Conditioned taste avoidance
9.3 Akademische Reaktionen
9.3.1 Seligmans Rettungsversuch
9.3.2 Einengung der Empirie
9.3.3 Distanzierung von der Empirie
9.3.4 Cargo Cult Science
Fünfter Themenkreis: Ordnung und Organisation
10 Der strukturwissenschaftliche Ansatz
10.1 Zwei prototypische Naturwissenschaften
10.1.1 Systematik der Wissenschaften
10.1.2 Physik und Technik
10.1.3 Innerer und äußerer Sinn
10.1.4 Physik und Biologie
10.2 Die Rehabilitierung der Finalität
10.2.1 Teleologie und Teleonomie
10.2.2 Kurt Lewin und Egon Brunswik
10.2.3 Probabilistischer Funktionalismus
10.3 Repräsentative Versuchsplanung
10.3.1 Rückkehr zur historisch-geographischen Betrachtung
10.3.2 Ein Experiment mit nicht-repräsentativen Stimuli
10.3.3 Sinn und Unsinn der »distalen Fokussierung«
11 Systemische Reduktion
11.1 Das demiurgische Prinzip
11.1.1 Die Wende zum äußeren Sinn
11.1.2 Das Black-Box-Problem
11.1.3 Ultimate und proximate Analyse
11.1.4 Formalismus und Funktionalismus
11.2 Konstanzleistungen
11.2.1 Größenkonstanz
11.2.2 Nystagmus und Bewegungskonstanz
11.2.3 Das Rätsel des Farbkreises
11.3 Kompensation, Rekonstruktion und Korrektur
11.3.1 Das Kompensationsprinzip
11.3.2 Das Rekonstruktionsprinzip
11.3.3 Das Korrekturprinzip
11.4 Homogenität und System
11.4.1 »Starke« und »schwache« Kausalität
11.4.2 Die Suggestivität des Auffälligen
11.4.3 Ganzheit
11.5 Funktionelle und genetische Reduktion
11.5.1 Funktionelle Reduktion
11.5.2 Genetische Reduktion
11.5.3 Ökologische Randbedingungen
11.5.4 Homologie und Analogie
11.5.5 Der »Schluss vom Tier auf den Menschen«
Sechster Themenkreis: Mensch und Tier
12 Instinkt
12.1 Prärationale Verhaltensorganisation
12.1.1 Evolutionäre Anthropologie
12.1.2 Der Instinktbegriff
12.1.3 Appetenzen
12.1.4 Aversionen und Ruhezustände
12.2 Die basalen Mechanismen
12.2.1 Motivation als Regelkreis
12.2.2 Schemata und Radikale
12.2.3 Kumulation und Katharsis
12.3 Der Coping-Apparat
12.3.1 Anreiz und Akzess
12.3.2 Barrieren und Konditionierung
12.3.3 Allo- und Autoplastische Coping-Strategien
12.3.4 Frustrationstheorien
12.4 Die Funktion der Emotionen
12.4.1 Definitionsprobleme
12.4.2 Signale an den Coping-Apparat
12.4.3 Der Zeigarnik-Effekt
12.4.4 »Positive« und »negative« Emotionen
12.5 Vormenschliche Kommunikation
12.5.1 Kommunikation und Veridikalität
12.5.2 Mitteilung von Sachverhalten
12.5.3 Ausdruck von Bereitschaften
12.5.4 Ritualisation
12.5.5 Die Orientierung der Ausdrucksmotorik
13 Phantasie
13.1 Die Simulation der Wirklichkeit
13.1.1 Die Differenzierung der Invention
13.1.2 Mentales Probehandeln
13.1.3 Synchrone Identität
13.1.4 Das »I« und das »Me«
13.2 Ausweitung der sozialen Kognition
13.2.1 Die Reflexion im Spiegel
13.2.2 Imitation
13.2.3 Empathie
13.3 Anthropoide Intelligenz
13.3.1 Die Sprache der Schimpansen
13.3.2 Verdinglichung und Abstraktion
13.3.3 Anfänge des produktiven Denkens
13.3.4 Abbildende Gestaltung
13.3.5 Die Rolle der Syntax
14 Reflexion
14.1 Das Problem des Antriebsmanagements
14.1.1 Die Verlagerung zur Endsituation
14.1.2 Prioritätenregelung
14.1.3 Wert und Erwartung
14.2 Die Evolution des Zeiterlebens
14.2.1 Die Primärzeit
14.2.2 Die Sekundärzeit
14.2.3 Das Weltgerüst
14.2.4 Permanente Identität
14.2.5 Exekutive Kontrolle
14.3 Bezugssysteme
14.3.1 Die »unscheinbare« Relativität
14.3.2 Hintergrundeffekte
14.3.3 »Projektive« Prozesse
14.4 Theory of Mind
14.4.1 Die Reflexion auf Bezugssysteme
14.4.2 Perspektivenübernahme
14.4.3 Das Maxi-Paradigma
14.4.4 Phylogenese und Ontogenese
Siebter Themenkreis: Triebe und Motive
15 Soziale Motivation
15.1 Bindung
15.1.1 Distanzregulation
15.1.2 Anonyme Geselligkeit
15.1.3 Gruppen- und Sippenselektion
15.1.4 Vertrautheit und Fremdheit
15.1.5 Die Bindungstheorie
15.2 Sexualität
15.2.1 Vermehrung und Paarung
15.2.2 Distanzierende Inzestbarrieren
15.2.3 Repressive Inzestbarrieren
15.3 Sicherheit, Erregung und Autonomie
15.3.1 Bindung und Ablösung
15.3.2 Die Regulation der Sicherheit
15.3.3 Die Regulation der Erregung
15.3.4 Synchronisation und Dominanz
15.3.5 Die Regulation der Autonomie
15.4 Die Vernetzung der sozialen Motive
15.4.1 Kovariante Motive
15.4.2 Der Einsatz von Coping-Strategien
15.4.3 Alpha- und Omega-Hierarchie
15.4.4 Soziodynamische Probleme der Adoleszenz
15.4.5 Bindung, Intimität, Affiliation
16 Das Wirkungsgefüge der Antriebe
16.1 Das Problem der Trieblisten
16.1.1 Unsystematische Aufzählung
16.1.2 Die fraktale Struktur der Antriebsziele
16.1.3 Funktionale Autonomie
16.2 Bewahrung und Erweiterung
16.2.1 Homöostase und »Mangelmotivation«
16.2.2 Hierarchische Gliederung
16.2.3 Schichttheoretische Gliederung
16.3 Taxonomie der Motive
16.3.1 Funktionen und Ziele
16.3.2 Die vormenschlichen Motive
16.4 Funktionelle Koppelungen
16.4.1 Vegetative Begleitprozesse
16.4.2 Hormone und Motive
16.4.3 Die Akklimatisation des Autonomieanspruchs
16.4.4 Dysfunktionale Stressantworten
17 Das spezifisch Menschliche
17.1 Neue Ziele
17.1.1 »Primäre« und »sekundäre« Antriebe
17.1.2 Die Frage der Dysfunktionalität
17.1.3 Die Evolution spezifisch menschlicher Motive
17.2 Die Differenzierung des Autonomieanspruchs
17.2.1 Macht- und Geltungshierarchie
17.2.2 Zur Phylogenese des Geltungsmotivs
17.2.3 Selbstwertgefühl und permanente Identität
17.3 Die metaphysische Sinnfrage
17.3.1 Ablösung und Rückbindung
17.3.2 Der Einbruch der Existenzangst
17.3.3 Ansammlung von Besitz
17.3.4 Aufhellung der Zeitperspektive
17.4 Zur Phylogenese der Moral
17.4.1 Soziale Kontrolle
17.4.2 Schuldgefühl
17.4.3 Schamgefühl
17.4.4 Die moralische Klemme
Achter Themenkreis: Denken und Fühlen
18 Die kognitive Wende
18.1 Das »Informationsparadigma«
18.1.1 Was heißt eigentlich Kognition?
18.1.2 Die empiristische Ausgangslage
18.1.3 Die rationalistische Wende
18.1.4 Informationsverarbeitung
18.2 Die kartesische Erblast
18.2.1 Interaktionistischer Dualismus
18.2.2 Verhalten und Handlung
18.2.3 Ursachen und Gründe
18.3 Die Rationalisierung der Emotion
18.3.1 Die Trennung von »Kognition« und »Emotion«
18.3.2 William James
18.3.3 Stanley Schachter
18.3.4 Bernard Weiner
18.3.5 Die Zajonc-Lazarus-Kontroverse
18.4 Die reduktive Bilanz
18.4.1 Semantik und »Propositionalität«
18.4.2 Synthetisches gegenüber analytischem Denken
18.4.3 Das genetische Skotom
18.4.4 Ein dritter Weg?
19 Die biologische Herausforderung
19.1 Biophile Ansätze
19.1.1 Historischer Überblick
19.1.2 William McDougall
19.1.3 Robert Plutchik
19.1.4 Silvan Tomkins
19.1.5 Paul Ekman
19.2 Evolutionäre Psychologie
19.2.1 Gerätetechnische Restriktionen
19.2.2 Tit for tat
19.2.3 Das proximate Defizit
19.3 Verhaltensphysiologie
19.3.1 Erich von Holst
19.3.2 Konrad Lorenz
19.3.3 Zur psychologischen Rezeption
19.4 Die Rede von der kulturellen Evolution
19.4.1 Das sozialwissenschaftliche Standardmodell
19.4.2 Die Stadt auf dem Hügel
19.4.3 »Bio-kultureller Ko-Konstruktivismus«
19.4.4 Kultur und Zivilisation
Ausblick
20 Psychologie heute
20.1 Der Preis des Fortschritts
20.1.1 Eine gut gemeinte Fiktion
20.1.2 Publish or perish
20.1.3 Zwei dysfunktionale Extremvarianten
20.2 Der ganz normale Wissenschaftsbetrieb
20.2.1 Peer review
20.2.2 Impact
20.2.3 Im Brennpunkt der Aufmerksamkeit
20.2.4 Das Schweigen des Objekts
20.3 Der Mann kann gut Englisch
20.3.1 Lingua franca
20.3.2 Der sogenannte Sprachenstreit
20.3.3 Was bleibt uns übrig?
20.3.4 Ein unverdrossen optimistischer Schluss
Literatur
Bildnachweise
Namenregister
Sachregister
Vorwort
Warum schon wieder ein »Grundkurs«? Gibt es nicht längst genügend Einführungsliteratur in das Psychologiestudium? Stromlinienförmig aufbereitete, heiter illustrierte, die modernen Möglichkeiten des E-Learnings klug einbindende, Anfänger um keinen Preis überfordernde Lehrtexte, aus denen man sich trefflich auf die Multiple-Choice-Prüftechnik des Bologna-Zeitalters vorbereiten kann? Die Frage ist berechtigt.
Es ist üblich geworden, psychologische Lehrbücher nach den Kriterien »theoriezentriert« und »phänomenorientiert« einzuteilen. Der Trend geht eindeutig in die erstgenannte Richtung. Das hängt mit der zunehmenden Verschulung des akademischen Betriebes zusammen, angesichts derer wir uns gern einreden würden, es handle sich auch bei unserem Fach um einen Kanon abfragbarer Tatsachen und exakt formulierbarer Gesetze. Weil das aber einfach nicht stimmt, zieht man sich gern auf das Einzige zurück, wozu sich eindeutig richtige oder falsche Aussagen formulieren lassen – nämlich, welcher Autor was behauptet hat. Daher die Beliebtheit »theoriezentrierter« Darstellungen. Aber das kann nicht genügen. Wir kommen nicht umhin, »phänomenorientiert« vorzugehen, und das heißt, uns auf die Sache selbst einzulassen. Theorien sind – mehr oder minder nützliche – Wegweiser zu diesem Ziel, sie sollen uns Sackgassen und Umwege vermeiden helfen; aber für sich genommen stellen sie keinen Erkenntniswert dar.
Was heißt also »Grundkurs«? Falsch wäre sicher, sich darunter eine Art Psychology for dummies vorzustellen; sie würde ihrem Namen wörtlicher gerecht, als es dem Autor lieb sein könnte. Ein »Grundkurs« kann aber auch das sein, was der Name eigentlich besagt: der Versuch, ein Fundament zu legen. Ein Fundament muss auf Trägern ruhen, die tief in die Materie hineingetrieben sind, damit es sich als stabil genug erweist, um darauf später das anwachsende Fachwissen aufbauen zu können. Ein solcher Grundkurs ist kein Repetitorium; er soll Kompetenz vermitteln, selbst mit den Problemen des Gegenstandsfeldes fertig zu werden. Und an diesen herrscht bei uns kein Mangel.
Wer sich auf Psychologie einlässt, sollte wissen, dass ihm ein anderes Abenteuer bevorsteht als bei einem Studium der Botanik oder der Festkörperphysik. Unser Fach ist keineswegs aus einem Guss. Forschungsinteressen und Praxisanforderungen driften immer weiter auseinander; und die Grundlagenfächer selbst unterscheiden sich in ihren Denkansätzen erheblich und haben ihre je eigene Begriffswelt entwickelt, die oft nicht mehr erkennen lässt, wenn im nächsten Hörsaal in anderer Sprache von derselben Sache die Rede ist. Den Studierenden bleibt selbst überlassen, das alles zu einem zusammenhängenden Ganzen zu integrieren, womit aber nicht nur Anfangssemester überfordert sind.
Der hier vorgelegte Grundkurs versucht, in dieser Situation Hilfestellung zu leisten. Er beleuchtet die Entstehungsgeschichte der repräsentativen Problemstränge, macht die im Zuge der Spezialisierung längst unkenntlich gewordenen Querverbindungen wieder transparent und reflektiert Leitideen, die verstehen lassen, warum gewisse Fragen überhaupt aufgeworfen, andere aber ausgeblendet werden und warum dem je herrschenden Zeitgeist manche Theorien und Methoden so viel akzeptabler erscheinen als andere. Bei all dem verliert er nie das eigentliche Anliegen der Psychologie aus dem Auge – zu verstehen, wie menschliches Erleben und Verhalten als Ganzes funktioniert.
Das Buch verlangt keine fachspezifische Vorbildung, aber es stellt Anforderungen an Interesse und Engagement. Es richtet sich an Leser, die in das Gebiet der Psychologie ernsthaft eindringen und sich mit seiner Problematik auseinandersetzen wollen. Die wirklich substantiellen Themen werden nicht nur an der Oberfläche gestreift, sondern kommen gründlich zur Sprache, wenn auch in oft ungewohnter Verbindung, gegliedert nicht nach dem üblichen Fächerkanon, sondern nach ihrer Tiefenstruktur.
Üblicherweise künden einführende Lehrbücher vom sogenannten »Mainstream«. Eine ungeschriebene Regel gebietet dabei, die anerkannten Autoritäten zu referieren, aber nicht zu kritisieren. Anfangssemester sollen erst einmal einen Wissensfundus erwerben, über den die Majorität der Fachvertreter momentan nicht zu streiten übereingekommen ist. Was aber, wenn der Mainstream selbst eine Besinnung nötig hat? Käme es hier nicht darauf an, die Studierenden möglichst früh zu selbstständigem Denken zu ermutigen? Das geht dann freilich nicht ohne die Bereitschaft, den mitgeteilten Lehrstoff auch kritisch zu hinterfragen. Manche Entwicklungen in unserer Wissenschaft nimmt man mit Sorge zur Kenntnis, und es ist kein Grund ersichtlich, warum Studienanfänger das nicht wissen dürften. Unter ihnen sind die Fachvertreter von morgen; sie sollten rechtzeitig erkennen, dass noch manches der Verbesserung bedarf, und dass es ihrer Generation aufgegeben ist, dabei mitzuwirken.
Es ist ein guter Brauch, am Ende des Vorwortes denen zu danken, ohne die das Buch nicht oder nur in minderer Qualität zustandegekommen wäre. Etliche Freunde und Kollegen haben das Manuskript ganz oder in Teilen gelesen und wertvolle Rückmeldungen geliefert. Ich bin hier vor allem August Anzenberger, Athanasios Chasiotis, Dietrich Dörner, Gregor Kappler, Matthias Leder, Wolfgang Marx, Rolf Oerter und Rainer Reisenzein zu Dank verpflichtet. Damit der Verkaufspreis trotz des reichen Bildmaterials in einem realistischen Rahmen bleiben konnte, war finanzielle Unterstützung erforderlich; diese wurde großzügig von der Stiftung zur Förderung der Psychoanalyse und der Köhler-Stiftung geleistet. Die Stifterinnen – Frau Prof. Dr. Christa Rohde-Dachser und Frau Dr. Lotte Köhler – stehen der Psychoanalyse und teilweise der Bindungstheorie nahe, was insofern beachtenswert ist, als ich mit ihnen gerade über meine Kritik an Sigmund Freud und John Bowlby in Berührung gekommen bin. Es ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, ihnen dafür zu danken, dass sie das Sachinteresse so eindrucksvoll über Forderungen der Parteilichkeit gestellt haben.
Es bedarf fast keiner ausdrücklichen Erwähnung, wie sehr ich meiner Frau und meinen Töchtern zu danken habe, nicht nur für den allzeit regen Gedankenaustausch, mit dem sie das Entstehen dieses Buches begleitet haben, sondern auch einfach für das heutzutage immer seltener werdende Geschenk eines emotional intakten und tragfähigen sozialen Netzwerkes, unter aktiver Beteiligung meiner drei Schwiergersöhne, die unsere Familie inzwischen zur famiglia, family und mischpoche ausgeweitet haben. Besonders nennen möchte ich meine Tochter Annette Bischof-Campbell, die sich nach einem naturwissenschaftlichen Erststudium ein zweites Mal zur Universität begeben hat, um Psychologie zu studieren, und die die Entstehung des Manuskriptes aus der Perspektive der Studentin kritisch begleitet hat. Auch die Erstellung des Registers lag bei ihr in bewährten Händen.
Es würde etwas Wesentliches fehlen, wenn an dieser Stelle nicht auch meine Studierenden genannt würden. Das Buch basiert auf einer Abendvorlesung, die ich an der Münchner Universität seit etlichen Jahren regelmäßig im Wintersemester anbiete. Aus zahlreichen Rückmeldungen ist ersichtlich, dass die Teilnehmer die Herausforderung annehmen, ja dass sie für sie gerade den Reiz der Veranstaltung ausmacht. Nie ist verlangt worden, das Niveau zu senken, und obwohl ich zuweilen recht deutlich Stellung beziehe, wurde doch nie Einseitigkeit moniert; aber oft wird anschließend noch bei einem Bier bis spät in die Nacht weiterdiskutiert. Das ermutigt mich, den Stoff in Form eines Lehrbuches auch einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen.
München, im April 2008
Norbert Bischof
Vorwort zur zweiten Auflage
Knapp ein Jahr nach Erscheinen ist die erste Auflage bereits vergriffen, sodass schneller als erwartet die zweite in Angriff genommen werden musste. Wegen der Kürze der Zeitspanne war keine substantielle Umarbeitung erforderlich, sodass sich die Änderungen, abgesehen von ein paar neu eingearbeiteten aktuellen Bezügen, im Wesentlichen auf typographische und stilistische Korrekturen sowie die Verbesserung einiger Abbildungen beschränken konnte.
Ich nehme gern die Gelegenheit wahr, Herrn Dr. Ruprecht Poensgen und Frau Ulrike Merkel vom Kohlhammer-Verlag für die gute Zusammenarbeit zu danken, und ich danke auch allen Kollegen, die mir in Zuschriften zu dem Buch Mut gemacht haben, meine zuweilen etwas exponierte Position am Rande des Mainstreams durchzuhalten.
München, im April 2009
Norbert Bischof
Einstimmung
1 Wissenschaft und Kennerschaft
1.1 Das öffentliche Geheimnis
1.1.1 Warten auf den Knoten
Das Studium der Psychologie kann von irritierenden Erfahrungen begleitet sein. Natürlich hängt das auch davon ab, aus welchen Motiven heraus man sich für das Fach interessiert. Die meisten werden es aber wohl deshalb gewählt haben, weil sie ihre Mitmenschen und sich selbst besser verstehen möchten, also gewissermaßen professionelle »Menschenkenner« werden wollen.
Vielleicht haben sie schon bemerkt, dass sie ganz gut auf andere eingehen können, ihre Mitmenschen richtig beurteilen; sie mögen die Erfahrung gemacht haben, dass andere Vertrauen zu ihnen fassen, dass sie da und dort nützlichen Rat geben konnten; und nun erhoffen sie sich vom Studium Vertiefung und Ausbau dieses Talents. Oder sie kennen jemanden, der über diese Qualitäten verfügt, und möchten auch so werden. Vielleicht haben sie umgekehrt erleben müssen, dass sie sich in ihren Mitmenschen gründlich getäuscht haben, vielleicht immer wieder erneut täuschen, und wollen diesem Mangel auf den Grund gehen. Oder sie finden ganz einfach Menschen faszinierend und wollen mehr über sie erfahren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























