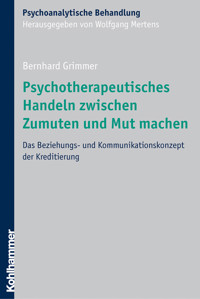
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Psychotherapeutisch wirksames Handeln setzt Zutrauen in die Entwicklungsfähigkeit eines Patienten voraus, mutet ihm neue Einsichten zu und fordert ihn zu Veränderungen heraus. Zugleich muss der Patient ermutigt werden, die damit verbundene Verunsicherung zu ertragen. Von einer solchen Beziehungsgestaltung handelt das Kommunikationskonzept der Kreditierung, das in diesem Buch neu entwickelt wird. Es beginnt mit einem Überblick über die Bedeutung der therapeutischen Beziehung in der Psychoanalyse und einer Darstellung der neueren Ergebnisse der Psychotherapie- sowie der Entwicklungsforschung zur Wirkungsweise des Zutrauens und des Zumutens. Anschließend werden die verschiedenen Formen therapeutischer Kreditierung anhand zahlreicher Fallbeispiele aus ambulanten und stationären Kontexten erläutert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2005
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Psychotherapeutisch wirksames Handeln setzt Zutrauen in die Entwicklungsfähigkeit eines Patienten voraus, mutet ihm neue Einsichten zu und fordert ihn zu Veränderungen heraus. Zugleich muss der Patient ermutigt werden, die damit verbundene Verunsicherung zu ertragen. Von einer solchen Beziehungsgestaltung handelt das Kommunikationskonzept der Kreditierung, das in diesem Buch neu entwickelt wird. Es beginnt mit einem Überblick über die Bedeutung der therapeutischen Beziehung in der Psychoanalyse und einer Darstellung der neueren Ergebnisse der Psychotherapie- sowie der Entwicklungsforschung zur Wirkungsweise des Zutrauens und des Zumutens. Anschließend werden die verschiedenen Formen therapeutischer Kreditierung anhand zahlreicher Fallbeispiele aus ambulanten und stationären Kontexten erläutert.
Dr. Bernhard Grimmer ist Oberassistent an der Abteilung für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse der Universität Zürich.
Psychoanalytische Behandlung
Herausgegeben von Wolfgang Mertens
Wolfgang Mertens/Rolf HaublDer Psychoanalytiker als Archäologe
Rolf Haubl/Wolfgang MertensDer Psychoanalytiker als Detektiv
Willi FringsHumor in der Psychoanalyse
Anneliese BuchtaAggression von Frauen
Stefan ReichardWiederholungszwang
Siegfried BettighoferÜbuertragung und Gegenübertragung im therapeutischen Prozess
Bernhard Grimmer
Psychotherapeutisches Handeln zwischen Zumuten und Mut machen
Das Beziehungs- und Kommunikations- konzept der Kreditierung
Verlag W. Kohlhammer
Die vorliegende Arbeit wurde von der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich im Sommersemester 2005 auf Antrag von Frau Prof. Dr. Brigitte Boothe und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Mertens als Dissertation angenommen.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 1. Auflage 2006 Alle Rechte Vorbehalten © 2006 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-019040-5
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028020-5
mobi:
978-3-17-028021-2
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Einleitung
1 Die therapeutische Beziehung in der Psychoanalyse und aus Sicht der empirischen Psychotherapieforschung
1.1 Die therapeutische Beziehung aus psychoanalytischer Sicht
1.1.1 Grundlagen einer psychoanalytischen Beziehungstheorie
1.1.2 Die therapeutische Beziehung als Übertragungsbeziehung
1.1.3 Das Arbeitsbündnis und die Realbeziehung
1.2 Die therapeutische Beziehung als Gegenstand der empirischen Psychotherapieforschung
1.2.1 Die therapeutische Beziehung als Aushandlungsprozess
1.2.2 Vertrauen und Vertrauensbildung
1.2.3 Empathie
1.2.4 Erwartung, Hoffnung und Zuversicht
1.2.5 Die Glaubwürdigkeit und der Glaube des Therapeuten
Zusammenfassung
2 Kreditierung und Diskreditierung in der psychischen Entwicklung des Kindes und in pädagogischen Beziehungen
2.1 Psychoanalyse und Entwicklungsforschung
2.2 Entwicklungsfördernde Kommunikation zwischen Eltern und Kindern
2.2.1 Selbst- und Fremdregulierung in der kindlichen Entwicklung
2.2.2 Affektspiegelung und Mentalisierung
2.2.3 Fremdregulierung und der evozierte Gefährte
2.2.4 Elterliche Zuschreibungstätigkeit und imaginäre Interaktion
2.3 Kreditierung und Verweigerung
2.3.1 Das Kreditierungskonzept von Boothe und Heigl-Evers
2.3.2 Kreditierung und die soziale Konstruktion von Identität
2.3.3 Die Visionen der Eltern und die des Therapeuten
2.4 Kreditierung und Diskreditierung zwischen Lehrern und Schülern: Vergleichbare Konzepte in der Pädagogik
2.4.1 Erwartungseffekte im Lehrer-Schüler-Verhältnis
2.4.2 „Zones of proximal development“ und die Unterstellung von Fähigkeiten
Zusammenfassung
3 Die Struktur von Kreditierungsbeziehungen
3.1 Kreditierung und Diskreditierung in der Alltagssprache
3.2 Kreditierungsbeziehungen im Rahmen von Finanzdienstleistungen
3.3 Der Beziehungsmodus Kreditierung
4 Die therapeutische Beziehung als Kreditierungsbeziehung
4.1 Ist die therapeutische Beziehung eine Kreditierungsbeziehung?
4.1.1 Die therapeutische Beziehung als triadische Beziehung
4.1.2 Die Asymmetrie in der therapeutischen Beziehung
4.1.3 Die Suche des Patienten nach einem kreditierenden Objekt
4.1.4 Die Überprüfung der Kreditwürdigkeit: Was traut der Therapeut dem Patienten zu?
4.1.5 Die Aushandlung des therapeutischen Kredits
4.2 Therapeutisches Kreditierungshandeln
4.2.1 Kreditierungshandeln als triadische Positionierungsaktivität
4.2.2 Die Anerkennung des eigenen Akteurstatus
4.2.3 Die explizite Zuschreibung von Entwicklungspotentialen
4.2.4 Kreditierung oder Schonung
4.2.5 Kreditierung, Differenz und Spannung in der therapeutischen Beziehung
4.2.6 Kreditierung der Aktivität eines Patienten in der Psychotherapie: die Fähigkeit zur Selbstartikulation
4.2.7 Der Therapeut macht die Arbeit: Entlastung und Passivität des Patienten
4.2.8 Kreditierung in Bezug auf das Setting
4.2.9 Kreditierung und Überforderung
4.2.10 Kreditierung und Größenphantasien
Zusammenfassung
5 Das Kreditierungskonzept im psychoanalytischen Kontext und im Verhältnis zu anderen Beziehungskonzepten
5.1 Kreditierung und die Beziehungskonzepte der empirischen Psychotherapieforschung
5.1.1 Kreditierung und Empathie
5.1.2 Kreditierung und Vertrauen
5.1.3 Kreditierung, Erwartung und Zuversicht
5.2 Das Kreditierungskonzept im psychoanalytischen Kontext
5.2.1 Kreditierung und Suggestion
5.2.2 Kreditierungshandeln zwischen Übertragung und Gegenübertragung
5.2.3 Kreditierung und der Kampf um Anerkennung
Zusammenfassung
6 Die Wirkung therapeutischer Kreditierung
6.1 Die Identifikation mit einem kreditierenden Objekt
6.2 Kreditierung und das Konzept der Ich-Stützung: analysieren oder stützen?
6.3 Kreditierung und Deutung
6.4 Kreditierung und Mentalisierung
Zusammenfassung
7 Kreditierung – ein neues Beziehungskonzept: Desiderate für Praxis und Forschung
7.1 Zur praktischen Relevanz des Kreditierungskonzepts
7.2 Zur wissenschaftlichen Relevanz des Kreditierungskonzepts
Resümee
Konversationsanalytische Transkriptionszeichen
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vincent van Gogh, Erste Schritte (nach Millet), 1890 New York, The Metropolitan Museum of Modern Art
Geleitwort
In der psychoanalytischen Theorie der Behandlungstechnik gibt es eine Vielzahl an Auffassungen darüber, was wirkt, und die Diskussion hat vor allem seit der Einbeziehung gedächtnispsychologischer Befunde in den letzten Jahren neuen Auftrieb erhalten: Spielt die Bewusstmachung von verdrängten Kindheitserfahrungen in der modernen Psychoanalyse überhaupt noch eine entscheidende Rolle oder geschieht der Großteil der Veränderungen nicht eher anhand der Arbeit an den impliziten prozeduralen Beziehungsregeln? Schon seit geraumer Zeit ist allerdings das Deuten von symbolisierbaren Übertragungen zugunsten von solchen Interventionen in den Hintergrund getreten, die Einfühlung in noch kaum verbalisierbare Gefühle, ein Containment von unerträglichen Affektzuständen oder das behutsame Verständnis von psychischem Rückzug und Desobjektalisierung betonen. Der therapeutische beziehungsorientierte Umgang mit den nicht-deklarativen, impliziten Erinnerungen an das Unvergessbare, aber nicht Erinner- und Mentalisierbare schließt allerdings die Bewusstmachung und Erforschung von Übertragungen nicht aus; gerade bei Patienten mit in der frühen Kindheit erfolgten Traumatisierungen, mit einer unsicheren Bindungspräsentation und einer Beeinträchtigung ihrer sozioemotionalen und kognitiven Kompetenzen bleibt die sorgfältige Beachtung der Übertragungsphantasien und entsprechender Enactments nach wie vor sehr wichtig. Diese Befundlage macht auch Überlegungen zum Ineinandergreifen verschiedener behandlungstechnischer Vorgehensweisen erforderlich.
Bernhard Grimmer entwirft in seiner Arbeit eine neue Sichtweise auf das Beziehungsgeschehen in Analysen und Therapien, indem er ein innovatives Konzept, das der Kreditierung, kenntnisreich und sorgfältig in den Kontext klassischer und moderner Auffassungen über Beziehungsgeschehen und analytische Wirkfaktoren stellt.
Ausgehend von den Konzepten und Forschungsbefunden einer entwicklungsfördernden Kommunikation zwischen Eltern und Kindern vergleicht der Autor die Erkenntnisse über Selbst- und Fremdregulierung, Affektspiegelung und Mentalisierung, mit dem von Brigitte Boothe und Anneliese Heigl-Evers ursprünglich beschriebenen Beziehungsmodus der Kreditierung, bei der dem Kind, seinen Handlungen und Begabungen eine Entwicklungsperspektive zugeschrieben wird. Dadurch können Vertrauen, Hoffnung, Mut und Zuversicht entstehen. Es liegt deshalb nahe, diese vertrauensvolle Beziehungsgestaltung auch auf die Therapeut-Patient-Beziehung zu übertragen, in der ein Therapeut seinem Patienten „Kredit“ für sein Anliegen gibt, aber auch ein Patient dem Therapeuten „Kredit“ für seine Kompetenz einräumt, ihn im therapeutischen Prozess sachkundig und verantwortlich zu begleiten.
Unmissverständlich macht Bernhard Grimmer deutlich, dass Kreditierung ein Beziehungskonzept ist und in einem interaktionellen Denken verwurzelt ist. Inwieweit ein Therapeut seinem Patienten Kredit geben kann, ist Resultat eines Aushandlungsprozesses. Dabei betont er immer wieder, dass Kreditierungshandeln keine regressive Verwöhnung oder eine ausschließlich empathische konkordante Identifizierung beinhaltet, sondern auch Raum für Zumutung, Konfrontation und Differenz lässt. Anhand von Beispielen und mit Hilfe von Methoden aus der Ethnomethodologie, Ethnographie und Erzählforschung zeigt er auf, dass Kreditierungshandeln durchaus auch eine triadische Positionierungsaktivität zulässt, um sog. „chicken traps“ zu vermeiden und Neutralität aufrechtzuerhalten.
Denn weder ist eine kreditierende Kommunikation eine Haltung, die blindlings Anerkennung und Zuspruch vermittelt, die wir vor allem bei schlecht ausgebildeten Therapeuten antreffen können, die sich erheblich selbst überschätzen und glauben, ausschließlich mit narzisstischer Stärkung bereits therapeutische Veränderungen bewirken zu können; noch ist eine kreditierende Haltung ein Locken mit Anerkennung, sofern bestimmte Leistungen erfüllt werden, was einer unreflektiert potentiell sadistischen Einstellung entspringen würde.
Vielmehr stellt sie, wie der Autor differenziert und in Anschluss an Martin Altmeyer, Jessika Benjamin und Axel Honneth herausarbeitet, eine Anerkennungserfahrung dar, die den meisten unserer Patienten aus den verschiedensten Gründen in ihrer Kindheit versagt geblieben ist. Entweder konnten sie für ihr Selbst-Sein nicht ausreichend geschätzt werden, weil sie den narzisstischen Erwartungen und Delegationen ihrer Eltern zu wenig entsprachen, oder sie waren einem verwöhnenden Erziehungsstil ausgesetzt, der überwiegend aus unbewussten Gründen dem Kind und Heranwachsenden die freudvolle Erfahrung versagt, an Herausforderungen und zumutbaren Enttäuschungen wachsen und sich entwickeln zu können. Eine Kreditierungskommunikation schließt deshalb Kämpfe und Grenzziehungen, erträgliche Versagungen und tolerierbare Enttäuschungen keineswegs aus, genauso wenig wie eine maßvolle Anerkennung von erfolgten Lernschritten.
Und gleichzeitig muss diese Haltung immer wieder reflektiert werden und in der Kommunikation mit einem ganz bestimmten Patienten immer wieder darauf hin überprüft werden, inwieweit die Kreditierung z. B. als narzisstische Manipulation oder als ein therapeutisch perfektionistischer Anspruch vom Patienten aufgrund seiner Übertragungsphantasien missverstanden und dadurch zum unabweislichen Übertragungsthema wird.
Grimmers Arbeit liest sich wie eine spannende Darstellung des bisher erreichten Diskussionsstands über das, was in einer analytischen Psychotherapie Veränderungen bewirken kann; sie ist jedoch mehr als nur eine gelehrte Abhandlung, denn gleichzeitig macht der Autor an vielen Beispielen deutlich, worin die Kreditierungskommunikation besteht, wie sie vom Patienten missverstanden werden und warum sie entgleisen kann.
Der Autor ist aber nicht nur behandlungspraktisch versiert, sondern er ist auch ein exzellenter Kenner der gegenwärtigen empirischen Psychotherapie- und Bindungsforschung. Beide Forschungsbereiche haben in den letzten Jahren auf das Problem der Passung zwischen Therapeut und Patient sowie auf die Bereitstellung einer sicheren Basis aufmerksam gemacht. Zwar wussten Psychoanalytiker schon sei langem, wie wichtig es ist, „den Patienten an die Person des Arztes zu attachieren“ (Freud), doch sind wir in den letzten Jahren noch sehr viel sensibler dafür geworden, wie ängstlich und schamhaft der therapeutische Kontakt von einem Patienten erlebt werden kann, und wie viel Geduld, Respekt und Achtung seitens des Analytikers vonnöten sind, einem Menschen zu begegnen, der sich oftmals mit ungemein großem Vertrauen, viel Idealisierungsbereitschaft, aber auch großer Kränkbarkeit einer Autorität öffnet und über intime Dinge spricht, die er vielleicht noch keinem Menschen zuvor anvertraut hat. Eine Kreditierungshaltung macht nicht nur Mut und mutet zugleich zu, sondern spricht dem Patienten auch ein Entwicklungspotenzial zu, sieht ihn nicht so, wie er ist, sondern so, wie er sein könnte, ohne ihn dabei zu überfordern. Der intentionale Akteurstatus wird angesprochen, ohne die bisherigen Zuschreibungen, sich selbst den äußeren Umständen oder den inneren Zuständen als ausgeliefert zu erleben, forciert und vorzeitig zu unterbrechen.
Grimmers Plädoyer für eine therapeutische Kreditierungskommunikation mag manchen wie das Ende einer allzu langen Verwöhnphase in der psychoanalytischen Community analog den knapper werdenden Mitteln eines Sozialstaates vorkommen; aber auch schon die Gründerväter, wie Freud und Ferenczi, haben darauf aufmerksam gemacht, dass man den Patienten etwas abverlangen sollte, wie z. B. sich mit einer ängstigenden Situation aktiv auseinanderzusetzen.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich zweifelsohne um eine sehr innovative und kenntnisreiche Untersuchung, bei der auf hohem konzeptuellen Niveau sorgfältige Argumentationen und ausgewogene Urteile in klarem und anschaulichem Stil über ein vielversprechendes Beziehungskonzept ausgearbeitet werden.
Wolfgang Mertens
München, im Herbst 2005
Einleitung
Vergangenheits- oder Zukunftsorientierung in der Psychoanalyse?
Im psychotherapeutischen Alltag einer psychoanalytisch orientierten Beratungs- und Therapiestelle bekommt man von Patienten, die unsicher sind, ob sie sich für eine Behandlung entscheiden sollen, oft ein bestimmtes Unbehagen zu hören: Eine Psychoanalyse decke nur schmerzhafte Konflikte und traumatisierende Erfahrungen auf. Der Patient wisse dann zwar mehr über sie, sei aber anschließend nur noch mit der Vergangenheit beschäftigt und bleibe schließlich mit seinen „offenen Wunden“ zurück.
Selbst wenn es sich dabei nur um ein Vorurteil handelt, das aus Abwehr und ohne eigene Erfahrung entsteht, so ist dessen Persistenz beeindruckend. Und dieses Unbehagen findet sich auch bei Psychoanalytikern selber. Thomä (1999) etwa hält es für bedenklich, wenn in der Psychoanalyse oft der Eindruck erweckt wird, dass der analysierende Prozess schon ein Zweck an sich ist und es nicht um das Ergebnis der Therapie geht. Das Forschen und Verstehen wird häufig für wichtiger gehalten als das Verändern und die Linderung seelischen Leidens. Thomä (2000, S. 178) bringt dies in Zusammenhang mit dem Fehlen geeigneter Konzepte, die auf Veränderung zielendes therapeutisches Handeln beschreiben. Er meint, dass „das psychoanalytische Vokabular relativ arm ist, wenn es darum geht, statt der Wiederholung in der Übertragung neue Erfahrungen und den Prozess der Veränderung zu beschreiben.“
In eine ähnliche Richtung argumentiert Ermann (1999, S. 261), der die Dominanz der Störungs- und Vergangenheitsorientierung in der Psychoanalyse kritisiert und eine stärkere Ressourcen- und Bewältigungsorientierung fordert. Seiner Meinung nach kommt es heute besonders darauf an, in einer Psychoanalyse „für die aktuellen Bewältigungsmöglichkeiten (...) genügend Raum zu schaffen.“ Wie dies konkret aussehen kann, macht Ermann (1999, S. 263) zwar an einem Fallbeispiel deutlich, in dem der Analytiker den Patienten unterstützt, eine bevorstehende Trennungssituation durch Tagebuchschreiben besser zu überstehen. Dabei ist die Rede von supportiven Elementen oder von der Anregung progressiver Kräfte des Patienten und der Anerkennung seiner bereits initiierten Bewältigungsschritte. Man gewinnt aber den Eindruck, dass zwischen dem konkreten Fallbeispiel und den allgemeinen Begriffen der Ressourcenorientierung und der Suche nach Bewältigungsmöglichkeiten eine gewisse Sprachlosigkeit herrscht. Es scheint, als fehlen passende psychoanalytische Konzepte, um genauer zu beschreiben, was eine bewältigungs- und zukunftsorientierte Beziehungsgestaltung in einer psychoanalytischen Therapie bedeutet.
Zutrauen und Zumuten: das Beziehungskonzept der Kreditierung
In einer psychoanalytischen Therapie arbeiten der Analytiker und der Analysand zusammen, damit es dem Analysanden anschließend besser geht. Die Zusammenarbeit findet in der Gegenwart statt und es wird viel über die Vergangenheit gesprochen, aber eigentlich ist die Therapie ein auf die Zukunft ausgerichtetes Projekt. Etwas, was noch nicht möglich ist, etwa die Lösung eines Beziehungskonflikts, soll für den Patienten später einmal möglich werden. Der Weg zu diesem Ziel ist aus psychoanalytischer Perspektive ein aufdeckender und konfrontierender: Dem Patienten wird zugemutet, etwas über sich zu erfahren, was er nicht wissen will, und Ängste zu ertragen, die ihm unerträglich schienen. Weil eine analytische Therapie also den Charakter einer Zumutung hat, stellt sich die Frage, woher der Patient den Mut dazu nimmt. Freud war sich der Bedeutung dieser Frage bewusst. Er hat die psychoanalytische Behandlung wiederholt als Kampf und kriegerische Auseinandersetzung metaphorisiert (Freud, 1937, 1941). Damit verwies er darauf, dass eine psychoanalytische Behandlung ein offener Prozess mit ungewissem Ausgang ist. Sie ist ein existentielles Wagnis, bei dem der Patient immer wieder vor der Entscheidung steht, „den produktiven Schritt ins eigene Ungewisse“ (Boothe, 1995, S. 159) zu wagen oder nicht. Er muss, so schreibt Freud (1914a, S. 132) in „Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten“ „den Mut erwerben, seine Aufmerksamkeit mit den Erscheinungen seiner Krankheit zu beschäftigen“. Diesen Mut, den eine psychoanalytische Behandlung erfordert, kann man nicht voraussetzen, er wird erst im Laufe der Therapie erworben: Der Patient braucht jemanden, der ihm Mut macht. Therapeutisches Handeln oszilliert somit zwischen Zumuten und Mut machen.
Aber wie macht ein Analytiker seinem Patienten auf eine authentische Weise Mut, ohne ihm nur beschwichtigend zuzureden? Und unter welchen Bedingungen glaubt er überhaupt an das Potential des Patienten, das es braucht, um von einer analytischen Therapie zu profitieren? Wenn man den Ergebnissen auch psychodynamischer Therapieforscher glaubt, spielen die Erwartungen des Therapeuten über die Fähigkeiten des Patienten und über den Verlauf einer möglichen Zusammenarbeit eine bedeutende Rolle für die Entwicklung des Arbeitsbündnisses und den Verlauf der Therapie (Rudolf, 1991): Um dem Patienten wirklich Mut machen und um ihm in der Zusammenarbeit etwas zumuten zu können, muss der Therapeut davon überzeugt sein, dass der Patient das dafür nötige Entwicklungspotential besitzt. Ein produktives Zumuten setzt ein solches Zutrauen voraus. Der Patient wiederum muss beides in der Zusammenarbeit mit dem Therapeuten erfahren, um an sich und die Möglichkeit zur Veränderung zu glauben.
Das Beziehungs- und Kommunikationskonzept der Kreditierung, das in diesem Buch anhand von Fallbeispielen entwickelt wird, handelt davon, wie Therapeuten das Potential ihrer Patienten fördern und Veränderungen initiieren, indem sie ihnen zutrauend und zumutend begegnen. Es ermöglicht, diesen zentralen Aspekt psychotherapeutischer Kommunikation, der von den bekannten Beziehungskonzepten bisher kaum erfasst wird, hervorzuheben und seine Wirkungsweise zu verstehen.
Heute liest man oft, es komme vor allem auf eine empathische und bestätigende Haltung des Therapeuten an. Konzepte wie Empathie, Holding, Containing oder neuerdings auch Vertrauensbildung, die auf eine Stabilisierung und Beruhigung in der Gegenwart zielen, sind verbreitet und anerkannt. Mit Kreditierung ist demgegenüber eine Behandlung des Patienten gemeint, die Herausforderung und Konfrontation beinhaltet und eine zeitweilige Verunsicherung des Patienten in Kauf nimmt, um ihm Veränderungen zu ermöglichen.
In ihrem Buch „Die Psychoanalyse der frühen weiblichen Entwicklung“ haben Boothe und Heigl-Evers (1996) das Beziehungskonzept der Kreditierung im Rahmen einer psychoanalytischen Entwicklungspsychologie formuliert und damit bestimmte Formen zutrauender Kommunikation zwischen Eltern und ihren Kindern bezeichnet. Dieses Konzept wird im Folgenden auf die therapeutische Beziehung übertragen, ausgestaltet und in den Kontext der in der Psychoanalyse gängigen Beziehungskonzepte gestellt.
Psychoanalytische Konzeptforschung
Damit versteht sich diese Arbeit als Beitrag zu einer psychoanalytischen Konzeptforschung, die laut Dreher (1999, S. 9) unentbehrlich ist, denn „der Fortschritt in einer Wissenschaft (basiert, B. G.) doch nicht nur auf einer Erweiterung der empirischen Indizienbasis, sondern stets auch auf neuen und veränderten Konzepten“ (ebd.). Unter psychoanalytischer Konzeptforschung versteht man meistens Forschungsaktivitäten, die eine „systematische Klärung des Gebrauchs psychoanalytischer Konzepte“ beabsichtigen (ebd.). Damit sind dann folgende Untersuchungsschritte verbunden:
Der Entstehungskontext eines Konzepts wird analysiert.
Die Geschichte eines Konzepts wird im Zusammenhang mit der sich verändernden psychoanalytischen Theorie nachgezeichnet.
Die aktuelle Verwendung eines Konzepts wird beschrieben.
Anregungen zu einer neuen Verwendung des Konzepts werden gegeben (Dreher, 1999, S. 23).
Eine solche Konzeptforschung hilft, den Gebrauch psychoanalytischer Konzepte (wie Narzissmus oder Übertragung) in ihrer historischen Entwicklung zu verstehen, ihn zu vereinheitlichen und ihren aktuellen Bedeutungshorizont abzustecken. In einer bestimmten Hinsicht ist sie jedoch konservativ, weil sie die alten Konzepte zwar neu liest, sie aber letztlich nur konserviert und aktualisiert, ohne neue Konzepte zu formulieren. Die Bereitschaft, auch tradierte Theorien und Konzepte aufzugeben, bzw. sie in einer zeitgenössischen Theoriesprache zu formulieren, ist aber eine notwendige Bedingung, um die Psychoanalyse auf Dauer lebensfähig zu halten (Dornes, 2004). Deshalb braucht es auch die Formulierung neuer Konzepte, die die aktuellen Erkenntnisse empirischer Forschung und klinischer Fallberichte aufgreift und in übergreifende Zusammenhänge bringt (Mertens, 2004).
Zum Aufbau des Buches
Die hier interessierenden Aspekte psychotherapeutischen Handelns wie das Zutrauen, die Ermutigung oder das Zumuten sind Beziehungsmerkmale. Sie finden im Hier und Jetzt der therapeutischen Beziehung statt und sie beeinflussen die vom Patienten erlebte Qualität der Zusammenarbeit mit dem Therapeuten. Die Untersuchung beginnt deshalb mit einem historischen Überblick zur Bedeutung der therapeutischen Beziehung in der Psychoanalyse. Was an der Beziehung zwischen Patient und Therapeut wurde überhaupt für therapeutisch wirksam gehalten und wie sollte ein Analytiker die Beziehung richtig gestalten? Wie veränderten sich die Beziehungskonzeptionen bis heute? Diese Entwicklung wird hier nur in ihren Grundzügen dargestellt, ein ausführlicher Überblick über die therapeutische Beziehung in der Psychoanalyse findet sich an anderer Stelle (Boothe & Grimmer, 2005).
Nach diesem Überblick wird diskutiert, wie die empirische Psychotherapieforschung das Wissen darüber, was eine gute therapeutische Beziehung ausmacht, verändert und erweitert hat. Die Ergebnisse der Psychotherapieforschung haben in jüngster Zeit zur Anerkennung solcher Beziehungsaspekte geführt, die die Psychoanalyse lange Zeit kaum beachtete.
Im zweiten Kapitel geht es um die psychoanalytische Entwicklungspsychologie. Seit dem Aufkommen der empirischen Säuglingsforschung werden aus der Beobachtung der Interaktion zwischen Eltern und Kindern immer wieder Rückschlüsse über die Wirkungsweise der Psychotherapie bei erwachsenen Patienten gezogen. Lange Zeit wurde heftig über die Zulässigkeit und Notwendigkeit solcher Rückschlüsse gestritten, inzwischen gilt dies jedoch allgemein als ein Vorgehen, von dem man sich neue Impulse für die Behandlungstheorie verspricht (Bohleber, 2002). Bevor das entwicklungspsychologische Konzept der Kreditierung von Boothe und Heigl-Evers (1996) dargestellt wird, wird es theoretisch eingebettet. Vor allem solche Ergebnisse aus der Kleinkindforschung, aus denen man die Wichtigkeit einer kreditierenden Zuwendung für die kindliche Entwicklung entnehmen kann, kommen zur Sprache.
Das dritte Kapitel beinhaltet eine abstrakte und modellhafte Beschreibung des Beziehungsmodus der Kreditierung, um dessen Strukturmerkmale sichtbar zu machen.
Das Zentrum des Buches bildet das vierte Kapitel, in dem die therapeutische Beziehung als Kreditierungsbeziehung betrachtet wird. Anhand von Fallbeispielen und auf der Basis psychoanalytischer Theorien wird begründet, warum dies sinnvoll ist. Danach wird therapeutisches Kreditierungshandeln als Beziehungsaktivität definiert und in seinen verschiedenen Varianten beschrieben. Dies geschieht wiederum anhand von Einzelfallbeispielen. Hierbei handelt es sich um Sequenzen aus psychoanalytischen Therapien, die auf Tonband aufgenommen und anschließend transkribiert wurden. Dieses Material erlaubt, eine bestimmte Gesprächssituation einzufrieren und die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindende Interaktion gesprächsanalytisch zu rekonstruieren. Kreditierungshandeln kann somit als Ereignis in einer konkreten Beziehungssituation bestimmt und gezeigt werden.
Anschließend wird das Kreditierungskonzept mit anderen psychoanalytischen Konzepten und den am Anfang beschriebenen Beziehungskonzepten verglichen. Überlegungen zur Frage, wie therapeutisches Kreditierungshandeln wirkt, finden sich im sechsten Kapitel. Das Buch endet mit den Schlussfolgerungen, die sich aus dem Kreditierungskonzept für die psychotherapeutische Praxis und für zukünftige Forschungsprojekte ergeben.
Übersicht über den Aufbau des Buches:
Die therapeutische Beziehung in der Psychoanalyse und aus Sicht der empirischen PsychotherapieforschungKreditierung und Diskreditierung in der psychischen Entwicklung des Kindes und in pädagogischen BeziehungenDie Struktur von KreditierungsbeziehungenDie therapeutische Beziehung als KreditierungsbeziehungDas Kreditierungskonzept im psychoanalytischen Kontext und im Verhältnis zu anderen BeziehungskonzeptenDie Wirkung therapeutischer KreditierungKreditierung – ein neues Beziehungskonzept: Desiderate für Praxis und ForschungIm Folgenden wird nicht zwischen Psychoanalyse (hochfrequente Therapie und Couch-Setting) und psychoanalytischer Psychotherapie unterschieden. Therapeutisches Kreditierungshandeln soll als ein grundlegender Beziehungsmodus in psychoanalytischen Therapien beschrieben und diskutiert werden. Möglicherweise spielt es unter bestimmten Setting-Bedingungen eine größere Rolle als unter anderen, aber darum geht es in dieser Arbeit nicht. Gegen eine vorschnelle Unterscheidung etwa zwischen hochfrequenter Psychoanalyse und analytischer Psychotherapie spricht auch, dass empirisch nicht geklärt ist, ob sich die verschiedenen Therapieformen in ihrer Wirkungsweise grundsätzlich unterscheiden (Sandell, 2001, Hartkamp, 1997). Ebenso wenig unterscheidet diese Arbeit zwischen Therapeut und Analytiker, es handelt sich lediglich um sprachliche Variationen. Die Arbeit bezieht sich immer auf die Beteiligten einer psychoanalytischen Therapie. Kreditierung und Diskreditierung kommen aber auch in anderen therapeutischen Beziehungen vor und beeinflussen den Prozess.
Viele der in diesem Buch entwickelten Gedanken und Ideen sind im intensiven Austausch mit Frau Professor Dr. Brigitte Boothe im Rahmen der gemeinsamen Arbeit in den letzten Jahren entstanden. Ohne ihre Anregungen und ihre Anteilnahme wäre das Buch nicht möglich gewesen. Herrn Professor Dr. Wolfgang Mertens danke ich für die gemeinsame Diskussion des Kreditierungskonzepts und die Möglichkeit, meine Arbeit in der Reihe „Psychoanalytische Behandlung“ zu publizieren. Für wertvolle Anmerkungen, Diskussionen und Unterstützung beim Erstellen dieser Arbeit danke ich außerdem Barbara Barth, Franziska Kubat, lic. phil. Hanspeter Mathys (von dem auch einige Fallbeispiele stammen) und Dr. phil. Marius Neukom.
1 Die therapeutische Beziehung in der Psychoanalyse und aus Sicht der empirischen Psychotherapieforschung
1.1 Die therapeutische Beziehung aus psychoanalytischer Sicht
1.1.1 Grundlagen einer psychoanalytischen Beziehungstheorie
Das Verständnis der Entstehung, der Formen und Wirkungen zwischenmenschlicher Beziehungen, insbesondere derjenigen der frühen Kindheit, ist ein zentrales Anliegen psychoanalytischen Denkens. Dennoch lässt sich der Begriff der Beziehung in den einschlägigen psychoanalytischen Wörterbüchern nicht finden (vgl. Laplanche & Pontalis, 1996; Mertens & Waldvogel, 2000; Mertens, 1997). Wenn von Beziehung die Rede ist, dann als Teil zusammengesetzter Begriffe wie Objektbeziehung, Übertragungsbeziehung oder therapeutische Beziehung.
In der Psychoanalyse ist der Begriff der Objektbeziehung gebräuchlich, um zwischenmenschliche Beziehungen zu beschreiben. Der Austauschprozess zwischen zwei Personen wird psychoanalytisch traditionell aus Sicht des Individuums (Subjekt) beschrieben, das mit einem anderen (Objekt) in Beziehung steht. Mit Kernberg (1997) kann man sehr allgemein sagen, dass jede psychoanalytische Theoriebildung immer auch eine Objektbeziehungstheorie ist, denn sie beschäftigt sich mit dem Einfluss früher Objektbeziehungen auf die Genese unbewusster Konflikte und die Entwicklung der psychischen Struktur sowie mit der Aktualisierung vergangener internalisierter Objektbeziehungen.
Bereits bei Freud (1905a, S. 82) findet sich die Aussage, dass „für die Psychoanalyse (...) die Beziehung zu einem Objekt das Wesentliche (ist, B. G.).“ Freud hat die Beziehung des Kindes zu seinen primären Bezugspersonen aus Sicht des sich entwickelnden Kindes beschrieben. Er sah im Kleinkind ein triebhaftes Wesen, das für sein physisches und psychisches Überleben auf Objektbeziehungen angewiesen ist. Das Kind tritt, motiviert durch widersprüchliche Triebkräfte, in Beziehung mit seinen Pflegepersonen. Die Entwicklung des Kindes versteht er im Wesentlichen als konfliktreiche Kompromissbildung zwischen dem Bedürfnis nach Selbsterhaltung und dem nach sexueller Triebbefriedigung (Freud, 1905a; vgl. auch Heigl-Evers & Boothe, 1997). Getrieben von dem Bedürfnis nach Selbsterhaltung bindet sich das Kind im Zustand der Hilflosigkeit an ein mütterliches Objekt mit dem Ziel, Versorgung sicherzustellen und Trennung, und damit drohende Vernichtung, zu vermeiden. Als Antagonisten des Selbsterhaltungstriebes sieht Freud den Sexualtrieb. Dessen Ziel ist nicht die Bindung an ein Objekt, sondern der Spannungsabbau in Form lustvoller Befriedigungserlebnisse. Das Objekt ist dabei nur soweit bedeutsam, wie es dazu dient, Triebbefriedigung zu ermöglichen (Freud, 1915). Da das Kind die ersten lustvollen Körperempfindungen im Zusammenhang mit den Pflegehandlungen macht, werden die Pflegepersonen zunächst in Anlehnung daran auch als Sexualobjekte besetzt. Mit dieser primären Objektwahl wird die auf Selbsterhalt ausgerichtete Beziehung erotisiert, was der Ursprung von Liebe und Zärtlichkeit ist (Freud, 1914b).
Im Laufe der Entwicklung kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen den sexuellen Triebwünschen und dem Bedürfnis nach Selbsterhaltung. Das Bedürfnis nach Selbsterhaltung und damit die Bindung an ein Objekt erweist sich dabei häufig stärker als der Wunsch nach Triebbefriedigung (Freud, 1915, 1926). Darum unterdrückt das Kind in verschiedenen Entwicklungsphasen Triebansprüche, um die Beziehung zu seinen Bezugspersonen nicht zu gefährden. Häufig werden die Triebwünsche aber nur aus dem Bewusstsein verdrängt, ohne dass der Wunsch nach Befriedigung aufgegeben wird. Der Konflikt zwischen Triebwunsch und Selbsterhaltung, der sich in der Beziehung zu den äußeren Objekten entwickelt, wird so verinnerlicht. Die nun unbewusst wirkenden Wünsche streben weiter nach Erfüllung und Triebbefriedigung. Daraus resultiert die Tendenz, immer wieder mit neuen Objekten Beziehungsmuster zu inszenieren, die Aussicht auf Wunscherfüllung und Triebbefriedigung bieten.
Freud hat sich besonders mit der Bedeutung der Bezugspersonen als Triebobjekte in der psychischen Realität des Kindes und mit den Folgen der skizzierten Beziehungskonflikte in Form von Verinnerlichung, Kompromiss- und Symptombildung beschäftigt. In der psychoanalytischen Theoriebildung nach Freud, in den psychoanalytischen Objektbeziehungstheorien, der Bindungsforschung und in der aktuellen Säuglingsforschung wird dagegen die Bedeutung der Qualität der realen Beziehung zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen für die psychische Entwicklung hervorgehoben (Balint, 1970; Winnicott, 1974; Bowlby, 1995; Dornes, 1999b). Danach geschieht der Aufbau der psychischen Struktur des Kindes über die Verinnerlichung wiederkehrender Beziehungserfahrungen. Indem sich das Kind mit den Interaktionserlebnissen, die zwischen ihm und den Bezugspersonen bestehen, identifiziert, bildet es psychische Repräsentanzen von sich selbst, den Objekten und den gemeinsamen Beziehungsmustern (Kernberg, 1997, 1999). Die so entstehende innere Welt der Objektbeziehungen beeinflusst das eigene Selbstbild und Selbstempfinden. Gleichzeitig wird sie zu einem Arbeitsmodell, das die Erwartung zukünftiger Beziehungserfahrungen steuert und so die Möglichkeiten und Grenzen eigenen Beziehungshandelns festlegt. Auf diese Weise wirken vergangene Objektbeziehungen in gegenwärtige Begegnungen hinein.
Lange Zeit wurde in der Psychoanalyse die dyadische Beziehung zwischen Mutter und Kind für die Entwicklung der inneren Welt des Kindes und seiner Fähigkeit, mit anderen in Beziehung zu treten, für überaus wichtig angesehen (Balint, 1970; Winnicott, 1974; Bowlby, 1995). Es ging dabei um die Qualitäten einer „hinreichend guten Mutter“ (Winnicott, 1974, S. 189), um ihre Fähigkeit, empathische Resonanz und Sicherheit zu bieten und narzisstische Anerkennung zu vermitteln. Wenn der Vater als dritte Person thematisiert wurde, dann trat er erst später als Motor der Triangulierung in Erscheinung: in der Funktion des Retters, der das Kind aus der verschlingenden Zweisamkeit mit seiner Mutter befreien muss (Schon, 2000, S. 732; Bauriedl, 1998, S. 129).
Inzwischen vertreten jedoch immer mehr Autoren die Ansicht, dass der Mensch in einen triadischen Beziehungsraum hineingeboren wird und sich Entwicklung in verschiedenen triangulären Beziehungskonstellationen abspielt (Heigl-Evers & Boothe, 1997, S. 124; Boothe & Heigl-Evers 1996, S. 140; Bürgin, 1998a, 1998b; Buchholz, 1993; Schon, 2000, S. 734; Bauriedl, 1998, S. 132). Vor der Geburt existiert das Kind zunächst in den Erwartungen und Phantasien der Eltern. Diese Einstellungen haben bereits Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des Kindes, wobei sich besonders die Fähigkeit der Eltern, triadische Beziehungen imaginieren und eingehen zu können, positiv auswirkt (von Klitzing, 2002; Bauriedl, 1998). Im Laufe der Entwicklung durchläuft das Kind verschiedene Positionen im triadischen Raum und unterhält jeweils unterschiedliche Beziehungen zu Vater und Mutter (Heigl-Evers & Boothe, 1997; Boothe & Heigl-Evers, 1996, S. 164 ff.). Die wechselnden Beziehungsstile und Beziehungssituationen in einer Triade, das Erleben von Unterschieden in der Kommunikation und im Umgang mit den Bedürfnissen des Kindes sind für die Entwicklung besonders anregend (von Klitzing, 2002). Das Vorherrschen ausgeprägter und andauernder dyadischer Beziehungen bei Ausschluss der dritten Person wird aus dieser Perspektive eher als ein pathologisches Phänomen angesehen (Heigl-Evers & Boothe, 1996; Schon, 2000, S. 734; Bauriedl, 1998, S. 137). Die Triangularität von Beziehungsstrukturen kann somit heute als zentraler Ausgangspunkt psychoanalytischen Denkens bezeichnet werden, von dem aus die „triebhafte und narzisstische Konflikthaftigkeit einer Person innerhalb des Gefüges ihrer Objektbeziehungen“ ermittelt werden kann (Heigl-Evers & Boothe, 1997, S. 136).
1.1.2 Die therapeutische Beziehung als Übertragungsbeziehung
In der Psychoanalyse wird davon ausgegangen, dass die in der frühen Kindheit verinnerlichten Objektbeziehungen, die daraus resultierenden Selbst- und Objektrepräsentanzen und die Art der Bewältigung der Triebkonflikte alle späteren neuen Beziehungen eines Menschen beeinflussen. In unterschiedlichem Ausmaß werden die alten Modi der Beziehungsgestaltung und die ihr zugrunde liegenden unbewussten Triebwünsche, Ängste und Erwartungen an das Verhalten eines Gegenübers jeweils wieder belebt und auf die neue Person übertragen. Die Psychoanalyse hat diesem Fortdauern vergangener Beziehungen in der Gegenwart schon immer besondere Bedeutung beigemessen und die therapeutische Beziehung zunächst vor allem als Übertragungsbeziehung betrachtet (Freud, 1905b, S. 279; 1917, S. 425). Die Beziehung zwischen Analytiker und Patienten sah man damit zunächst nicht so sehr als neue Beziehung, in der der Patient mit einer neuen Bezugsperson auf die Zukunft ausgerichtete, verändernde Erfahrungen machen kann. Vielmehr stand die Aktualisierung früherer Beziehungswünsche und -muster im Zentrum der Aufmerksamkeit (Boothe & Grimmer, 2005).
Nachdem Freud die Übertragung auf den Analytiker zuerst als störenden Widerstand angesehen hatte, der zum Abbruch von Therapien führen konnte, wie im Fall Dora (Freud, 1905b, S. 282), erklärte er die Entfaltung und Analyse der Übertragung später zum Kern der analytischen Arbeit (Freud, 1917, S. 434). Der Analytiker sollte die Beziehung nun so gestalten, dass sich die Übertragung des Patienten möglichst unbeeinflusst von seiner realen Person entfalten kann. Dafür soll er sich dem Patienten als Projektionsfläche für dessen innere Beziehungswelt anbieten. Je weniger der Patient dabei die reale Persönlichkeit des Analytikers und dessen emotionale Reaktionen erlebt, umso ungestörter kann sich die Übertragung als Neuauflage der Vergangenheit entfalten. Dies soll im liegenden Setting noch dadurch erleichtert werden, dass der Analytiker nicht im Blickfeld des Patienten sitzt. In der Regel allerdings erinnert sich der Patient nicht einfach an seine früheren Beziehungserfahrungen und -phantasien, sondern er wiederholt sie, indem er in der therapeutischen Situation unbewusst ähnliche Beziehungskonstellationen realisiert (Freud, 1914a).
Freud (1910, S. 126) erkannte, dass das Beziehungs- und Rollenangebot des Patienten den Analytiker dazu zu verführen droht, selbst affektiv zu reagieren und darauf unreflektiert zu antworten. Dadurch kann es zu einer bloßen Wiederholung früherer neurotischer Beziehungsformen kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Analytiker seine Gegenübertragung erkennen und bewältigen. Aus diesem Grund formulierte Freud (1919) seine Empfehlung für eine geeignete therapeutische Haltung: Der Analytiker soll seine Affekte wie ein Chirurg beiseite drängen und sich dem Patienten als Spiegel präsentieren, um einerseits die Übertragung anwachsen zu lassen und sie andererseits möglichst neutral und unbeeindruckt deuten zu können. In der Deutung der sich entfaltenden Übertragung und in ihrer Bewusstmachung sah er die eigentliche Aufgabe des Analytikers. Keinesfalls darf er die in der Übertragung an ihn gerichteten, triebhaften Wünsche erfüllen und die Bedürfnisse des Patienten befriedigen, denn dann bleibt es bei einer unbewussten Wiederholung der alten Beziehungsmodi. Deshalb formulierte Freud (1919, S. 187) für die therapeutische Beziehung die bekannte Regel: „Die analytische Kur soll, soweit wie es möglich ist, in der Entbehrung – Abstinenz – durchgeführt werden.“
Die Rezeption dieser behandlungstechnischen Regeln führte in der Nachfolge Freuds zum Ideal eines möglichst anonymen, neutralen und emotionslos handelnden Analytikers. Bei der Gestaltung der therapeutischen Beziehung wurde der emotionale Kontakt im Hier und Jetzt der Begegnung teilweise auf ein Minimum reduziert. Die gesamte Beziehungsgestaltung war am Ziel der Übertragungsbildung und -deutung ausgerichtet.
Es gab im Denken Freuds aber auch eine gegenläufige Tendenz, die im Widerspruch zum Ideal der spiegelnden Abstinenz und der chirurgischen Emotionslosigkeit steht. Dies gilt wohl besonders für seine eigene therapeutische Praxis, in der er sehr persönlich mit seinen Patienten in Beziehung trat (Cremerius, 1981). Aber auch in seinem Werk finden sich Äußerungen, die auf eine andere Form der Beziehungsgestaltung hindeuten. Schon die Aufgabe der Hypnose und die Entwicklung des psychoanalytischen Verfahrens begründete Freud (1925, S. 52) rückblickend damit, dass „die persönliche affektive Beziehung doch mächtiger war als alle kathartische Arbeit“. In den Studien über Hysterie (1895, S. 285) heißt es, dass der Arzt durch seine Teilnahme und Achtung hilft, dem „Kranken menschlich etwas leistet“ und ihm Sympathie entgegenbringt. Später sprach Freud davon, dass der Patient sich vertrauensvoll an den Arzt binden soll, und erklärte diese Bindung zur eigentlichen Kraft der Therapie (Freud, 1917, S. 463). Allerdings thematisierte er Vertrauensbildung als Aufgabe des Therapeuten nicht weiter. Vielmehr sah Freud sie ebenfalls als Ausdruck einer Übertragungsbeziehung, nämlich der milden, positiven Übertragung. Sie galt Freud als eine notwendige Voraussetzung, um als Analytiker überhaupt zu einer bedeutungsvollen Bezugsperson für den Patienten werden und Einfluss auf ihn ausüben zu können. Die Bezeichnung der Bindung an den Arzt als Übertragung macht deutlich, dass es sich hierbei um etwas handelt, was im Verständnis Freuds vom Patienten „mitgebracht“ werden muss. Daraus folgt aber, dass sich die Frage, was der Therapeut selbst zur Vertrauensbildung beiträgt und wie er den Patienten an sich bindet, gar nicht stellte. Auf diese Weise wurde es möglich, das Ideal einer emotionslosen, spiegelnden Abstinenz aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung zu betonen.
1.1.3 Das Arbeitsbündnis und die Realbeziehung
Seit den 40er und 50er Jahren wird zunehmend die Meinung vertreten, dass eine wirkungsvolle therapeutische Beziehung nicht nur auf Übertragung beruht. In der Begegnung zwischen Therapeut und Patient muss auch etwas Neues stattfinden, jenseits von Übertragungsprozessen (Gelso & Hayes, 1998). Den Ausgangspunkt bildete Sterbas (1934) Theorie der therapeutischen Ich-Spaltung. Er unterschied zwischen einem beobachtenden, reflektierenden und einem unmittelbar erlebenden Ich-Anteil, und erklärte die Fähigkeit des Patienten zur Ich-Spaltung zur Bedingung einer psychoanalytischen Behandlung. Diese Theorie bildet den Vorläufer für die späteren Konzepte der therapeutischen Allianz (Zettel, 1956) und vor allem des Arbeitsbündnisses (Greenson, 2000/1967). Greenson (2000, S. 202) konzipiert das Arbeitsbündnis als notwendige Ergänzung zur Übertragungsbeziehung: „Damit der Patient in die analytische Situation eintreten und in ihr effektiv arbeiten kann, ist es unerlässlich, dass er außer seinen Übertragungsreaktionen noch eine andere Beziehung zum Psychoanalytiker herstellt. Ich spreche hier vom Arbeitsbündnis“.
Das Arbeitsbündnis definiert er als „die relativ unneurotische, rationale Beziehung zwischen dem Patienten und dem Analytiker, die es dem Patienten ermöglicht, in der analytischen Situation zielstrebig zu arbeiten“ (Greenson, 2000, S. 59). Als Ergänzung zur Übertragungsbeziehung, die die Wiederkehr der Vergangenheit in der Gegenwart der therapeutischen Beziehung beschreibt, bezeichnet das Arbeitsbündnis die in der Gegenwart neu eingegangene Beziehung mit dem Ziel der Entwicklung und Veränderung auf die Zukunft hin. Zum Arbeitsbündnis tragen nach Greenson (2000) der Patient, der Analytiker und die analytische Situation bei. Von Seiten des Patienten sind es vor allem seine Motivation, sein Wunsch nach Besserung und seine eigene Hilflosigkeit, aber auch die bewusste Entscheidung, mit dem Analytiker zusammenzuarbeiten. Der Analytiker fördert das Arbeitsbündnis vor allem durch sein Verständnis und seine auf Einsicht zielende Einstellung, aber auch durch seine mitfühlende, aufrichtige und nicht wertende menschliche Haltung. Schließlich erleichtert das analytische Milieu, besonders die Häufigkeit der Sitzungen und die lange Dauer der Beziehung, die Bündnisbildung (Greenson, 2000, S. 60, 224).
Greenson (2000, S. 222) verbindet die Einführung des Arbeitsbündnisses mit einer Kritik an den behandlungstechnischen Empfehlungen Freuds. Besonders die Abstinenzregel führte dazu, dass viele Psychoanalytiker gegenüber ihren Patienten eine „strenge, distanzierte und sogar autoritäre Haltung“ einnahmen. Eine solche Haltung ist der Entwicklung eines Arbeitsbündnisses abträglich.
Das Arbeitsbündnis wurde in Abgrenzung zur Übertragungsbeziehung konzipiert und sollte die nichtneurotischen Aspekte der auf Veränderung angelegten Zusammenarbeit von Analytiker und Patient erfassen. Die Voraussetzung für die Bildung eines Arbeitsbündnisses sieht Greenson (2000) in der Fähigkeit des Patienten zur therapeutischen Ich-Spaltung, dessen Realisierung aber gilt als gemeinsame Aufgabe von Therapeut und Patient. Auch wenn schon von Greenson (2000, S. 224) selbst und bis heute diskutiert wird, inwieweit auch das Arbeitsbündnis infantile neurotische Anteile enthält und damit auch wieder Übertragungscharakter besitzt (Boothe, 1999; Gelso & Hayes, 1998, S. 23), so bekommt damit die auf Veränderung ausgerichtete Zusammenarbeit von Analytiker und Patient und die Frage, was der Therapeut zur Bündnisbildung und zur Beziehungsgestaltung beiträgt, ein größeres Gewicht. Außerdem wird die analytische Haltung, die bisher die bestmöglichen Bedingungen zur Übertragungsentfaltung schaffen sollte, hinterfragt und betont, dass sich die Beziehungsgestaltung des Analytikers auch daran orientieren muss, die Zusammenarbeit zu stärken und den Patienten für die Analyse zu motivieren.
Neben der Übertragung und dem Arbeitsbündnis hat ebenfalls Greenson (2000) in den 60er Jahren noch auf eine dritte Ebene der therapeutischen Beziehung hingewiesen: die reale Beziehung zwischen Analytiker und Patient. Die Idee, dass neben der Übertragungsbeziehung auch eine reale Beziehungsebene entsteht, ist bereits bei Freud (1937, S. 65–66) angelegt. In „Die endliche und die unendliche Analyse“ heißt es: „Und außerdem sei nicht jede gute Beziehung zwischen Analytiker und Analysiertem, während und nach der Analyse, als Übertragung einzuschätzen. Es gebe auch freundschaftliche Beziehungen, die real begründet sind und sich als lebensfähig erweisen.“ Der Patient geht auch eine reale neue Beziehung mit seinem Therapeuten ein, die sich auf realistische Wahrnehmungen und Einschätzungen gründet. Greenson (2000, S. 229) grenzt die reale Beziehung von der Übertragungsbeziehung und dem Arbeitsbündnis folgendermaßen ab: Während die Übertragung echt ist, aber unrealistisch, werden die realen Beziehungsaspekte als echt wahrgenommen und sind realistisch. Das Arbeitsbündnis schließlich ist zwar auch realistisch und echt, aber ein Kunstprodukt der analytischen Situation. Die Abgrenzung von Arbeitsbündnis und Realbeziehung bleibt unklar und ist letztlich nicht trennungsscharf. Am ehesten kann man sagen, das Arbeitsbündnis repräsentiert überwiegend einen spezifischen Teil der realen Beziehung zwischen Analytiker und Patient.
Das Konzept des Arbeitsbündnisses und die Anerkennung einer realen, neuen Beziehung zwischen Therapeut und Patient, die beide jedenfalls weitgehend unabhängig von der Übertragungsbeziehung situiert sind, haben eine Entwicklung eingeleitet, die dazu führte, dass heute das reale Beziehungsgeschehen zwischen Analytiker und Patient im Hier und Jetzt der therapeutischen Situation als Kern des Veränderungsprozesses angesehen wird.
Die Möglichkeit, im Analytiker einen dauerhaften und verlässlichen Partner zu finden, der sich von den neurotischen Übertragungserwartungen unterscheidet, und mit ihm neue und unerwartete Erfahrungen zu machen, wird nun schon seit längerem für ein besonders wirksames Moment psychoanalytischer Therapie gehalten. Es waren zunächst die Objektbeziehungstheoretiker der 60er und 70er Jahre, die dem Konzept Heilung durch Einsicht das Veränderungsmodell Heilung durch neue Beziehungserfahrungen entgegensetzten (Balint, 1970; Winnicott, 1974). Inzwischen begreift man Deutung und neue Beziehungserfahrungen meistens als wechselseitig aufeinander bezogen (Mertens, 1993b; Treurniet, 1996; Tress, 1990; Thomä & Kächele, 1996a; Bettighofer, 1998).





























