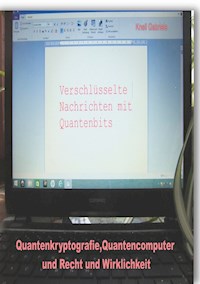
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Was ist und wie funktioniert Quantenkryptografie als eine neue abhörsichere Verschlüsselung? Was unterscheidet einen Quantencomputer von heutigen Computern? In welchen Bereichen kann man die Quantenkryptografie und den Quantencomputer anwenden und nutzen? Welche Auswirkungen haben diese Quantentechnologien auf unsere Gesellschaft, auf unser Leben, und auf Gesetze wie den Datenschutz? Auf all diese Fragen gebe ich Antworten in diesem Buch mit vielen Erklärungen und Aussagen von zahlreichen Quantenphysikern und Quantenphysikerinnen. Außerdem berichte ich auch von den neuesten Experimenten, und ich beleuchte auch philosophische Aspekte in Verbindung mit Quantenphysik und (Rechts)philosophie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Wie alles begann
Der Anfang vor vielen Jahren
Rechtsphilosophische Grundlagen und die Unterschiede zwischen Rechtswissenschaften und Naturwissenschaften
TEIL I
Überblick und Einleitung
TEIL II
Nähere Ausführungen zu den rechtswissenschaftlichen Ansätzen
Quantenkryptografie und Quantencomputer in Verbindung mit dem Datenschutz und der Datensicherheit
Europäische und nationale Datenschutzregelungen und Informationssicherheitsnormen…
Quantenkryptografie und Datenschutz
Zukunftsszenarien
TEIL III
Geschichte der Quantenkryptografie
TEIL IV
Quantenphysik, Philosophie und Feminismus
Feministische wissenschaftliche Aspekte
Physiker zu Objektivität
Objektivität in den Naturwissenschaften
Objektivität, Wirklichkeit, Recht und Quantenphysik
TEIL V
Die Zukunft
Zukunftsszenarien Fortsetzung
Neue Rechtsfragen
Rechtsphilosophische Überlegungen
Die Sprache
Zusammenfassung
TEIL VI
Quantencomputer
TEIL VII
Schluss
Das digitale Zeitalter
Supraleitung und Recht
Offene Fragen
WIE ALLES BEGONNEN HAT
Begonnen hat die Arbeit an diesem Buch nicht mit der Idee, ein Buch zu schreiben, sondern mit meinem Interesse an Quantenphysik und dem Ziel eine inhaltliche Verbindung zwischen Jus und Quantenphysik zu finden, die zu mindestens ich als lohnend erachte, sie zu vertiefen. Der erste Weg, um mich diesem Ziel zu nähern, war der Gang an die Universität zu vielen Physikvorlesungen, Seminaren und Fachvorträge über Quantenphysik bei Konferenzen, Symposien und Workshops an der Universität.
In Laufe dieser Beschäftigung und nach vielen Gesprächen mit Physikprofessoren und Studierenden und persönlichen Recherchen bin ich auf die Quantentechnologien gestoßen, kurz zusammengefasst geht es dabei um die praktischen Anwendungen von Quantenphysik. Jene Zeit an der Universität habe ich als sehr inspirierend in Erinnerung, als eine Zeit des intensiven Austausches mit anderen. Wichtig ist noch, um den Text besser zu verstehen, dass ich das Angebot des Leiters des Instituts für Technikfolgenabschätzung (TA Institut) an der österreichischen Akademie der Wissenschaften angenommen habe, ein Konzept zu entwickeln für ein wissenschaftliches Forschungsprojekt über mögliche Folgen von möglichen Anwendungen von Quantentechnologien. Der erste Teil, in dem ich mich näher auseinandersetze mit dem Datenschutz und Quantenkryptografie, wurde noch geschrieben in Hinblick auf eine rein wissenschaftliche Arbeit und Herangehensweise. Da aber das Thema Quantentechnologien und ihre Auswirkungen trotz des Interesses des Leiters des TA Instituts an meinem Konzept er dieses Projekt auf spätere Zeiten verschieben wollte, und ich das nicht wollte, habe ich die Arbeit letztendlich alleine verfasst, und ich habe entschieden, mich von einem reinen wissenschaftlichen Ansatz zu verabschieden, und der Freiheit und der Kreativität meiner Gedanken des Vorzug zu geben.
Als Juristin sind mir v.a. die Quantenkryptografie, also die quantenphysikalische Verschlüsselung und der Quantencomputer ins Auge gestochen, weil ich die Verbindung zu Jus und Quantenphysik im Datenschutz gesehen habe, und nun einen Einstieg entdeckt habe, um mich dieser Verbindung näher zu widmen.
Allerdings gibt es noch zahlreiche andere Rechtsgebiete, auch EU-Regelungen, die sich dafür eignen. Es wurde mit den Jahren also eine spannende Entdeckungsreise auf der Suche nach den gesellschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen von den beiden genannten Quantentechnologien.
DER ANFANG VOR VIELEN JAHREN
Zunächst ist die Schwierigkeit aufgetreten, dass ich mir überlegen musste, welche möglichen Folgen die von mir ausgewählten Quantentechnologien haben könnten. Und während dieses Prozesses habe ich mir gedacht, im Grunde müssten diese Aufgabe eigentlich Quantenphysiker und Quantenphysikerinnen übernehmen, da sie mitten in der Materie stehen, und einen ganz anderen Zugang haben wie ich als Juristin, die sich intensiv mit Quantenphysik beschäftigt hat. Ich fühlte mich ganz eindeutig als Außenstehende. Allerdings wurden diese Bedenken durch das Gespräch mit einem Quantenphysiker an der Universität Wien etwas abgeschwächt, da er kein Problem gesehen hat, dass ich als Juristin meinen Fokus durch die Auseinandersetzung mit Quantenphysik auch auf die gesellschaftlichen Folgen der praktischen Anwendungen von Quantenphysik gelegt habe.
Dennoch habe ich natürlich auf die Einschätzung von (möglichen) Folgen von quantenphysikalischen Anwendungen wie Quantenkryptografie und Quantencomputer auf die Einschätzung von ExpertInnen zurückgreifen müssen. Also schließt sich der Kreis wieder, und die Zusammenarbeit und der Austausch mit Quantenphysiker und Quantenphysikerinnen ist unverzichtbar.
RECHTSPHILOSOPHISCHE GRUNDLAGEN, UND UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN NATURWISSENSCHAFT UND RECHTSWISSENSCHAFTEN
Doch bevor ich meine Inhalte präsentiere, ist es als Einstieg in die Verbindung von Recht und der Naturwissenschaft Physik interessant den Autor meines Skriptums über die Einführung in die Rechtswissenschaften im 3.Teil der Rechtsphilosophie zu Wort kommen zu lassen. Dieses Skriptum gibt es in dieser Form nicht mehr, da längst eine andere Professorin prüft. Aber ich habe es in den fast 3 Jahrzehnten nach dem Beginn meines Jus Studiums noch aufbewahrt, die Inhalte in den neuesten Skripten über die Einführung in die Rechtsphilosophie sind weitgehend gleichgeblieben.
Zunächst beginnt der Autor auf Seite →, also ziemlich am Anfang unter Punkt aa Rechtsgesetze und Naturgesetz die Unterscheidung dieser beiden Arten von Gesetzen zu beschreiben:" Naturgesetze suchen die Welt des Seienden in ihrer Ordnung zu erfassen. Wir denken uns dabei die Natur als von Gesetzen bestimmt, die schlechthin gelten, unabhängig von unserem Dazutun bestehen und von uns bloß mehr oder weniger deutlich erkannt werden. Im Gegensatz dazu handelt es sich beim Recht um Sollens Normen, die die Anforderung enthalten, menschliches Verhalten in der Gesellschaft zu ordnen. Sie haben zum Ausgangspunkt den menschlichen Willen, wenden sich an den Menschen als verantwortliche Person mit dem Anspruch von ihm beachtet zu werden und nehmen eine Zurechnung von Handlung und Rechtsfolgen vor."
Auf Seite → des rechtsphilosophischen Teils schreibt der Autor über das Naturrecht unter Punkt a mit der Überschrift:" Der teleologische Naturbegriff des griechisch-römischen bzw. des christlich-mittelalterlichen Naturrechtsdenkens. In diesen Denktraditionen bestehen trotz gewichtiger Unterschiede im Hinblick auf den Naturbegriff des Naturrechts sehr wesentliche Gemeinsamkeiten: Natur gilt ihnen-im Unterschied zu unserem, von den Naturwissenschaften entscheidend geprägten Naturverständnis-als Inbegriff einer hierarchisch gestuften, von den Zwecken bewegten Ordnung, die, so die mittelalterliche Vorstellung, von Gott geschaffen und durch ihn vernünftig gegliedert wurde. In dieser vorgegebenen Ordnung der Schöpfung ist jedem Seienden gemäß seinem Wesen, der ihm zukommende Platz zugewiesen. Jedes Seiende ist dazu bestimmt, seine spezifische Vollkommenheit, dh. sein vorbestimmtes Wesen zu verwirklichen. Man spricht daher von einem teleologischen Naturbegriff (Telos= Ziel), weil es sich um das Konzept einer auf ursprüngliche Weise zielgerichteten Ordnung der Wirklichkeit handelt. Auch der Mensch ist Teil dieser zweckgerichteten Ordnung der Natur(...) Auch die grundlegenden Prinzipien des Rechts sind in dieser Ordnung der Natur zweckhaft vorgegeben. Aufgabe der Menschen ist es, diese Naturrechtsprinzipien zu erkennen und sie durch positive Rechtssetzung in Hinblick auf die konkreten Erfordernisse des Rechtslebens näher zu bestimmen.
Unter Punkt b mit der Überschrift:“ Das rationalistische Naturrecht der Neuzeit als Vernunftrecht“ leitet nun über zu dem Einfluss der modernen Naturwissenschaften auf das Naturrechtsdenken bzw. der inhaltlichen Ausgestaltung dieses Naturrechtsdenkens, das sich dadurch radikal und fundamental änderte. Der Autor erläutert: " Im Zuge der neuzeitlichen Entwicklung geriet das teleologische Naturrechtsdenken in eine Krise. Es war fortan nicht mehr möglich, das Recht auf Wesenselemente einer teleologisch verstandenen Naturordnung zu gründen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Neben politischgesellschaftlichen Faktoren (Abbau der religiös-politischen Einheitswelt des Mittelalters, Reformation, konfessionelle Bürgerkriege uam) kommt es auch zur Entfaltung eines geänderten Naturverständnisses, das sehr entscheidend durch die neuzeitlichen Naturwissenschaften geprägt wurde. In den neuzeitlichen Naturwissenschaften wird Natur nicht mehr als teleologisch vorstrukturierte Ordnung, sondern als wertfreier, mathematisch beschreibbarer Kausalzusammenhang bewegter Materie gedeutet. Sie wird also verstandenen als Inbegriff von Gegenständen, die empirisch erfahren, nach Maß, Zahl, Gewicht analysiert und im Zeichen technischen Verfügungswissens mechanisch getrennt bzw. verbunden werden können. Für das Rechtsdenken hat dies wichtige Konsequenzen. Es folgt nämlich daraus, daß aus diesem Naturverständnis keine vorgegebenen Rechtszwecke abgeleitet werden können. Aus dem Faktum naturgesetzlicher Abläufe läßt sich kein rechtliches Sollen ableiten." Der neue Bezugspunkt wurde nun der Mensch in seiner Eigenschaft als freies, vernünftiges Individuum.
An diesen beschriebenen Entwicklungen und Einflüssen wird deutlich, dass wissenschaftliche Veränderungen eine sehr große Wirkung auf andere gesellschaftliche Bereiche haben können. In diesem Fall wirkt die moderne Naturwissenschaft direkt in das Naturrechtsdenken hinein, abgesehen von den grundsätzlichen Veränderungen der modernen Naturwissenschaften, die ein industrialisiertes und besonders ein immer stärker hochtechnisiertes, gesellschaftliches Leben gebracht haben.
Der Schnittpunkt von Recht und Physik ist jedoch eher auf der Ebene von gesellschaftlichen Folgen der Anwendung neuer Technologien wie der Quantenkryptografie oder dem Quantencomputer zu sehen, und nicht so sehr in rein inhaltlichen Ansätzen von wissenschaftlichen Grundsätzen oder Weltbildern.
Doch ich möchte auf jeden Fall in diesem Buch gegen die doch von vielen PhysikerInnen in zahlreichen Gesprächen und Kontakten bewertete große Distanz von Recht und Physik als Wissenschaften, die da keinerlei inhaltliche gemeinsame wissenschaftliche Fragen und wissenschaftliche Zusammenarbeit scheinbar sehen, antreten. Ich meine hingegen der Blickwinkel müsste ein anderer sein, es müssten die möglichen Folgen möglicher Anwendungen immer auch im Fokus der forschenden PhysikerInnen stehen und dadurch ergibt sich automatisch die Verbindung zum Recht und den Gesetzen.
Für viele ForscherInnen, auch für PhysikerInnen ist die Freiheit der Forschung ein ganz wichtiges Element der Forschung, doch gerade auch diese Forschungsfreiheit ist geregelt in dem internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte in Artikel 15 Ziffer 3, der besagt, dass die Vertragsstaaten sich verpflichten, „die zu wissenschaftlicher Forschung und schöpferischer Tätigkeit unerläßliche Freiheit zu achten“. Hiermit verhilft das Recht der Forschung zu ihrer notwendigen Freiheit, auf die sich im Prinzip jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin berufen kann.
Hinzufügen muss man an dieser Stelle, dass in den Rechtswissenschaften unterschieden wird zwischen positiven Recht und dem Naturrecht, während ersteres nicht nach Kriterien von Sitte oder Gerechtigkeit bestimmt, sondern ausschließlich aufgrund der Art der Rechtssetzung, basiert das Naturrecht im Gegensatz dazu eben gerade auf sittlichen Grundsätzen allgemein verbindlicher Gerechtigkeit, d.h. der Inhalt der Normen ist die entscheidende Anforderung an das Recht. Im positiven Recht zählt wie Recht gebildet wird, unter anderem wesentlich durch Gesetze. Die Effektivität des Rechts und der Rechtsetzungsprozess sind relevant als Anforderungen an das Recht, auch wird es durch Zwang durchgesetzt. Auf Seite → des rechtsphilosophischen Skriptums schreibt der Autor, dass" das Zwangsmoment am Recht darf aber nicht überbetont werden. Im Vordergrund steht ohne Zweifel das Ziel, die Normadressaten zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen, das primär auf Grund freiwilliger Befolgung und nicht aus Furcht vor der Sanktion geleistet wird. Zwang ist im Recht kein Selbstzweck, sondern bloß Mittel zum Zweck."
Wichtig an dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass das Naturrecht in der Gegenwart v.a. als Inhalt und zum Thema die Menschenrechte hat, und in dieser Hinsicht kritisch zum positiven Recht steht. Man könnte auch schlussfolgern, dass sowohl das positive Recht als auch das Naturrecht seinen berechtigten Platz haben, und diesen auch erstrittenen haben durch ihre verschiedenen VertreterInnen in Laufe der Geschichte der Rechtswissenschaften.
In den Rechtswissenschaften sind zudem, und darauf werde ich an einer späteren Stelle in dieser Arbeit noch genauer eingehen, die Thematik und die Unterscheidung zwischen dem Sollen, also den Rechtsvorschriften und Rechtsnormen für menschliches Verhalten, und dem Sein, den tatsächlichen Lebensverhältnissen und Lebensrealitäten von Menschen, viel diskutiert.
Wobei es umstritten ist, worin die Berechtigung für das Sollen, also die Rechtsnorm, die das menschliche Verhalten regelt, liegt.
Während die Naturrechtslehre einen anderen Ansatz verfolgt, wie die Vernunft des Menschen als Maßstab für Rechtsnormen, sieht das positive Recht nach Kelsen den Ausgangspunkt für das Sollen in einer Grundnorm, auf die der gesamte Rechtsetzungsprozess gegründet wird. Letztendlich muss man aber feststellen aus einer praktischen Sicht, dass ein reines Sollen selbst mit Sanktionen für sich noch keine Rechtsnorm darstellt, denn auch in der Medizin werden ständig Verhaltensregeln aufgestellt, wie Menschen sich verhalten sollen, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Wir kennen alle die deutlichen Hinweise von MedizinerInnen und ErnährungsexpertInnen, was wir essen sollten, damit wir unserer Gesundheit nicht schaden. Am Beispiel des Rauchens kann man nachvollziehen, wie eine Rechtsnorm oder ein Gesetz entstehen kann.
Rauchen gilt auch als sehr ungesund, aber es gibt kein generelles Rauchverbot, sondern nur einzelne Gesetze, die genau vorschreiben, wann und wo Rauchen verboten ist, z.B. in öffentlichen Einrichtungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, etc. Manche fühlen sich dadurch zwar bevormundet, befolgt werden diese Gesetze dennoch. Meines Erachtens ist das entscheidende Kriterium, nicht das Sollen für die Rechtsordnung, sondern, dass diese durch ein Gesetz geregelt wird. Zunächst kommt eine Regierungsvorlage ins Parlament, und dort entscheiden die Parteien, ob diese Regierungsvorlage für ein einfaches Gesetz oder ein Verfassungsgesetz die jeweils nötige Mehrheit bekommt. Letztendlich also liegt es bei der Einigung von politischen Parteien, die in den Nationalrat gewählt wurden, welches Verhalten von Menschen wie geregelt werden soll in Form von Gesetzen. Und genau diese Form ist wesentlich, dass ein Sollen auch als Rechtsvorschrift gilt, und beachtet wird. Denn ein Sollen, dass nicht im Gesetz steht, oder nicht in die Form des Gesetzes gegossen wird, ist keine Rechtsnorm. Meine Interpretation spricht also sehr für das positive Recht, da der Akt der Rechtssetzung mir als fundamental erscheint für dieses Sollen, das rechtliche Sollen.
Doch auch das Naturrecht kommt in unserem Rechtssystem zur Geltung, denn wenn Gesetze verabschiedet werden im Parlament, deren Inhalt von der Opposition, von NGOs oder anderen Menschen als gleichheitswidrig eingestuft werden, also als inhaltliche Verstöße gegen Menschenrechte bewertet werden, die bei uns in der Verfassung stehen, gibt es die Möglichkeit das Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Das geschieht auch manchmal, auch mit Erfolg.
Diese strenge begriffliche Unterscheidung zwischen Sollen und Sein, kann realistischer Weise nicht durchgehalten werden, da dieses Sollen immer auch auf das Sein bezogen ist, oder sich aus diesem sogar herleitet, seinen Ursprung dort hat. Geregelt wird in einer Rechtsordnung also das, was sein sollte, oder noch genauer was idealerweise sein sollte. Das Gesetz spiegelt auch gesellschaftliche Idealvorstellungen ab, wie Menschen sich ein friedliches, harmonisches Zusammenleben von Menschen vorstellen, ohne dass es
Unterdrückung, Ausbeutung, Benachteiligung oder Gewalt an anderen gibt.
Die entscheidende Unterscheidung zwischen den Naturwissenschaften und den Rechtswissenschaften wird in dem 1. Teil meines Skriptums zur Einführung in die Rechtswissenschaften genau in dieser Diskrepanz zwischen Sein und Sollen gesehen. Während die Rechtswissenschaften als Gegenstand das Sollen haben, sieht der Autor dieses Teils des Skriptums das Sein als das zentrale Charakteristikum der Naturwissenschaft, diese erforscht nicht, was sein soll, sondern, was wirklich, tatsächlich ist, wie Naturvorgänge ablaufen. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, und sollte auch kontrovers diskutiert werden.
Denn, was wirklich ist, auch das ist, gerade wie uns die Quantenphysik zeigt, eigentlich gar nicht so eindeutig, und durchaus auch rätselhaft, so klar kann man also das Sein gar nicht erfassen. Das sollte auch zu denken geben.
Dieser kurz umrissene Einblick in grundlegende rechtsphilosophische Themen, soll überleiten in meine nun kommenden inhaltlichen Ausführungen.
TEIL I ÜBERBLICK und EINLEITUNG
Um die Tragweite und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Quantentechnologien näher zu beleuchten, ist es erforderlich zunächst die Wurzeln der Entstehung dieser Technologien anzuführen: Die bisherigen Erkenntnisse der Quantenphysik, die ihren Ausgangspunkt am Beginn des 20.Jahrhunderts um 1900 durch Max Planck nahmen, der auch den Begriff des Quants einführte, unterscheiden sich fundamental von den Naturgesetzen der klassischen Physik, die wir in unserer Alltagsrealität direkt wahrnehmen und beobachten können und auch alle technischen “Errungenschaften”, die auf den Gesetzen der Mechanik, Thermodynamik und Elektrodynamik basieren, wurden durch die Anwendungen der klassischen Physik entwickelt.
Am Ende des 19. Jahrhunderts waren die Physiker überzeugt mit Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik und Optik alle Naturvorgänge beschreiben zu können. Doch es gab noch ein Phänomen, das nicht durch die bekannten vorhin genannten Naturgesetze beschreibbar war, und das war die Energie bzw. das Strahlungsspektrum, das schwarze(heiße) Körper abstrahlen. Und gerade die Lösung führte zu einer Revolution in der Physik. Max Planck entdeckte, dass Energie nur mit bestimmten nicht mehr teilbaren Paketen emittiert wird, er nannte sie Quanten. Max Planck änderte eine „Kleinigkeit“ an einer Formel, am Wienschen Strahlungsgesetz, und damit konnte man das beobachtete Phänomen beschreiben, auch wenn zunächst weder er noch andere Physiker sich diese Änderung erklären konnten. Bis heute bezeichnen Physiker die Quantenphysik als ein Rätsel, weil die Experimente an den quantenphysikalischen Phänomenen noch eine Reihe weiterer neuartiger und ungewöhnlicher Erkenntnisse lieferten, z. B.: den Dualismus von Teilchen und Welle, ein Quantenzustand kann als Teilchen oder als Welle auftreten je nach Art des Experiments bzw. der Beobachtung, aber es soll auch schon möglich sein, Teilchen und Welle in einem Experiment sichtbar zu machen.
Der Vorstoß der physikalischen Forschung in immer kleinere Welten, die unserer menschlichen Sinneswahrnehmung nicht mehr zugänglich sind, und wo nur noch sogenannte Quantenzustände existieren, die durch Zufall, Wahrscheinlichkeiten, Unbestimmtheit und der Überlagerung von Möglichkeiten charakterisiert sind, führte letztendlich durch jahrzehntelanges Experimentieren, das zunächst philosophisch motiviert war, zu der Entwicklung neuer und zukünftiger Technologien. Man kann sie als Quantentechnologien bezeichnen, weil sie auf der Umsetzung und auf dem Ziel der Umsetzung der Theorien der Quantenphysik in praktische, technische Anwendungen beruhen.
Transistoren, Laser, Kernspintomografie, Supraleitung und Halbleiter sind Technologien, die auf Grundlage der Quantenphysik entwickelt wurden, und die bereits in verschiedenen Anwendungsbereichen von Medizin, Militär, Industrie, Mikroelektronik (z. B.: Mobiltelefon, TV, Autos, DVDs, Computer etc.) Forschung, Kunst und alternative Energieversorgung (Solarenergie) genutzt werden, die aber noch Potenzial zu weiteren Anwendungen bzw. zur Weiterentwicklung haben. Quantencomputer, Quantenkryptografie und Quantenteleportation hingegen - die auch unter dem Begriff Quanteninformation oder Quantenkommunikation zusammengefasst werden - sind Technologien, die erst im Entstehen sind.
Ich habe nun einige Fragen entwickelt, die ich im Laufe der Arbeit auch versuche zu beantworten:
Welche dieser Quantentechnologien könnten bei neuen, zukünftigen Anwendungen in bestimmten gesellschaftlichen Lebensbereichen bedeutende Veränderungen bewirken?
1.Beispielsweise könnte Supraleitung in der verlustfreien bzw. widerstandsfreien Stromleitung oder der Stromspeicherung eingesetzt werden. Sind diese genannten zukünftigen technischen Möglichkeiten dazu geeignet, das Verbraucherinnern und Verbraucher Energie effizienter und energiesparender nutzen können und könnte ein größerer Energiebedarf damit gedeckt werden?
2. Die Quantenkryptografie verspricht ein abhörsicheres System: Man kann kein Quantensystem abhören, ohne es zu beeinflussen, ohne es zu stören, zufolge der Theorie können dadurch Abhörversuche nicht unentdeckt bleiben. Jene Verschlüsselungssysteme, die bisher entwickelt wurden - und die noch keinem breiten Markt zur Verfügung stehen, häufig wird die Software von Forscherinnen und Forschern verwendet - wurden aber von einigen Forschungsteams auf ihre Sicherheit getestet, mit einem negativen Ergebnis. Das bedeutet, es ist möglich das System abzuhören, ohne dass es auffällt.
Aufgrund dieser unerwarteten Entwicklung versuchen die Forscherinnen und Forscher die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis aufzuheben, in dem sie ihre Methoden und Systeme verbessern. Sie sind weiterhin überzeugt, dass die Theorie der Abhörsicherheit verwirklichbar ist. Dies war die Situation nach meinen Recherchen noch im Jahr 2012. Doch laut dem Quantenphysiker Harald Weinfurter wurden diese erfolgreichen Abhörversuche bis heute durch verbesserte Geräte der Quantenkryptografie beendet, d.h. die verbesserten Geräte sind doch abhörsicher, stellt er fest. Es liegt also an den Geräten, d.h. der Umsetzung der Theorie in die Praxis. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich aber auch genauer beschreiben, dass es durchaus auch an dem Forschungsansatz in der Quantenkryptografie liegt, wie abhörsicher diese ist. Ob beispielsweise mit einzelnen Photonen oder mit verschränkten Photonen geforscht wird.
Die Firma IdQuantique.com ist eine Spin-off Firma, der seit Langem und auch derzeit sicher besten Gruppe an der Universität Genf. Sie vertreibt seit Langem Geräte mit Quantenkryptografie.
Anton Zeilinger erklärt: Allerdings entfällt ein wichtiges Sicherheitsproblem existierender Methoden: Aufgrund der Möglichkeiten der Quantenphysik kann der Schlüssel an beiden Orten gleichzeitig erzeugt werden, dieser muss nicht von einem Ort zum anderen transportiert werden.
2a) Sollte es tatsächlich gelingen, ein abhörsicheres System zu entwickeln, was laut Aussagen der Experten auf dem Gebiet der Quantenkryptografie bereits gelungen ist, würde dieses die gegenwärtigen Probleme mit der nicht möglichen völligen sicheren Übertragung von Daten lösen können?
Und was würde eine solche mögliche Entwicklung für das Datenschutzgesetz bedeutet?
3. Da die Tendenz zur Miniaturisierung in der Elektronik weitergeht - davon gehen viele ForscherInnen aus - wird irgendwann die kleinste Ebene erreicht sein, und Information nur noch durch Quanten (wo also auch die Wellennatur des Elektrons eine Rolle spielt) übertragen werden kann.
Dann würde die Stunde des Quantencomputers schlagen.
Auf der theoretischen Ebene - quantenphysikalisch und mathematisch - ist der Bau von Quantencomputern verwirklichbar. Gegenstand der Forschung sind also hauptsächlich die technische Umsetzung, die bisher erst mit kleinen Kapazitäten gelungen ist.
Beim klassischen Computer arbeitet man mit Bits für die Kommunikation und Übertragung von Information, hingegen beim Quantencomputer mit Quantenbits und während das klassische Bit nur den Wert 1 ODER 0 annehmen kann, kann das Quantenbit den Wert 0 UND 1 annehmen, und existiert in einer Überlagerung von 0 und 1, was ganz andere Möglichkeiten der Informationsübertragung eröffnet.
Theoretisch wird also von einem Quantencomputer viel erwartet. Heutige kommerziell genutzten Verschlüsselungssysteme beruhen auf der Schwierigkeit der Zerlegung großer Zahlen in ihre Primfaktoren, um sichere Codes zu produzieren, praktisch ist es nicht möglich große Zahlen in Primfaktoren zu zerlegen, es würde unvorstellbar lange dauern, ein Quantencomputer würde diese Codes schnell und einfach knacken. Für die Datensicherheit hätte das grundlegende katastrophale Auswirkungen.
Aber die Quantenphysik kann eben auch die vorhin erwähnte abhörsichere Verschlüsselungsmethode liefern. Das bedeutet, dass die Entwicklung des Quantencomputers auch entscheidend ist für die Quantenkryptografie, beide Technologien haben sehr ähnliche quantenphysikalische Grundlagen.
Nämlich das Prinzip der sogenannten Verschränkung: Teilchen, die einmal miteinander verbunden waren, bleiben das auch dann, wenn sie getrennt werden, unabhängig von der räumlichen Distanz. Es bleibt ein Quantensystem, und das bedeutet, wenn bei einem Teilchen eine Messung durchgeführt wird, wirkt sich diese automatisch und instantan auf das andere räumlich getrennte Teilchen in der Form aus, dass man sofort weiß, welche Eigenschaften das andere Teilchen aufweist auch ohne Messung.
Denn die Besonderheit der Quantenphysik im Gegensatz zur klassischen Physik und damit zu unseren Alltagserfahrungen besteht darin, dass Teilchen bzw. Quantensysteme vor einer Beobachtung, meist Messung, keine bestimmten Eigenschaften zeigen, sondern in einer Überlagerung von möglichen Eigenschaften vorkommen. Erst die Messung oder Beobachtung führt zu einem bestimmten Verhalten oder einer bestimmten Eigenschaft, die gemessen wird. Doch warum dies so ist, und v.a. wie diese Naturvorgänge in der Quantenwelt erklärbar sind, ist Ausgangspunkt vieler philosophischer Überlegungen und unterschiedlicher Interpretationen seit ihrer Entdeckung. Die Frage nach der Wirklichkeit ist so eine der brennenden Fragen, die die beschriebenen Besonderheiten der Quantenphysik aufwerfen lassen. Damit haben sich schon damals berühmte Physiker beschäftigt wie Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger oder Werner Heisenberg.
Zudem würde ein Quantencomputer grundsätzlich Rechenvorgänge viel schneller als der klassische Computer ausführen können, weil er mehrere Vorgänge (Informationsinhalte) parallel bearbeiten könnte. Ebenso kann er auch gemeinsame Eigenschaften verschiedener Inputs herausfiltern. All dies ist aber noch Zukunftsmusik, dennoch wird an dem Bau eines Quantencomputers weltweit intensiv in den Physiklabors gearbeitet, und man kann sich über mögliche Auswirkungen einer solchen neuen Technologie schon gegenwärtig Gedanken machen:
3a) Wird der klassische Computer eines Tages zur Gänze vom Quantencomputer abgelöst werden können? Hat der Quantencomputer das Potenzial Prozesse im Arbeitsleben, wo heute schon Computer im Einsatz sind, zu beschleunigen, effizienter und kostengünstiger zu machen?
3b) Welche Folgen hätte der Einsatz des Quantencomputers in der Finanzwelt? Ein Großteil des Börsenhandels weltweit wird bereits mit Computerprogrammen abgewickelt, diese Praxis wird als Hochfrequenzhandel bezeichnet. Computersysteme analysieren und handeln Finanzprodukte in Bruchteilen von Sekunden. Das Ziel der Finanzbranche sind Programme, die noch effizienter und schneller sind, dafür würde sich der Quantencomputer anbieten, doch mit welchen Folgen? Experten warnen heute schon, dass computergesteuerter Börsenhandel das Crashszenario an den Börsen beschleunigen kann. Auf EU-Ebene gibt es seit Frühling 2014 eine Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, darin wird auch der Hochfrequenzhandel reguliert. Ist diese Richtlinie auch geeignet zur Anwendung auf neue Technologien wie den Quantencomputer?
3c) Wäre denn der Quantencomputer nicht eine gefährliche und unerwünschte Technologie, da sie herkömmliche Verschlüsselungscodes so einfach knacken kann?
Da die Quantenphysik eine revolutionäre Wende in der Physik gebracht hat, und folglich auch die Möglichkeiten der Quantenphysik in der Umsetzung in praktisch technische Anwendungen andere sind als jene der klassischen Physik, sprechen viele Quantenphysiker und Quantenphysikerinnen schon heute vom Quantenzeitalter.
Aufgrund dessen habe ich mich in meinen inhaltlichen Ausführungen auf jene Quantentechnologien konzentriert, die meines Wissens ein größeres gesellschaftliches Veränderungspotenzial versprechen. Mein Schwerpunkt aus rechtswissenschaftlicher Perspektive liegt bei den neuen Informationstechnologien der Quantenkryptografie und dem Quantencomputer, hauptsächlich könnte sich ein Bedarf für neue, erweiterte oder veränderte gesetzliche Regelungen ergeben, die die Datensicherheit und den Datenschutz betreffen.
Ich habe mich für die Methode der Szenario Gestaltung entschieden, um meine aufgeworfenen Fragestellungen, die zukunftsweisend sind, beantworten zu können, und habe dafür verschiedene Zukunftssituationen entwickelt:
Szenario 1:
Die entwickelten quantenkryptografischen Verschlüsselungssysteme werden-wie schon länger vorhergesagt-auf einem breiten Markt zur Anwendung kommen.
Szenario 2:
Es gelingt den Forscherinnen und Forschern einen Quantencomputer mit solchen Kapazitäten zu bauen, der bisherige klassische Verschlüsselungssysteme, die auf der Schwierigkeit der Zerlegung großer Zahlen in ihre Primfaktoren basieren, schnell und leicht knacken kann. Gleichzeitig kommt es aber zu keiner breiten Anwendung von Quantenkryptografie.
Szenario 3:
Die entwickelten Quantencomputer erreichen Rechenkapazitäten, die mindestens jenen der heutigen klassischen Computer entsprechen oder sogar weit darüber hinaus gehen. Im Prinzip kann dieser Quantencomputer den klassischen Computer ersetzen.
Betrachtet wird der Einsatz eines solchen Quantencomputers in jenen Arbeitsprozessen und Lebensbereichen, wo man schon bisher Computer eingesetzt hat, (z.B.: digitaler Stromzähler, selbstfahrende Autos) und in der Finanzwelt beim computergesteuerten Börsenhandel, dem Hochfrequenzhandel. In einer EU-Richtlinie wird dieser geregelt. In diesem Zusammenhang wird die Frage erörtert, ob und ab wann die neue Technologie des Quantencomputers in diese Regelung miteinbezogen werden sollte.
Szenario 4:
Die Anwendung der Quantentechnologie der Supraleitung wird für die Stromleitung genutzt. Im Gegensatz zu den gegenwärtigen technischen Möglichkeiten durch die, laut Schätzungen 15% der Leistung durch den Leistungswiderstand verloren gehen, ermöglicht die Supraleitung eine widerstandsfreie bzw. verlustfreie Stromleitung.
Aufgedrängt hat sich aufgrund meines Wissens auch die philosophische Auseinandersetzung mit der Problematik der Diskrepanz von Theorie und Praxis bei der Quantenkryptografie, die eigentlich die Verwirklichung eines Ideals der (totalen) Abhörsicherheit verspricht. Es ist interessant, dies kritisch zu hinterfragen.
Hier nun als Einleitung ein kurzer Exkurs in die Wissenschaftstheorie und die Fragen nach der Wirklichkeit:
In der Wissenschaftsgeschichte haben sich ForscherInnen auseinandergesetzt mit der Entwicklung von Wissenschaft, und wie es zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gekommen ist. In der Disziplin der Wissenschaftstheorie gab es verschiedene Ansätze und Erklärungsversuche, was als wissenschaftlich gelten kann und als Quelle für wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt werden kann. Zunächst wurden die Wahrnehmung und die Beobachtung als Wege gewählt, um zu wissenschaftlichen Aussagen zu kommen. Den Schwerpunkt der Theorie als Quelle wissenschaftlicher Erkenntnis und die Wichtigkeit des Experiments stellen andere Wissenschaftstheorien in den Vordergrund.
Der Astrophysiker Stephen Hawking wurde oft kritisiert von Wissenschaftstheoretikern für seine Sicht über die Bedeutung von Theorien im Zusammenhang mit der Wirklichkeit. Hawking schreibt in dem Buch mit dem Titel Einsteins Traum: "Es ist in der Wissenschaftstheorie schwierig, Realist zu sein-also die Auffassung zu vertreten, dass die Wirklichkeit unabhängig von unserer Erfahrung existiert - denn, das, was wir für wirklich halten, ist den Bedingungen der Theorie unterworfen, an der wir uns jeweils orientieren(...) Eine Theorie ist eine gute Theorie, wenn sie ein elegantes Modell ist, wenn sie eine umfassende Klasse von Beobachtungen beschreibt und wenn sie die Ergebnisse weiterer Beobachtungen vorhersagt.
Darüber hinaus hat es keinen Sinn zu fragen, ob sie mit der Wirklichkeit übereinstimmt, weil wir nicht wissen, welche Wirklichkeit gemeint ist. Es hat keinen Zweck sich auf die Wirklichkeit zu berufen, weil wir kein modellunabhängiges Konzept der Wirklichkeit besitzen." Für diese Auffassung wurde Hawking von Wissenschaftstheoretikern als überholt kritisiert. Er selbst hingegen fühlte sich von diesen verunglimpft, und hielt wenig von Wissenschaftstheoretikern.
Er schreibt in dem erwähnten Buch" Einsteins Traum" auf Seite →, dass einige Philosophen der Naturwissenschaft sich nicht mit den Besonderheiten der Quantenphysik abfinden können:" Ihre Schwierigkeit kommt daher, dass sie sich implizit an einem klassischen Wirklichkeitsbegriff orientieren, in dem ein Objekt nur eine einzige bestimmte Geschichte hat. Die Besonderheit der Quantenmechanik liegt darin, dass sie ein anderes Bild der Wirklichkeit vermittelt. Danach hat ein Objekt nicht nur eine einzige Geschichte, sondern alle Geschichten, die möglich sind.
(...) Wie können wir wissen, was real ist, wenn wir uns nicht an eine Theorie an ein Modell halten, mit dem wir den Realitätsbegriff interpretieren." Ich halte die von Stephen Hawking beschriebene Sichtweise für nicht überholt, denn die Quantenphysik stellt anscheinend auch neue Denkanforderungen an die philosophische Wissenschaft.
Auch Werner Heisenberg hat in seinem Buch: Der Teil und das Ganze in einem Kapitel in einem Gespräch mit Carl Friedrich von Weizsäcker und Grete Hermann, einer Philosophin, über die Kant`sche Philosophie der Kausalität, die nicht in Einklang zu bringen ist mit der Quantenmechanik, die nur vom Zufall bestimmt wird, folgende Schlussfolgerung aus diesem Gespräch gezogen: " Es wäre an dieser Stelle sicher falsch, naturwissenschaftliches und philosophisches Wissen mit dem Satz: Jede Zeit hat ihre eigene Wahrheit aufweichen zu wollen. Aber man muss sich doch gleichzeitig vor Augen halten, dass sich mit der historischen Entwicklung auch die Struktur des menschlichen Denkens ändert. Der Fortschritt der Wissenschaft vollzieht sich nicht nur dadurch, dass uns neue Tatsachen bekannt und verständlich werden, sondern auch dadurch, dass wir immer wieder neu lernen, was das Wort verstehen bedeuten kann." Philosophische Auseinandersetzungen von Physikern und Physikerinnen haben besonders mit der Entwicklung der Quantenmechanik an Brisanz gewonnen.
In einem späteren Kapitel beschäftige ich mich noch eingehender mit dem Fragen der Wirklichkeit und der Quantenphysik.
Die oben erwähnte Entstehung der Quantenphysik basierte auf einem Widerspruch zwischen einem physikalischen Gesetz und den Messungen, durch eine Korrektur eines bestimmten physikalischen Gesetzes durch Max Planck stimmte dieses wieder mit den Messungen überein. Doch der theoretische Rahmen der Quantenphysik wurde erst ab den 1920iger Jahren entwickelt durch wichtige Theoretiker wie Erwin Schrödinger mit der nach ihm benannten Schrödinger Gleichung, oder das Gesetz der Unschärferelation von Heisenberg, und die erst 1966 entwickelte Ungleichung von John Bell.
Zudem ist die Einbeziehung von Fachleuten, die auf dem Gebiet der Quantentechnologien forschen erforderlich, wenn spezielles quantenphysikalisches Wissen benötigt wird. Ich werde dem in Form von Zitaten aus Büchern von Quantenphysikern und Quantenphysikerinnen und/oder Zitaten aus Artikeln und Interviews und auch durch persönliche schriftliche und mündliche Kommunikation mit den Physikerinnen nachkommen.
TEIL II NÄHERE AUSFÜHRUNGEN ZU DEN RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN ANSÄTZEN:
Fragestellung: Welche positiven und/oder negativen Auswirkungen könnten die Quanteninformationstechnologien Quantenkryptografie und Quantencomputer im Alltagsleben, und auch in rechtlichen Regelungen bewirken?
Hans Peter Bull schreibt in dem Buch" Datenschutz, Informationsrecht und Rechtspolitik" einleitend über Informationsrecht: "Der Rechtsstoff des Informationsrechts stammt aus verschiedenen Epochen und Teilgebieten der Rechtsentwicklung.





























