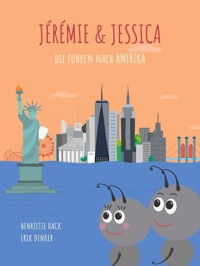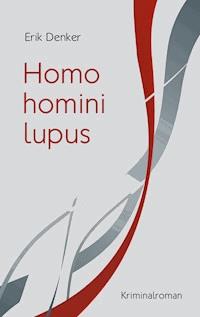Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Lieber Ernest, was ich Dir noch sagen möchte Es ist die Geschichte Deiner deutschen Verwandtschaft. Es soll Dir die Familie Deines Vaters näher bringen. Dabei denke ich weniger an eine trockene Chronologie, sondern mehr an eine lockere Erzählung über die Dinge Deiner Familie, die Du als mein Enkel wissen solltest, also was war, wer wir waren und woher wir kommen. Es ist die Reise Deines Deines Namensgebers und Ur-Ur-Großvaters Ernst Hinrich Kabel zehn Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und zwar von Sülfeld in Schleswig-Holstein zu den Schlacht-Feldern von Verdun, dann nach Paris, sowie dem Besuch bei dem emigrierten Kaiser Wilhelm des Zweiten in den Niederlanden auf dem Rückweg. Es ist das Tagebuch über meine Reise auf dem Camino frances in Nordspanien, den ich 70 jährig, als Pilger begangen habe. Sie gab mir Gelegenheit meine Erlebnisse, meine Erkenntnisse und meine Sicht über die Dinge des Lebens einmal niederzuschreiben und so die Reise-Beschreibung mit eigenen Gedanken anzureichern. Dies ist ein Nachwort und in Teilen auch ein Resümee, wie man es im französischen bezeichnet. Es erfasst u.a. Beschreibungen, die nicht in einem direkten Zusammenhang mit unserer Familie stehen, nicht desto trotz sollen sie Dir nicht nur einen Einblick in die deutsch-französische Geschichte, sondern auch Hinweise auf meine politischen Einsichten geben. In Liebe, Dein Großvater
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog:
Was ich Dir noch sagen möchte
Kapitel I:
Eine Zeitreise von 1690 bis in die Gegenwart
Kapitel II:
Eine Reise nach Paris im Jahre 1928
Kapitel III:
Eine Reise nach Santiago im Jahre 2009
Epilog:
Was ich noch vergessen habe
Geschrieben und gewidmet für meinen Enkel:
Ernest Maurice Erik Eli Denker-Bercoff
Prolog
Lieber Ernest, was ich Dir noch sagen möchte …
Deine „Muttersprache“ ist Französisch. Ich denke, wenn Du dieses Buch erhältst, wirst Du auch gute Kenntnisse Deiner „Vatersprache“ haben. Nicht desto trotz wirst Du beim Lesen dieses Buches auf viele Worte stossen, die Du noch nicht kennst oder die Du nicht verstehst. Das ist, weil ich glaube, dass diese weder in Deiner Schule gelehrt, noch in der Gebrauchssprache verwendet werden. Mach Dir nichts daraus, Du hast Deinen deutschen Vater, er wird es Dir erklären oder Du liest das Buch zu einem späteren Zeitpunkt, wann es Dir gefällt, einfach noch einmal.
Ich habe ganz bewusst geografische, historische, kulturelle und politische Gegebenheiten, die mit meinen Ausführungen zusammen hängen, etwas ausführlicher beschrieben, um Dir Deutschland vertrauter zu machen. Ich werde nicht mit meiner Meinung über „Gott und die Welt“ zurückhalten. Ich verspreche Dir aber, dass ich mich jeglicher Belehrungen und Ratschläge für Dich enthalten werde. Es gibt also keine Vorschläge, was Du tun oder lassen solltest. Aber vielleicht ist das Buch Anregung für Dich, über die eine oder andere Passage einmal nachzudenken.
Vielleicht findest Du in der Familie Deiner Mutter jemanden der das, was ich berichte ergänzt, so hättest Du eine Aufzeichnung, die dann wirklich vollständig Deine Familie und Deine Herkunft wiedergibt. Wenn Du niemanden findest, dann befrage Deine Großeltern Lolita und Maurico oder Deine andere Verwandtschaft und ergänze diese Aufzeichnungen selber.
Ich beneide die französische Familie Deiner Mama, die durch Religion und Beruf viel in der Welt herumgekommen ist und eine ganze Anzahl von Fremdsprachen spricht. Ich hatte während der Schulzeit kein Interesse und während des Berufslebens keine Gelegenheit Sprachen zu lernen. Lediglich in Englisch habe ich mir Grundkenntnisse angeeignet. Wenn ich nun dieses Buch schreibe, möchte ich es gelegentlich auch in Englisch tun, soweit ich es kann. So etwas ist für mich eine gute Übung und macht das Schreiben und das Lesen etwas interessanter. Übrigens achte einmal darauf, dass doch viele Worte des verwendeten Sprachschatzes eine französische Herkunft haben.
Außer, dass ich ein paar Fachaufsätze veröffentlicht habe, habe ich keine schriftstellerischen Erfahrungen. Trotzdem bin ich guten Mutes, Dir eine interessante Lektüre zu hinterlassen. „Who does only that what he can, will still remain what he is“. Let´s go on.
„Quasi modo geniti“, warum nenne ich diese Aufzeichnungen so? Im christlichen Kirchenkalender wird damit der erste Sonntag nach Ostern bezeichnet. Die neusprachliche Übersetzung der Losung für diesen Tag bedeutet sinngemäß: „Wie die neugeborenen Kinder nach der Muttermilch, seid begierig nach der unverfälschten Erkenntnis der Schöpfung“ (Quasi modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite.). Ursprünglich war „Quasi modo“ nur ein Arbeitstitel für meine Textabspeicherung. Er gefiel mir zunehmend gut, weil er ausgesprochen ungewöhnlich, die Syntax stimmig ist und das ständige Bestreben nach der Erkenntnis unseres Daseins eine der höchsten Aufgaben des Menschen ist. Dies sei eben Anspruch, auch an mich, bei der Abfassung dieser Aufzeichnungen.
Das Wort „Saga“ kommt aus dem isländischen und bezeichnet eine literarisch gestaltete Familienchronik (Duden). Die deutschen Worte „Vorwort“ und auch „Nachwort“ erscheinen mir sehr abgegriffen, deshalb bevorzuge ich die lateinischen Bezeichnungen „Prolog“ und „Epilog“, sie meinen das Gleiche. Prolog nennt man übrigens auch das Anfangsrennen bei dem berühmtesten Radrennen der Welt, der „Tour de France“.
Vieles auf den nachstehenden Kapiteln wird von mir handeln, dass heißt dieses Buch hat mit Ausnahme des Kapitels „Eine Reise nach Paris“ einen starken autobiografischen Charakter. Dies ist nicht, weil ich mich besonders darstellen möchte, sondern weil ich nicht weiß, wie das, was ich schreiben möchte, anders zu bewerkstelligen ist.
Lieber Ernest, dieses Buch habe ich allein für Dich geschrieben. Ich meine damit nicht, dass andere, die daran interessiert sind, dieses Buch nicht lesen dürfen. Aber ich habe nur an Dich gedacht, als ich 2009 auf dem Pilgerweg nach Santiago in Nordspanien die Idee dazu hatte.
Wenn einer eine Rede hält, tut er gut daran, seine Zuhörer vorher durch eine Ankündigung oder durch ein paar Sätze den Inhalt und die Zeitdauer seines Vortrages wissen zu lassen und den Vortrag selbst durch einen eindeutigen Anfang und Ende zu strukturieren. Dies macht die Rede interessanter und nachhaltiger. Sinngemäß das Gleiche möchte ich für dieses Buch mit nachfolgender Kurzbeschreibung tun:
Kapitel I: Eine Zeitreise zwischen 1684 und der Gegenwart
Es ist die Geschichte Deiner deutschen Verwandtschaft. Es soll Dir die Familie Deines Vaters näher bringen. Dabei denke ich weniger an eine trockene Chronologie, sondern mehr an eine lockere Erzählung über die Dinge Deiner Familie, die Du als mein Enkel wissen solltest, also was war, wer wir waren und woher wir kommen. Auch über Dich möchte ich schreiben. Natürlich nur Kleinigkeiten, die ich in den ersten Lebensjahren beobachtet habe, also Dinge an die Du Dich nicht erinnern wirst, Dich aber vielleicht erfreuen, wenn Du sie erfährst.
Um Dir die Übersicht zu erleichtern, habe ich Dir auf der letzten Seite dieses Kapitels, in kleinen Kästchen, Deine Verwandten zusammengestellt, so dass Du dort Dich dort zwischendurch beim Lesen orientieren kannst.
Kapitel II: Eine Reise nach Paris im Jahre 1928
Während ich diese Zeilen schreibe, habe ich von meinem Cousin Volker Rumohr aus Seefeld in Bayern, die Kopie des Tagebuchs Deines Ur-Ur-Großvaters erhalten. Er ist sozusagen Dein Namensgeber und hieß Ernst Hinrich Kabel. Er schrieb über eine „Reise nach Paris“, die er als 40-jähriger im Jahre 1928 unternahm. Dieses Dokument möchte ich Dir nicht vorenthalten. Ich habe es als eigenes Kapitel diesen Aufzeichnungen beigefügt.
Kapitel III: Eine Reise nach Santiago im Jahre 2009
Es ist das Tagebuch über meine Reise auf dem „Camino frances“ in Nordspanien, den ich 70 jährig, als Pilger begangen habe. Ich habe mich weniger aus religiösen, als aus persönlichen Gründen, zu dieser Reise entschlossen. Ich hatte einfach das Bedürfnis einmal länger allein zu sein und über die Schöpfung, aber auch über mich selber nachzudenken. Mein Gedanke ist, meine Tagebuch-Aufzeichnungen in dieses Buch einfließen zu lassen, da es mir Gelegenheit gibt, meine Erlebnisse, meine Erkenntnisse und meine Sicht über die Dinge des Lebens einmal niederzuschreiben und so die Reisebeschreibung mit eigenen Gedanken anzureichern.
Epilog: Was ich noch vergessen habe …
Dies ist ein Nachwort und in Teilen auch ein Resümee, wie man es im französischen bezeichnet. Es erfasst u.a. Beschreibungen, die nicht in einem direkten Zusammenhang mit unserer Familie stehen, nichts desto trotz soll es einen Einblick in die deutsch-französische Geschichte, aber auch Hinweise auf meine politischen Einsichten geben. An dieser Stelle findest Du auch mein ganz persönliches Schlusswort.
Kapitel I
Eine Zeitreise zwischen 1682 und der Gegenwart
Die Jahreszahl 1682 steht für das Heiratsdatum von Paul Kabel. Es ist der älteste, dokumentierte Eintrag unserer Familie in einer Urkunde. Es ist der Urahn meiner Mutter, Herta Denker, geborene Kabel. Er wurde in Tönningstedt ca. 30 km nördlich von Hamburg geboren.
Zwischen meiner Mutter und Paul Kabel liegen, wenn ich richtig gezählt habe, sechs Generationen, die alle aus dem nördlichsten Bundesland Deutschlands, Schleswig-Holstein und dort aus dem Kreis Segeberg stammen. Von Beruf waren sie Hufner, dies ist ein altdeutscher Begriff. Ein Hufner ist ein Bauer, der als Grundbesitz eine oder mehrere Hufen Land bewirtschaftete. Eine Hufe ist ein Flächenmaß, das in unterschiedlichen Gegenden, unterschiedliche Größen aufweist, meist zwischen 30 bis 80 Morgen, also 7,5 bis 20 Hektar.
Comming now to our present family and, naturally, me too. I was born in march 1939, still in the time of peace, half a year before the Second World War started on the first September with the occupation of Poland.
Meine Eltern sind Erik und Herta Denker. Geboren wurde ich in Hamburg, am 17. März 1939 in Hamburg-Rahlstedt in der Klinik „Dr. Wiemer“ in der Krögerstraße. Das war eine alte, mehrgeschossige Villa ohne Aufzug, aber mit einem kräftigen Pfleger, der die Patienten aus den Behandlungsräumen über eine Treppe in die oberen Krankenzimmer trug. Deine Urgroßeltern Erik und Herta hatten einige Jahre vor meiner Geburt eine Gastwirtschaft, den „Tonndorfer Hof“, in der angrenzenden Gemeinde Tonndorf-Lohe gekauft und sind dort mit 200 Reichsmark ihrer Eltern und einem Fass Freibier von der Brauerei als Wirtsleute angefangen.
A „Gastwirtschaft“ in Germany is more than a bistro, but less than a restaurant. Sie ist ein Gemenge aus Kneipe, Kaffee- und Clubhaus mit uneingeschränkter Konzession für Essen und Trinken. Zudem wurden dort Versammlungen und Familienfeiern durchgeführt.
Ich erinnere mich an einen Wellensittich, der zum Gaudi der Gäste frei in der Gaststube herumflog und sich regelmäßig mit Bierschaum an den Zapfhähnen besoff bis er eines Tages in alkoholisiertem Zustand an eine Fensterscheibe flog und starb.
Das Gebäude, mein Elternhaus, war über 100 Jahre alt und ohne besondere Fundamente errichtet. Es gab nur einen kleinen Getränkekeller, in dem unter anderem die aus Holz gefertigten und mit Eisenbändern versehenen Bierfässer gelagert und angeschlossen wurden. Sie wurden von außen mit Krampen versehenen Tauen über eine Rampe herabgelassen.
Hinter dem Haus stand ein etwa 10 x 10 m großer Holzschuppen, der als Garage, Schweinestall und als Umkleideraum für Fußballmannschaften, sowie zur Holz- und Kohle-Lagerung diente. Zudem war dem Hauptgebäude eine ausgedehnte „Veranda“ für den Eisverkauf vorgelagert. Sie wurde von Deiner Ur-Großmutter Herta bewirtschaftet.
Der „Tonndorfer Hof“ war ein beliebter, bürgerlicher Treffpunkt der erweiterten Nachbarschaft, der Handwerker, der Taubenzüchter, der Anti-Alkoholiger, der Lastwagenfahrer der Fa.Krages, die auf ihren Langholztransporten von Hamburg nach Lübeck fuhren, sowie Vereinslokal für den Fußballverein „Tonndorf-Lohe e.V.“.
Mit Beginn des Krieges wurde Dein Urgroßvater Erik zum Kriegsdienst eingezogen. Er verrichtete seinen Dienst als einfacher Soldat in Frankreich. Deine Urgroßmutter Herta zog mit ihren Kindern Ernst Erik und Edith nach Sülfeld um dort die Kriegsereignisse abzuwarten. Sülfeld, wie auch Tönningstedt, liegen ca. 30 km nordöstlich von Hamburg. Dort befindet sich eine bemerkenswert alte Backsteinkirche auf deren alten Friedhof steht der Grabstein von Ernst und Emma Kabel, dem Vater und der Mutter Deiner Urgroßmutter Herta steht.
Dein Ur-Ur-Großvater Ernst Kabel war ein konservativer Landwirt aus Tönningstedt, der sich nach seiner Kriegsverletzung im 1. Weltkrieg in Sülfeld ein relativ prachtvolles zweigeschossiges Herrenhaus mit Stallungen kaufte und von dort eine kleine Landwirtschaft auf ca. 40 Hektar Landfläche betrieb. Zudem richtete er „Kabels Gasthof“ mit zwei großen Festsälen und einem Clubraum ein. Einmal in der Woche kam ein Kinowagen mit dessen mobilen Spulen-Geräten ein Film für die Dorfgemeinschaft aufgeführt wurde.
In der Mitte der großen Küche befand sich ein Tisch für ca. 12 Personen an dem gemeinschaftlich mit der Familie das Gesinde aß. Darunter versteht man die Melker, die damals Schweizer genannt wurden, die Landarbeiter, die Küchenhilfen und die Bedienungen aus der Gastwirtschaft. Meistens gab es Bratkartoffeln und Eintopf.
Der große Herd wurde mit Holz und sogenannten Eierkohlen befeuert und die Spüle unter dem einzigen Fenster war mit Backsteinen gemauert.
Ernst Kabel hat noch 1928 den deutschen Kaiser Wilhelm II im holländischen Exil in Dorn besucht. Doch davon erzähle ich in einem gesonderten Kapitel mehr.
Dies sind meine Oma Emma Kabel, Tante Anneliese, meine Mutter Herta, Tante Gertrud (Tuti) und mein Opa Ernst Kabel.
Dein Ur-Urgroßvater hatte übrigens das erste Motorrad im Dorf. Geboren wurde er am 21. Juli 1888, wie ich dem Grabstein entnommen habe. Er starb unmittelbar bevor ich geboren wurde und zwar am 09. Februar 1939. Zu seinem Andenken erhielt ich, unter anderen, den Vornamen Ernst. Zur Erinnerung an mich, Deinem Großvater, haben Deine Eltern Dich Ernest genannt.
Deinen dritten Namen Erik hast Du von Deinem Urgroßvater.
Emma Kabel ist eine am 01.06.1885 geborene Rüder aus Gräberkate. Dies ist ebenfalls ein Nachbardorf von Sülfeld. Gestorben ist sie am 02. Juli. 1988. Die Familie bestand ebenfalls aus Bauern. Das Bauern- und das „Altenteilhaus“ stehen heute noch. Es gibt dort einen herrlichen Baumbestand und einen kleinen See. Insgesamt ein romantisches Ambiente.
Meine Mutter, Schwester Edith, Schwester Ingeborg und Dein Opa
Ernst und Emma Kabel hatten drei Töchter: Deine Urgroßmutter Herta, meine Tante Tutti (Gertrud) und meine Tante Anneliese. Herta heiratete Deinen Urgroßvater Erik und Tutti einen Wehrmachtsoffizier namens Jochen Rumohr. Er wurde im im 2. Weltkrieg General und kämpfte im Osten Europas. Er erschoss sich am Kriegsende mit einer Pistole.
Sein Grab liegt in Budapest, wo seine Division ihr letztes Gefecht hatte, auf dem Elisabeth-Friedhof. Tuti und Jochen hatten drei Kinder. Volker, Eckehard und Heike. Nach dem Krieg heiratete Tante Tutti ein zweites mal und zwar Hans Stolten. Sie haben eine gemeinsame Tochter namens Frauke.
Die Kinder dieser Zeit hatten alle indogermanische Namen, wie sie in der Hitlerzeit populär waren. Auch Erik, Edith und Ingeborg gehören dazu.
Tante Anneliese heiratete Onkel Herbert Evers. Beide erbten und bewirtschafteten die Landflächen und „Kabels Gasthof“ während des Krieges und danach.
Edith und Ingeborg sind meine Schwestern, also Deine Großtanten. Edith ist neun Jahre älter und Ingeborg vier Jahre jünger als ich. Ingeborg wurde während des Krieges in Radolfzell am Bodensee geboren.
Wie schon beschrieben, zogen meine Mutter, Edith und ich Anfang der 40er Jahre von Hamburg nach Sülfeld in Kabels Gasthof, um vor Luftangriffen geschützt zu sein. Ingeborg war noch nicht geboren. Unmittelbar, nach dem Umzug, ich war 9 Monate alt, erkrankte ich lebensgefährlich an einer Entzündung der Mittelohren. Ich kam in eine Spezialklinik nach St. Peter-Ording an der schleswigholsteinischen Nordseeküste. Man hat mir erzählt, ich sei der verwöhnte Liebling der Schwestern gewesen, wohl weil ich der jüngste Patient war.
Wir lebten bis 1947 in Sülfeld. Meine Schwester Ingeborg wurde in dieser Zeit geboren, Schwester Edith besuchte die Maria-Luise-Schule in Bad Oldesloe und ich die Volksschule in Sülfeld. Mein Vater kam aus britischer Kriegsgefangenschaft zurück.
Meine frühesten Erinnerungen liegen in dieser Kriegszeit. So sehe ich meine Schwester Edith mit der Blechbüchse durchs Dorf laufen, um für einen guten Zweck in dieser schweren Zeit zu sammeln. Sie hatte lange geflochtene Zöpfe, wie es für die damalige Zeit Mode war. Onkel Herbert sperrte mich wegen einer Kleinigkeit in einen fensterlosen Kohlenkeller.
Auf der linken Seite auf dem Weg nach Borstel erinnere ich mich an ein brennendes Bauernhaus. Das abgebrannte Bauernhaus gehörte Frieda Wolgast, der Tochter von Oma Kabels Schwester Anna.
Am Eingang zum Borsteler Wald waren Flakscheinwerfer aufgebaut, um feindlichen Flugzeuge auf dem nächtlichen Flug nach Hamburg sichtbar zu machen und so den Flakgeschützen die Möglichkeit der Abwehr zu geben. Im Sülfelder Moor wurden Beleuchtungsanlagen installiert, um die alliierten Bomberflotten auf ihren Flug auf die Stadt Hamburg zu irritieren.
Meine Schwester Edith, Dein Opa als Baby.
Ich erinnere mich noch, an das Ende des Krieges, als wir alle ängstlich hinter geschlossenen Gardinen in unserem Wohnbereich im Kabels Gasthof den Panzereinmarsch der britischen Armee beobachteten und wie erleichtert alle waren, dass es keine Zwischenfälle gab.
Damit war auch für uns der größte und grausamste Krieg der Menschheitsgeschichte zu Ende. Es folgten Jahre der Entbehrung und mit bitterer Kälte.
Ich musste im Sülfelder Moor beim Torf stechen helfen, genauer gesagt, musste ich die Torfringe, die zum Trocknen aufgebaut wurden, auflösen und auf so genannte Torfmieten aufstapeln. Im Schatten dieser Torfringe befanden sich häufiger Schlangen, Blindschleichen und Kreuzottern. Eine gewisse Angst vor diesen Reptilien ist mir bis heute geblieben. Die Arbeit war sehr wichtig. Alle Welt brauchte dringend Brennstoffe für die kalten Nachkriegswinter. 1947 wieder in Hamburg ging alles seinen Weg, wenn auch einen sehr bescheidenen.
Im Jahre 1947 zogen wir wieder von Süffeln nach Tonndorf in Hamburg. Wegen der guten Beziehungen meines Vaters zur Landwirtschaft in Sülfeld und Umgebung brauchten wir nicht zu hungern. Mein Vater fuhr einmal die Woche mit dem Motorrad auf das Land und tauschte und besorgte das Notwendige. Er fuhr eine Maschine der Marke BMW, der Bayrischen Motorenwerke, die zum Starten angeschoben werden musste. Einmal, so wurde mir erzählt, hat Vater den Soziussitz einschließlich seiner Tochter Edith verloren, ohne es längere Zeit zu bemerken.
Die britischen Besatzungssoldaten waren u.a. in Tonndorf stationiert. Gelegentlich feierten sie bei uns im „Tonndorfer Hof“ und brachten dazu ihre eigenen Speisen und Getränke mit. Verluste an deren Lebensmitteln, zu unserem persönlichen Gebrauch, gab es immer. Die Engländer sahen es mit Gelassenheit. Ich aß damals das erste Weißbrot meines Lebens. Es schmeckte mir wie Marzipan. Der Hit bei uns Kindern waren jedoch von britischen Soldaten erbetteltes Kaugummi.
Ein Ereignis möchte ich nicht unerwähnt lassen. Etwa 200 m hinter dem „Tonndorfer Hof“ verlief die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck. Auch der ganze Skandinavienverkehr verlief über diese Strecke. Häufig kamen hier die Züge zum Stillstand. Waren dies Kohlenzüge, wurden sie in Arbeitsteilung gestürmt. Die Erwachsenen erkletterten die Züge und warfen die Briketts auf die seitlichen Böschungen. Jugendliche sammelten diese so schnell wie möglich in Säcke und verschwanden.
Ich bin ein einziges Mal dabei gewesen und just an diesem Tag kamen die zur Bewachung gerufenen britischen Soldaten, genau genommen waren es Schotten. Sie schossen scharf ohne lang zu überlegen erst einmal kräftig in die Luft. Bei mir löste dies den kräftigsten Adrenalin-Stoß meines jungen Lebens aus. Alles liegen lassend hechtete ich über den angrenzenden Zaun und verkroch mich bei uns zu Hause in unserem Schuppen.
Hier ein Ausschnitt aus dem „Hamburger Abendblatt“: „Im Hungerwinter 1946/47 starben viele Menschen wegen mangelnder Ernährung und der unbarmherzigen Kälte. Die Temperaturen fielen auf unter -15 Grad Celsius. Es gab nur wenig beheizte Räume. Es wurden Lebensmittelkarten ausgegeben. Die für Rentner nannte man „Sterbekarten“, weil man dafür so wenig bekam, dass es kaum zum Überleben reichte. Die Hamburger hatten nur einen Gedanken: überleben. Sie gingen stehlen. Sie schickten Ihre Kinder zu den Bauern betteln. Mehr als 450 Kohlendiebe wurden in nur einem Monat verurteilt. Erst ein dramatischer Appell des Hamburger Bürgermeisters, Max Brauer, an die britische Besatzungsmacht änderte etwas und rettete Tausenden das Leben.“
Meine Schwester Edith beendete ihre Schule in Oldesloe und begann eine kaufmännische Lehre bei dem Schiffsausrüster Marquard & Co in Hamburg. Ich wartete immer auf ihren Feierabend und laß in der „Morgenpost“ auf der letzten Seite die Comic Strips. Meine schulischen Leistungen in der Grundschule in Tonndorf waren erschreckend schlecht. Die Anzahl der Schüler pro Klasse lag deutlich über 40, ich war unterernährt, unkonzentriert und fiel bei der kleinsten Anforderung in eine psychologische Starre.
Meine Mutter hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie sich wegen des Geschäftshaushaltes nicht um uns Kinder kümmern konnte. Sie überzeugte meinen Vater, mich und Schwester Ingeborg auf die private „Rudolf-Steiner-Schule“ ein- bzw. umzuschulen. Diese Schule war damals die einzige nicht konfessionelle Privatschule in Hamburg.
Steiner war Philosoph und Begründer der Anthroposophie und beeinflusste stark die Waldorf-Pädagogik. Die Anzahl der Kritiker ist sicherlich so groß wie die der Anhänger. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich vieles Positives berichten. Zwar waren damals die Klassen nicht kleiner, aber die Lehrer engagierter. Vieles haben die öffentlichen Schulen zwischenzeitlich übernommen, so die Erkenntnis der Wichtigkeit darstellender Kunst, wie Theateraufführungen, das Beherrschen von Musikinstrumenten, Chorgesang, kreative Malerei und Formgestaltung, Epochenunterricht und die intensive Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern.
Um die Deutlichkeit der Sprache und die dazu erforderliche Atemtechnik zu üben, mussten wir Gedichte und Auszüge aus deutschen Dramen von Herder, Goethe, Schiller u.s.w. auswendig lernen und vortragen. Ich erinnere mich noch an folgenden Auszug, den ich vortragen mußte, ich meine er ist aus Goethes Faust:
„Feiger Gedanken, bängliches Schwanken, weibisches Zagen, ängstliches Klagen, wendet kein Elend, macht dich nicht frei. Allen Gewalten, zum Trutz sich erhalten, nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen, rufet die Arme der Götter herbei.“
Das Manko nichtausreichender naturwissenschaftlicher Leistungen an dieser Schule, bis heute ein häufiger Kritikpunkt, habe auch ich erlebt. Auf jeden Fall wurde ich ausgeglichener und meine Beurteilungen besser. Nichts destotrotz verliess ich die Schule nach der 10. Klasse mit der Absicht, eine Lehre als Maschinenbauer zu beginnen und Ingenieurwesen zu studieren.