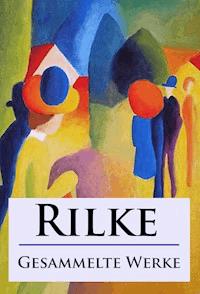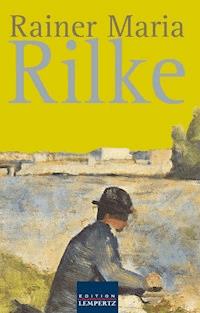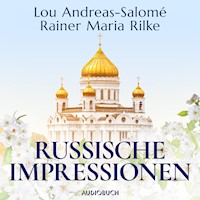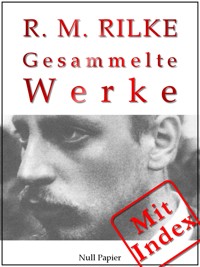
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
NEU: Mit alphabetischem Index Über 500 Werke auf 2187 Seiten Das Marien-Leben Sonette an Orpheus Das Stundenbuch Mädchenmelancholie Duineser Elegien Archaischer Torso Apollos Geschichten vom lieben Gott Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge August Rodin Russische Kunst Thomas Manns ›Buddenbrooks‹ Jakob Wassermann – ›Der Moloch‹ Worpswede u.a. Rainer Maria Rilke (Geboren 4.12.1875 in Prag) gilt mit seinen von der bildenden Kunst beeinflussten Versen als einer der bedeutendsten Dichter der literarischen Moderne. Er verfasste Erzählungen, einen Roman und Aufsätze zu Kunst und Kultur sowie zahlreiche Übersetzungen aus dem Französischen. Ursprünglich von seinem Vater für die Militärlaufbahn vorgesehen, bereitete sich Rilke lieber auf das Abitur vor und studierte anschließend Literatur und Kunstgeschichte in Prag, Berlin und München. Auf ausgedehnten Reisen nach Russland – bei denen er unter anderem auch Tolstoi traf - lernte Rilke die "russische Seele" kennen. 1900 ließ er sich in der Künstlerkolonie Worpswede nieder und heirate eine Bildhauerin von der er sich aber 1902 wieder scheiden ließ. 1905 wurde er für einige Zeit der Sekretär von Rodin in Paris. Nach einem unerfreulichen Intermezzo der Zwangsrekrutierung für den 1. Weltkrieg um 1916, wurde er aus Gesundheitsgründen aus dem Militärdienst entlassen. Die Erlebnisse dort müssen für Rilke traumatisch gewesen sein, blieb doch sein Werk ab da für lange Zeit dünn. In einer intensiven Schaffenszeit vollendete Rilke innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk. Lange Zeit mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen kämpfend starb Rilke 1926 in einem Schweizer Sanatorium an Leukämie. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2114
Ähnliche
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Gesammelte Werke
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Gesammelte Werke
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Jürgen Schulze 3. Auflage, ISBN 978-3-954186-44-0
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Lyrik
Das Marien-Leben
Sonette an Orpheus –– 1. Teil
Sonette an Orpheus –– 2. Teil
Das Stundenbuch
Das Buch der Bilder
Duineser Elegien
Toten-Tanz
Delphine
Die Greisin
Kretisches Artemis
Der Stylit
Der Tod der Geliebten
Die Laute
Nächtliche Fahrt
Samuels Erscheinung von Saul
Papageien-Park
Schlafmohn
Don Juans Auswahl
Die Brandstätte
Der Käferstein
Tröstung des Elia
Mohammeds Berufung
Der Reliquienschrein
Venezianischer Morgen
Lied vom Meer
Eva
Der Abenteuerer
Vor-Ostern
Buddha in der Glorie
Archaischer Torso Apollos
Ein Prophet
Der Hund
Der Apfelgarten
Don Juans Kindheit
Das Gold
Kreuzigung
Legende von den drei Lebendigen und den drei Toten
Schlangen-Beschwörung
Das Rosen-Innere
Leda
Ein Doge
Der Auferstandene
Persisches Heliotrop
Der Einsame
Begegnung in der Kastanien-Allee
Aus dem Leben eines Heiligen
Klage um Antinous
Der Berg
Die Entführung
Römische Campagna
Absaloms Abfall
Falken-Beize
Auswanderer-Schiff
Der Blinde
Das Kind
Landschaft
Dame vor dem Spiegel
Die Liebende
Jeremia
Die Irren
Spätherbst in Venedig
Schlaflied
Der Alchimist
Die Parke
Der Leser
Corrida
Die Schwestern
San Marco
Rosa Hortensie
Eine von den Alten
Abendmahl
Das Jüngste Gericht
Das Wappen
Das Bett
Die Gruppe
Die ägyptische Maria
Adam
Klage um Jonathan
Der König von Münster
Die Sonnenuhr
Eine Welke
Der Pavillon
Die Insel der Sirenen
Der Ball
Übung am Klavier
Der Fremde
Irre im Garten
Die Flamingos
Der Balkon
Die Versuchung
Dame auf einem Balkon
Esther
Die Bettler
Magnificat
Bildnis
Der aussätzige König
Damen-Bildnis aus den Achtziger-Jahren
Sankt Georg
Eine Sibylle
Der Junggeselle
Die Anfahrt
Leichenwäsche
Fremde Familie
Requiem
Requiem
Tanagra
Römische Sarkophage
Die Erblindende
O Lacrimosa, II
Das Karussell –– Jardin du Luxembourg
Mädchenklage
Der Turm
Opfer
Der Stifter
Der Schwan
Todes-Erfahrung
Feder und Schwert
Das Christkind
Pierre Dumont
Die Näherin
Die goldene Kiste
Mohn ...
Ein Charakter
Und doch in den Tod
Das Ereignis
Der Sterbetag
Die Flucht
Weißes Glück
Die Stimme
Eine Tote
Der Apostel
Ihr Opfer
Im Vorgärtchen
Sonntag
Heiliger Frühling
Das Familienfest
Das Geheimnis
Greise
Kismét
Alle in Einer
Einig
König Bohusch
Die Geschwister
Ewald Tragy
Masken
Fernsichten
Leise Begleitung
Generationen
Im Leben
Teufelsspuk
Im Gespräch
Der Liebende
Die Letzten
Das Lachen des Pên Mrêz
Wladimir, der Wolkenmaler
*Aufzeichnung*
*Ein Abend*
Ein Morgen
Der Kardinal
Reflexe
Das Haus
Vitali erwachte ...
Aus einem Mädchenbrief
Zwei Fragmente
Albrecht Ostermann
Der Drachentöter
Der Totengräber
Die Turnstunde
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
Frau Blahas Magd
Kleine Schriften
Erlebnis (I)
(II)
(Aufzeichnung)
Erinnerung
Ur-Geräusch
Kunstwerke
Geschichten vom lieben Gott
Der Brief des jungen Arbeiters
Erzählungen aus dem Nachlaß
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
Aufsätze und Rezensionen
August Rodin –– Erster Teil
August Rodin –– Zweiter Teil
Von Kunst-Dingen –– Kritische Schriften –– Dichterische Bekenntnisse
Worpswede
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
Rainer Maria Rilke (Geboren 4.12.1875 in Prag) gilt mit seinen von der bildenden Kunst beeinflussten Versen als einer der bedeutendsten Dichter der literarischen Moderne.
Er verfasste Erzählungen, einen Roman und Aufsätze zu Kunst und Kultur sowie zahlreiche Übersetzungen aus dem Französischen.
Ursprünglich von seinem Vater für die Militärlaufbahn vorgesehen, bereitete sich Rilke lieber auf das Abitur vor und studierte anschließend Literatur und Kunstgeschichte in Prag, Berlin und München. Auf ausgedehnten Reisen nach Russland –– bei denen er unter anderem auch Tolstoi traf –– lernte Rilke die »russische Seele« kennen. 1900 ließ er sich in der Künstlerkolonie Worpswede nieder und heirate eine Bildhauerin von der er sich aber 1902 wieder scheiden ließ. 1905 wurde er für einige Zeit der Sekretär von Rodin in Paris. Nach einem unerfreulichen Intermezzo der Zwangsrekrutierung für den 1. Weltkrieg um 1916, wurde er aus Gesundheitsgründen aus dem Militärdienst entlassen. Die Erlebnisse dort müssen für Rilke traumatisch gewesen sein, blieb doch sein Werk ab da für lange Zeit dünn.
In einer intensiven Schaffenszeit vollendete Rilke innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk.
Lange Zeit mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen kämpfend starb Rilke 1926 in einem Schweizer Sanatorium an Leukämie.
Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?) Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?) Bin dein Gewand und dein Gewerbe, mit mir verlierst du deinen Sinn.
*
Lyrik
Das Marien-Leben
Geburt Mariae
O was muß es die Engel gekostet haben, nicht aufzusingen plötzlich, wie man aufweint, da sie doch wußten: in dieser Nacht wird dem Knaben die Mutter geboren, dem Einen, der bald erscheint. Schwingend verschwiegen sie sich und zeigten die Richtung, wo, allein, das Gehöft lag des Joachim, ach, sie fühlten in sich und im Raum die reine Verdichtung, aber es durfte keiner nieder zu ihm. Denn die beiden waren schon so außer sich vor Getue. Eine Nachbarin kam und klugte und wußte nicht wie, und der Alte, vorsichtig, ging und verhielt das Gemuhe einer dunkelen Kuh. Denn so war es noch nie.
Die Darstellung Mariae im Tempel
Um zu begreifen, wie sie damals war, mußt du dich erst an eine Stelle rufen, wo Säulen in dir wirken; wo du Stufen nachfühlen kannst; wo Bogen voll Gefahr den Abgrund eines Raumes überbrücken, der in dir blieb, weil er aus solchen Stücken getürmt war, daß du sie nicht mehr aus dir ausheben kannst: du rissest dich denn ein. Bist du so weit, ist alles in dir Stein, Wand, Aufgang, Durchblick, Wölbung ––, so probier den großen Vorhang, den du vor dir hast, ein wenig wegzuzerrn mit beiden Händen: da glänzt es von ganz hohen Gegenständen und übertrifft dir Atem und Getast. Hinauf, hinab, Palast steht auf Palast, Geländer strömen breiter aus Geländern und tauchen oben auf an solchen Rändern, daß dich, wie du sie siehst, der Schwindel faßt. Dabei macht ein Gewölk aus Räucherständern die Nähe trüb; aber das Fernste zielt in dich hinein mit seinen graden Strahlen ––, und wenn jetzt Schein aus klaren Flammenschalen auf langsam nahenden Gewändern spielt: wie hältst du’s aus? Sie aber kam und hob den Blick, um dieses alles anzuschauen. (Ein Kind, ein kleines Mädchen zwischen Frauen.) Dann stieg sie ruhig, voller Selbstvertrauen, dem Aufwand zu, der sich verwöhnt verschob: So sehr war alles, was die Menschen bauen, schon überwogen von dem Lob in ihrem Herzen. Von der Lust sich hinzugeben an die innern Zeichen: Die Eltern meinten, sie hinaufzureichen, der Drohende mit der Juwelenbrust empfing sie scheinbar: Doch sie ging durch alle, klein wie sie war, aus jeder Hand hinaus und in ihr Los, das, höher als die Halle, schon fertig war, und schwerer als das Haus.
Mariae Verkündigung
NICHT daß ein Engel eintrat (das erkenn), erschreckte sie. Sowenig andre, wenn ein Sonnenstrahl oder der Mond bei Nacht in ihrem Zimmer sich zu schaffen macht, auffahren ––, pflegte sie an der Gestalt, in der ein Engel ging, sich zu entrüsten; sie ahnte kaum, daß dieser Aufenthalt mühsam für Engel ist. (O wenn wir wüßten, wie rein sie war. Hat eine Hirschkuh nicht, die, liegend, einmal sie im Wald eräugte, sich so in sie versehn, daß sich in ihr, ganz ohne Paarigen, das Einhorn zeugte, das Tier aus Licht, das reine Tier ––,) Nicht, daß er eintrat, aber daß er dicht, der Engel, eines Jünglings Angesicht so zu ihr neigte; daß sein Blick und der, mit dem sie aufsah, so zusammenschlugen als wäre draußen plötzlich alles leer und, was Millionen schauten, trieben, trugen, hineingedrängt in sie: nur sie und er; Schaun und Geschautes, Aug und Augenweide sonst nirgends als an dieser Stelle ––: sieh, dieses erschreckt. Und sie erschraken beide. Dann sang der Engel seine Melodie.
Mariae Heimsuchung
NOCH erging sie’s leicht im Anbeginne, doch im Steigen manchmal ward sie schon ihres wunderbaren Leibes inne, –– und dann stand sie, atmend, auf den hohn Judenbergen. Aber nicht das Land, ihre Fülle war um sie gebreitet; gehend fühlte sie: man überschreitet nie die Größe, die sie jetzt empfand. Und es drängte sie, die Hand zu legen auf den andern Leib, der weiter war. Und die Frauen schwankten sich entgegen und berührten sich Gewand und Haar. Jede, voll von ihrem Heiligtume, schützte sich mit der Gevatterin. Ach der Heiland in ihr war noch Blume, doch den Täufer in dem Schlooß der Muhme riß die Freude schon zum Hüpfen hin.
Argwohn Josephs
UND der Engel sprach und gab sich Müh an dem Mann, der seine Fäuste ballte: Aber siehst du nicht an jeder Falte, daß sie kühl ist wie die Gottesfrüh. Doch der andre sah ihn finster an, murmelnd nur: Was hat sie so verwandelt? Doch da schrie der Engel: Zimmermann, merkst du’s noch nicht, daß der Herrgott handelt? Weil du Bretter machst, in deinem Stolze, willst du wirklich den zu Rede stelln, der bescheiden aus dem gleichen Holze Blätter treiben macht und Knospen schwelln? Er begriff. Und wie er jetzt die Blicke, recht erschrocken, zu dem Engel hob, war der fort. Da schob er seine dicke Mütze langsam ab. Dann sang er lob.
Verkündigung über den Hirten
SEHT auf, ihr Männer. Männer dort am Feuer, die ihr den grenzenlosen Himmel kennt, Sterndeuter, hierher! Seht, ich bin ein neuer steigender Stern. Mein ganzes Wesen brennt und strahlt so stark und ist so ungeheuer voll Licht, daß mir das tiefe Firmament nicht mehr genügt. Laßt meinen Glanz hinein in euer Dasein –– Oh, die dunklen Blicke, die dunklen Herzen, nächtige Geschicke die euch erfüllen. Hirten, wie allein bin ich in euch. Auf einmal wird mir Raum. Stauntet ihr nich: der große Brotfruchtbaum warf einen Schatten. Ja, das kam von mir. Ihr Unerschrockenen, o wüßtet ihr, wie jetzt auf eurem schauenden Gesichte die Zukunft scheint. In diesem starken Lichte wird viel geschehen. Euch vertrau ichs, denn ihr seid verschwiegen; euch Gradgläubigen redet hier alles. Glut und Regen spricht, der Vögel Zug, der Wind und was ihr seid, keins überwiegt und wächst zur Eitelkeit sich mästend an. Ihr haltet nicht die Dinge auf im Zwischenraum der Brust um sie zu quälen. So wie seine Lust durch einen Engel strömt, so treibt durch euch das Irdische. Und wenn ein Dorngesträuch aufflammte plötzlich, dürfte noch aus ihm der Ewige euch rufen, Cherubim, wenn sie geruhten neben eurer Herde einherzuschreiten, wunderten euch nicht: ihr stürztet euch auf euer Angesicht, betetet an und nenntet dies die Erde. Doch dieses war. Nun soll ein Neues sein, von dem der Erdkreis ringender sich weitet. Was ist ein Dörnicht uns: Gott fühlt sich ein in einer Jungfrau Schoß. Ich bin der Schein von ihrer Innigkeit, der euch geleitet.
Geburt Christi
HÄTTEST du der Einfalt nicht, wie sollte dir geschehn, was jetzt die Nacht erhellt? Sieh, der Gott, der über Völkern grollte, macht sich mild und kommt in dir zur Welt. Hast du dir ihn größer vorgestellt? Was ist Größe? Quer durch alle Maße, die er durchstreicht, geht sein grades Los. Selbst ein Stern hat keine solche Straße. Siehst du, diese Könige sind groß, und sie schleppen dir vor deinen Schoß Schätze, die sie für die größten halten, und du staunst vielleicht bei dieser Gift ––: aber schau in deines Tuches Falten, wie er jetzt schon alles übertrifft. Aller Amber, den man weit verschifft, jeder Goldschmuck und das Luftgewürze, das sich trübend in die Sinne streut: alles dieses war von rascher Kürze, und am Ende hat man es bereut. Aber (du wirst sehen): Er erfreut.
Rast auf der Flucht in Aegypten
DIESE, die noch eben atemlos flohen mitten aus dem Kindermorden: o wie waren sie unmerklich groß über ihrer Wanderschaft geworden. Kaum noch daß im scheuen Rückwärtsschauen ihres Schreckens Not zergangen war, und schon brachten sie auf ihrem grauen Maultier ganze Städte in Gefahr; denn so wie sie, klein im großen Land, –– fast ein Nichts –– den starken Tempeln nahten, platzten alle Götzen wie verraten und verloren völlig den Verstand. Ist es denkbar, daß von ihrem Gange alles so verzweifelt sich erbost? und sie wurden vor sich selber bange, nur das Kind war namenlos getrost. Immerhin, sie mußten sich darüber eine Weile setzen. Doch da ging –– sieh: der Baum, der still sie überhing, wie ein Dienender zu ihnen über: er verneigte sich. Derselbe Baum, dessen Kränze toten Pharaonen für das Ewige die Stirnen schonen, neigte sich. Er fühlte neue Kronen blühen. Und sie saßen wie im Traum.
Von der Hochzeit zu Kana
KONNTE sie denn anders, als auf ihn stolz sein, der ihr Schlichtestes verschönte? War nicht selbst die hohe, großgewöhnte Nacht wie außer sich, da er erschien? Ging nicht auch, daß er sich einst verloren, unerhört zu seiner Glorie aus? Hatten nicht die Weisesten die Ohren mit dem Mund vertauscht? Und war das Haus nicht wie neu von seiner Stimme? Ach sicher hatte sie zu hundert Malen ihre Freude an ihm auszustrahlen sich verwehrt. Sie ging ihm staunend nach. Aber da bei jenem Hochzeitsfeste, als es unversehns an Wein gebrach, –– sah sie hin und bat um eine Geste und begriff nicht, daß er widersprach. Und dann tat er’s. Sie verstand es später, wie sie ihn in seinen Weg gedrängt: denn jetzt war er wirklich Wundertäter, und das ganze Opfer war verhängt, unaufhaltsam. Ja, es stand geschrieben. Aber war es damals schon bereit? Sie: sie hatte es herbeigetrieben in der Blindheit ihrer Eitelkeit. An dem Tisch voll Früchten und Gemüsen freute sie sich mit und sah nicht ein, daß das Wasser ihrer Tränendrüsen Blut geworden war mit diesem Wein.
Vor der Passion
O HAST du dies gewollt, du hättest nicht durch eines Weibes Leib entspringen dürfen: Heilande muß man in den Bergen schürfen, wo man das Harte aus dem Harten bricht. Tut dirs nicht selber leid, dein liebes Tal so zu verwüsten? Siehe meine Schwäche; ich habe nichts als Milch- und Tränenbäche, und du warst immer in der Überzahl. Mit solchem Aufwand wardst du mir verheißen. Was tratst du nicht gleich wild aus mir hinaus? Wenn du nur Tiger brauchst, dich zu zerreißen, warum erzog man mich im Frauenhaus, ein weiches reines Kleid für dich zu weben, darin nicht einmal die geringste Spur von Naht dich drückt ––: so war mein ganzes Leben, und jetzt verkehrst du plötzlich die Natur.
Pietà
JETZT wird mein Elend voll, und namenlos erfüllt es mich. Ich starre wie des Steins Inneres starrt. Hart wie ich bin, weiß ich nur Eins : Du wurdest groß –– ...... und wurdest groß, um als zu großer Schmerz ganz über meines Herzens Fassung hinauszustehn. Jetzt liegst du quer durch meinen Schoß, jetzt kann ich dich nicht mehr gebären.
Stillung Mariae mit dem Auferstandenen
WAS sie damals empfanden: ist es nicht vor allen Geheimnissen süß und immer noch irdisch: da er, ein wenig blaß noch vom Grab, erleichtert zu ihr trat: an allen Stellen erstanden. O zu ihr zuerst. Wie waren sie da unaussprechlich in Heilung. Ja sie heilten, das war’s. Sie hatten nicht nötig, sich stark zu berühren. Er legte ihr eine Sekunde kaum seine nächstens ewige Hand an die frauliche Schulter. Und sie begannen still wie die Bäume im Frühling, unendlich zugleich, diese Jahreszeit ihres äußersten Umgangs.
Vom Tode Mariae
(Drei Stücke)
I
DERSELBE große Engel, welcher einst ihr der Gebärung Botschaft niederbrachte, stand da, abwartend daß sie ihn beachte, und sprach: Jetzt wird es Zeit, daß du erscheinst. Und sie erschrak wie damals und erwies sich wieder als die Magd, ihn tief bejahend. Er aber strahlte und, unendlich nahend, schwand er wie in ihr Angesicht –– und hieß die weithin ausgegangenen Bekehrer zusammenkommen in das Haus am Hang, das Haus des Abendmahls. Sie kamen schwerer und traten bange ein: Da lag, entlang die schmale Bettstatt, die in Untergang und Auserwählung rätselhaft Getauchte, ganz unversehrt, wie eine Ungebrauchte, und achtete auf englischen Gesang. Nun da sie alle hinter ihren Kerzen abwarten sah, riß sie vom Übermaß der Stimmen sich und schenkte noch von Herzen die beiden Kleider fort, die sie besaß, und hob ihr Antlitz auf zu dem und dem... (O Ursprung namenloser Tränen-Bäche). Sie aber legte sich in ihre Schwäche und zog die Himmel an Jerusalem so nah heran, daß ihre Seele nur, austretend, sich ein wenig strecken mußte: schon hob er sie, der alles von ihr wußte, hinein in ihre göttliche Natur.
II
WER hat bedacht, daß bis zu ihrem Kommen der viele Himmel unvollständig war? Der Auferstandne hatte Platz genommen, doch neben ihm, durch vierundzwanzig Jahr, war leer der Sitz. Und sie begannen schon sich an die reine Lücke zu gewöhnen, die wie verheilt war, denn mit seinem schönen Hinüberscheinen füllte sie der Sohn. So ging auch sie, die in die Himmel trat, nicht auf ihn zu, so sehr es sie verlangte; dort war kein Platz, nur Er war dort und prangte mit einer Strahlung, die ihr wehe tat. Doch da sie jetzt, die rührende Gestalt, sich zu den neuen Seligen gesellte und unauffällig, licht zu licht, sich stellte, da brach aus ihrem Sein ein Hinterhalt von solchem Glanz, daß der von ihr erhellte Engel geblendet aufschrie: Wer ist die? Ein Staunen war. Dann sahn sie alle, wie Gott-Vater oben unsern Herrn verhielt, so daß, von milder Dämmerung umspielt, die leere Stelle wie ein wenig Leid sich zeigte, eine Spur von Einsamkeit, wie etwas, was er noch ertrug, ein Rest irdischer Zeit, ein trockenes Gebrest ––. Man sah nach ihr; sie schaute ängstlich hin, weit vorgeneigt, als fühlte sie: ich bin sein längster Schmerz ––: und stürzte plötzlich vor. Die Engel aber nahmen sie zu sich und stützten sie und sangen seliglich und trugen sie das letzte Stück empor.
III
DOCH vor dem Apostel Thomas, der kam, da es zu spät war, trat der schnelle längst darauf gefaßte Engel her und befahl an der Begräbnisstelle. Dräng den Stein beiseite. Willst du wissen, wo die ist, die dir das Herz bewegt: Sieh: sie ward wie ein Lavendelkissen eine Weile da hineingelegt, daß die Erde künftig nach ihr rieche in den Falten wie ein feines Tuch. Alles Tote (fühlst du), alles Sieche ist betäubt von ihrem Wohl-Geruch. Schau den Leinwand: wo ist eine Bleiche, wo er blendend wird und geht nicht ein? Dieses Licht aus dieser reinen Leiche War ihm klärender als Sonnenschein. Staunst du nicht, wie sanft sie ihm entging? Fast als wär sie’s noch, nichts ist verschoben. Doch die Himmel sind erschüttert oben: Mann, knie hin und sieh mir nach und sing.
Sonette an Orpheus –– 1. Teil
Sonett 1
Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung! O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr! Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Tiere aus Stille drangen aus dem klaren gelösten Wald von Lager und Genist; und da ergab sich, daß sie nicht aus List und nicht aus Angst in sich so leise waren, sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Geröhr schien klein in ihren Herzen. Und wo eben kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen mit einem Zugang, dessen Pfosten beben, –– da schufst du ihnen Tempel im Gehör.
Sonett 2
Und fast ein Mädchen wars und ging hervor aus diesem einigen Glück von Sang und Leier und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier und machte sich ein Bett in meinem Ohr. Und schlief in mir. Und alles war ihr Schlaf. Die Bäume, die ich je bewundert, diese fühlbar Ferne, die gefühlte Wiese und jedes Staunen, das mich selbst betraf. Sie schlief die Welt. Singender Gott, wie hast du sie vollendet, daß sie nicht begehrte, erst wach zu sein? Sieh, sie erstand und schlief. Wo ist ihr Tod? O wirst du dies Motiv erfinden noch, eh sich dein Lied verzehrte? –– Wo sinkt sie hin aus mir? ... Ein Mädchen fast ...
Sonett 3
Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier? Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier Herzwege steht kein Tempel für Apoll. Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr, nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes ; Gesang ist Dasein. Für den Gott ein Leichtes. Wann aber sind wir? Und wann wendet er an unser Sein die Erde und die Sterne? Dies ists nicht, Jüngling, daß du liebst, wenn auch die Stimme dann den Mund dir aufstößt, –– lerne vergessen, daß du aufsangst. Das verrinnt. In Wahrheit singen, ist ein andrer Hauch. Ein Hauch um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein Wind.
Sonett 4
O ihr Zärtlichen, tretet zuweilen in den Atem, der euch nicht meint, laßt ihn an eueren Wangen sich teilen, hinter zittert er, wieder vereint. O ihr Seligen o ihr Heilen, die ihr der Anfang der Herzen scheint. Bogen der Pfeile und Ziele von Pfeilen, ewiger glänzt euer Lächeln verweint. Fürchtet Euch nicht zu leiden, die Schwere, gebt sie zurück an der Erde Gewicht; schwer sind die Berge, schwer sind die Meere. Selbst die als Kinder ihr pflanztet, die Bäume, wurden zu schwer längst; ihr trügt sie nicht. Aber die Lüfte... aber die Räume...
Sonett 5
Errichtet keinen Denkstein. Laßt die Rose nur jedes Jahr zu seinen Gunsten blühn. Denn Orpheus ists. Seine Metamorphose in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühn um andre Namen. Ein für alle Male ists Orpheus, wenn es singt. Er kommt und geht. Ists nicht schon viel, wenn er die Rosenschale um ein paar Tage manchmal übersteht? O wie er schwinden muß, daß ihrs begrifft! Und wenn ihm selbst auch bangte, daß er schwände. Indem sein Wort das Hiersein übertrifft, ist er schon dort, wohin ihrs nicht begleitet. Der Leier Gitter zwängt ihm nicht die Hände. Und er gehorcht, indem er überschreitet.
Sonett 6
Ist er ein Hiesiger? Nein, aus beiden Reichen erwuchs seine weite Natur. Kundiger böge die Zweige der Weiden, wer die Wurzeln der Weiden erfuhr. Geht ihr zu Bette, so laßt auf dem Tische Brot nicht und Milch nicht; die Toten ziehts ––. Aber er, der Beschwörende mische unter der Milde des Augenlids ihre Erscheinung in alles Geschaute; und der Zauber von Erdreich und Raute sei ihm so wahr wie der klarste Bezug. Nichts kann das gültige Bild ihm verschlimmern; sei es aus Gräbern, sei aus Zimmern, rühme er Fingerring, Spange und Krug.
Sonett 7
Rühmen, das ists! Ein zum Rühmen Bestellter, ging er hervor wie das Erz aus des Steins Schweigen. Sein Herz, o vergängliche Kelter eines den Menschen unendlichen Weins. Nie versagt ihm die Stimme am Staube, wenn ihn das göttliche Beispiel ergreift. Alles wird Weinberg, alles wird Traube, in seinem fühlenden Süden gereift. Nicht in den Grüften der Könige Moder straft ihm die Rühmung Lügen, oder daß von den Göttern ein Schatten fällt. Er ist einer der bleibenden Boten, der noch weit in die Türen der Toten Schalen mit rühmlichen Früchten hält.
Sonett 8
Nur im Raum der Rühmung darf die Klage gehen, die Nymphe des geweinten Quells, wachend über unserm Niederschlage, daß er klar sei an demselben Fels, der die Tore trägt und die Altäre. –– Sieh, um ihre stillen Schultern früht das Gefühl, daß sie die jüngste wäre unter den Geschwistern im Gemüt. Jubel weiß und Sehnsucht ist geständig, –– nur die Klage lernt noch; mädchenhändig zählt sie nächtelang das alte Schlimme. Aber plötzlich, schräg und ungeübt, hält sie doch ein Sternbild unserer Stimme in den Himmel, den ihr Hauch nicht trübt.
Sonett 9
Nur wer die Leier schon hob auch unter Schatten, darf das unendliche Lob ahnend erstatten. Nur wer mit Toten vom Mohn aß, von dem ihren, wird nicht den leisesten Ton wieder verlieren. Mag auch die Spieglung im Teich oft uns verschwimmen: Wisse das Bild. Erst in dem Doppelbereich werden die Stimmen ewig und mild.
Sonett 10
Euch, die ihr nie mein Gefühl verließt, grüß ich, antikische Sarkophage, die das fröhliche Wasser römischer Tage als ein wandelndes Lied durchfließt. Oder jene so offenen, wie das Aug eines frohen erwachenden Hirten, –– innen voll Stille und Bienensaug –– denen entzückte Falter entschwirrten; alle, die man dem Zweifel entreißt, grüß ich, die wiedergeöffneten Munde, die schon wußten, was schweigen heißt. Wissen wirs, Freunde, wissens wir nicht? Beides bildet die zögernde Stunde in dem menschlichen Angesicht.
Sonett 11
Sieh den Himmel. Heißt kein Sternbild Reiter? Denn dies ist uns seltsam eingeprägt: dieser Stolz aus Erde. Und ein Zweiter, der ihn treibt und hält und den er trägt. Ist nicht so, gejagt und dann gebändigt, diese sehnige Natur des Seins? Weg und Wendung. Doch ein Druck verständigt. Neue Weite. Und die zwei sind eins. Aber sind sie’s? Oder meinen beide nicht den Weg, den sie zusammen tun? Namenlos schon trennt sie Tisch und Weide. Auch die sternische Verbindung trügt. Doch uns freue eine Weile nun der Figur zu glauben. Das genügt.
Sonett 12
Heil dem Geist, der uns verbinden mag; denn wir leben wahrhaft in Figuren. Und mit kleinen Schritten gehen die Uhren neben unserm eigentlichen Tag. Ohne unsern wahren Platz zu kennen, handeln wir aus wirklichem Bezug. Die Antennen fühlen die Antennen, und die leere Ferne trug ... Reine Spannung. O Musik der Kräfte! Ist nicht durch die läßlichen Geschäfte jede Störung von dir abgelenkt? Selbst wenn sich der Bauer sorgt und handelt, wo die Saat in Sommer sich verwandelt, reicht er niemals hin. Die Erde schenkt.
Sonett 13
Voller Apfel, Birne und Banane, Stachelbeere ... Alles dieses spricht Tod und Leben in den Mund ... Ich ahne ... Lest es einem Kind vom Angesicht, wenn es sie erschmeckt. Dies kommt von weit. Wird euch langsam namenlos im Munde? Wo sonst Worte waren, fließen Funde, aus dem Fruchtfleisch überrascht befreit. Wagt zu sagen, was ihr Apfel nennt. Diese Süße, die sich erst verdichtet, um, im Schmecken leise aufgerichtet, klar zu werden, wach und transparent, doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig ––: O Erfahrung, Fühlung, Freude ––, riesig!
Sonett 14
Wir gehen um mit Blume, Weinblatt, Frucht. Sie sprechen nicht die Sprache nur des Jahres. Aus Dunkel steigt ein buntes Offenbares und hat vielleicht den Glanz der Eifersucht der Toten an sich, die die Erde stärken. Was wissen wir von ihren Teil an dem? Es ist seit langem ihre Art, den Lehm mit ihrem freiem Marke zu durchmärken. Nun fragt sich nur : tun sie es gern? ... Drängt diese Frucht, ein Werk von schweren Sklaven, geballt zu uns empor, zu ihren Herrn? Sind sie die Herren, die bei den Wurzel schlafen, und gönnen uns aus ihren Überflüssen dies Zwischending aus stummer Kraft und Küssen?
Sonett 15
Wartet ..., das schmeckt ... Schon ists auf der Flucht. ... Wenig Musik nur, ein Stampfen, ein Summen ––: Mädchen, ihr warmen, Mädchen, ihr stummen, tanzt den Geschmack der erfahrenen Frucht! Tanzt die Orange. Wer kann sie vergessen, wie sie, ertrinkend in sich, sich wehrt wider ihr Süßsein. Ihr habt sie besessen. Sie hat sich köstlich zu euch bekehrt. Tanzt die Orange. Die wärmere Landschaft, werft sie aus euch, daß die reife erstrahle in Lüften der Heimat! Erglühte, enthüllt Düfte um Düfte. Schafft die Verwandtschaft mit der reinen, sich weigernden Schale, mit dem Saft, der die glückliche füllt!
Sonett 16
Du, mein Freund, bist einsam, weil...Wir machen mit Worten und Fingerzeigen uns allmählich die Welt zu eigen, vielleicht ihren schwächsten, gefährlichsten Teil. Wer zeigt mit den Fingern auf einen Geruch? –– Doch von den Kräften, die uns bedrohten, fühlst du viele ... Du kennst die Toten, und du erschrickst vor dem Zauberspruch. Sieh, nun heißt es zusammen ertragen Stückwerk und Teile, als sei es das Ganze. Dir helfen wird schwer sein. Vor allem: pflanze mich nicht in dein Herz. Ich wüchse zu schnell. Doch meines Herren Hand will ich führen und sagen: Hier. Das ist Esau in seinem Fell.
Sonett 17
Zu unterst der Alte, verworrn, all der Erbauten Wurzel, verborgener Born, den sie nie schauten. Sturmhelm und Jägerhorn, Spruch von Ergrauten, Männer im Bruderzorn, Frauen wie Lauten ... Drängender Zweig an Zweig, nirgends ein freier ... Einer! o steig ... o steig ... Aber sie brechen noch. Dieser erst oben doch biegt sich zur Leier.
Sonett 18
Hörst du das Neue, Herr, dröhnen und beben? Kommen Verkündiger, die es erheben. Zwar ist kein Hören heil in dem Durchtobtsein. doch der Maschinenteil will jetzt gelobt sein. Sieh, die Maschine: wie sie sich wälzt und rächt und uns entstellt und schwächt. Hat sie aus uns auch Kraft, sie, ohne Leidenschaft, treibe und diene.
Sonett 19
Wandelt sich rasch auch die Welt wie Wolkengestalten, alles Vollendete fällt heim zum Uralten. Über dem Wandel und Gang, weiter und freier, währt noch dein Vor-Gesang, Gott mit der Leier. Nicht sind die Leiden erkannt, nicht ist die Liebe gelernt, und was im Tod uns entfernt, ist nicht entschleiert. Einzig das Lied überm Land heiligt und feiert.
Sonett 20
Dir aber, Herr, o was weih ich dir, sag, der das Ohr den Geschöpfen gelehrt? –– Mein Erinnern an einen Frühlingstag, seinen Abend, in Rußland ––, ein Pferd... Herüber vom Dorf kam der Schimmel allein, an der vorderen Fessel den Pflock, um die Nacht auf den Wiesen allein zu sein; wie schlug der Mähne Gelock an dem Hals im Takte des Übermuts, bei dem grob gehemmten Galopp. Wie sprangen die Quellen des Rossebluts! Der fühlte die Weiten, und ob! Der sang und der hörte ––, dein Sagenkreis war in ihm geschlossen. Sein Bild: ich weih’s.
Sonett 21
Frühling ist wiedergekommen. Die Erde ist wie ein Kind, das Gedichte weiß; viele, o viele ... Für die Beschwerde langen Lernens bekommt sie den Preis. Streng war ihr Lehrer. Wir mochten das Weiße an dem Barte des alten Manns. Nun, wie das Grüne, das Blaue heiße, dürfen wir fragen: sie kanns, sie kanns! Erde, die frei hat, du glückliche, spiele nun mit den Kindern. Wir wollen dich fangen, fröhliche Erde. Dem Frohsten gelingts. O, was der Lehrer sie lehrte, das Viele, und was gedruckt steht in Wurzeln und langen schwierigen Stämmen : sie singts, sie singts.
Sonett 22
Wir sind die Treibenden. Aber den Schritt der Zeit, nehmt in als Kleinigkeit im immer Bleibenden. Alle das Eilende wird schon vorüber sein; denn da Verweilende erst weiht uns ein. Knaben o werft den Mut nicht in die Schnelligkeit, nicht in den Flugversuch. Alles ist ausgeruht. Dunkel und Helligkeit Blume und Buch.
Sonett 23
O erst dann, wenn der Flug nicht mehr um seinetwillen wird in die Himmelstillen steigen, sich selber genug, um in lichten Profilen, als das Gerät, das gelang, Liebling der Winde zu spielen, sicher schwenkend und schlank, –– erst wenn ein reines Wohin wachsender Apparate Knabenstolz überwiegt, wird, überstürzt von Gewinn, jener den Fernen Genahtesein, was er einsam erfliegt.
Sonett 24
Sollen wir unsere uralte Freundschaft, die großen niemals werbenden Götter, weil sie der harte Stahl, den wir streng erzogen, nicht kennen, verstoßen oder sie plötzlich suchen auf einer Karte? Diese gewaltigen Freunde, die uns die Toten nehmen, rühren nirgends an unsere Räder. Unsere Gastmähler haben wir weit ––, unsere Bäder, fortgerückt, und ihre uns lang schon zu langsamen Boten überholen wir immer. Einsamer nun aufeinander ganz angewiesen, ohne einander zu kennen, führen wir nicht mehr die Pfade als schöne Mäander, sondern als Grade. Nur noch in Dampfkesseln brennen die einstigen Feuer und heben die Hämmer, die immer größern. Wir aber nehmen an Kraft ab, wie Schwimmer.
Sonett 25
Dich aber will ich nun, Dich, die ich kannte wie eine Blume, von ich den Namen nicht weiß, noch ein Mal erinnern und ihnen zeigen, Entwandte, schöne Gespielin, des unüberwindlichen Schrei’s. Tänzerin erst, die plötzlich, den Körper voll Zögern anhielt, als göß man ihr Jungsein in Erz; trauernd und lauschend ––. Da, von den hohen Vermögern fiel ihr Musik in das veränderte Herz. Nah war die Krankheit. Schon von den Schatten bemächtigt, drängte verdunkelt das Blut, doch, wie flüchtig verdächtigt, trieb es in seinen natürlichen Frühling hervor. Wieder und wieder, von Dunkel und Sturz unterbrochen, glänzte es irdisch. Bis es nach schrecklichem Pochen trat in das trostlos offene Tor.
Sonett 26
Du aber, Göttlicher, du, bis zuletzt noch Ertöner, da ihn der Schwarm der verschmähten Mänaden befiel, hast ihr Geschrei übertönt mit Ordnung, du Schöner, aus den Zerstörenden stieg dein erbauendes Spiel. Keine war da, daß sie Haupt dir und Leier zerstör. Wie sie auch rangen und rasten, und alle die scharfen Steine, die sie nach deinem Herzen warfen, wurden zu Sanften an dir und begabt mit Gehör. Schließlich zerschlugen sie dich, von der Rache gehetzt, während dein Klang noch in Löwen und Felsen verweilte und in den Bäumen und Vögeln. Dort singst du noch jetzt. O du verlorener Gott! Du unendliche Spur! Nur weil dich reißend zuletzt die Feindschaft verteilte, sind wir die Hörenden jetzt und ein Mund der Natur.
Sonette an Orpheus –– 2. Teil
Sonett 1
Atmen, du unsichtbares Gedicht! Immerfort um das eigne Sein rein eingetauschter Weltraum. Gegengewicht, in dem ich mich rhythmisch ereigne. Einzige Welle, deren allmähliches Meer ich bin; sparsamstes du von allen möglichen Meeren, –– Raumgewinn. Wieviele von diesen Stellen der Räume waren schon innen in mir. Manche Winde sind wie mein Sohn. Erkennst du mich, Luft, du, voll noch einst meiniger Orte? Du, einmal glatte Rinde, Rundung und Blatt meiner Worte.
Sonett 2
So wie dem Meister manchmal das eilig nähere Blatt den wirklichen Strich abnimmt: so nehmen oft Spiegel das heilig einzige Lächeln der Mädchen in sich, wenn sie den Morgen erproben, allein, –– oder im Glanze der dienenden Lichter. Und in das Atmen der echten Gesichter, später, fällt nur ein Widerschein.Was haben Augen einst ins umrußte lange Verglühn der Kamine geschaut: Blicke des Lebens, für immer verlorne. Ach, der Erde, wer kennt die Verluste? Nur, wer mit dennoch preisendem Laut sänge das Herz, das ins Ganze geborne.
Sonett 3
Spiegel: noch nie hat man wissend beschrieben, was ihr in euerem Wesen seid. Ihr, wie mit lauter Löchern von Sieben erfüllten Zwischenräume der Zeit. Ihr, noch des leeren Saales Verschwender ––, wenn es dämmert, wie Wälder weit ... Und der Lüster geht wie ein Sechzehn-Ender durch eure Unbetretbarkeit. Manchmal seid ihr voll Malerei. Einige scheinen in euch gegangen ––, andere schicktet ihr scheu vorbei. Aber die Schönste wird bleiben, bis drüben in ihre enthaltenen Wangen eindrang der klare gelöste Narziß.
Sonett 4
O dieses ist das Tier, das es nicht gibt. Sie wußtens nicht und habens jeden Falls –– sein Wandeln, seine Haltung, seinen Hals, bis in des stillen Blickes Licht –– geliebt. Zwar war es nicht. Doch weil sie’s liebten, ward ein reines Tier. Sie ließen immer Raum. Und in dem Raume, klar und ausgespart erhob es leicht sein Haupt und brauchte kaum zu sein. Sie nährten es mit keinem Korn, nur immer mit der Möglichkeit, es sei. Und die gab solche Stärke an das Tier, daß es aus sich ein Stirnhorn trieb. Ein Horn. Zu einer Jungfrau kam es weiß herbei –– und war im Silber-Spiegel und in ihr.
Sonett 5
Blumenmuskel, der der Anemone Wiesenmorgen nach und nach erschließt, bis in ihren Schoß das polyphone Licht der lauten Himmel sich ergießt, in den stillen Blütenstern gespannter Muskel des unendlichen Empfangs, manchmal so von Fülle übermannter, daß der Ruhewink des Untergangs kaum vermag die weitzurückgeschnellten Blätterränder dir zurückzugeben: du, Entschluß und Kraft von wieviel Welten! Wir, Gewaltsamen, wir währen länger. Aber wann, in welchem aller Leben, sind wir endlich offen und Empfänger?
Sonett 6
Rose, du thronende, denen im Altertum warst du ein Kelch mit einfachem Rand.Uns aber bist du die volle zahllose Blume, der unerschöpfliche Gegenstand. In deinem Reichtum scheinst du wie Kleidung um Kleidung um einen Leib aus nichts als Glanz; aber dein einzelnes Blatt ist zugleich die Vermeidung und die Verleugnung jedes Gewands. Seit Jahrhunderten ruft uns dein Duft seinen süßesten Namen herüber; plötzlich liegt er wie Ruhm in der Luft. Dennoch wir wissen ihn nicht zu nennen, wir raten... Und Erinnerung geht zu ihm über, die wir von rufbaren Stunden erbaten.
Sonett 7
Blumen, ihr schließlich den ordnenden Händen verwandte, (Händen der Mädchen von einst und jetzt), die auf dem Gartentisch oft von Kante zu Kante lagen, ermattet und sanft verletzt, wartend des Wassers, das sie noch einmal erhole aus dem begonnenen Tod ––, und nun wieder erhobene zwischen die strömenden Pole fühlender Finger, die wohlzutun mehr noch vermögen, als ihr ahntet, ihr leichten, wenn ihr euch wiederfandet im Krug, langsam erkühlend und Warmes der Mädchen, wie Beichten, von euch gebend, wie trübe ermüdende Sünden, die das Gepflücktsein beging, als Bezug wieder zu ihnen, die sich euch blühend verbünden.
Sonett 8
Wenige ihr, der einstigen Kindheit Gespielen in den zerstreuten Gärten der Stadt: wie wir uns fanden und uns zögernd gefielen und, wie das Lamm mit dem redenden Blatt, sprachen als Schweigende. Wenn wir uns einmal freuten, keinem gehörte es. Wessen wars? Und wie zergings unter allen den gehenden Leuten und im Bangen des langen Jahrs. Wagen umrollten uns fremd, vorübergezogen, Häuser umstanden uns stark, aber unwahr, –– und keines kannte uns je. Was war wirklich im All? Nichts. Nur die Bälle, ihre herrlichen Bogen. Auch nicht die Kinder ... Aber manchmal trat eines, ach ein vergehendes, unter den fallenden Ball.(In memoriam Egon von Rilke)
Sonett 9
Rühmt euch, ihr Richtenden, nicht der entbehrlichen Folter und daß das Eisen nicht länger an Hälsen sperrt. Keins ist gesteigert, kein Herz ––, weil ein gewollter Krampf der Milde euch zarter verzerrt. Was es durch Zeiten bekam, das schenkt das Schafott wieder zurück, wie Kinder ihr Spielzeug vom vorig alten Geburtstag. Ins reine, ins hohe, ins torig offene Herz träte er anders, der Gott wirklicher Milde. Er käme gewaltig und griffe strahlender um sich, wie Göttliche sind.Mehr als ein Wind für die großen gesicherten Schiffe. Weniger nicht, als die heimliche leise Gewahrung, die uns im Innern schweigend gewinnt wie ein still spielendes Kind aus unendlicher Paarung.
Sonett 10
Alles Erworbene bedroht die Maschine, solange sie sich erdreistet, im Geist, statt im Gehorchen, zu sein. Daß nicht der herrlichen Hand schöneres Zögern mehr prange, zu dem entschlossenern Bau schneidet sie steifer den Stein. Nirgends bleibt sie zurück, daß wir ihr ein Mal entrönnen und sie in stiller Fabrik ölend sich selber gehört. Sie ist das Leben, –– sie meint es am besten zu können, die mit dem gleichen Entschluß ordnet und schafft und zerstört. Aber noch ist uns das Dasein verzaubert; an hundert Stellen ist es noch Ursprung. Ein Spielen von reinen Kräften, die keiner berührt, der nicht kniet und bewundert. Worte gehen noch zart am Unsäglichen aus ... Und die Musik, immer neu, aus den bebendsten Steinen, baut im unbrauchbaren Raum ihr vergöttlichtes Haus.
Sonett 11
Manche, des Todes, entstand ruhig geordnete Regel, weiterbezwingender Mensch, seit du im Jagen beharrst; mehr doch als Falle und Netz, weiß ich dich, Streifen von Segel, den man hinuntergehängt in den höhligen Karst. Leise ließ man dich ein, als wärst du ein Zeichen, Frieden zu feiern. Doch dann : rang dich am Rande der Knecht, –– und aus den Höhlen, die Nacht warf eine Handvoll von bleichen taumelnden Tauben ans Licht... Aber auch das ist im Recht. Fern von dem Schauenden sie jeglicher Hauch des Bedauerns, nicht nur vom Jäger allein, der, was sich zeitig erweist, wachsam und handelnd vollzieht.Töten ist eine Gestalt unseres wandernden Trauerns ... Rein ist im heiteren Geist, was an uns selber geschieht.
Sonett 12
Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert, drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt; jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt. Was sich ins Bleiben verschließt, schon ists das Erstarrte; wähnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Grau’s? Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte. Wehe ––: abwesender Hammer holt aus! Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung; und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne, das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt. Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung, den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne will, seit sie lorbeern fühlt, daß du dich wandelst in Wind.
Sonett 13
Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter dir, wie der Winter, der eben geht. Denn unter Wintern ist einer so endlich Winter, daß, überwinternd, Dein Herz überhaupt widersteht. Sei immer tot in Eurydike ––, singender steige, preisender steige zurück in den reinen Bezug. Hier, unter Schwindenden, sei, im Reiche der Neige, sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug. Sei –– und wisse zugleich des Nicht-Seins Bedingung, den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung, daß du sie völlig vollziehst dieses einzige Mal. Zu dem gebrauchten sowohl, wie zum dumpfen und stummen Vorrat der vollen Natur, den unsäglichen Summen, zähle dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl.
Sonett 14
Siehe die Blumen, diese dem Irdischen treuen, denen wir Schicksal vom Rande des Schicksals leihn, –– aber wer weiß es! Wenn sie ihr Welken bereuen, ist es an uns, ihre Reue zu sein. Alles will schweben. Da gehn wir umher wie Beschwerer, legen auf alles uns selbst, vom Gewichte entzückt; o was sind wir den Dingen für zehrende Lehrer, weil ihnen ewige Kindheit glückt. Nähme sie einer ins innige Schlafen und schliefe tief mit den Dingen ––: o wie käme er leicht, anders zum anderen Tag, aus der gemeinsamen Tiefe. Oder er bliebe vielleicht; und sie blühten und priesen ihn, den Bekehrten, der nun den Ihrigen gleicht, allen den stillen Geschwistern im Winde der Wiesen.
Sonett 15
O Brunnen-Mund, du gebender, du Mund, der unerschöpflich Eines, Reines spricht, –– du, vor des Wassers fließendem Gesicht, marmorne Maske. Und im Hintergrund der Aquädukte Herkunft. Weiter an Gräbern vorbei, vom Hang des Apennins tragen sie dir dein Sagen zu, das dann am schwarzen Altern deines Kinns vorüberfällt in das Gefäß davor. Dies ist das schlafend hingelegte Ohr, das Marmorohr, in das du immer sprichst. Ein Ohr der Erde. Nur mit sich allein redet sie also. Schiebt ein Krug sich ein, so scheint es ihr, daß du sie unterbrichst.
Sonett 16
Immer wieder von uns aufgerissen, ist der Gott die Stelle, welche heilt. Wir sind Scharfe, denn wir wollen wissen, aber er ist heiter und verteilt. Selbst die reine, die geweihte Spende nimmt er anders nicht in seine Welt, als indem er sich dem freien Ende unbewegt entgegenstellt. Nur der Tote trinkt aus der hier von uns gehörten Quelle, wenn der Gott ihm schweigend winkt, dem Toten.Uns wird nur das Lärmen angeboten. Und das Lamm erbittet seine Schelle aus dem stilleren Instinkt.
Sonett 17
Wo, in welchen immer selig bewässerten Gärten, an welchen Bäumen, aus welchen zärtlich entblätterten Blüten-Kelchen reifen die fremdartigen Früchte der Tröstung? Diese köstlichen, deren du eine vielleicht in der zertretenen Wiese deiner Armut findest. Von einem zum anderen Male wunderst du dich über die Größe der Frucht, über ihr Heilsein, über die Sanftheit der Schale und daß sie der Leichtsinn des Vogels dir nicht vorwegnahm und nicht die Eifersucht unten des Wurms. Gibt es denn Bäume, von Engeln beflogen, und von verborgenen langsamen Gärtnern so seltsam gezogen, daß sie uns tragen ohne uns zu gehören? Haben wir niemals vermocht, wir Schatten und Schemen, durch unser voreilig reifes und wieder welkes Benehmen jener gelassenen Sommer Gleichmut zu stören?
Sonett 18
Tänzerin: o du Verlegung alles Vergehens in Gang: Wie brachtest du’s dar. Und dieser Wirbel am Schluß, dieser Baum aus Bewegung, nahm er nicht ganz in Besitz das erschwungene Jahr? Blühte nicht, daß ihn dein Schwingen von vorhin umschwärme, plötzlich sein Wipfel voll Stille? Und über ihr, war sie nicht Sonne, war sie nicht Sommer, die Wärme diese unzählige Wärme aus dir? Aber er trug auch, er trug, dein Baum der Ekstase. Sind sie nicht seine ruhigen Früchte : Der Krug, reifend gestreift, und die gereiftere Vase? Und in den Bildern: ist nicht die Zeichnung geblieben, die deiner Braue dunkler Zug rasch an die Wandung der eigenen Wendung geschrieben?
Sonett 19
Irgendwo wohnt das Gold in der verwöhnenden Bank und mit Tausenden tut es vertraulich. Doch jener Blinde, der Bettler, ist selbst dem kupfernern Zehner, wie ein verlorener Ort, wie das staubige Eck unterm Schrank. In den Geschäften entlang ist das Geld wie zuhause und verkleidet sich scheinbar in Seide, Nelken und Pelz. Er, der Schweigende, steht in der Atempause alles des wach oder schlafend atmenden Gelds. O wie mag sie sich schließen bei Nacht, diese immer offene Hand. Morgen holt sie das Schicksal wieder, und täglich hält es sie hin: hell, elend, unendlich zerstörbar. Daß doch einer, ein Schauender, endlich ihren langen Bestand staunend begriffe und rühmte. Nur dem Aufsingenden säglich. Nur dem Göttlichen hörbar.
Sonett 20
Zwischen den Sternen, wie weit; und doch, um wievieles noch weiter, was man am Hiesigen lernt. Einer, zum Beispiel ein Kind... und ein Nächster, ein Zweiter ––, o wie unfaßlich entfernt. Schicksal, es mißt uns vielleicht mit des Seienden Spanne, daß es uns fremd erscheint; denk, wieviel Spannen allein vom Mädchen zum Manne, wenn es ihn meidet und meint. Alles ist weit ––, und nirgends schließt sich der Kreis. Sieh in der Schüssel, auf heiter bereitetem Tische seltsam der Fische Gesicht Fische sind stumm ..., meinte man einmal. Wer weiß? Aber ist nicht am Ende ein Ort, wo man das, was der Fische Sprache wäre, ohne sie spricht?
Sonett 21
Singe die Gärten, mein Herz, die du nicht kennst; wie in Glas eingegossene Gärten, klar, unerreichbar, Wasser und Rosen von Isphahan oder Schiras, singe sie selig, preise sie, keinem vergleichbar. Zeige, mein Herz, daß du sie niemals entbehrst. Daß sie dich meinen, ihre reifenden Feigen. Daß du mit ihren, zwischen den blühenden Zweigen wie zum Gesicht gesteigerten Lüften verkehrst. Meide den Irrtum, daß es Entbehrungen gebe für den geschehnen Entschluß, diesen: zu sein! Seidener Faden, kamst du hinein ins Gewebe. Welchem der Bilder du auch im Innern geeint bist (sei es selbst ein Moment aus dem Leben der Pein), fühl, daß der ganze, rühmliche Teppich gemeint ist.
Sonett 22
O trotz Schicksal: die herrlichen Überflüsse unseres Daseins, in Parken übergeschäumt, –– oder als steinerne Männer neben die Schlüsse hoher Portale, unter Balkone gebäumt! O die eherne Glocke, die ihre Keule täglich wider den stumpfen Alltag hebt. Oder die eine, in Karnak, die Säule, die Säule, die fast ewige Tempel überlebt. Heute stürzen die Überschüsse, dieselben, nur noch als Eile vorbei, aus dem waagrechten gelben Tag in die blendend mit Licht übertriebene Nacht. Aber das Rasen zergeht und läßt keine Spuren. Kurven des Flugs durch die Luft und die, die sie fuhren, keine vielleicht ist umsonst. Doch nur wie gedacht.
Sonett 23
Rufe mich zu jener Deiner Stunden, die dir unaufhörlich widersteht: flehend nah, wie das Gesicht von Hunden, aber immer wieder weggedreht, wenn du endlich meinst, sie zu erfassen. So Entzognes ist am meisten dein. Wir sind frei. Wir wurden dort entlassen wo wir meinten erst begrüßt zu sein. Bang verlangen wir nach einem Halte, wir zu Jungen manchmal für das Alte und zu alt für das, was niemals war. Wir, gerecht nur, wo wir dennoch preisen, weil wir, ach, der Ast sind und das Eisen und das Süße reifender Gefahr.
Sonett 24
O diese Lust, immer neu, aus gelockertem Lehm! Niemand beinah hat den frühesten Wagern geholfen. Städte entstanden trotzdem an beseligten Golfen, Wasser und Öl füllten die Krüge trotzdem. Götter, wir planen sie erst in erkühnten Entwürfen, die uns das mürrische Schicksal wieder zerstört. Aber sie sind die Unsterblichen. Sehet, wir dürfen jenen erhorchen, der uns am Ende erhört. Wir, ein Geschlecht durch Jahrtausende: Mütter und Väter, immer erfüllter von dem künftigen Kind, daß es uns einst, übersteigend, erschüttere, später. Wir, wir unendlich Gewagten, was haben wir Zeit! Und nur der schweigsame Tod, der weiß, was wir sind und was er immer gewinnt, wenn er uns leiht.
Sonett 25
Schon, horch, hörst du der ersten Harken Arbeit; wieder den menschlichen Takt in der verhaltenen Stille der starken Vorfrühlingserde. Unabgeschmackt scheint dir das Kommende. Jenes so oft dir schon Gekommene scheint dir zu kommen wieder wie Neues. Immer erhofft nahmst du es niemals. Es hat dich genommen. Selbst die Blätter durchwinterter Eichen scheinen im Abend ein künftiges Braun Manchmal geben sich Lüfte ein Zeichen. Schwarz sind die Sträucher. Doch Haufen von Dünger lagern als satteres Schwarz in den Aun. Jede Stunde, die hingeht, wird jünger.
Sonett 26
Wie ergreift uns der Vogelschrei... Irgendein einmal erschaffenes Schreien. Selbst die Kinder schon, spielend im Freien, schreien am wirklichen Schreien vorbei. Schreien den Zufall. In Zwischenräume dieses, des Weltraums, (in welchen der heile Vogelschrei eingeht, wie Menschen in Träume ––) treiben sie ihre, des Kreischens, Keile. Wehe, wo sind wir? Immer noch freier wie die losgerissenen Drachen jagen wir halbhoch, mit Rändern von Lachen, windig zerfetzten. –– Ordne die Schreier, singender Gott! daß sie rauschend erwachen, tragend als Strömung das Haupt und die Leier.
Sonett 27
Gibt es wirklich die Zeit, die zerstörende? Wann, auf dem ruhenden Berg, zerbricht sie die Burg? Dieses Herz, das unendlich den Göttern gehörende, wann vergewaltigts der Demiurg? Sind wir wirklich so ängstlich Zerbrechliche, wie das Schicksal uns wahr machen will? Ist die Kindheit, die tiefe versprechliche, in den Wurzeln –– später –– still? Ach, das Gespenst des Vergänglichen, durch den arglos Empfänglichen geht es, als wär es ein Rauch. Als die, die wir sind, als die Treibenden, gelten wir doch bei bleibenden Kräften als göttlicher Brauch.
Sonett 28
O komm und geh. Du, fast noch Kind, ergänze für einen Augenblick die Tanzfigur zum reinem Sternbild eines jener Tänze, darin wir die dumpf ordnende Natur vergänglich übertreffen. Denn sie regte sich völlig hörend nur, da Orpheus sang. Du warst noch die von damals her Bewegte und leicht befremdet, wenn ein Baum sich lang besann, mit dir nach dem Gehör zu gehen. Du wußtest noch die Stelle, wo die Leier sich tönend hob ––; die unerhörte Mitte. Für sie versuchtest du die schönen Schritte und hofftest, einmal zu der heilen Feier des Freundes Gang und Antlitz hinzudrehn.
Sonett 29
Stiller Freund der vielen Fernen, fühle, wie dein Atem noch den Raum vermehrt. Im Gebälk der finsteren Glockenstühle laß dich läuten. Das, was an dir zehrt, wird ein Starkes über dieser Nahrung. Geh in der Verwandlung aus und ein. Was ist deine leidendste Erfahrung? Ist dir Trinken bitter, werde Wein. Sei in dieser Nacht aus Übermaß Zauberkraft am Kreuzweg Deiner Sinne, ihrer seltsamen Begegnung Sinn. Und wenn dich das Irdische vergaß, zu der stillen Erde sag: Ich rinne. Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin.
Das Stundenbuch
Gelegt in die Hände von Lou
Das Buch vom mönchischen Leben
(1899)
Da neigt sich die Stunde und rührt mich an
Da neigt sich die Stunde und rührt mich an mit klarem, metallenem Schlag: mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann –– und ich fasse den plastischen Tag. Nichts war noch vollendet, eh ich es erschaut, ein jedes Werden stand still. Meine Blicke sind reif, und wie eine Braut kommt jedem das Ding, das er will. Nichts ist mir zu klein und ich lieb es trotzdem und mal es auf Goldgrund und groß, und halte es hoch, und ich weiß nicht wem löst es die Seele los...
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise jahrtausendelang; und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang.
Ich habe viele Brüder in Sutanen
Ich habe viele Brüder in Sutanen im Süden, wo in Klöstern Lorbeer steht. Ich weiß, wie menschlich sie Madonnen planen, und träume oft von jungen Tizianen, durch die der Gott in Gluten geht. Doch wie ich mich auch in mich selber neige:Mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe von hundert Wurzeln, welche schweigsam trinken. Nur, daß ich mich aus seiner Wärme hebe, mehr weiß ich nicht, weil alle meine Zweige tief unten ruhn und nur im Winde winken.
Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen
Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen, du Dämmernde, aus der der Morgen stieg. Wir holen aus den alten Farbenschalen die gleichen Striche und die gleichen Strahlen, mit denen dich der Heilige verschwieg. Wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände; so daß schon tausend Mauern um dich stehn. Denn dich verhüllen unsre frommen Hände, sooft dich unsre Herzen offen sehn.
Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden
Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden, in welchen meine Sinne sich vertiefen; in ihnen hab ich, wie in alten Briefen, mein täglich Leben schon gelebt gefunden und wie Legende weit und überwunden. Aus ihnen kommt mir Wissen, daß ich Raum zu einem zweiten zeitlos breiten Leben habe. Und manchmal bin ich wie der Baum, der, reif und rauschend, über einem Grabe den Traum erfüllt, den der vergangne Knabe (um den sich seine warmen Wurzeln drängen) verlor in Traurigkeiten und Gesängen.
Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manchesmal
Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manchesmal in langer Nacht mit hartem Klopfen störe, so ists, weil ich dich selten atmen höre und weiß: Du bist allein im Saal. Und wenn du etwas brauchst, ist keiner da, um deinem Tasten einen Trank zu reichen: Ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen. Ich bin ganz nah. Nur eine schmale Wand ist zwischen uns, durch Zufall; denn es könnte sein: ein Rufen deines oder meines Munds –– und sie bricht ein ganz ohne Lärm und Laut. Aus deinen Bildern ist sie aufgebaut. Und deine Bilder stehn vor dir wie Namen. Und wenn einmal das Licht in mir entbrennt, mit welchem meine Tiefe dich erkennt, vergeudet sichs als Glanz auf ihren Rahmen. Und meine Sinne, welche schnell erlahmen, sind ohne Heimat und von dir getrennt.
Wenn es nur einmal so ganz stille wäre
Wenn es nur einmal so ganz stille wäre. Wenn das Zufällige und Ungefähre verstummte und das nachbarliche Lachen, wenn das Geräusch, das meine Sinne machen, mich nicht so sehr verhinderte am Wachen ––: Dann könnte ich in einem tausendfachen Gedanken bis an deinen Rand dich denken und dich besitzen (nur ein Lächeln lang), um dich an alles Leben zu verschenken wie einen Dank.
Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht
Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht. Man fühlt den Wind von einem großen Blatt, das Gott und du und ich beschrieben hat und das sich hoch in fremden Händen dreht. Man fühlt den Glanz von einer neuen Seite, auf der noch Alles werden kann. Die stillen Kräfte prüfen ihre Breite und sehn einander dunkel an.
Ich lese es heraus aus deinem Wort
Ich lese es heraus aus deinem Wort, aus der Geschichte der Gebärden, mit welchen deine Hände um das Werden sich rundeten, begrenzend, warm und weise. Du sagtest leben laut und sterben leise und wiederholtest immer wieder: Sein. Doch vor dem ersten Tode kam der Mord. Da ging ein Riß durch deine reifen Kreise und ging ein Schrein und riß die Stimmen fort, die eben erst sich sammelten um dich zu sagen, um dich zu tragen alles Abgrunds Brücke –– Und was sie seither stammelten, sind Stücke deines alten Namens.
Der blasse Adelknabe spricht
Der blasse Adelknabe spricht: Ich bin nicht. Der Bruder hat mir was getan, was meine Augen nicht sahn. Er hat mir das Licht verhängt. Er hat mein Gesicht verdrängt mit seinem Gesicht. Er ist jetzt allein. Ich denke, er muß noch sein. Denn ihm tut niemand, wie er mir getan. Es gingen alle meine Bahn, kommen alle vor seinen Zorn, gehen alle an ihm verloren. Ich glaube, mein großer Bruder wacht wie ein Gericht. An mich hat die Nacht gedacht; an ihn nicht.
Du Dunkelheit, aus der ich stamme
Du Dunkelheit, aus der ich stamme, ich liebe dich mehr als die Flamme, welche die Welt begrenzt, indem sie glänzt für irgend einen Kreis, aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß. Aber die Dunkelheit hält alles an sich: Gestalten und Flammen, Tiere und mich, wie sie’s errafft, Menschen und Mächte –– Und es kann sein: eine große Kraft rührt sich in meiner Nachbarschaft. Ich glaube an Nächte.
Ich glaube an Alles noch nie Gesagte
Ich glaube an Alles noch nie Gesagte. Ich will meine frömmsten Gefühle befrein. Was noch keiner zu wollen wagte, wird mir einmal unwillkürlich sein. Ist das vermessen, mein Gott, vergib. Aber ich will dir damit nur sagen: Meine beste Kraft soll sein wie ein Trieb, so ohne Zürnen und ohne Zagen; so haben dich ja die Kinder lieb. Mit diesem Hinfluten, mit diesem Münden in breiten Armen ins offene Meer, mit dieser wachsenden Wiederkehr will ich dich bekennen, will ich dich verkünden wie keiner vorher. Und ist das Hoffahrt, so laß mich hoffährtig sein für mein Gebet, das so ernst und allein vor deiner wolkigen Stirne steht.
Ich bin auf der Welt zu allein und doch nicht allein genug
Ich bin auf der Welt zu allein und doch nicht allein genug, um jede Stunde zu weihn. Ich bin auf der Welt zu gering und doch nicht klein genug, um vor dir zu sein wie ein Ding, dunkel und klug. Ich will meinen Willen und will meinen Willen begleiten die Wege zur Tat; und will in stillen, irgendwie zögernden Zeiten, wenn etwas naht, unter den Wissenden sein oder allein. Ich will dich immer spiegeln in ganzer Gestalt, und will niemals blind sein oder zu alt um dein schweres schwankendes Bild zu halten. Ich will mich entfalten. Nirgends will ich gebogen bleiben, denn dort bin ich gelogen, wo ich gebogen bin. Und ich will meinen Sinn wahr vor dir. Ich will mich beschreiben wie ein Bild das ich sah, lange und nah, wie ein Wort, das ich begriff, wie meinen täglichen Krug, wie meiner Mutter Gesicht, wie ein Schiff, das mich trug durch den tödlichsten Sturm.
Du siehst, ich will viel
Du siehst, ich will viel. Vielleicht will ich Alles: das Dunkel jedes unendlichen Falles und jedes Steigens lichtzitterndes Spiel. Es leben so viele und wollen nichts, und sind durch ihres leichten Gerichts glatte Gefühle gefürstet. Aber du freust dich jedes Gesichts, das dient und dürstet. Du freust dich Aller, die dich gebrauchen wie ein Gerät. Noch bist du nicht kalt, und es ist nicht zu spät, in deine werdenden Tiefen zu tauchen, wo sich das Leben ruhig verrät.
Wir bauen an dir mit zitternden Händen
Wir bauen an dir mit zitternden Händen und wir türmen Atom auf Atom. Aber wer kann dich vollenden, du Dom. Was ist Rom? Es zerfällt. Was ist die Welt? Sie wird zerschlagen eh deine Türme Kuppeln tragen, eh aus Meilen von Mosaik deine strahlende Stirne stieg. Aber manchmal im Traum kann ich deinen Raum überschaun, tief vom Beginne bis zu des Daches goldenem Grate. Und ich seh: meine Sinne bilden und baun die letzten Zierate.
Daraus, daß Einer dich einmal gewollt hat
Daraus, daß Einer dich einmal gewollt hat, weiß ich, daß wir dich wollen dürfen. Wenn wir auch alle Tiefen verwürfen: wenn ein Gebirge Gold hat und keiner mehr es ergraben mag, trägt es einmal der Fluß zutag, der in die Stille der Steine greift, der vollen. Auch wenn wir nicht wollen:Gott reift.
Wer seines Lebens viele Widersinne
Wer seines Lebens viele Widersinne versöhnt und dankbar in ein Sinnbild faßt, der drängt die Lärmenden aus dem Palast, wird anders festlich, und du bist der Gast, den er an sanften Abenden empfängt. Du bist der Zweite seiner Einsamkeit, die ruhige Mitte seinen Monologen; und jeder Kreis, um dich gezogen, spannt ihm den Zirkel aus der Zeit.
Was irren meine Hände in den Pinseln?
Was irren meine Hände in den Pinseln? Wenn ich dich male, Gott, du merkst es kaum. Ich fühle dich. An meiner Sinne Saum beginnst du zögernd, wie mit vielen Inseln, und deinen Augen, welche niemals blinseln,