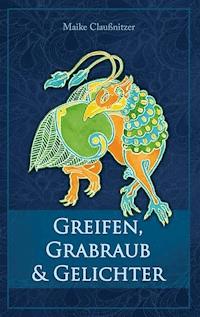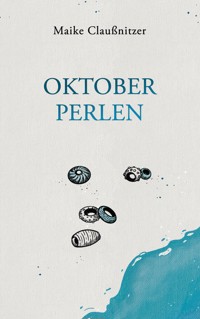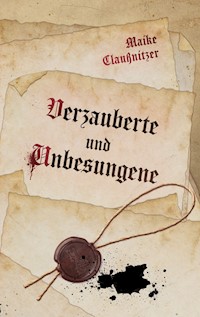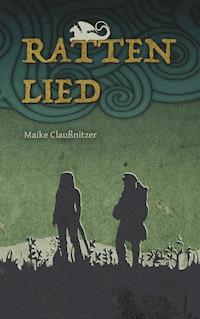
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Abenteuer ist vorbei, zumindest wenn es nach der Kriegerin Lucardis geht. Nach einer gefahrvollen Reise hat sie genug damit zu tun, in ihrer Heimat wieder Fuß zu fassen. Doch als sie ein Pferd, das ihr nicht gehört, gegen einen versklavten Sänger eintauscht, steht sie bald vor ganz neuen Schwierigkeiten. Denn mit Audoin hat es mehr auf sich, als er selbst ahnt, und so bekommen es die beiden nicht allein mit hungrigen Greifen, einem Fluch und ungesühntem Unrecht zu tun, sondern auch mit der berüchtigten Söldnerin, die sich Ratte nennt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Auch von Maike Claußnitzer erschienen:
Tricontium
Greifen, Grabraub & Gelichter
INHALT
Kapitel: Sängerkauf
Kapitel: Descensus in servitudinem
Kapitel: Von mancherlei Ratten
Kapitel: Heimkehr
Kapitel: Fluchthilfe
Kapitel: Von nächtlichen Besuchern
Kapitel: Mors improvisa
Kapitel: Corvisium
Kapitel: Autharis Sturz
Kapitel: Fragen und Antworten
Kapitel: Abendunterhaltung
Kapitel: Gespenster und Greifen
Kapitel: Seht euren Freund
Kapitel: Wahrheiten
Kapitel: Jagderfolg
Kapitel: Vom Umgang mit Geistern
Kapitel: Ius gladii
Kapitel: Waldgespräche
Kapitel: Flucht und verflucht
Kapitel: Von kleinen Zaubern
Kapitel: Anstelle einer Buße
Kapitel: Aufbruch
Anhang
1. Kapitel: Sängerkauf
Hätte Asa vom Schwanenhof geahnt, dass Lucardis eines ihrer kostbaren Steppenpferde um nichts als ein gutes Gewissen verkaufen würde, hätte sie es ihr niemals anvertraut, und hätte sie nicht gewusst, dass sie selbst schon ärgere Sünden begangen hatte, hätte sie ihr nicht verziehen. Doch an dem Frühjahrsmorgen, als sie unter dem Tor mit seinen gekreuzten Schwanenköpfen aus Eichenholz die Zügel weiterreichte, dachte sie wohl noch nicht an solche Verfehlungen, sondern nur an das bewundernde Staunen, das ihre Botin auf dem prächtigen Tier hervorrufen würde.
»Gutes Gelingen!«, war alles, was sie noch sagte, und der Wunsch wurde ringsum von ihrem ganzen Haushalt aufgegriffen und um weitere Segensformeln ergänzt. So sollte Lucardis vor Feinden, schlechtem Wetter, Stürzen und missgünstigen Trollen bewahrt bleiben. Daran, ihr auch Schutz vor eigenen Torheiten zu wünschen, dachte niemand, am wenigsten sie selbst.
Gewöhnlich ging sie schließlich nicht unverantwortlich mit fremdem Eigentum um, und als sie sich zwischen den Fischteichen und Obstgärten noch einmal im Sattel umdrehte, um zum Abschied zu winken, war sie ohnehin überzeugt, dass ihr auf dem Weg zur Burg beim Schwarzen Stein und dort selbst wenig Bemerkenswertes begegnen würde.
Die übertriebene Förmlichkeit des Abschieds war angesichts der Reise von wenigen Stunden, die vor ihr lag, lächerlich, zugleich aber unverzichtbar, um allen vor Augen zu führen, dass auf dem Schwanenhof wieder eine Herrin wohnte, die nach unruhigen Tagen das Leben in geordnete und gewohnte Bahnen lenkte, Nachlässigkeiten der Vergangenheit ausglich und alte Bündnisse diesseits und jenseits der Grenze wiederbelebte.
Wo genau Austrasien endete und das Heidenland begann, war nördlich des Schwanenhofs eher Auslegungssache als festgefügte Wahrheit, denn es gab keinen trennenden Fluss, keinen Grenzstein und auch keinen Posten, der den schmalen Weg bewacht hätte, der über die Kuppe der Schlafenden Frau in ein kleines Waldstück und dann in die Heide hinaus führte. Das offene Land dehnte sich in sanften Hügeln unter einem weiten Himmel. Hier gehörte es niemandem, allenfalls den jagenden Greifvögeln, und sah auch nicht viel anders als weiter südlich aus, voller Heidekraut und Wacholder.
Dass sie dorthin gelangt war, wo Bardo herrschte, nahm Lucardis erst so recht wahr, als sie nach anderthalb Stunden den Schäfer erspähte, der ihr schon bei ihrem letzten Ritt hier heraus begegnet war. Heute grüßte sie nur von ferne zu ihm hinüber, aber vor zwei Jahren hatten Helga und sie bei ihm angehalten und eine Weile geplaudert, und so erinnerte sie sich, dass er wie die Schafe Bardo gehörte. Das Wissen darum war es, das ihr die Grenze wirklicher erscheinen ließ, als eine gedachte unregelmäßige Linie zwischen Findlingen und kleinen Sträuchern es je hätte sein können. Damals war ihr bei der Vorstellung unwohl gewesen, dass sie mit jemandem sprach, der nicht frei war, und wenn Helga nicht gewesen wäre, die alles gleichmütiger hingenommen hatte, hätte sie nicht so lange in seiner Gesellschaft gerastet.
Mittlerweile hatte sie draußen in den östlichen Steppen weit Unschöneres und Seltsameres gesehen, wahllos zusammengeraubte Sklaven, sonderbare Opferbräuche und sogar Krieger, die ihrem toten Herrn ins Grab folgten. Nach all dem wirkten die Verhältnisse auf Bardos Ländereien denen auf dem Schwanenhof schon wieder so ähnlich, dass es müßig war, über unerfreuliche Kleinigkeiten zu klagen.
Das redete sie sich zumindest ein, als sie den Schäfer hinter sich zurückließ, und wollte sich die Frage nicht stellen, warum sie ihre Rast noch eine Viertelstunde hinausschob, wenn sie sich heute wirklich nicht mehr davor fürchtete, mit ihm zu sprechen und die Gedanken zu denken, die sie seinerzeit so belastet hatten.
Es war einfacher, sich kurz im Dorf im Sandgrund auszuruhen, das zwischen einem Wäldchen und mageren Feldern ohnehin am Weg lag und über klares, gutes Wasser verfügte.
Die beiden Alten, die beim Brunnen in der Sonne saßen und das Kommen und Gehen auf der staubigen Straße beobachteten, die den Ort von Süden nach Norden durchquerte, waren schon alt gewesen, als Lucardis das letzte Mal hier vorbeigekommen war.
Sie mochten friedlich wirken, wie sie so auf der Feldsteinmauer hockten und die erste Frühjahrswärme genossen, aber sie hatten neugierige Augen und flinke Zungen. Früher hatte das Lucardis nicht weiter berührt, doch heute durfte es ihr nicht gleichgültig sein, und so fand sie sich damit ab, dass die Pause allenfalls für das Pferd erholsam werden würde, nicht aber für sie.
Nach Gruß und Gegengruß herrschte geraume Zeit Schweigen, während drüben in der hohen Birke ein Vogel sang und in einem der Häuser nahebei ein Webstuhl klapperte.
Der Greis, der sich die spärlichen verbliebenen Haare zu einem Zopf geflochten hatte, der den freien Mann verriet, zog die buschigen Brauen zusammen und musterte Lucardis. Besonders lange blieb sein Blick an dem schlichten Schwertgriff hängen, den Lucardis mit voller Absicht unter dem blauen Mantel hervorsehen ließ, den sie heute zum ersten Mal trug. Der Umhang war aus gutem Stoff, ihrem neuen Rang angemessen, aber längst noch nicht eingetragen und damit auch nicht so bequem, wie sie gehofft hatte.
Die Frau in dem rehbraunen Kittel sah nicht so auffällig hin wie ihr Gefährte und war doch am Ende diejenige, die zuerst sprach.
»Du bist vom Schwanenhof hinter der Grenze«, sagte sie, als Lucardis schon begonnen hatte, das Pferd zu tränken; es war keine Frage.
»Du bist lange nicht mehr hier gewesen«, setzte der Mann hinzu.
Lucardis nickte. »Ich war auf Reisen«, erwiderte sie leichthin, obwohl es wahrlich nicht einfach gewesen war, mit Helga und Hortensia auszuziehen, um Asa nach dem Tod ihres Vaters aufzuspüren. Ganz vorüber war alles immer noch nicht, denn auch wenn sie nun zurück waren, hatte sich noch längst kein behaglicher Alltag eingespielt.
Die alte Frau schloss die Hände enger um den Knauf des knorrigen Gehstocks, der zwischen ihren Knien lehnte. »Man sagt, dass Asmunds Tochter jetzt Herrin auf dem Schwanenhof ist.«
Lucardis nickte erneut. »Wir haben sie zurückgeholt, nachdem Asmund gestorben war.«
Die Alte, von der Lucardis nie so recht gewusst hatte, ob sie die Ehefrau oder nur eine treue Bekannte des Mannes war, wiegte sinnend den Kopf. »Das war wohlgetan«, befand sie ohne überflüssige Worte. »Reitest du zu Bardo?«
Sie sprach ohne übertriebene Ehrfurcht von dem Mann, dem ihr Dorf abgabepflichtig war, und Lucardis, für die selbst Asa, mit der sie aufgewachsen war, Dritten gegenüber stets zu »Frau Asa« wurde, musste ein Lächeln verbergen. »Ja, um ihm Grüße und Geschenke von der neuen Herrin auf dem Schwanenhof zu bringen. Wir hoffen, dass sich die gute Freundschaft fortsetzt, die wir stets mit den Leuten vom Schwarzen Stein gehalten haben.«
Die alte Bäuerin nickte, und auf ihrem nachdenklichen Gesicht meinte Lucardis die Vermutung zu erkennen, dass auch Wigand, der gern an Asas Stelle Asmunds Erbe angetreten hätte, Gaben schicken und um Bardos Unterstützung werben würde. Aber vielleicht las sie auch nur ihre eigenen Sorgen in die zerfurchte Miene hinein.
»Asmund hat stets seine Schwertmeisterin gesandt«, sagte der Greis unvermittelt.
»Helga ist tot, und Asa schickt mich«, entgegnete Lucardis und ließ die Hand ein wenig auf dem Griff von Helgas Waffe ruhen.
»Sieh an.« Der alte Mann musterte sie noch gründlicher als zuvor. »Ich dachte immer, Gersvind würde Helga einmal nachfolgen.«
Es war keine ganz unsinnige Vermutung. Gersvind hatte den Befehl über die daheimgebliebenen Kämpfer des Schwanenhofs geführt, nachdem Helga auf die Suche nach Asa gegangen war, und in früheren Jahren hatte Lucardis selbst oft damit gerechnet, dass die Kriegerin, die im Alter halb zwischen Helga und ihr stand, vielleicht einmal Asmunds Schwertmeisterin oder die seines Sohnes werden würde. Doch Asmund war nicht mehr am Leben, Jung-Asmund ebenso wenig, und Asas Rückkehr hatte vieles geändert.
»Frau Asa hat anders entschieden«, entgegnete sie also nur.
Den beiden schien die knappe Angabe zu genügen, denn sie fragten nicht weiter nach.
Lucardis hielt sich nach dem Gespräch nicht viel länger auf und wusste schon, als sie wieder in den Sattel stieg, dass die Nachricht von ihrem Kommen sie auf dem Rest ihres Weges begleiten und spätestens dort überholen würde, wo die Straße einen weiten Bogen nach Westen machte, um das Moor zu umgehen, in dem sich nur die Einheimischen sicher zurechtfanden. Bardo würde bald unterrichtet sein, dass ihm Besuch drohte, doch wenn man in Frieden kam, war es ja nicht das Schlechteste, denen, die man überfiel, ein wenig Zeit zur Vorbereitung zu lassen. Wenn alles gut ging, würde Bardo daran gelegen sein, sie freundlich zu empfangen, und dann würde sich das ein oder andere an dem Aufenthalt auf seiner Burg genießen lassen. Seine Tafel war nie zu verachten gewesen und so etwas wie das würzige Brot, das er stets hatte auftischen lassen, hatte Lucardis in den langen Monaten in der Ferne durchaus vermisst.
Überhaupt wurde ihr jetzt, da die heikle Unterhaltung überstanden war, erst in aller Deutlichkeit bewusst, wie seltsam es sich anfühlte, wieder inmitten dieser vertrauten Gegend und mit einer wiederkehrenden Aufgabe befasst zu sein, die gar nicht ihre hätte sein sollen.
Zu Hause auf dem Schwanenhof waren in den letzten Tagen zu viele tastende Schritte der Eingewöhnung zu unternehmen gewesen, um ausführlich nachzudenken, ganz zu schweigen von dem unseligen Begräbnis, um das sie sich allein hatte kümmern müssen, weil Asa es so befohlen hatte.
Nun aber, da sie das Pferd im offenen Land Schritt gehen ließ, stürzte die Wirklichkeit dieses Zurückseins mit unerwarteter Heftigkeit auf sie ein. Vogelzwitschern von ferne, leichter Wind von Westen her, eine Eidechse auf den Steinen links des Weges … Das war, wie es immer gewesen war, und doch war die Welt nicht mehr dieselbe.
Eine eigenartige Beklommenheit überkam sie.
»Du versäumst nicht viel, Helga«, sagte sie in die Stille hinein. »Es ist hier noch ganz wie immer.«
Doch Helga antwortete nicht, wie sie schon seit einem Jahr nicht mehr geantwortet hatte. Als Geist hatte sie sich Lucardis nie gezeigt.
Dabei wäre ein Gespenst als unsichtbare Helferin höchst nützlich gewesen, um die eine Veränderung inmitten all des Wohlbekannten gut meistern zu können, die nämlich, dass Lucardis nicht länger schweigende Beobachterin sein durfte. Eine Schwertmeisterin, die ihre Herrin vertrat, musste reden, und das auf dem Hof am Schwarzen Stein weit ausführlicher und geschickter als mit den alten Leuten im Dorf. Das Richtige zu tun und zu sagen war bei einem Antrittsbesuch schließlich noch wichtiger als bei allen künftigen Treffen, denn anders als Helga, die sich über Jahre beiderseits der Grenze einen untadeligen Ruf erworben hatte, genoss Lucardis bisher nur den, die stille Kriegerin in Helgas Schatten zu sein.
Künftig würde man sie wohl auch als die zerzauste Botin kennen, denn als ihr einfiel, dass sie das letzte Waldstück, durch das die Straße führte, eigentlich hatte nutzen wollen, um noch einmal außer Sicht anzuhalten, den kleinen Bronzespiegel aus der Satteltasche hervorzusuchen und sich gründlich Haar und Mantel zu richten, war sie schon auf der Hügelkuppe, von der aus man den namensgebenden Schwarzen Stein und dahinter den mächtigen Ringwall der Burg erkennen konnte. Der kleine Turm, der im Inneren der Umfriedung aufragte, gestattete es, die Straße bis zum Waldrand im Auge behalten. Eine kurze Umkehr wäre hier und jetzt nicht unbemerkt geblieben, ein gezückter Kamm auch nicht. So hatte Lucardis keine Wahl, als mit nur flüchtig glattgestrichenem Umhang den Rest der Strecke zum Tor zurückzulegen.
Die beiden Krieger, die dort wachten, verstanden sich nicht gut darauf, Erstaunen zu heucheln, bemühten sich aber redlich, sich nicht anmerken zu lassen, dass die Neuigkeit schon auf dem Bohlenweg durchs Moor und auf schmalen Heidepfaden zu ihnen gelangt war. Sie hätten ebenso gut auf das Spiel verzichten können, denn dass alles, was in Bardos Haushalt Rang und Namen hatte, rein zufällig in der Halle versammelt war, als man die Besucherin dorthin bat, hätte wohl auch ein leichtgläubigerer Gast bemerkenswert gefunden.
Die Höflichkeit gebot jedoch, über alle Auffälligkeiten zu schweigen und mit einer Verneigung vor Bardo hinzutreten, der wie ein König auf seinem erhöhten Sitz am Kopfende des düsteren Saals thronte, obwohl er ein ganz gewöhnliches Reetdach über sich hatte und nur deshalb ein großer Häuptling war, weil der Landstrich, über den er herrschte, bei Mächtigeren nie Begehrlichkeiten geweckt hatte.
Er war ein mittelgroßer, früh ergrauter Mann, der etwas über sein vierzigstes Jahr hinaus war und dem man anzumerken begann, dass er diese Lebenszeit genutzt hatte, um allerlei Leidenschaften zu frönen, dem Kampf wie der Jagd und der Liebe. Das Nachlassen seines einst gefälligen Aussehens schien ihn jedoch nicht weiter zu bekümmern, und zugegebenermaßen hatte er es wohl auch nicht mehr nötig, das andere Geschlecht sonderlich zu beeindrucken. Von einem jungen Mann, der seinen Vater mittlerweile um einen halben Kopf überragte, bis zu einem kleinen Mädchen von höchstens fünf Jahren hatte er sieben überlebende Kinder, die sich nun allesamt um ihn drängten. Soweit Lucardis wusste, stammten nicht mehr als zwei der mittleren von der Ehefrau, die er längst begraben hatte. Sie hatte nie viel Einfluss auf der Burg gehabt, und wenn es auch keiner von Bardos Konkubinen gelungen war, sich zur Herrin aufzuschwingen, so deshalb, weil die wichtigste Frau am Schwarzen Stein stets eine andere gewesen war.
Keinen ganzen Schritt von Bardos Stuhl entfernt stand Hathui, seine Schwertmeisterin und zugleich seine Halbschwester. Sie war kein vollbürtiges Kind seiner Mutter, die sich nach dem Tod zweier Ehemänner nicht wieder verheiratet, sondern sich nur einen jugendlichen Beischläfer genommen hatte. Daher hatte sie keinen Anteil an Land und Würden erben können, doch Zuneigung und Vertrauen ihres Halbbruders genoss sie überreich. Es empfahl sich also, die Kriegerin mit den klaren Augen so ehrerbietig zu begrüßen wie Bardo selbst, bevor dann die versammelte Nachkommenschaft des Burgherrn freundlich angesprochen sein wollte.
Die Ersten unter Bardos Kriegern und seine alte Runenmeisterin hielten sich etwas abseits von den Familienmitgliedern, doch auch sie würden gut zuhören und jede Geste beobachten.
Noch war alles einfach; die vertrauten Formeln der Begrüßung, das Nennen der Gründe für den ungebetenen Besuch, das Annehmen des Angebots, über Nacht zu bleiben, nach dem ersten höflichen Ablehnen. Das alles kam wie von selbst und half, Zeit zu gewinnen, um zu erspüren und abzuwägen, wie die Dinge hier standen.
Es schien eher Neugier in der Luft zu liegen als Feindseligkeit, und das machte Lucardis Hoffnung. Falls Wigand die letzten Monate damit verbracht hatte, Bardo von einem Bündnis gegen Asa zu überzeugen, war er damit allem Anschein nach nicht so weit gekommen, dass man ihre Botin nicht anhören wollte.
Zum Glück schienen Asas großzügige Geschenke allgemeinen Beifall zu finden: Zwölf Ellen feinster tiefroter Seide aus Merkand gelangten nicht alle Tage in die Gegend, ebenso wenig wie zwei Pfund des besten Tees, den Lucardis je getrunken hatte. Die Zeit, die von der Begutachtung dieser Gaben durch alle, die sich dazu berufen fühlten, in Anspruch genommen wurde, ließ sich gut mit der Erzählung darüber ausfüllen, wie Helga, die Schreiberin Hortensia und Lucardis selbst nach Asmunds Tod ausgezogen waren, um seine Tochter und Erbin zu suchen, wie sie, leider nur noch zu zweit, Asa gefunden hatten und mit ihr durch Steppe, Sturm und allerlei Fährnisse zurückgekehrt waren.
Lucardis umriss vorerst nur das Notwendigste. Die Schilderung von Wunderdingen und unterhaltsamen wie merkwürdigen Begebenheiten gehörte in die Stunden am Feuer nach dem Abendessen, die gewiss lang genug werden würden. Die Grundzüge der neuen Verhältnisse auf dem Schwanenhof und der Weg, auf dem es zu ihnen gekommen war, konnten jedoch nicht warten, wenn später vernünftige Gespräche mit Bardo und seinen Getreuen stattfinden sollten.
Die Meinung teilte er wohl, denn er lauschte aufmerksam und stellte am Ende die Frage, die zu erwarten gewesen war. »Ist Asa allein zurückgekehrt?«
Er sprach nicht von in der Fremde gewonnenen Gefolgsleuten, das schien auch sein ältester Sohn zu wissen, dessen Blick nun forschend auf Lucardis ruhte. In die stumme Frage mengte sich bei ihm ein Ausdruck, der ihr nicht gefiel, so dass sie froh war, verneinen zu können.
»Frau Asa hat seit fünf Jahren einen Mann und …«
Sie hatte eigentlich noch hinzufügen wollen, dass Asa auch zwei gesunde Kinder hatte und deshalb so schnell kein Bedarf an einem neuen Ehemann bestehen würde, selbst wenn Herr Tergai wider Erwarten an der üblen Erkältung einging, die ihn derzeit plagte. Doch so weit war sie in ihren Ausführungen noch nicht gekommen, als die Vordertür zur Halle derart schwungvoll aufgestoßen wurde, dass sie gegen die Innenwand prallte.
Auf den Namen des rothaarigen Hünen, der mit großen Schritten hereinkam, konnte Lucardis sich nicht besinnen, und ihr fiel erst jetzt auf, dass er heute im Kreise von Bardos bevorzugten Kriegern gefehlt hatte. Er war einer der besten Bogenschützen am Schwarzen Stein und verfügte – wie er soeben abermals bewies – über wenig Benehmen, aber dafür über ein hervorragendes Gespür für unpassende Zeitpunkte.
Mit nicht mehr als einem flüchtigen Nicken in die Runde verkündete er laut: »Wir haben ihn!«
Sein Mantel, der von einer etwas zu auffälligen bernsteinbesetzten Fibel gehalten wurde, war staubig, als hätte er einige Zeit auf sandigen Heidewegen auf der Jagd oder auf der Suche verbracht, aber ob sie einem gefährlichen Keiler, einem entlaufenen Lieblingshund des Burgherrn oder einem flüchtigen Dieb gegolten hatte, war aus seinem fröhlichen Tonfall nicht zu entnehmen.
Bis auf Lucardis schienen allerdings alle sehr gut unterrichtet zu sein, wen oder was er meinte, und das unbehagliche Schweigen verriet, dass auch niemand wollte, dass sich an dieser Verteilung von Wissen und Unwissen etwas änderte.
Hinter dem roten Krieger war mittlerweile einer der unglücklichen Torwächter erschienen. Ihm war überdeutlich anzusehen, dass er alles versucht hatte, um diesen unerfreulichen Auftritt vor Asas Schwertmeisterin zu unterbinden, und nun Bardos Verzeihung für sein offensichtliches Versagen heischte.
Der Häuptling tat ihm nicht den Gefallen, auch nur durch eine unauffällige Geste zu bekunden, dass er sich keine Sorgen machen sollte.
»Na, der soll bekommen, was er verdient!«, sagte Bardos Ältester schließlich und war schon auf halbem Wege zur Tür, bevor irgendjemand sonst auch nur ein Wort hatte sagen können.
Ein Blick ging zwischen Bardo und Hathui hin und her. Dann setzte die Schwertmeisterin mit der gemurmelten Bitte an Lucardis, sie für einen Augenblick zu entschuldigen, ihrem Neffen nach, als gelte es, ein Unglück zu verhindern.
Der Krieger, der die Aufregung verursacht hatte, kratzte sich im Nacken und begann unbeholfen: »Ich dachte nur …«
Bardo brachte ihn mit einem raschen Kopfschütteln zum Schweigen und wandte sich mit einem gezwungenen Lächeln wieder an Lucardis. »Wir waren bei Asa und ihrem Mann, nicht wahr? Stammt er von dort aus dem Osten?«
Lucardis versuchte sich zu entsinnen, was genau sie hatte sagen wollen, kam nicht mehr darauf und setzte neu an, um gleich wieder abzubrechen. Denn draußen ertönte ein Aufschrei, der Schmerz und Schrecken zugleich verriet.
Lucardis zuckte zusammen.
Vielleicht vergaß sie den ein oder anderen Namen, doch sie hatte ein Gedächtnis für Stimmen, und diese Stimme hier kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie weder hierher gehörte, noch so gequält hätte klingen sollen, auch gut genug, um nun aufzuspringen und ins Freie zu laufen, ohne darüber nachzudenken, wie diese Unhöflichkeit auf den Häuptling wirken mochte.
Bardos Krieger versperrten ihr nicht den Weg, und das war sehr gut, denn sie hätte wohl alle beiseitegestoßen und damit noch mehr angerichtet, als sie es mit ihrer unbedachten Hast ohnehin schon tat. Als sie dann vor der Halle ankam, wünschte sie sich dennoch nicht mehr Vernunft und Geduld, sondern nur, dass sie schneller gewesen wäre.
Vor dem Turm prügelte Bardos Sohn wie von Sinnen auf einen gefesselten Mann ein.
So blindwütig ließ kein anständiger Mensch seinen Zorn an einem Hilflosen aus, und Lucardis hätte wohl auch versucht, einzuschreiten, wenn ein Fremder so misshandelt worden wäre. Aber dies war nicht irgendein Gefangener, sondern einer, den sie kannte und der hier nichts zu suchen hatte, weder auf der Burg am Schwarzen Stein, noch im Frühling, noch unter den Fäusten des Häuptlingssohns.
Es musste doch Herbst sein, wenn sie ihn sah, zwischen reifen Äpfeln und ziehenden Wildgänsen, wenn die Nächte schon kalt waren, die Tage aber noch mild und sonnig sein konnten. Er hätte an einem friedlichen Abend an den Fischteichen vorbei und durchs Tor kommen sollen, seine Harfe und alte wie neue Lieder im Gepäck. Auf dem Schwanenhof wäre er freudig und freundlich empfangen worden, und später hätte er in der Halle mit großer Geste die Hülle der Harfe abgestreift, um dann heiter zu plaudern und allerlei Neuigkeiten weiterzutratschen und aufzuschnappen, während seine flinken Finger die Saiten stimmten.
Das alles hätte er tun sollen, statt mit auf den Rücken geschnürten Händen und mittlerweile blutigem Gesicht taumelnd vor Schlägen zurückzuweichen, denen er auf die Dauer doch nicht entgehen konnte, und dass er dennoch dazu gezwungen war, war doppelt und dreifach falsch und gegen die rechte Ordnung der Welt.
Es war nur ein schwacher Trost, dass andere ebenfalls entsetzt zu sein schienen: Die beiden Krieger, die den Gefangenen wohl bis eben gehalten oder zumindest hergeführt hatten, hatten ihn losgelassen und waren zurückgewichen, als wollten sie mit der Sache so wenig wie möglich zu schaffen haben. Diener – freie wie unfreie – standen im Halbkreis ringsum und gafften, doch niemand griff ein, als der junge Mann seinem Opfer einen Tritt versetzte, der es keuchend in die Knie brechen ließ, niemand bis auf Hathui.
»Heriger, es ist genug!«, sagte sie, wie sie es, wenn es nach Lucardis gegangen wäre, schon längst hätte tun sollen, und packte entschlossen zu, als ihr Neffe wenig Neigung erkennen ließ, auf sie zu hören.
Lucardis wusste, dass sie ihr nicht helfen durfte, Heriger niederzuringen, der sich fuchsteufelswild wehrte, denn das hätte geheißen, die Hand gegen ein Mitglied von Bardos Haushalt zu erheben. So blieb ihr nur, sich der verkrümmten Gestalt zuzuwenden, um die sich noch immer niemand zu kümmern wagte.
Der Mann, dessen braune Locken kurz – zu kurz – geschnitten waren, hustete mittlerweile zum Erbarmen, doch er hob den Kopf, als Lucardis ihn aufrichtete, so gut es irgend ging.
»Ihr haltet den Mund und lasst mich reden«, sagte sie leise zu ihm, während sie einen raschen Blick auf Bardos Krieger warf, die aber weiter auf Abstand blieben. »Ich regele die Angelegenheit.«
Es erstaunte sie nicht, dass er nicht antwortete, denn er hätte jetzt wohl ohnehin kaum sprechen können. Dafür entsetzte sie, dass in seinen dunklen Augen, von denen eines auf dem besten Wege war, zuzuschwellen, tatsächlich ein unendliches Vertrauen in ihr Versprechen stand, ihm aus seiner misslichen Lage zu helfen.
Zwar hatte sie das durchaus vor, doch ein paar vor Monaten und Jahren geführte Gespräche über Nichtigkeiten waren nicht genug, um sich so sehr auf jemanden zu verlassen. Das musste ein fahrender Sänger wissen, der so weit in der Welt herumgekommen war wie er, und wusste es wohl auch. Wenn er dennoch auf sie zu hoffen wagte, musste er verzweifelt genug sein, sich an jeden Strohhalm zu klammern, und das ließ Lucardis ihrerseits hoffen, dass Hathui Heriger, der daran einen Teil der Schuld trug, das Genick brechen würde.
Anlass genug hätte sie gehabt, da ihr Neffe in seinen Versuchen, sich ihrem eisernen Griff zu entwinden, nicht nachließ und sie, wenn auch nur flüsternd, aufs Übelste dafür beschimpfte, ihn vor einer Fremden lächerlich gemacht zu haben. Dass sein eigenes Verhalten dazu tatkräftig beitrug, entging ihm offenbar.
Hathui, die schon ganz andere gebändigt hatte, ließ sich davon nicht anfechten. Sie sah nur rasch zu dem rothaarigen Krieger hinüber, der mittlerweile aus der Halle hervorgekommen war, und gab ihm mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass er Bardos Gast von der selbstauferlegten Pflicht erlösen sollte, sich mit dem Gefangenen zu befassen.
Der Krieger eilte über den Hof heran, winkte noch unterwegs zwei der umstehenden Knechte herbei, damit sie sich des Verletzten annahmen, und wandte sich selbst an Lucardis.
»Kommt«, sagte er, und dann noch irgendetwas, das sicher dazu beitragen sollte, die unangenehme Lage zu entschärfen, sei es, dass es Dankesworte für ihre gütige Besorgnis waren, sei es, dass er sie wieder ins Haus bat. Was es auch war, es wurde mühelos von Herigers erzürnter Stimme übertönt, die seine Tante weniger gedämpft als vorher aufforderte, ihn nun endlich loszulassen.
Sie tat es, aber wohl nur, weil sie erkannte, dass jetzt jemand anwesend war, vor dessen Augen sich selbst Heriger zurückhalten würde. Bardo war gemessenen Schritts herausgekommen und besah sich die Lage mit unfroher Miene.
Ein solcher Augenblick der Scham und Verunsicherung würde bei ihm nicht so rasch wiederkehren, und Lucardis ergriff die Gelegenheit.
»Ich muss mich wundern, Herr Bardo«, sagte sie, als stünde sie nicht allein inmitten von vielen. »Was habt Ihr Herrn Audoin vorzuwerfen, wenn Ihr billigt, dass man ihn auf Eurer Burg so misshandelt?«
Unabhängig von dem Spiel, das sie spielte, hätte sie die Antwort auf die Frage gern gehört, doch Bardo stellte nur selbst eine. »Audoin? Heißt er so?«
Sein Erstaunen über den Namen schien genauso aufrichtig zu sein wie Lucardis’ eigenes angesichts dessen, dass der Häuptling anscheinend noch nicht einmal wusste, wen seine Leute hergeschleift hatten.
»So heißt er«, sagte sie dennoch nur, »und ich kaufe ihn frei, ganz gleich, wie die Vorgeschichte aussieht.«
Sie hatte eine silberne Mantelspange, eine zierliche Halskette und die achatbesetzte Nadel, die ihr hochgestecktes Haar schmückte, dazu noch Helgas vorzügliches Schwert, das sie hier nicht einsetzen durfte, wenn sie keine Fehde heraufbeschwören wollte. Zusammengenommen war das gewiss genug, um eine Buße zu bezahlen – oder auch den Preis für einen Mann, der nicht selbst über sich verfügen durfte.
»Das ist ein Angebot«, begann Bardo und bewies, dass auch er einer war, der sich keine günstige Gelegenheit entgehen ließ. »Ihr seid auf einem sehr schönen Pferd hergekommen, wie man mir sagt.«
Lucardis war sich sicher, dass er selbst neugierig auf dem Turm gestanden hatte, und mehr als sicher, dass Asa auf Wochen hinaus kein Wort mehr mit ihr wechseln würde, wenn sie eigenmächtig eines ihrer kostbaren Steppenpferde weggab. Doch das war kein Gegengrund. »Das Pferd also?«
Bardo wiegte den Kopf. »Das Pferd. Aber das Sattelzeug war auch nicht zu verachten.« Dass er damit zugab, selbst einen Blick darauf erhascht zu haben, schien ihn nicht weiter zu stören.
»Halt«, sagte Lucardis, obwohl es sie zu diesem Zeitpunkt schon herzlich wenig kümmerte, dass auch der Sattel nicht ihrer war. »Ein Pferd gegen einen Mann, das ist gerecht; aber wenn ich noch den Sattel hergeben soll, will ich mindestens einen Eurer guten Schinken haben.«
Das Schweigen, das daraufhin herrschte, war halb verblüfft, halb abwartend, als sei sich niemand so recht sicher, ob das eine Herausforderung, ein Scherz oder ein ernsthafter Vorschlag gewesen war.
Am Ende war es Audoin, der das Wort ergriff, mit rauerer Stimme als gewohnt, aber in einem Tonfall, der ganz nach ihm klang: »Ihr wollt doch nicht sagen, dass ich Euch nur dann ein gesatteltes Pferd wert bin, wenn sie noch einen Schinken mit dazugeben?« Die Frage hörte sich nicht so entgeistert an, wie ihr Wortlaut es hätte vermuten lassen, und war vielleicht wohlberechnet.
Auf jeden Fall tat sie ihre Wirkung.
Nach einem weiteren Augenblick der Stille warf Hathui den Kopf in den Nacken und begann schallend zu lachen. Andere fielen mit ein, und die Anspannung legte sich so weit, dass Lucardis nun glaubte, ohne Gefahr Audoins Oberarm loslassen zu können, um den sich ihre Finger ein wenig zu fest gekrampft hatten.
Bardo trat derweil mit ausgestreckter Hand auf sie zu und sagte mit aller Selbstverständlichkeit: »Also abgemacht? Schinken und den hier, gegen das Pferd mit dem Sattel?«
Heriger öffnete den Mund und wagte es am Ende doch nicht, Einwände zu erheben. Lucardis schlug ein, und der Handel war geschlossen, ohne dass sie gewusst hätte, wie sie Asa das alles erklären sollte. Vielleicht würde ja der mitgebrachte Schinken eine besänftigende Wirkung entfalten.
»Nimm ihm den Strick ab, Rollo«, befahl Bardo dem rothaarigen Krieger, ehe Lucardis noch darauf verfallen konnte, ein Messer zu zücken. »Den habe ich nicht mitverkauft.« Dann sah er Lucardis an und holte Luft, als wolle er sie wieder daran erinnern, dass sie doch vorhin bei Asas Mann stehen geblieben wären.
Asa aber war die Letzte, über die Lucardis jetzt reden oder auch nur nachdenken wollte; so neigte sie höflich den Kopf und bat unter Verweis auf die anstrengende Reise vom Schwanenhof her darum, sich bis zum Abendessen zurückziehen zu dürfen.
Mit Audoin sprach sie erst, nachdem sie ihn sicher auf das Bett gesetzt hatte, das in einem Nebengebäude für sie bereitstand.
»So«, sagte sie dann, indem sie ein Tuch in die Waschschüssel tunkte, die wohl eigentlich ebenfalls ihr zugedacht gewesen war. »Sitzt jetzt still und erzählt mir, wie zum Teufel Ihr hierher geraten seid und was Heriger gegen Euch hat. Nein, nicht weinen! Dann könnt Ihr nichts erzählen, und ich kann auch Euer Gesicht nicht sauberbekommen. Nicht weinen, ja?«
Aber er weinte doch, und Lucardis stand hilflos mit ihrem Tuch daneben und fragte sich, warum in den Liedern, die er sang, die von edelmütigen Kriegern Geretteten immer so viel ansprechbarer und vernünftiger waren und ihren Befreiern keine Scherereien machten.
Nach einer Weile hatte er sich wieder in der Gewalt, aber als er sich endlich unbeholfen die Tränen abwischte, schien er vergessen zu haben, was sie gefragt hatte, denn er sagte nur: »Ich ersetze Euch Euer Pferd, sobald ich kann.«
»Es war nicht mein Pferd.«
»Oh. Ist das nun noch schlimmer oder nicht ganz so schlimm?«
»Es hat Frau Asa gehört.«
Das schien seine Frage zu seiner Zufriedenheit zu beantworten, denn er sah sie ebenso mitleidig wie dankbar an. »Sie ist wie ihr Vater, ja?«
Darauf frei heraus zu antworten, stand Lucardis nicht zu, und so entgegnete sie nur: »Sie wäre gewiss sehr erfreut, wenn ich ihr zumindest sagen könnte, wie es so weit gekommen ist. Mögt Ihr mir nun erzählen, wie es Euch hierher verschlagen hat?«
»Das kann ich tun, aber Ihr werdet mir kein Wort glauben«, sagte Audoin, der doch jede noch so abenteuerliche und märchenhafte Geschichte glaubwürdig klingen lassen konnte, voll ehrlicher Überzeugung.
2. Kapitel: Descensus in servitudinem
Audoin der Sänger war wie ein Zugvogel. Jedenfalls behauptete er das gern von sich, weil es lange Wege, hungrige Tage und müde Füße vergessen machte und weit besser klang als jede schlichtere Beschreibung seiner Lebensweise. In einer Hinsicht griff der Vergleich aber durchaus, denn man konnte je nach Jahreszeit mit nur geringen Abweichungen vorhersagen, in welcher Gegend man ihn finden würde. Der Schwanenhof, den er in jedem Herbst getreulich aufsuchte, war ein Ort von vielen auf seiner immer gleichen Runde, der nördlichste Punkt, an dem in Audoins Verständnis ein langer Sommer des Umherschweifens endete und der Rückweg in südlichere Gefilde angetreten werden musste, bevor der Winter hereinbrach. Wenn er den Schwanenhof wieder verließ, nahm er stets den Pfad, der zur alten Heerstraße führte, über die man in zwei Tagesmärschen am aufgelassenen Kloster von Bocernae vorüber nach Aquae Calicis gelangen konnte. Um vor dem Vogt und seinem Gefolge dort aufzutreten, war er nach eigenem Dafürhalten ein zu kleiner Fisch. Doch im Gasthaus »Zum Bischof Garimund« ließ es sich gut rasten, bevor man den langen Weg nach Südwesten in Angriff nahm. Die Harfe konnte in ihrer Hülle schlafen und Audoin auf der Bank daneben dösen oder, wenn das Wetter schön war, durchs Hafentor ans Flussufer der Mugila hinuntergehen und den Kähnen und Enten zusehen. Ein solcher Ruhetag tat nach dem Aufenthalt auf dem Schwanenhof immer sehr wohl.
»Ist es denn so anstrengend bei uns?«, fragte Lucardis gekränkt, als er an diese Stelle seiner Erläuterungen gelangt war, die ihr ohnehin zu ausführlich vorkamen, da Bardos Name bisher kein einziges Mal gefallen war.
Audoin sah sie schief an, betastete mit vorsichtigen Fingern die Umgebung seines blaugeschlagenen Auges und versuchte offenbar, zwischen Ehrlichkeit und der einer edlen Befreierin geschuldeten Höflichkeit abzuwägen. »Der Schwanenhof ist der letzte von sechs kleinen Herrensitzen, die ich nacheinander besuche«, sagte er schließlich, obwohl das keine Antwort und vielleicht doch eine war.
»Auf jedem will man denselben Klatsch aus der Gegend hören, die neuesten Lieder und die aufregendsten Geschichten von weither, die doch immer nur dieselben bleiben. Das ermüdet auf die Dauer, und in Aquae bin ich dann erschöpft. Das müsst Ihr verstehen.«
Lucardis bemühte sich zumindest um ein gewisses Verständnis, was mehr war, als sie für die meisten getan hätte. »Gut. Ihr wart also auch im letzten Herbst in Aquae?«
Er nickte. »Und vorher auf dem Schwanenhof, aber Ihr wart nicht da, sondern auf der Suche nach Frau Asa, wie man mir sagte … Auf einem guten Weg, wie Euer Vater meinte. Er hat so etwas im Gespür, nicht wahr?«
»Wir haben Asa gefunden, das wisst Ihr ja nun. Aquae?«
Er seufzte über so viel Ungeduld, die einen Verstand verriet, der es nicht gewohnt war, eine Erzählung schön aufzubauen, sondern nur das Nötigste aufgereiht haben wollte. »Am zweiten Abend, den ich dort im Gasthaus verbrachte, war auch eine Frau da, die sich Ratte nennt, und wenn es nach ihr ginge, wäre ich tot.«
»Die Ratte?«
Audoin nickte und Lucardis war gebührend beeindruckt, denn der Name »Ratte« war selbst auf dem Schwanenhof nicht unbekannt, auf dem man ihre Dienste nie benötigt hatte und, so Gott wollte, auch nie in Anspruch nehmen würde.
Die Frau, die sich hinter jener wenig schmeichelhaften Bezeichnung verbarg, hatte zuerst vor sechs, sieben Jahren von sich reden gemacht, als Faroald, der Königssohn, sich gegen seinen Vater Gundoald erhoben hatte, um ihm die Herrschaft über Austrasien, wenn nicht über das ganze Reich zu entreißen. Es war ihm nicht geglückt, und der Aufstand war mit ihm in der Schlacht von Bocernae gestorben, die auch über den Schwanenhof viel Leid gebracht hatte. Guten und ehrbaren Menschen brachten Bürgerkriege schließlich niemals Glück, aber andere benötigten gerade ein solches Umfeld mit seinen Gräueln und Unwägbarkeiten, um zu gedeihen, Söldner, Spitzel und noch üblere Gestalten.
Zu Letzteren zählte jene Ratte, die dem Vernehmen nach vieles verkaufte, vor allem eine sicher geführte Klinge zu allen denkbaren Zwecken, wenn nur der Preis ihr behagte, aber auch Wissen, Bosheit und überhaupt ihre Hilfe bei allem, an dem aufrechtere Seelen sich niemals beteiligt hätten. In den dunklen Tagen nach dem Krieg war sie unter denen gewesen, die Jagd auf Faroalds in alle Winde zerstreute Unterstützer gemacht hatten. Vielleicht stimmte nicht jede Geschichte über die von ihr zur Mahnung an Gerichtslinden genagelten Schwurhände – nicht in allen Fällen abgeschlagen, wie es hieß, und ebenso wenig nur toten Verrätern zugehörig –, aber man war sich einig, dass sie sich einmal übernommener Aufträge zuverlässig entledigte, ganz gleich, worin sie bestanden.
Was sie allerdings bewogen haben mochte, einen Anschlag auf Audoin zu unternehmen, konnte Lucardis sich beim besten Willen nicht vorstellen.
»Ihr kennt sie?«, hakte sie nach, als er nicht von sich aus weitersprach, sondern in sich versunken einen Riss in seinem linken Hosenbein betrachtete.
Er schaute auf. »Was heißt schon kennen? Ich bin ihr im Laufe der Jahre hier und da begegnet, aber damit hat es sich.« Das klang nach wenig dafür, dass Ratte ihm nach dem Leben getrachtet haben sollte, aber er fuhr fort: »Es war schon spät, als sie ins Gasthaus kam, und sie war eigenartig blass und erschöpft. Das hätte mir wohl auffallen sollen, und fiel mir auf, wie einem etwas ohne viel Bedeutung auffällt, auch, dass sie hinkte und nicht allein war. Aber sie sprach mich nicht an, und ich sie nicht, auch nicht die Leute, mit denen sie gekommen war.« Er fuhr sich über die kurzen Locken. »In dem Gasthaus waren auch ein paar Söldner aus Lunde, die über den Winter zurück in ihre Heimat im Norden wollten. Die schien sie besser zu kennen als mich, denn mit ihnen sah ich sie ein paar Worte wechseln, dachte mir aber nicht viel dabei. Wenn ich einen von meiner Art treffe, frage ich ja auch, wie die Geschäfte stehen oder dergleichen, warum sollte sie also nicht mit ihresgleichen reden? Aber sie muss von ihnen meinen Kopf verlangt haben, denn am nächsten Morgen, als ich früh auf der Straße nach Salvinae war, die doch gar nicht auf ihrem Weg lag, lauerten mir diese Söldner auf und überfielen mich.«
Die wenigen Sätze hatten gereicht, ihn im Erzählen wieder Tritt fassen zu lassen, denn das Übrige klang wie eine der Geschichten, die er auch schon auf dem Schwanenhof zum Besten gegeben hatte, voll finsterer Mienen und aufblitzender Klingen im Morgennebel, in dem jede Bitte um Schonung ungehört verhallen musste, während die Raben schon in freudiger Erwartung eines reichen Mahls krächzten.
Doch alle Rabenhoffnungen zerschlugen sich, als einer der Söldner, den seine Gefährten Gorm nannten, den übrigen Einhalt gebot und Audoin, der zu dem Zeitpunkt schon am Boden lag, prüfend musterte. »Sie hat gesagt: ›Schafft mir den Sänger vom Hals‹, nicht mehr und nicht weniger als das, nicht wahr?«, fragte er in die Runde, und als keiner sich an eine anderslautende Anweisung erinnern konnte oder wollte, lachte Gorm und sagte: »Lebend bringt er uns mehr ein, und ob er nun am Straßenrand verscharrt oder in die Fremde verkauft ist, wird sie doch nie herausfinden.«
Das schien den anderen gut gesprochen, und dass Audoin wenig von diesen Plänen hielt, kümmerte niemanden, abgesehen davon, dass man ihn niederschlug, als er um Hilfe zu rufen wagte.
Von da an reisten sie querfeldein und auf kaum begangenen Wegen nach Norden, und die wenigen Leute, denen sie begegneten, vermuteten kein Verbrechen dahinter, dass eine kleine Kriegerschar einen Gefangenen gefesselt und geknebelt mit sich führte. Vermutlich hätte Audoin dankbar sein sollen, dass sie ihn überhaupt am Leben gelassen hatten, aber das war kaum ein Trost, wenn man eigentlich etwas anderes vorgehabt hatte, als sich über die Grenze verschleppen zu lassen, zu tief ins Heidenland, als dass eine rasche Flucht möglich gewesen wäre. Als Gorm unterwegs die Harfe zu Geld machte, hegte Audoin ernsthafte Mordgedanken, doch er hätte sie auch dann nicht in die Tat umsetzen können, wenn seine Entführer nicht noch am selben Abend ein Würfelspiel verloren hätten. Den Einsatz beglichen sie lieber in finster dreinblickenden Sängern als in Münzen.
Der glückliche Gewinner des Würfelspiels, ein gewisser Brun, zuckte nur die Schultern, als sein neues Eigentum erklärte, widerrechtlich seiner Freiheit beraubt worden zu sein. Als Audoin zu beharren wagte, schlug Brun ohne große Aufregung zwei oder drei Mal zu und sagte: »Das kann jeder behaupten, aber ich könnte dich leicht vom Gegenteil überzeugen. Willst du mich dazu zwingen, oder wollen wir es lieber im Guten miteinander versuchen?«
Und mit einem Mann wie diesem versuchte man es lieber im Guten, das lernte Audoin binnen kürzester Frist.
Natürlich hätte Brun abgestritten, nichts als ein Räuberhauptmann zu sein. Den gedrungenen Turm, in dem er mit fünf Jagdhunden und ebenso vielen Kriegern hauste, und die paar Grubenhäuser ringsum bezeichnete er stolz als seinen Herrenhof. Die Einkünfte aus dem Fetzen Land und der Schafherde, die er sein Eigen nannte, hätten aber nie ausgereicht, den üppigen Goldschmuck anzuschaffen, mit dem er gern prahlte, oder die Pferde und Waffen seiner Gefolgsleute zu unterhalten. Weit einträglicher war für ihn, dass sein kleiner Winkel der Welt im Westen von einer Straße durchschnitten wurde, auf der er sich entweder nahm, was er wollte, oder sich fürstlich dafür entlohnen ließ, dass er dieses zweifelhafte Recht keinem anderen zugestand, so weit seine Macht reichte.
Wenn sechs Bewaffnete nicht genug waren, bezog Brun auch sein Gesinde in seine Unternehmungen mit ein, doch ein Blick auf Audoin genügte, um ihn davon zu überzeugen, dass er zu dergleichen nicht taugen würde. Aber er brauchte jemanden, der sich um die nötigsten täglich anfallenden Arbeiten im Turm kümmerte, nachdem der arme Mensch, zu dessen Pflichten dies vorher gehört hatte, im Streit mit einem der wackeren Krieger ein sehr unrühmliches Ende genommen hatte. Audoin fand sich also statt mit einer Harfe mit einem Besen in der Hand wieder und konnte sich über einen Mangel an Beschäftigung wahrlich nicht beklagen.
Zu dem Zeitpunkt herrschte schon Frost, und zur Grenze waren es zu Fuß zwei, vielleicht drei Tage. Das war zu weit, wenn man die Gegend nicht gut genug kannte, um zu wissen, wo man einen sicheren Unterschlupf finden konnte, zumal, wenn man fürchten musste, von Hunden und Reitern gehetzt zu werden.
Also blieb er, sah zu, mit niemandem aneinanderzugeraten, und schmiedete Fluchtpläne und zornige Verse, während er Bruns Wäsche mit dem Glättstein bearbeitete, Wassereimer schleppte und auf den Frühling wartete.
Am Ende kam er aber schon aus dem Turm fort, bevor das alte Jahr herum war, wenn auch nicht so, wie er sich die Sache vorgestellt hatte. Schuld an der neuerlichen Wendung, die sein Schicksal nahm, war die Tatsache, dass Brun zu allem Übel auch noch ein schlechter Nachbar war und in ständigem Streit mit Bardo lebte, dessen Herrschaftsbereich im Südosten an seinen grenzte. Kleinere Unfreundlichkeiten war man beiderseits gewohnt, doch irgendwann, als die Tage am kürzesten waren, ging Brun zu weit und raubte eine Magd von Bardos Burg. Das Mädchen vom Schwarzen Stein hatte nichts dagegen, Bardo aber sehr wohl, und da bei Schnee und Eis niemandem der Sinn danach stand, die Sache mit Waffen auszutragen, musste man sich anderweitig einigen.
Die Jagdhunde, die Bardo gern anstelle der Magd mit zurück zum Schwarzen Stein genommen hätte, wollte Brun nicht herausgeben. Was oder vielmehr wer sich stattdessen anbot, lag auf der Hand, auch wenn Brun mit Bedauern anmerkte, dass seine Hemden noch nie in so tadellosem Zustand gewesen seien wie in den Wochen, in denen sein Neuzugang aus dem Süden sich mit ihnen befasst habe. Das hörte Bardo gern, denn immerhin wusste er daraufhin gleich, welche Verwendung sich für die Entschädigung empfahl.
Audoin hatte nichts gegen die Übereinkunft einzuwenden, denn es war ihm nur recht, auf einer grenznahen Burg sein Warten fortsetzen zu können. Noch ein paar Wochen, so dachte er, dann würde er sich davonstehlen. Bis dahin hätte es Schlimmeres geben können, als Hemden zu waschen und Strümpfe zu stopfen, besonders, da die Leute vom Schwarzen Stein im Großen und Ganzen erträglicher waren als Bruns Bande.
Allerdings waren erst wenige Tage vergangen, als eine der Viehmägde Audoin schöne Augen zu machen begann. Damit kam er, obwohl er ihr nichts abgewinnen konnte, noch besser zurecht als mit der Tatsache, dass auch Hathuis Blick mehr als einmal auf ihm ruhen blieb. Anders als das Mädchen aus den Ställen lächelte und zwinkerte die Schwertmeisterin nicht, aber sie verstand sich umso besser darauf, unerwartet aufzutauchen und ein Gespräch mit Audoin anzuknüpfen, wenn er ihr nicht ausweichen konnte.
Mochten die Bemerkungen, die Hathui bei diesen Gelegenheiten machte, auch noch so unverfänglich sein, Audoin misstraute ihr, und als sie sich eines Abends im Vorfrühling mit erwartungsvoller Miene zu ihm setzte, während er sich im spärlichen Feuerschein mit einer Flickarbeit abmühte, befürchtete er, dass sie nun nicht länger um den heißen Brei herumreden, sondern ihn geradewegs in ihr Bett befehlen würde.
»Wer bist du?«, sagte sie stattdessen. »Oder vielmehr – wer warst du, bevor du der hier wurdest?«
Als Audoin sie nur erschrocken ansah, ging sie sogar so weit, die Hand, die sie wie so häufig bequem auf ihren Schwertgriff gestützt hatte, zu lösen und flach auf die Bank neben sich zu legen, um zu zeigen, dass von ihr nichts zu befürchten war.
»Du warst nicht immer einer, der sich um die Wäsche kümmert und den Kopf gesenkt hält«, fuhr sie fort, »das sehe ich, das höre ich an der Art, wie du dich ausdrückst, und wusste es vom ersten Tag an. Erst dachte ich ja, Brun hätte uns ein Paar Augen auf den Hof geschickt, aber jetzt bist du schon wochenlang hier und hast nie auch nur den Versuch unternommen, eine Botschaft an ihn zu senden, mit Fremden zu sprechen oder dich fortzuschleichen. Überdies bist du kein Krieger, warst nie einer, auch das sehe ich. Wer also bist du, und wie bist du zu Brun gekommen?«
Audoin hätte ihr die Wahrheit sagen können, und Hathuis offener, freundlicher Blick brachte ihn auch beinahe dazu. Doch er hatte sie zu lange in bösem, wenn auch wohl unbegründetem Verdacht gehabt und war noch voller Misstrauen und Zweifel.
Sein erster Gedanke war also, dass er sich durch übereilte Mitteilsamkeit nur jede Hoffnung verbauen würde, ungehindert Austrasien und damit die Freiheit zu erreichen. Einem fahrenden Sänger, der überall durchkommen konnte und nicht an Sesshaftigkeit gewöhnt war, würde man weit eher als jedem anderen eine Flucht zutrauen, und dass Bardo bereit sein würde, ihn ohne Gegenleistung gehen zu lassen, war schlicht undenkbar. Ganz gleich, ob er ihn als Hemdenwäscher behalten wollte oder seine Sangeskünste zu schätzen wissen würde, er würde ihm niemals die Entscheidung überlassen, ob er weiter am Schwarzen Stein leben würde oder nicht.
Darüber, wie es einem Sänger ergehen konnte, den man zum Bleiben zwingen wollte, machte Audoin sich keine besonders rosigen Vorstellungen. In seiner Jugend hatte er in der alten aula regia von Masolacum die Kette gesehen, an die Hilmegis, der dort einst geherrscht hatte, den am Rande einer Schlacht aufgegriffenen Hofdichter seines Rivalen Bertachar hatte legen lassen. Jener Unglückliche war ein anderer Audoin gewesen, so dass sein Schicksal allein schon deshalb von übler Vorbedeutung war. Die Geschichten darüber, wie der arme Mann drei Jahre lang gezwungen gewesen war, für seine Peiniger die Leier zu spielen und Verse vorzutragen, hatten seinen jüngeren Namensvetter so nachhaltig beeindruckt, dass sie ihm noch immer einen Schauer über den Rücken jagten. Er hatte schließlich auch, als gerade niemand hingesehen hatte, die noch immer so stolz allen Gästen und Reisenden gezeigte Kette angehoben und sie elend schwer gefunden, so dass sich zum bloßen Anblick in seiner Erinnerung noch die Last von Eisengliedern auf seiner Handfläche gesellte.
An all das dachte er nun bei Hathuis Frage und wagte nicht zu hoffen, dass sich seit jener betrüblichen Begebenheit der Umgang mit Sängern, die nicht freiwillig bleiben wollten, sehr geändert hatte.
»Was wollt Ihr Dinge aufstören, die nicht mehr sind?«, erwiderte er daher nur.
Hathui runzelte die Stirn und wollte sich mit der ausweichenden Antwort nicht abspeisen lassen. Sie hätte wohl auf einer besseren bestanden, wenn nicht just in dem Augenblick eine ihrer jüngeren Nichten erschienen wäre, um ihr aufgeregt zu erzählen, ein fahrender Sänger aus Austrasien sei auf die Burg gekommen. Hathui ließ sich gutmütig Richtung Tür mitziehen, und als das Kind im Gehen auch noch den Namen des unerwarteten Gasts verriet, hatte Audoin gleich doppelt Anlass, sein Nähzeug zusammenzuraffen und sich davonzuschleichen, denn wenn er einem Menschen ganz gewiss nicht über den Weg laufen wollte, dann seinem Vater.
»Halt«, unterbrach Lucardis ihn an dieser Stelle und war froh, dass Audoin tatsächlich verblüfft genug war, zu schweigen und ihr die nötige Zeit zu lassen, zu begreifen, was er da gerade gesagt hatte.
Sich eingestehen zu müssen, dass man bei jemandem, der ohne feste Bindungen kam und ging wie er, Angehörige gewöhnlich gar nicht einberechnete, war schlimm genug, aber wenn sie dem Bild, das sie sich stets von Audoin gemacht hatte, einen offenbar ebenfalls über die Burgen und Höfe streifenden Vater hinzufügte, ergab dieses letzte Stück seiner Geschichte keinen Sinn, oder zumindest keinen sehr erfreulichen.
Wenn sie im Heidenland festgesessen hätte, wäre ihr Vater der Erste gewesen, von dem sie sich Rettung erhofft hätte, und wenn er dort nur zufällig auf der Durchreise gewesen wäre, hätte sie alles getan, um sich bemerkbar zu machen.
Audoin lächelte fein, als könne er jeden einzelnen ihrer Gedanken lesen, und erklärte ihr doch nichts. »Darf ich weitersprechen, Frau Lucardis?«
Lucardis nickte stumm und dachte an die lange Wanderung, die vor ihnen lag, Zeit genug, jemanden, der sich jetzt zierte, nach Herzenslust auszufragen, besonders, wenn er schwer an einem großen Schinken zu tragen hatte.
Audoin wollte also seinem Vater nicht begegnen und stahl sich durch eine Hintertür fort, um durch die zu dieser Tageszeit verlassenen Wohnräume des Burgherrn und seiner Familie ins Freie zu gelangen. Ein ausgebessertes Wäschestück in die richtige Truhe zurückbringen zu wollen, war ein so guter Vorwand wie nur irgendeiner für diesen Umweg, und aus Bardos Schlafkammer führte eine Tür geradewegs in den Küchengarten hinaus, durch den man sich unbemerkt zu den Gesindeunterkünften schleichen konnte.
Doch die Zimmer hinter der Halle waren nicht ganz so leer, wie er angenommen hatte, und so geschah es, dass er mit einem anderen Gefangenen Freundschaft schloss und sich in den Kopf setzte, nicht ohne ihn zu fliehen.
Etwa zum selben Zeitpunkt, als Asa auf den letzten Meilen zum Schwanenhof Lucardis’ Frage, ob es nicht schön sei, nach Hause zu kommen, mit einem zweifelnden »Nun ja … Hier regnet es noch immer viel, nicht wahr?« beantwortet hatte, war ein Kaufmann aus dem Wilzenland auf die Burg am Schwarzen Stein gekommen. Als erster Händler des Jahres wäre er auch dann freudig willkommen geheißen worden, wenn er nicht mehr als die üblichen Waren auf seinem Karren mitgeführt hätte. Doch er hatte auch einen kleinen Käfig dabeigehabt, von dessen Insassen er gehofft hatte, dass er Bardos Kinder entzücken und einen hübschen Gewinn einbringen würde.
Damit hatte er sich nicht getäuscht, doch während der Händler wohl eher auf die Begeisterung der kleinen Jungen und Mädchen aus der Familie des Häuptlings gesetzt hatte, war am Ende entscheidend gewesen, wie angetan Heriger von dem Birkenhörnchen aus den östlichen Wäldern gewesen war. Ohne langes Feilschen hatte er einen ganzen austrasischen Goldsolidus für das kleine, schwarz und weiß gefleckte Geschöpf mit dem buschigen Schwanz und den funkelnden dunklen Augen bezahlt.
Seine Vorliebe für fremdländische Tiere hielt sich gleichwohl in Grenzen. Er hatte aber eine für Hildburg, die Erbin der Leute vom Hof auf dem Bärenhügel, oder rechnete sich zumindest aus, dass eine Heirat mit der jungen Frau ihn davor bewahren würde, einmal ein Leben wie seine Tante zu führen. Da andere aber weitaus mehr zu bieten hatten als er, war die Zuneigung des Mädchens das Einzige, was ihm den Weg ans Ziel ebnen konnte. Dementsprechend unerfreulich war es für ihn, dass sie ihm seit einem kleinen Streit im Winter nicht mehr gewogen war, und da wohlgesetzte Worte allein den Schaden nicht behoben hatten, hatte er beschlossen, sich auf Bestechung zu verlegen.
Das ungewöhnliche Tier schien ihm für sie, die doch so an ihren buntgefiederten Vögeln aus dem Süden hing, das passende Geschenk zu sein, und so plante er seit Tagen aufs Schönste, wie er ihr damit gegenübertreten und ihre Gunst zurückgewinnen würde. Als passenden Zeitpunkt, ihr das Hörnchen zu übergeben, hatte er das Frühlingsfest ausersehen. Zur Tagundnachtgleiche strömten so gut wie alle Bewohner der Gegend an dem uralten, aufrecht stehenden Stein zusammen, der Bardos Burg ihren Namen gegeben hatte. Bis dahin war allerdings noch etwas Zeit, und so blieb das Tier vorerst bei Heriger.
Audoin hatte alledem bisher nicht viel Beachtung geschenkt, abgesehen von der ebenso flüchtigen wie mitleidigen Überlegung, dass der Käfig, der auf Herigers Truhe stand, viel zu klein für ein Wesen wirkte, das doch dazu geschaffen war, durch Baumkronen zu huschen.
Doch als er sich jetzt aus der Halle davonschlich, hielt ihn ein Geräusch – nein, ein Rufen – auf. Er hatte nicht gewusst, ob das Birkenhörnchen überhaupt Laute von sich geben konnte, und hätte von ihm eher mit etwas wie dem Schimpfen eines Eichhörnchens als mit dem jämmerlichen, durchdringenden Ton gerechnet, der ihn nun zwang, stehen zu bleiben und sich umzusehen.
Zwei dunkle Augen, die stärker nach vorn gerichtet waren als bei einem Eichhörnchen, musterten ihn und sagten ganz eindeutig: Siehst du nicht, dass es mir hier nicht gefällt, Audoin? Und willst du nichts dagegen unternehmen?
Alles, was Audoin vorerst zu unternehmen wagte, war, versuchsweise einen Finger durchs Gitter zu stecken und sich zu freuen, dass er nicht gebissen wurde. Behutsam streichelte er das Köpfchen, das sich ihm bereitwillig entgegenstreckte.
Das rief einen zufriedeneren Laut hervor und Audoin beschloss, dass das Birkenhörnchen in seiner Obhut besser aufgehoben sein würde als bei einer Frau, die Kerle wie Heriger anzog. Ob es sich empfahl, es einfach im Wald auszusetzen, obwohl es doch nicht von hier stammte, wusste er nicht, doch er kannte einen Diakon unten in Corvisium, der viel über fremdländische Tiere wusste, und eine Handvoll Hörnchen bis dorthin mitzunehmen, konnte so schwer ja nicht sein.
Du und ich, wir gehen zusammen von hier fort, versprach er also schweigend und achtete in den folgenden Tagen darauf, das Birkenhörnchen oft zu besuchen, es zu füttern und freundliche Nichtigkeiten mit ihm zu reden.
Mit Hathui wollte er weniger gern sprechen, doch da sie nicht abließ und ihre lästige Frage wiederholte, erzählte er ihr, er sei im Süden Schreiber gewesen und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände um seine Freiheit gekommen. Damit, dass Hathui ihm etwas zu schreiben geben würde, rechnete er, ohne sich sehr davor zu fürchten, denn er traute niemandem am Schwarzen Stein zu, seine Hand von der eines echten Schreibers zu unterscheiden oder gar zu bemerken, dass sein Latein nicht das beste war.
Nachdem sie ihn so auf die Probe gestellt hatte, griff Hathui allerdings nie auf seine Schreiberdienste zurück, doch das mochte daran liegen, dass auf Bardos Hof kaum etwas schriftlich festgehalten wurde. Hier waren rein mündliche Absprachen noch gebräuchlich, und es hatte noch nie einen hauptamtlichen Schreiber gegeben, so dass wahrscheinlich auch jetzt kein Bedarf an einem bestand.
Audoin störte das nicht weiter. Er wartete ab, während die Tage milder und schließlich auch die Nächte erträglich wurden. Als dann ein schöner, sonniger Morgen kam, verkündete er, heute sei günstiges Wetter zum Wäschebleichen auf der Grasfläche südlich der Wälle am kleinen Bach, was durchaus zutraf. Dass in einem der Körbe, die er ins Freie schleppte, auch noch ein Bündel mit den nötigsten Vorräten und ein gut in eines von Bardos Unterhemden verpacktes Birkenhörnchen steckten, musste ja niemand erfahren, weder die Leute, denen er auf dem Hof begegnete, noch die Wachen am Tor, die ihm kaum Beachtung schenkten.
Audoin ging harmlos an die Arbeit und ließ sich Zeit, bis endlich das eintrat, worauf er gehofft hatte, und jemand aus einem von Bardos Dörfern die Straße entlang zum Tor kam. Das lebhafte Geplauder, das sich zwischen dem Besucher und den Kriegern entspann, reichte aus, alle abzulenken. Audoin nahm, was er bereitgelegt hatte, und machte, dass er ins nahe Waldstück und damit außer Sicht kam.
Dieser erste Teil der Flucht war ungefähr der einzige, der wie geplant verlief, und so lag nun wohl ein hastig weggeworfenes Bündel im Heidekraut auf dem Elfenhügel, während ein im letzten Augenblick freigelassenes Birkenhörnchen durch eine Gegend irrte, die ihm fremd war. Das kleine Tier war zu flink gewesen, sich wieder einfangen zu lassen; Audoin nicht.
Und das war auch schon die ganze Geschichte.
Lucardis hatte im Verlauf der Erzählung die Zeit gefunden, ihr Haar zu kämmen und neu aufzustecken. Nun tat sie, als würde sie sich weiter selbst in ihrem kleinen Spiegel betrachten. »Nein. Die ganze Geschichte ist das nicht, denn eines verstehe ich nicht: Warum wollte Ratte Euch ans Leben? Habt Ihr der Frau etwas getan oder einem Dritten einen Grund geliefert, ihre Dienste gegen Euch zu kaufen?«
Falls Audoin den Unschuldigen nur spielte, gelang es ihm überzeugend. »Warum? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Mittlerweile nehme ich an, dass es ausgereicht hat, dass ich sie kannte und in die falsche Richtung unterwegs war.«
»In die falsche Richtung?«
»Die Söldner, die sie augenscheinlich ebenfalls kannten, wollten über die Grenze nach Norden«, erläuterte Audoin geduldig, »ich dagegen weiter nach Süden, in die Gegenden, in denen Rattes Arbeit zuweilen sehr gefragt ist. Sie kann sich dort nicht nur Freunde gemacht haben und wollte vielleicht nicht, dass sich dort unten etwas über ihren derzeitigen Aufenthaltsort herumsprach. Wie gesagt, sie hinkte und war zu bleich, womöglich nicht ganz gesund … Wer in Ruhe seine Wunden lecken will, kann einen, der von Geschichten und Gerüchten lebt, nicht gebrauchen, und geht vielleicht aus Angst und Aufregung zu weit. Überdies …« Er zögerte.
Lucardis wartete schweigend ab.
Audoin hatte einen Fleck an seinem Ärmel entdeckt und rieb halbherzig daran herum, bevor er doch wieder aufschaute. »Sie war ja nicht allein. Eine Frau und ein Kind waren bei ihr, dick in ihre Mäntel eingemummelte Gestalten. Und wer ein Kind dabei hat, vielleicht gar noch das eigene, sieht mehr Gespenster als sonst in den Schatten. Wenn sie auch nur die geringste Bedrohung in mir erblickt hat, wird die Anwesenheit des kleinen Mädchens ihre Besorgnis verdoppelt haben.«
Lucardis nickte leicht. Ein verängstigtes wildes Tier war schlimm genug, doch eines, das Junge führte, noch schlimmer. Die Weisheit traf gewiss auch auf Ratten von dieser Art zu, und Furcht in einer misslichen Lage mochte einen zu so einigem treiben. Eine hinreichende Erklärung für einen Mord oder eine Entführung war sie dennoch nicht. Man konnte schließlich nicht jeden aus dem Weg schaffen, der kein Fremder für einen war, vor allem, wenn man sich in belebten Gasthäusern aufhielt und Begegnungen mit Bekannten geradezu herausforderte.
Doch selbst wenn Audoin nicht alles sagte, was er wusste oder ahnte, war jetzt nicht der rechte Augenblick, mehr aus ihm hervorzulocken, und das nicht allein, weil die Zeit knapp wurde. Der Sänger sah so müde und zerschlagen aus, dass Lucardis im Stillen bedauerte, ihm nicht tröstend durchs Haar fahren zu dürfen.
»Das könnte sein«, sagte sie deshalb nur. »Gebt auf jeden Fall acht, Ratte so rasch nicht mehr über den Weg zu laufen. Wenn grundlose Befürchtungen schon das hier verursacht haben, möchte ich nicht wissen, was sie erst tut, wenn sie Euch verdächtigt, Rache nehmen zu wollen.«
Audoin sah sie groß an. »Wisst Ihr«, erwiderte er nach einer kleinen Weile stillen Unbehagens, »es wäre nicht das Schlechteste, wenn Ihr Bardo erzählen würdet, dass es Euch um das Pferd reut und Ihr den Handel rückgängig machen wollt. Ich glaube, hier ist es sicherer und schöner, als ich bisher dachte.«
Es war ein Scherz, aber ein sehr schwacher. Lucardis lächelte nur halb. »Schlaft jetzt oder ruht Euch zumindest aus, während ich versuche, nüchtern zu bleiben und trotz meiner Unbedachtheit noch als ernstzunehmende Abgesandte zu gelten. Morgen redet Ihr dann keinen solchen Unsinn mehr und wir denken in Ruhe darüber nach, was wir in Rattendingen unternehmen können.«
Audoin nickte brav, schüttelte die Schuhe von den Füßen, als sei es zu viel verlangt, sich zu bücken, um sie abzustreifen, und streckte sich auf den weichen Schaffellen und Decken des Lagers aus.
Lucardis sah befriedigt zu und ging dann, um sich abermals Bardo und seinen Leuten zu stellen.
»Das alles hättest du besser gemacht, ich weiß«, sagte sie stumm zu Helga und erhielt wie immer keine Antwort.
Die tote Schwertmeisterin war allerdings die Einzige, die ihren Gewohnheiten im Umgang mit Lucardis treu blieb. Schon auf dem Weg über den Hof zur Halle bemerkte sie, dass die Leute sie anders ansahen als noch bei ihrer Ankunft, und Bardo empfing sie mit einem Lächeln, das aufrichtig wirkte.
Bei Tisch legte ihr der Diener, der die Speisen auftrug, die besten Stücke mit einer Miene vor, die verriet, dass dies nicht nur Liebenswürdigkeit einem Gast gegenüber, sondern eine nach empfundenem Verdienst bemessene Auszeichnung war. Die Krieger an der Tafel musterten sie halb anerkennend, halb schmunzelnd, als wären sie sich nicht ganz sicher, ob sie nun eine Verrückte, eine Heldin oder beides sei. Vielleicht war das nicht die ungünstigste Mischung.
Bardo war ob des guten Geschäfts, das er bei ihrem Handel gemacht hatte, in bester Laune. Er lachte und scherzte und hatte schon zugestimmt, noch vor Mittsommer selbst einen Besuch auf dem Schwanenhof zu machen, bevor er so recht erwogen hatte, wie viel Entgegenkommen er damit zeigte.
Mehrere Leute fragten nach Helga und ihrem Tod. Lucardis berichtete wahrheitsgemäß, dass ein Pfeil ihrem Leben ein Ende gesetzt habe, da einige Barsakhanen auf Raubzug in der alten Schwertmeisterin wohl eine Gefahr erblickt hätten. Wer diesen Pfeil abgeschossen hatte, verriet sie nicht, und auch nicht, dass Helga nicht dort draußen beigesetzt war. Sie wollte Asas Bitte nicht zuwiderhandeln.
»Lass Helga in der Steppe tot und begraben sein«, hatte die neue Herrin auf dem Schwanenhof gesagt, und Lucardis sah ein, warum es ihr so lieber war, auch wenn sie es selbst für falsch hielt.