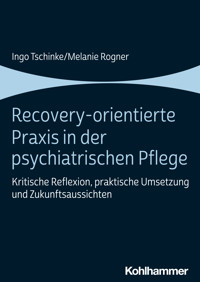
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind oftmals mit starken Veränderungen und Einschränkungen in ihrer aktuellen Lebenssituation konfrontiert. Das persönliche Recovery bietet die Möglichkeit, trotz bestehender Symptome ein erfülltes Leben zu erfahren und stärker aus der Krise hervorzugehen. Dabei geht es darum, dass Betroffene Hoffnung, einen neuen Lebenssinn und eine mögliche Neuausrichtung ihrer Identität entdecken. Das Buch gibt einen Überblick über Grundlagen und Theorien zum persönlichen Recovery, welche durch evidenzbasiertes Wissen aus den Bereichen Pflege, Medizin und Versorgungsforschung zu Recovery fundiert werden. Es kommen sowohl Betroffene als auch Mediziner und Pflegende zu Wort, die ihre Erfahrungen mit der psychiatrischen Versorgung darstellen. Dabei werden Versorgungsrealitäten den Veränderungsbedarfen in den Bereichen Medizin und Pflege gegenübergestellt und es werden konkrete Ideen zur Umsetzung von Recovery in der Praxis aufgezeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contents
Cover
Titelei
Vorwort
1 Einführung
2 Recovery – ein Wort, drei Bedeutungen und fünf Auslegungen
2.1 Persönliche Ebene
2.2 Klinisches Recovery
2.2.1 Sichtweisen der Betroffenen
2.2.2 Pflegerische Perspektive
2.2.3 Ärztlich-psychotherapeutische Perspektive
2.2.4 Zusammenfassung und Recovery-orientierte Perspektiven
2.3 Persönliches Recovery
2.3.1 Sichtweisen der Betroffenen
2.3.2 Pflegerische Perspektive
2.3.3 Ärztlich-psychotherapeutische Perspektive
2.3.4 Zusammenfassung und Recovery-orientierte Perspektiven
2.4 Recovery-Orientierung als positivistische Unterstützungshaltung von psychiatrisch Tätigen
2.4.1 Sichtweisen der Betroffenen
2.4.2 Pflegerische Perspektive
2.4.3 Ärztlich-psychotherapeutische Recovery-orientierte Haltung
2.4.4 Zusammenfassung
2.5 Recovery-Bewegung
2.5.1 Sichtweisen der Betroffenen und Handlungsmöglichkeiten
2.5.2 Pflegerische Perspektive und Handlungsmöglichkeiten
2.5.3 Ärztlich-psychotherapeutische Perspektive und Handlungsmöglichkeiten
2.5.4 Zusammenfassung
3 Biopsychosoziales Behandlungsmodell versus Recovery-Orientierung
3.1 Sichtweisen der Betroffenen
3.2 Pflegerische Perspektive
3.3 Ärztlich-psychotherapeutische Perspektive
3.4 Zusammenfassung und Perspektiven für eine Recovery-Orientierung in der psychiatrischen Versorgung
4 Ethik und Werteorientierung in einer Recovery-orientierten Praxis
4.1 Eigene Ethik und Werteorientierung der Betroffenen
4.2 Ethik und Werteorientierung der psychiatrisch Pflegenden
4.3 Ethik & Werteorientierung der Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen
4.4 Zusammenfassung
5 Begegnungen – Erstkontakte mit Kliniken, Fachärzt*innen, Psycholog*innen und psychiatrisch Pflegenden
5.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen
5.2 Gestaltung erster Begegnungen durch psychiatrisch Pflegende
5.3 Zusammenfassung und Umsetzung von ersten Begegnungen
6 Kommunikation
6.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen
6.2 Gestaltung von Kommunikation durch psychiatrisch Pflegende
6.3 Gestaltung von Kommunikation durch Fachärzt*innen und Psychotherapeut*innen
6.4 Zusammenfassung und Gestaltung von Kommunikation in der psychiatrischen Versorgung
7 Biografie-Arbeit – Verstehen im Kontext
7.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen
7.2 Erforschung der Biografie im psychiatrisch pflegerischen Kontext
7.3 Zusammenfassung
8 Betroffene werden als Expert*innen ihrer Erkrankung gesehen
8.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen
8.2 Annahme des Expertentums durch psychiatrisch Pflegende
8.3 Zusammenfassung
9 Verantwortungsübernahme im Recovery-Prozess
9.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen
9.2 Verantwortung im Recovery für die psychiatrische Pflege
9.3 Zusammenfassung
10 Förderung des Recovery–Prozesses
10.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen
10.2 Förderung des Recovery–Prozesses durch psychiatrische Pflege
10.3 Zusammenfassung
11 Gestaltung von Therapie und Begleitung im Recovery
11.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen
11.2 Begleitung und Coaching von Betroffenen im persönlichen Recovery für psychiatrisch Pflegende
11.3 Behandlung und Therapie von Betroffenen unter Berücksichtigung des persönlichen Recovery für Fachärzt*innen und Psychotherapeut*innen
11.4 Zusammenfassung
12 Lebensweltorientierung im persönlichen Recovery
12.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen
12.2 Begleitung in der persönlichen Lebenswelt durch psychiatrische Pflege
12.3 Zusammenfassung
13 Zusammenfassung und Ausblick auf die psychiatrische Versorgung unter Recovery-orientierten Aspekten
Literaturverzeichnis
Der Autor, die Autorin
Ingo Tschinke,Dr. Public Health (Candit.), M. Sc. in Pflege- und Gesundheitswissenschaften, M. A. Nursing Management, Dipl.-Pflegewirt, Fachpfleger in der Psychiatrie.
Melanie Rogner, Dipl.-Jur., B. A. in Social Science, Dozentin für Recovery.
Unter Mitarbeit von
Madeline Albers,Uwe Gonther,Anja Neumann
Ingo Tschinke/Melanie Rogner
Recovery-orientierte Praxis in der psychiatrischen Pflege
Kritische Reflexion, praktische Umsetzung und Zukunftsaussichten
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2024
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-042194-3
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-042195-0epub:ISBN 978-3-17-042196-7
Vorwort
Als Reisende auf dem Wege des Recovery (eigene Genesung), haben wir – als Herausgeber dieses Buches – über die vergangenen Jahre viele persönliche Erfahrungen mit Recovery in den verschiedensten Auslegungen gemacht. Begonnen hat diese Reise für uns beide in der persönlichen Auseinandersetzung im Rahmen der Begleitung der ambulanten psychiatrischen Pflege.
Melanie war damals nach der Geburt ihres ersten Kindes in einer kritischen Phase ihrer Psychose und ich habe den Auftrag durch den behandelnden Facharzt bekommen, sie zu begleiten und zu unterstützen. Diese Unterstützung fand über fast neun Jahre statt – mit immer wieder stattfindenden Unterbrechungen durch die Beendigungen der Verordnungen der Regelversorgung und später der integrierten Versorgung. Dabei haben wir gemeinsam viele Höhen und Tiefen der Krankheitsphasen von Melanie durchlebt – zu denen Melanie im Laufe des Buches aus ihrer eigenen Erfahrung noch viel schildern wird. Das wohl Wichtigste war die gemeinsame Recovery Erfahrung, die wir als Lernende und Lehrende zusammen durchlebt haben.
Ich hatte im Vorfeld auf verschiedenen Kongressen und durch Artikel und Lehrbücher von Recovery gehört und gelesen und mir gedacht, dass ich vieles davon durch meine sozialpsychiatrische Grundhaltung eigentlich schon umsetze. Das dem nicht so war, war eine Erfahrung, die ich mit Melanie gemacht habe. Durch mein Master-Studium an der Martin-Luther-Universität in Halle/Saale habe ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit vertiefend mit Recovery beschäftigt, aber richtig begriffen und gelebt hatte ich es in der Praxis noch nicht. Das habe ich dann mit Melanie in der letzten Phase der Begleitung umgesetzt und dabei haben wir beide die Erfahrung gemacht, was es heißt den persönlichen Recovery-Weg zu finden und zu beschreiten.
Melanie befand sich damals in einer Phase einer relativen Stabilität und war am überlegen, wie sie ihre zukünftige Berufstätigkeit gestalten könnte – als Dipl. Juristin und Bachelor Absolventin der Sozialwissenschaften hat sie sich eine Tätigkeit in diesen Bereichen nicht vorstellen können. Wir hatten im Vorfeld schon über die Möglichkeiten des persönlichen Recovery-Weges gesprochen und uns mit dem Recovery-Handbuch (Perkins & Rinaldi 2007a) und dem persönlichen Recovery-Plan (Perkins & Rinaldi 2007b) befasst, den Melanie für sich erarbeitet hatte. Aus meiner Sicht hat das persönliche Recovery von Melanie erst richtig Fahrt aufgenommen, als ich sie als Assistentin für meine qualitative Forschungsarbeit im Rahmen meiner Master-Qualifikation für die Fokus-Gruppeninterviews zur Adaption eines britischen Recovery-Schulungsprogramms (Bird et al. 2014) auf die Bedarfe für Fort- und Weiterbildung für ambulante psychiatrische Pflegedienste hinzugezogen hatte. Die Erkenntnis, dass sie dadurch ihr Studium der Sozialwissenschaften, ihr Experten-Wissen als Betroffene und auch ihre besondere Wahrnehmungsfähigkeit als Mensch mit einer Psychose zur Anwendung bringen konnte, hat ihren persönlichen Recovery-Prozess beflügelt.
Als dann unter den Teilnehmer*innen der Fokus-Gruppen – alles fachliche Leitungen von psychiatrischen Pflegediensten – die Frage aufkam, wann wir dieses Programm in die Praxis umsetzen, kamen Melanie und ich schon ins Grübeln. Die Antwort ergab sich dann recht schnell – wenn nicht jetzt, wann dann. Also haben wir die Schulungen gemeinsam auf uns umgearbeitet und haben diese dann 2018 gestartet. Neben der Fortführung der persönlichen Reise von Melanie, ergab sich daraus unsere gemeinsame Reise als Dozierende für die Förderung der Reise des persönlichen Recovery der Betroffenen und einer Recovery-orientierten Haltung für psychiatrisch Tätige. Seit dieser Zeit haben wir diesen Kurs zur Ausbildung zum Recovery-Coach etwa 25-mal durchgeführt, haben gemeinsam an einem Lehrbuch für ambulante psychiatrische Pflege gearbeitet (Tschinke et al. 2021a) und die Idee für dieses Buch entwickelt.
Wir haben daher die Erfahrung gemacht, was Recovery auf der persönlichen Ebene bedeutet und was den Unterschied zum klinischen Recovery ausmacht. Durch unsere Schulungen haben wir in vielen Konstellationen mit den verschiedensten Berufsgruppen darüber diskutiert, was eine Förderung des persönlichen Recovery und eine Recovery-Orientierung in der Haltung von psychiatrisch Tätigen ausmacht und uns damit auf die Reise begeben, wie sich Haltungsveränderungen in der Psychiatrie umsetzen lassen. Wir haben uns auch damit beschäftigt, Recovery auf gesellschaftlicher Ebene voranzutreiben, indem wir auf breiterer Ebene durch Publikationen die Diskussionen über Recovery anregen. Für diesen gemeinsamen Recovery-Weg ist es allerdings wichtig, dass alle Sichtweisen zu Wort kommen, weswegen Melanie dies auch aus ihrer Sicht schildert:
Meine Recovery-Reise begann schon sehr viel früher, ohne dass ich es wusste. Ich musste bis 2012 feststellen, dass ich permanent scheiterte, bei den Versuchen, die Krankheit Psychose zu meistern. Als ich 2012 meinen ersten Sohn bekam, war ich zum ersten Mal intrinsisch motiviert, etwas zunächst für meinen Sohn zu tun, damit es ihm gut ginge. Dies beinhaltete, dass ich mich aktiv mit meiner Krankheit auseinandersetzen musste, waren die Jahre zwischen 2008 und 2012 die schwierigste Zeit in meinem Leben, da immer wiederkehrende Schübe in kurzen zeitlichen Abständen vorkamen. Es musste dringend eine Besserung her, für meinen Sohn, für meine Familie, für mich.
Damals bekam ich die ambulante psychiatrische Pflege vermittelt und Ingo kam zu mir nach Hause, redete mit mir und führte Reflexionsgespräche mit mir, um meine Wahrnehmung wieder in gesunde Bahnen zu lenken. Ich fing an, mich mit meiner Frühwarnsymptomatik auseinanderzusetzen und mich mit meiner Krankheit und dem Sinn dahinter zum ersten Mal zu beschäftigen. Ingo und ich sahen uns in immer größeren Abständen. Es folgte eine Phase jahrelanger Psychose-Freiheit, bis mein zweiter Sohn zur Welt kam und ich hormonell bedingt – und weil eine Geburt nun einmal ein sehr aufregendes Erlebnis darstellt – wieder in eine krankhafte Episode rutschte.
So ganz wollte ich die Psychose als Erkrankung nie akzeptieren. 2016 hörte ich dann zum ersten Mal von dem Begriff Recovery. Ingo fragte mich, ob ich schon einmal davon gehört hätte. Er schob mir ein Buch über den Tisch mit dem Titel »Recovery, das Ende der Unheilbarkeit« (Amering & Schmolke 2012). Ehrlich gesagt, war dies etwas, wonach ich die ganze Zeit meines erkrankten Lebens gesucht hatte. Es ging nicht um meine Defizite, nicht darum, was ich alles nicht mehr konnte, sondern um Hoffnung. Hoffnung auf bessere Zeiten mit mehr Lebensqualität. Gedanklich spielte ich mit Möglichkeiten, an die ich mich bislang nicht einmal getraut hatte, zu denken. Vielleicht könnte ich doch so etwas ähnliches haben wie einen Beruf. Vielleicht hätte ich sogar die Chance auf so etwas wie ein normales Leben – ich kam mir in diesem Moment fast wagemutig und töricht vor.
Den Begriff »normal« relativierte ich später schnell für mich im Rahmen meines Recovery-Wegs, als ich das Konzept des Recovery verstanden hatte und erleichtert feststellte, dass es gar nicht um ein gesamtgesellschaftliches Normal ging, sondern um persönliche Entwicklung und Veränderung hin zu einem sinnvollen Leben mit mehr Zufriedenheit sowie Lebensqualität. Wo mich dieser entfachte Gedanke allerdings hintragen würde, war mir damals nicht bewusst. Als Dozentin zu arbeiten, überstieg meine Vorstellungskraft, fühlte ich mich doch so klein, empfindsam und beinah verschreckt. Dennoch machte mir der Gedanke an Recovery Mut, Dinge auszuprobieren – eben auch irgendwann die Dozententätigkeit, ich fasste auch den Mut an meiner Mutterrolle zu arbeiten und mein Leben mit meiner selbstgesuchten Familie zu gestalten und nicht mehr abwartend in der gesellschaftlichen »Ecke« zu verharren und das Leben an mir vorbeiziehen zu lassen.
Recovery bedeutet für mich in allererster Linie Veränderung. Veränderung hin zu mehr Lebensqualität, mit der Erkrankung. Dabei ist es unerheblich, ob eine Psychose, Depression, Borderlinestörung, eine Bipolare Störung oder eine andere psychiatrische Diagnose vorliegt. Es geht nicht darum, alles »wegzumachen«. Stimmen müssen nicht zum Schweigen gebracht werden, es geht auch nicht darum die Gefühle der Niedergeschlagenheit, der Selbstvorwürfe und die Gefühle der Zerrissenheit aufzulösen und ständig ausgeglichen und fröhlich durch die Welt zu gehen. Es geht darum, anzuerkennen, dass es schwierige Lebensphasen gibt, dass diese Phasen auch immer wieder kommen können. Diese Krisen sind jedoch zeitlich begrenzt und können überwunden werden. Jeder kann aus diesen schlechten Zeiten etwas für sich gewinnen, was ihn weiterbringt und kann daran wachsen.
Es geht nicht um das OB, es geht um das WIE. Wie gehe ich mit Krisen um? Wie finde ich meine Frühwarnsymptomatik heraus? Wie reagiere ich auf erste Warnzeichen? Wie hart gehe ich mit mir ins Gericht, wenn ich die Krise nicht beherrschen kann und in die Klinik muss? Wie kann ich nachsichtig mit mir sein? Wie kann ich wieder Hoffnung schöpfen und nach vorne blicken? Wie kann ich wieder Ziele haben im Leben? Wie kann ich einen Mehrwert aus meiner Erkrankung ziehen? Wie kann ich Selbstfürsorge betreiben?
Das Wichtigste ist jedoch, dass ich auch scheitern darf bei all den Versuchen, die Wie-Fragen im Leben zu beantworten. Der EIGENE Weg ist das Ziel. Vergleiche mit anderen sind kontraproduktiv und tun uns allen nicht gut. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo, in dem er an Dinge oder Situationen herangeht und Probleme löst. Eine psychische Erkrankung zu bekommen ist auch eine Form der Problemlösung, wenn auch eine sehr schmerzhafte und oft sehr langwierige. Man sollte aber die Phase des posttraumatischen Wachstumsprozesses nicht unterschätzen. Diesen Transformationsprozess kann jeder von uns leisten. Es geht um mehr Lebenszufriedenheit mit der Erkrankung.
Heute ist mein Leben erfüllt – trotz Erkrankung, trotz Symptomatik. Ich habe keine Ahnung davon, ob ich jemals wieder so erkranke, dass ich in eine Klinik muss, aber sicher ist, dass ich in diesem Moment noch nie so glücklich in meinem Leben war.
Für mich ist es immer noch unfassbar, wohin mich meine eigene Recovery-Reise getragen hat, wie sie mich trägt und ich bin gespannt, was das Leben an Erfahrungen auf dieser Reise für mich bereithält. Ich freue mich auf eine lebenslange Reise im Sinne des Recovery, auf neue Herausforderungen und ein bewegtes Leben mit allen dazugehörigen Facetten, um innerlich und an der Seite meiner Familie zu wachsen.
Neben Melanie kommen in diesem Buch auch noch einige Betroffene zu Wort, die mit ihren Erfahrungen über klinisches und persönliches Recovery die Sichtweisen noch erweitern. Die geneigten Leser*innen werden feststellen, dass die Betroffenenberichte sich durchaus unterscheiden, denn alle Betroffenen, die an diesem Buch mitgeschrieben haben, befinden sich in unterschiedlichen Phasen ihres persönliches Recovery-Prozesses und wir möchte diese Unterschiede eher deutlich machen als vereinheitlichen. Was die Betroffenen allerdings eint, ist die Tatsache, dass sie alle von mir – Ingo Tschinke – als Betroffene in ihrem Genesungsprozess in der ambulanten psychiatrischen Pflege begleitet wurden oder noch immer werden. Deswegen sollte es die Leser*innen auch nicht verwundern, dass ich in ihren Geschichten als Ingo (Melanie Rogner – wir sind inzwischen Kollegen und duzen uns) und Herr Tschinke (Madeline Albers und Anja Neumann – wir haben eine professionelle Beziehung) vorkomme. Dieses Buch ist Teil ihres persönlichen Prozesses, ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen und sich selbst und das, was sie mitzuteilen haben, wichtig zu nehmen. Durch diese Narrative der Betroffenen möchten wir deutlich machen, wie wichtig es ist, die Subjektivität der verschiedenen Persönlichkeiten zu verstehen und die Menschen in dem Kontext ihrer eigenen Lebenswelt und Lebensumgebung zu sehen.
Besonders wichtig ist uns auch die Beteiligung von Prof. Dr. Uwe Gonther an diesem Buch, denn gerade Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen tun sich mit den systemischen Veränderungen schwer, die die Recovery-Orientierung von ihnen fordert (Le Boutillier et al. 2015b). Diese Berufsgruppe muss sich insbesondere mit den Themen der Behandlungs-Ethik des Recovery (Barker 2011b), Risiken und Krisen (Juckel & Hoffmann 2016) sowie der Verantwortung (Beauchamp & Childress 2019) auseinandersetzen. Dammann schreibt im Nervenarzt, dass in der Recovery-Literatur eine »karikaturhafte verzerrte Sicht der Psychiater*innen gezeichnet wird, die wenig Zeit haben, nur Medikamente geben und ihre Patienten mit negativen Prognosen ängstigen.« (Dammann 2014, S. 1159). Dem möchten wir durch die Beteiligung eines Arztes und Psychotherapeuten entgegenwirken. Denn es steht außer Frage, dass Institutionen, welche mit einer Recovery-orientierten Praxis arbeiten, diese nur mit einem interdisziplinären Ansatz umsetzen können. Dabei ist es nötig, dass Ärzt*innen und die Pflege zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig für das Problem verantwortlich machen. So herrscht oftmals die Einstellung vor, dass die Pflege nur etwas umsetzen könnte, wenn die Ärzt*innen endlich mitmachen würden, während diese darauf verweisen, dass es gerade die Pflege ist, die eine paternalistische, kustodiale und risikobetontere Haltung einnimmt.« (Dammann 2014, S. 1164).
Das Autorenteam möchte den Leser*innen Möglichkeiten aufzeigen, wie eine Recovery-orientierte Haltung entwickelt werden kann und welche Faktoren zur Umsetzung aus Sicht der Betroffenen und mit einem professionellen Ansatz notwendig sind. Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass innerhalb der Beschreibungen der Betroffenen und der Professionellen aus Medizin und Pflege einige kritische Anmerkungen gemacht werden. Es geht uns dabei nicht darum, die Sozialpsychiatrie polemisch zu kritisieren und den Recovery-Ansatz als den einzig richtigen darzustellen. Es geht darum, auf dem sozialpsychiatrischen beziehungsorientierten Ansatz aufzubauen, denn Recovery ist an und für sich nichts zu idealisierendes Neues, sondern es beinhaltet einen Perspektivenwechsel in der Haltung und Begleitung gegenüber den Betroffenen. Dabei möchten wir auch mit den Missverständnissen gegenüber des Recovery aufräumen: Denn es bedeutet nicht, dass die medikamentöse Therapie mit Neuroleptika einseitig verteufelt wird, man sich nur noch mit den Ressourcen und Stärken auseinandersetzt und gleichzeitig die Krankheitssymptome unberücksichtigt lässt (Dammann 2014, 1161 ff).
Sollte in dem Text der Betroffenen aus ihren persönlichen Erfahrungen über Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen und Kliniken berichtet werden, so haben wir diese bewusst abgewandelt, sodass keine Rückschlüsse auf diese Personen und Institutionen geschlossen werden können. Dies gilt ebenso, wenn die Betroffenen von anderen Betroffenen und deren Erfahrungen berichten. Die erwähnten Personen sind darüber informiert worden und haben ihr Einverständnis gegeben, diese Erfahrungen unter abgewandelten Namen hier niederzuschreiben.
Wir wünschen allen Leser*innen eine interessante Lektüre mit diesem Buch und hoffen, dass es uns gelingt, zum Nachdenken und Reflektieren anzuregen.
Ingo Tschinke und Melanie Rogner
1 Einführung
Ingo Tschinke
Wozu nun ein Buch über Recovery in seinen verschiedenen Formen? Was bedeutet Recovery eigentlich und wo bestehen Unterschiede zum dem gängigen sozialpsychiatrischen Versorgungssystem und dem biopsychosozialen Modell, welches zur Behandlung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen eingesetzt wird? Diesen und anderen Fragen möchten wir in diesem Buch nachgehen, denn Recovery ist in seinen verschiedenen Ausprägungen recht vielschichtig und kann dadurch auch etwas undifferenziert erscheinen (DGPPN 2019, S. 48). Als klinisches Recovery hat es etwas mit der regulären und standardisierten Behandlung von psychischen Erkrankungen zu tun, als persönliches Recovery ist der »Recovery Weg« höchst individuell und eine Angelegenheit der Betroffenen, die dadurch einen hoffnungsvollen Weg der Selbstbestimmtheit, Selbstbefähigung und -wirksamkeit, Akzeptanz und Autonomie beschreiten können (Slade 2009). Die Form der Recovery-Orientierung in der Haltung der professionellen psychiatrisch tätigen Berufsgruppen hat viel mit einer inneren Grundhaltung (normative Ethik) im Sinne einer Recovery-orientierten Praxis zu tun, die von den Berufsgruppen die Umsetzung von spezifischen Werten als auch die Einhaltung von bestimmten Prinzipien in Umgang und dem Verhalten gegenüber den Betroffenen einfordert (Barker 2011a). Des Weiteren ist Recovery ein gesellschaftlicher Prozess, um einen aufgeschlosseneren Umgang mit psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft gewährleisten zu können (Pilgrim & McCranie 2013, S. 169), und ein Grundkonzept zur Erstellung von gesundheitspolitischen und medizinischen Richtlinien (Slade 2009, S. 74) und Leitlinien (DGPPN 2019). All dies ist sehr komplex – weitaus komplexer als das, was die psychiatrische Pflege und die behandelnden Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen bisher in Begleitung und Behandlung umgesetzt haben (Le Boutillier et al. 2015a; Le Boutillier et al. 2015b). Auch für die Betroffenen ist das persönliche Recovery im Vergleich zum klinischen Recovery – die Behandlung im »Business as usual« – sehr viel komplexer in Bezug auf das Verständnis der eigenen Transformation (Beck 2021) und des posttraumatischen Wachstums (Slade et al. 2019), die Krankheit als Chance zu sehen und gestärkt aus der Krise hervorgehen zu können. Diese komplexe Intervention führt zu einer völligen Veränderung der Sichtweise der psychiatrischen Versorgung, in der nicht mehr die psychische Erkrankung und deren Behandlung im Vordergrund steht, sondern alles sich um das persönliche Recovery der Betroffenen dreht, wobei Behandlung nur noch eine Option der Bewältigung ist, aber nicht mehr die Primäre (Slade & Longden 2015). Aus diesem Grunde lassen wir in diesem Buch alle Beteiligten durch die verschiedenen Autoren zu Wort kommen – sowohl die Betroffenen mit ihren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen mit der Psychiatrie und ihrem persönlichen Recovery-Weg als auch die psychiatrische Pflege sowie Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen, um Perspektiven für diese Veränderungen in der psychiatrischen Versorgung darzulegen.
Seit Ende der neunziger Jahre ist das Prinzip des persönlichen Recovery immer mehr in die Diskussion gerückt, da sich feststellen ließ, dass die bisherige Versorgung Menschen von dem System abhängig machte, dass das Heilungskonzept bei schweren psychischen Erkrankungen nur unzureichend funktionierte und die Menschen somit in eine Chronifizierung ihrer Erkrankung führte (Shepheard et al. 2008; Amering & Schmolke 2012). In den deutschsprachigen Ländern ist das Konzept des persönlichen Recovery zum Umgang mit Betroffenen in der Diskussion von Pflegefachpersonen, Ärzt*innen, Psycholog*innen und wird in Behandlungsleitlinien auch berücksichtigt (DGPPN 2019). Die Versorgungsrealität im psychiatrischen Versorgungssystem unterliegt noch immer einer fürsorglichen sozialpsychiatrischen Prägung mit einer Grundausrichtung auf das biomedizinische Modell (Prestin 2019). Dadurch stehen die Reduktion von Symptomen und die Fokussierung auf Probleme und Defizite in den Behandlungskonzepten noch häufig im Vordergrund. Dies fördert eher die Asymmetrien in der Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und Professionellen, sodass nicht die Betroffenen, sondern die professionell psychiatrisch Tätigen als Expert*innen der Erkrankung angesehen werden können und eine Begleitung und Behandlung auf Augenhöhe durch ein »Shared Decision Making« nur unter dem Fokus der Behandlung stattfinden kann (Deegan & Drake 2006). Eine qualitative Studie zu den Widersprüchlichkeiten bei der Nutzung von Recovery aus Großbritannien zeigt anschaulich, dass, wenn das biomedizinische Modell den Fokus der Behandlung (Medikation und Therapie) und der Beziehung zwischen Betroffenen und Professionellen bestimmt, immer noch die Erkrankung und die Reduktion der Symptome im Vordergrund stehen und weniger die subjektiven Wünsche, Bedürfnisse und das Lebensumfeld der Betroffenen, auch wenn die Professionellen die Förderung des persönliche Recovery und eine Recovery-Orientierung für ihre Arbeit internalisiert haben (McCabe et al. 2018). Dadurch werden die Machtstrukturen der psychiatrischen Versorgung weiterhin manifestiert, wodurch vermehrt paternalistische Entscheidungen für die Betroffenen getroffen werden, was zu einer gesteigerten Selbststigmatisierung führen und das Ergebnis der Behandlung negativ beeinflussen kann (Hamann et al. 2017; McCabe et al. 2018). Vielfach kommt es dazu, dass das persönliche Recovery »nur« als unterstützendes Konzept in der Behandlung betrachtet wird, was aufgrund seiner »Komplexität« zeitweise vergessen wird (Slade et al. 2014). Dadurch erhält sich eine starke Fokussierung auf die psychische Erkrankung durch die Betroffenen selbst, da sie keine anderen Optionen kennenlernen, und auch der psychiatrisch Tätigen, weil sich das Psychiatrie-System in der vorherrschenden Form autopoetisch erhält (Goffman 2014; Berghaus & Luhmann 2011). Selbst Fachleute, die sich kritisch mit dem Recovery-Konzept auseinandersetzen, gehen davon aus, dass Betroffene weiterhin die Hierarchien und Machtstrukturen der Psychiatrie in Deutschland und der Schweiz als gegeben akzeptieren müssten (Dammann 2014), obgleich Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass es auch anders geht (van Veldhuizen & Bähler 2017; Bradstreet & McBrierty 2012).
Abb. 1:Versorgung mit dem Fokus auf die Erkrankung und Versorgung (vgl. Beck 2021, S. 5)
Das richtige Verständnis des persönlichen Recovery kehrt das System um, denn Recovery (Genesung) ist der Kern der persönlichen Entwicklung der Betroffenen und die Behandlung kann dabei ein Mosaikstein des persönlichen Recovery sein, muss es aber nicht. Das persönliche Recovery steht mit seinen subjektiven Werten, Empfindungen, Bedürfnissen und dem individuellen Kontextbezug (▸ Abb. 2) im Vordergrund (Klevan et al. 2021). Dies kann mit oder ohne Behandlung (Medikamente, Therapie etc.) geschehen, je nach Bedarf der Betroffenen, der durch das Shared Decision Making zu ermitteln ist (Slade 2017). In schweren Krisen und lebensbedrohlichen Situationen, kann es sein, dass die Ausprägungen der Erkrankung in den Vordergrund rücken, um die Betroffenen zu schützen, trotzdem darf dieser Aspekt des persönlichen Recovery nicht vergessen werden (Prytherch et al. 2021). Bei dem persönlichen Recovery geht es in erster Linie darum, mit Hilfe von Hoffnung und dem Optimismus das Leben wieder in den Griff zu bekommen, sowie der Übernahme von Selbstverantwortung, der »Rück«-Gewinnung von Sinnfindung, der Bildung einer neuen Identität und der Verbesserung von Lebensqualität trotz Symptomen neue Wege zu finden. Dazu muss es Betroffenen auch gelingen sich aus der Abhängigkeit eines Konformität und Anpassung fordernden Psychiatriesystems zu lösen, solange sich das System nicht völlig neu ausrichtet. In Zukunft sollten neue Wege für die Betroffenen als auch die psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung gefunden werden, die es den Betroffenen durch die Transformation des posttraumatischen Wachstums ermöglicht, zu eigenen Stärken und Identitäten zu finden, die sie befähigen, das System nach ihrem Bedarf nutzen.
Abb. 2:Personen- und Recovery-zentrierte Versorgung (vgl. Beck 2021, S. 6)
Das persönliche Recovery der Betroffenen ist subjektiv und bezieht sich sowohl auf den Entwicklungskontext der Krankheit als auch auf die Lebenswelt der Betroffenen. Aus diesem Grunde spielt in der Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen die Erkundung der Lebensgeschichte und das Verstehen des Kontextes des individuellen Lebens eine wichtige Rolle. Dies möchten wir auch durch die Geschichten, die die Betroffenen in diesem Buch darlegen, begreiflich machen. Sie schildern ihre persönlichen Lebensgeschichten und damit auch die persönlich wahrgenommen Faktoren, die ihnen geholfen, aber auch Dinge, die sie bei ihrem persönlichen Genesungsweg gehemmt haben. Dabei müssen alle Aspekte des Lebensumfeldes berücksichtigt werden, die das Leben des Menschen ausmachen, um den Kontext zu verstehen und damit Stärken und Ressourcen außerhalb der Krankheit herausgearbeitet werden können (Rapp & Goscha 2006).
Aus diesem Grunde muss in dem Bereich der Pflege und Medizin ein gemeinsamer Umdenkungsprozess stattfinden, der zwar auch die Versorgungsrealitäten in Deutschland berücksichtigen soll, aber auch zu einem Paradigmen-Wechsel in der Haltung von Mediziner*innen und Pflegekräften und zur Förderung der Betroffenen führen muss.
In Schulungen zum Thema Recovery für psychiatrische Fachkräfte ließ sich feststellen, dass die Verknüpfung von evidenzbasierten Wissensbeständen aus der internationalen Forschung mit den Narrativen von Betroffenen aus deren Recovery-Reise einen besseren Praxisbezug herstellen lässt (Tschinke & Rogner 2019). Durch die Narrative der Betroffenen, die ihr persönliches Recovery erlebt haben und daraus beurteilen können, was für sie subjektiv hilfreich gewesen ist, bekommen die Theorien zum Recovery eine erlebbare Lebendigkeit, die ein nachhaltiges emotionales Lernen möglich machen können.
Aus diesem Grunde haben wir die Struktur eines jeden Kapitels darauf angepasst. Wir stellen das persönliche Erleben der Betroffenen in den verschiedenen Settings dar. Diese schildern darin ihre hilfreichen und hemmenden Erlebnisse – was für sie in ihrer subjektiven Wahrnehmung und ihrem Lebenskontext wirksam war und was nicht, um dadurch das Verstehen der Leser*innen für den Kontext zu stärken. So werden auch die Wünsche und Vorstellungen der Betroffenen selbst zu den jeweiligen Themen beschrieben. Auf diese Narrative folgt durch die Professionellen aus diesem Gebiet eine Darstellung der momentanen Versorgungsrealitäten und Veränderungsbedarfe im Bereich Pflege und Medizin, die auch auf die Grundlagen, Theorien und das evidenzbasierte Wissen aus Pflege-, Psychologie-, Medizin- und Versorgungsforschung (Public Health) zu Recovery eingehen. Dazu werden dann auch Beispiele aus der klinischen und ambulanten Praxis mit konkreten Ideen zu Umsetzung in Koproduktion dargestellt.
2 Recovery – ein Wort, drei Bedeutungen und fünf Auslegungen
Ingo Tschinke
Der Begriff des Recovery stammt aus amerikanischen und britischen Bezügen und ist dementsprechend einer der vielen Anglizismen, die in die deutsche Sprache mit übernommen wurden, da es nur unzureichende deutsche Bezeichnungen gibt, die die Bedeutung klar darstellen. Recovery bedeutet im Wortsinn – Erholung, Genesung, Gesundung etc. und wird als natürlicher und persönlicher Heilungsprozess verstanden, der über die Zeit eintritt. Die Betroffenenbewegungen in den USA, die sich dem Psychiatrie-System mit seinen paternalistischen Machtstrukturen entziehen und entgegenstellen wollten, haben den Begriff des »Personal Recovery« geprägt, um die Hoffnung, Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Selbstbefähigung in den Vordergrund zu stellen (Davidson 2010). Durch diese neue Sichtweise wurde in den USA, Großbritannien und weltweit die Psychiatrie geradezu revolutioniert, denn Recovery bewegt sich weg vom Defizitmodell in Richtung Empowerment, Resilienz und Hoffnung, um bei den gesellschaftlichen, gesundheitspolitischen und psychiatrischen Richtlinien eine Veränderung zu bewirken, was in der Konsequenz auch neue Chancen für die Betroffenen und ihre Versorgung nach sich zieht (Amering & Schmolke 2012). Praktisch bedeutet dies, dass der Genesungsprozess in den Händen der Betroffenen liegt und die Behandlung (Therapie, Medikamente etc.) außerhalb einer bedrohlichen Krise nur noch eine Option unter vielen darstellt (Davidson 2009).
Auf der persönlichen Ebene kann unterschieden werden zwischen klinischem und persönlichem Recovery:
•
Klinisches Recovery bedeutet die Behandlung im herkömmlichen Sinne zur Symptom-Reduktion durch Medikamente, Psychosoziale Therapien und Behandlung
•
Persönliches Recovery beschreibt einen Prozess, durch den die Betroffenen die persönlichen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen einer psychischen Erkrankung überwinden und zurück zu einem erfüllten Leben finden. Recovery bedeutet nicht zwangsläufig Heilung, sondern meint eine Teilhabe in der Gesellschaft trotz Erkrankung
Die Recovery-orientierte Praxis umfasst die Begleitung des persönlichen Recovery-Weges aus der Sicht der professionellen arbeitenden psychiatrisch Tätigen. Hierbei handelt es sich um eine optimistische Rahmenstruktur, welche die einzunehmende Haltung und damit in Zusammenhang stehenden Werte, das Wissen über Recovery, die notwendigen Fähigkeiten sowie das Verhalten, die Praxisumsetzung und Unterstützung durch das Leadership und Management beschreibt (Department of Health and Ageing 2013; NHS Education for Scotland/Scottish Recovery Network 2007). Zugrunde liegend ist eine Ethik der Behandlung und nicht mehr eine Behandlungsethik, d. h., die Behandlung und Begleitung folgt den Bedarfen der Betroffenen und richtet seine Angebote auf die Unterstützung des Recovery–Weges aus (Davidson 2010). Sinn und Ziel besteht darin, die Person zu unterstützen, sodass diese auch mit bestehenden Symptomen in Handlung für sich kommen und eine nachhaltige Veränderung für sich erreichen. Es ist in dieser Begleitung genau darauf zu achten, was für die Betroffenen auf ihrem Weg des persönlichen Recovery funktioniert und was nicht. Also Risiken zuzulassen und sie nicht in Watte zu packen, aber sie auch nicht gegen eine Wand fahren zu lassen.
Recovery ist aber auch eine gesellschaftliche Bewegung, in der psychiatrisch Tätige und Menschen auf ihrem Recovery-Weg gemeinsam versuchen, die Begleitung und Behandlung durch das Psychiatriesystem zu verändern und transformieren. Dabei werden verschiedene Sichtweisen und Expertisen wertschätzend mit einbezogen, die sich aus persönlicher Erfahrung, wissenschaftlicher Evidenz, Training und dem Vorteil der Zusammenarbeit und Kooperation speisen, um in kooperativer Konstruktion und Koproduktion ein Lehren, Lernen und Verändern zu ermöglichen.
2.1 Persönliche Ebene
Ingo Tschinke
Die Grenzen zwischen dem persönlichen und dem klinischen Recovery sind in dem persönlichen Kontext der Betroffenen eher schwimmend und nicht so klar abzugrenzen, es sei denn, Betroffene entscheiden sich komplett für einen eigenen Weg außerhalb des Psychiatrie-Systems. Ansonsten kann es Menschen geben, die die angebotenen Hilfen des Psychiatrie-Systems vermehrt nutzen, während andere weitaus weniger darauf zurückgreifen, ob nun in der klinischen oder ambulanten Behandlung. Im Weiteren spielt das persönliche Erleben der Betroffenen eine Rolle. Erlebe ich mich eher als Hilfesuchender, der Orientierung und Stützung benötigt oder als Menschen, der immer wieder in der Psychiatrie »landet« und sich eher als Jemand erlebt, der Behandlung ertragen und erdulden muss, obgleich man gar nicht weiß, wofür das gut sein soll – für mich, meine Umwelt, meine Angehörigen, die Gesellschaft etc. Erlebe ich Umstände und Begegnungen, die mit meinen Werten konsistent sind, wie das einfühlende Verstehen, Respekt, sinnvolle Aufklärung und »Edukation«, Wertschätzung und vieles mehr, oder fühle ich mich bevormundet, unverstanden und respektlos behandelt. Auch in den Schilderungen der Betroffenen in diesem Buch zeigt sich, dass manche Aspekte des klinischen Recovery als positiv und manche als negativ empfunden wurden. Alle beschreiben hilfreiche Aspekte, die ihnen bei ihrem persönlichen Recovery-Weg geholfen haben, nachdem sie diesen für sich erkannt haben. Dabei kann der Anstoß aus dem Hilfesystem herausgekommen sein, aber der Entschluss zur Veränderung und Transformation von der hilfesuchenden Person zu einer Person der Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Autonomie haben alle selbst getroffen. Dies hat ihnen auch einen kritischen Blick auf das Psychiatrie-System gegeben und ihnen geholfen mit diesem selbstbewusster umzugehen und als Genesungsbegleiter*innen gemeinsam mit reflexionswilligen professionell Tätigen die Arbeit mit Betroffenen zu betrachten.
Für professionell Tätige bedeutet dies, dass die Förderung und Unterstützung des persönlichen Recovery immer primär im Vordergrund stehen sollte und dann noch die für die Betroffenen als hilfreich empfundene Maßnahmen (Interventionen, medikamentöse Behandlung und Therapien etc.) hinzukommen können (Grey et al. 2014b). Das persönliche Recovery bedeutet keine Ergänzung zur Behandlung, es ist die Grundlage von allem, was in der Psychiatrie-Versorgung geschieht (Davidson 2009).
2.2 Klinisches Recovery
Ingo Tschinke
Das Klinische Recovery, d. h. eine wie auch immer gestaltete Behandlung, Begleitung und Therapie, hatte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten den Auftrag, Menschen mit einer psychischen Erkrankung einer Art Heilung zuzuführen. Es kann bei einigen Erkrankungen tatsächlich gelingen, dass Menschen durch medikamentöse Therapien und psychotherapeutische Behandlung ihr weiteres Leben dekompensationsfrei beschreiten können und dann ein »normales« Leben weiterleben. Diese Ausrichtung hat dann im Gegenteil bei den Menschen mit immer wiederkehrenden Dekompensationen (Depressionen, Bipolare Störungen, Essstörungen, Schizoaffektive Psychosen etc.) oder einer ständig bestehenden Erkrankung (Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenien, Angst- und Zwangsstörungen etc.) zu Bezeichnungen geführt, dass jemand »unheilbar« krank oder »austherapiert« sei, d. h., man medizinisch im Sinne der Heilung nichts mehr machen kann, es ist sozusagen Hopfen und Malz verloren, dieser Mensch wird nicht mehr normal – er bleibt chronisch krank.
Von diesen Menschen wurde vielfach eine Krankheitseinsicht gefordert, was sich dadurch zeigte, dass der Mangel eben dieser als eher negativ betrachtet wurde. Aber eine Krankheitseinsicht fordert von den betroffenen Menschen, dass sie sich von ihrem bisherigen Leben mit allen positiven und sinnvollen Optionen, die das Leben ausmachen können, verabschieden. Verbindet man mit dieser Krankheitseinsicht die Erwartung, dass sich Menschen in allgegenwärtigen und permanenten Umständen einer Behinderung für sich akzeptieren, welches sie dazu verdammt ein Leben in Abhängigkeit und Verzweiflung zu führen, dann widerspricht dies in geradezu eklatanter Art und Weise den Voraussetzungen für das eigene persönliche Recovery (Davidson 2009, S. 77).
Patrica Deegan berichtet dazu aus ihrer persönlichen Erfahrung:
»Bevor ich die Diagnose erhielt, wurde ich als ganzheitliche Person wahrgenommen, nachdem allerdings die Diagnose im Raum stand, wurde ich durch Professionelle in der Psychiatrie wie durch Zerrspiegel wahrgenommen und wurde als schwer erkrankt und völlig defizitär dargestellt. [...] Es wurde nun alles, was ich tat durch diese Zerrspiegel der Psychopathologie interpretiert. So hat z. B. meine Großmutter mir in der Zeit meines Aufwachsens in meiner Kindheit häufig gesagt, dass ich ›Hummeln im Hintern‹ hätte. In der psychiatrischen Klinik wurde ich als agitiert wahrgenommen. Ich habe als Kind nie viel geweint, aber nach meiner Diagnose galt ich als emotional verflacht und mangelnd schwingungsfähig. Ebenso war ich schon immer still, schüchtern und introvertiert. Jetzt mit der Diagnose war ich vorsichtig, misstrauisch und hatte autistische Züge. In einer klassischen Double-Bind-Beziehung protestierte ich gegen diese pathologisierenden Interpretationen und bewies damit, dass ich wirklich als schizophren mit mangelnder Krankheitseinsicht betrachtet werden sollte!« (Deegan 2001, S 4 – Übersetzung durch Autoren)
Die klinische Behandlung als solches hat durchaus seine Berechtigung und wird von vielen Menschen durch eine gelebte Personenzentrierung der Sozialpsychiatrie als positiv erlebt, aber es ist auch unbestreitbar, dass durch eine medizinische Interpretation der Unheilbarkeit viele Menschen erst in eine Chronifizierung und Hoffnungslosigkeit abgerutscht sind (Amering & Schmolke 2012). In Kapitel 3 haben wir deswegen die Ausprägungen des biopsychosozialen Modells denen des persönlichen Recovery gegenübergestellt und gehen noch vertieft auf die Aspekte ein (▸ Kap. 3). Wir möchten aber nun die Betroffenen zu Wort kommen lassen, wie sie selbst ihre Krankheitsentstehung empfunden haben, um zu verstehen, wie sie die »Krankheit« für sich wahrnehmen.
2.2.1 Sichtweisen der Betroffenen
Madeline Albers, Anja Neumann, Melanie Rogner
Madeline Albers:
Bevor ich näher auf das klinische Recovery eingehe, möchte ich von meiner Krisenzeit und dem Therapiebeginn erzählen. Als Betroffene von psychischen Erkrankungen (rezidivierende depressive Störung, Dysthymie, generalisierte Angststörung) habe ich im Laufe der Zeit viele Erfahrungen mit dem psychiatrischen Versorgungssystem gemacht. Um meinen Entwicklungsprozess im Kontext des klinischen und persönlichen Recoverys zu verdeutlichen, halte ich es für wichtig, auch einen Einblick in die Zeit zu geben, in der ich noch keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe.
Bereits meine Kindheit war gezeichnet von einer hohen Vulnerabilität und negativen Gefühlen. Kleinigkeiten rissen mich in tiefe Krisen, ich war eine labile, sensible Schülerin. Meine Gedanken waren zumeist pessimistisch und kreisten häufig um Probleme. Doch ich konnte meinen Alltag bewältigen, absolvierte sogar das Abitur mit sehr gutem Abschluss. Im direkten Anschluss an meine Schulzeit entschied ich mich, an der Universität Bremen Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie Germanistik zu studieren. Diese Entscheidung war weniger Ausdruck meiner beruflichen Wünsche, sondern vielmehr ein Kompromiss – ich konnte meine Bedürfnisse hinsichtlich meiner Zukunft nicht identifizieren und entschied mich daher für jene Studiengänge, welche mich in der Auswahl am ehesten interessierten. Folglich studierte ich einige Semester, während sich meine psychische Verfassung fortlaufend verschlechterte.
2015 war dann ein ganz besonderes Jahr. Ein besonders schweres, aber auch der Startschuss für einen inneren Veränderungsprozess. Meine Kräfte und Handlungsmöglichkeiten kollidierten inzwischen mit den Anforderungen des Studiums: Ich war depressiv und lebensmüde. Während mich die Struktur des Schulsystems noch aufrecht hielt, verlangte das Studium eine Selbstständigkeit, die mich überforderte und mir meine emotionale Instabilität und fehlende Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwierigkeiten des Alltags auf einem Silbertablett präsentierte. Die großen Konzentrationsschwierigkeiten sorgten dafür, dass ich dem Unterricht nicht mehr folgen konnte, meine Aufmerksamkeitsspanne umfasste einige Sekunden. Viele Seminare und Vorlesungen besuchte ich nicht mehr, da mein grauer Schleier sich tonnenschwer auf mich legte, und nur der fehlenden Anwesenheitspflicht war es zu verdanken, dass man mich nicht bereits exmatrikuliert hatte. Je mehr Zeit verging, desto mehr verdrängte ich meine Situation, flüchtete mich in die mediale Berieselung fernab meiner für mich nur schwer zu ertragenden Realität.
Meine sozialen Kontakte – zumindest diejenigen, die ich noch an meinem Leben teilhaben ließ – erkannten meine wachsende Verzweiflung und baten mich wiederholt, mir professionelle Hilfe zu holen. Doch damals war ich davon überzeugt, dass ich mich in einer Krisenphase befand, die von allein wieder gehen würde. Ich glaubte an die Zeit, aber nicht an mich und die Fähigkeit, mein Leben aktiv zu beeinflussen. Im Gegenteil: Mir selbst habe ich nichts zugetraut. Sei es der Abschluss meines Studiums, das Führen einer Partnerschaft, der erfolgreiche berufliche Werdegang, das Erreichen von Zielen oder die Selbstbefähigung, ein im Großen und Ganzen zufriedenes Leben führen zu können. Dass ich die Zeit zu meinem Heilsbringer ausrief, war letztlich eine Flucht vor mir selbst und den Gefühlen, die mich innerlich zerrissen. Und so stand ich dem Todesgedanken näher als jenem, mich einer professionellen Fachkraft zu offenbaren, die mich womöglich sowieso nicht verstand.
Je mehr Zeit verging, desto mehr spitzte sich meine Situation zu und ich verlor zunehmend Lebensfähigkeit. Ich war entweder überflutet von einer tiefen Traurigkeit und Verzweiflung oder mich packte die Welle der Gleichgültigkeit und Leere. Wie ich nun weiß, befand ich mich zu dieser Zeit inmitten einer schweren depressiven Episode. Ich hatte keine Lebensfreude mehr, keinen Antrieb, keine Lust auf den Tag und Angst vor der Nacht, in der ich zumeist nicht schlafen konnte. Es fällt mir schwer zu beschreiben, wie quälend Hoffnungslosigkeit und der Gedanke sein kann, leben zu müssen. Und, so hart das auch klingen mag, das Leben war für mich in der Tat eine Art Pflicht. Ein Labyrinth voller Irrwege und ohne Ausweg. Ein Rätsel, das ich nicht lösen konnte. Ein Käfig, der mich einsperrte und dessen Sinn ich nicht verstand. Und mir fehlte die Vorstellungskraft für eine Zukunft, in der ich mich wohlfühlen würde. Somit verbrachte ich Stunden vor dem Fernseher und tauchte ein in eine andere Welt, ich vernachlässigte die Wohnungs- und Körperhygiene und entfernte mich größtenteils aus meinem geregelten Alltags- und Sozialleben.
Als ich an einem Montagmorgen aufstand, mich wie automatisiert anzog und zu meiner Hausarztpraxis fuhr, setzte ich damit den ersten Schritt ins psychiatrische Hilfe-System. An dieser Stelle möchte ich die Brücke schlagen zum klinischen Recovery. Das klinische Recovery beschreibt die Behandlung im herkömmlichen Sinne, also die Reduktion von Symptomen durch den Einsatz von Medikamenten oder durch psychosoziale Therapien. Ziel ist es, die soziale Funktionsfähigkeit wiederherzustellen und pathologische Anteile des Menschen zu beseitigen. Für sich allein genommen bedeutet das klinische Recovery und damit auch diese gewisse Psychopathologisierung eine Entfernung vom Menschen als ganzheitliches Individuum und folglich die Fokussierung auf Symptome und Krankheit. In Anbetracht dessen war ich sehr froh, dass meine Hausärztin mir zunächst einfühlsam und geduldig zuhörte und mir daraufhin eine Überweisung für einen teilstationären Aufenthalt in der psychiatrischen Tagesklinik ausstellte, welche Recovery-orientiert und personenzentriert mit den Betroffenen zusammenarbeitete.
Das klinische Recovery funktioniert aus meiner Sicht am besten im Zusammenspiel mit dem persönlichen Recovery und als untergeordnete Rolle: Mein wichtigster Schritt auf dem Genesungsweg war die Auseinandersetzung mit Hoffnung, Sinnfindung, meiner Lebensgeschichte und mit meinen Ressourcen, Bedürfnissen und Wertvorstellungen. Das Gefühl, selbstwirksam zu sein und Vorhaben erreichen zu können, hat mir das Selbstbewusstsein und auch die Selbstbefähigung gegeben, einen neuen Umgang mit meinen Belastungen zu finden. Das klinische Recovery war hinsichtlich meines Genesungswegs nicht unwichtig, doch halte ich beispielsweise die medikamentöse Therapie in erster Linie als eine sinnvolle Begleitung anderer Unterstützungsoptionen. In meiner Therapiezeit habe ich insgesamt sechs verschiedene Antidepressiva probiert, keines hat mir geholfen. Das lag im Wesentlichen daran, dass meine seelischen Belastungen durch sie nicht aufgeschlüsselt, sondern meine negativen Gefühle gedeckelt wurden. Erst, als wir ein Antikonvulsivum gefunden haben, welches mein tägliches und übersteigertes Angstlevel verringert hat, konnte ich im Zusammenspiel mit dem persönlichen Recovery und der Stärkung von Eigenschaften und Fähigkeiten einen Zustand erreichen, der mich trotz vorhandener Belastungen einen Umgang mit dem Alltag finden ließ. Dieses Medikament nehme ich inzwischen seit Jahren in ähnlicher Dosierung und aus Überzeugung. Denn: Im Gespräch mit meinem Psychiater, der vielmehr ein Sparringspartner als Alleinentscheider ist, sind wir zu der kooperativen Entscheidung gekommen, dass das Medikament hinsichtlich meiner Ängste auch weiterhin eine wichtige Unterstützung und Stabilisierungshilfe darstellen kann. Nicht, weil es meine Belastungen in der Tiefe bekämpft – sondern weil es mir hilft, durch Verringerung von Angstzuständen selbst in diese Tiefe zu steigen und dort zu lernen, zu verstehen und selbst aktiv zu werden.
Aufgrund meiner Erfahrungen der letzten Jahre spielt das klinische Recovery für mich somit eine bedeutsame, aber doch untergeordnete Rolle im Vergleich zum persönlichen Recovery. Erst, als ich mit therapeutischer Unterstützung meine Biografie aufgearbeitet habe und mich intensiver mit meiner Lebensgeschichte, meinen Werten und Bedürfnissen, meinen Ressourcen und der Stärkung meiner Fähigkeiten auseinandergesetzt habe, konnte ich eine positive Veränderung der inneren Haltung herbeiführen. Dabei war das klinische Recovery unterstützend – und das persönliche Recovery wegweisend.
Anja Neumann:
Der erste Zusammenbruch
Mein gesundheitlicher Leidensweg begann, als mein Sohn neun Jahre alt war. Damals war ich Mutter zweier Kinder, Ehefrau und berufstätig und hatte das Gefühl, gut im Leben angekommen zu sein. Als ich eines Tages meinen Kindern beim Spielen zugesehen habe, kamen plötzlich mehrere heftige Flashbacks aus meiner Kindheit. Es meldeten sich so verdrängte Erinnerungen, die ich tief in mir vergraben hatte. In den nächsten 14 Jahren brach immer mehr diese Mauer vor meinen Augen in sich zusammen und ich verstand, dass ich dies mit gutem Grund verdrängt hatte. Diese erste Erschütterung im Erwachsenalter führte dazu, dass meine erste schwere Depression ausbrach.
Die Traumata – oder wo alles begann...
Mein erstes traumatisches Erlebnis (da war ich selbst erst neun Jahre alt) war die Trennung meiner Eltern, die für mich ganz plötzlich und unerwartet über meine heile Kinderwelt hereinbrach.
Ich wurde ohne Vorwarnung von meiner Schwester und meinem Vater getrennt. Ohne gefragt zu werden, wurde ich aus meinem alten Leben gerissen, in eine fremde Stadt gebracht und in ein neues und fremdes Leben gezerrt. Da hatte ich das erste Mal so richtig Angst in meinem Leben. In dieser neuen Welt fühlte ich mich schutzlos und allein gelassen. Gefühle von Hilflosigkeit, dem Ausgeliefert sein, Ohnmacht und Scham bestimmen und beeinflussen mich bis heute noch sowie ein chronisch schlechtes Gewissen. Damals ahnte ich nicht, dass dieses Trauma mein ganzes Leben beeinträchtigen sowie mein zukünftiges Verhalten und meine Entscheidungen bestimmen würde. Auch auf die Erziehung meiner eigenen Kinder hatte das später noch Auswirkungen, aber ganz besonders auf meine eigene Gesundheit.
Das zweite Trauma erlitt ich in diesem nun neuen Leben – ein neuer Mann an der Seite meiner Mutter, ein Alkoholiker, häusliche und emotionale Gewalt und sexuelle Übergriffe. Bis heute wurde dieses Thema nicht mit meiner Mutter besprochen. Ich konnte mit ihr als Kind nicht darüber reden, da sie das Thema einfach negiert hat. Heute will ich das nicht mehr. In den Jahren danach ist viel passiert, zu viel und zu schambehaftet, um es hier aufzuschreiben. All das jahrelange Erlebte als Kind und Jugendliche, diese übermächtige Angst – diese »Todesangst in mir« hatte sich tief in meinem Gehirn versteckt bis ins Erwachsenenalter, zum Schutz in meinem Unterbewusstsein.
Erst als ich dann als Erwachsene meine eigenen Kinder so ansah, als ich erkannte, wie klein und verletzlich man als Kind noch ist, brach alles wieder hervor. Ab da konnte ich diese Flashbacks nicht mehr stoppen. Ich bekam eine schwere Depression. Dadurch war jeder Tag eine Qual. Ich schämte mich dafür. Hatte ich doch jetzt eigentlich alles, was ich brauchte, um glücklich zu sein – zwei großartige gesunde Kinder, einen Mann, meinen Traumjob und ein schönes Zuhause. Keiner sollte sehen, dass es mir schlecht ging. Ich schämte mich zu sehr dafür und empfand mich selbst als undankbar und wertlos. Ich weinte nur heimlich oder nachts, wenn ich wie so oft nicht schlafen konnte. Ich suchte dann Hilfe beim Hausarzt und dieser schickte mich zu einer Psychiaterin. Danach folgte eine tiefenpsychologische Therapie (zu diesen Begegnungen berichte ich in ▸ Kap. 5.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen).
Jahre später – jetzt ging es erst richtig los
Vier Jahre nach der tiefenpsychologischen Therapie kam es zu einem Rückfall – die zweite Depression begann. Diesmal zog sich die Erkrankung über mehrere Jahre hinweg und kam immer wieder in Schüben – sogar heute, acht Jahre später, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass sie je richtig weg war. Dazu kamen diesmal aber auch noch Angstzustände, eine Panikstörung, eine ständige Reizüberflutung, Unruhe, Grübelneigung, schwere Einschlaf- und Durchschlafstörung, ein Restless Legs-Syndrom und auch die Migräne brach mehrmals im Monat, oft sogar mehrfach in der Woche, mit voller Wucht wieder aus. Dieses Mal versank ich regelrecht in der Depression. Ich hatte keine Kraft mehr dagegen anzukämpfen. Ein zusätzlicher Hörsturz führte mich dann erst in eine psychosomatische Reha und dann zu allem Übel auch noch nach 27 Jahren von meinem Traumberuf zu einer Versetzung in einen neuen Job – in ein ganz anderes Tätigkeitsfeld. Die Reha ging über fünf Wochen. Als ich dort ankam, habe ich viel geweint, ich war verängstigt, müde und mit mir und der neuen Situation dort überfordert. Ein Selbstwertgefühl hatte ich nicht mehr. Ich konnte mich weder mit Worten wehren noch mich abgrenzen. Ich dachte immer, dass ich schuld an allem war. Überhaupt fühlte ich mich ständig schuldig und hatte permanent ein schlechtes Gewissen, etwas falsch gemacht zu haben. Auch wenn ich bewusst gar nichts gemacht habe. Ich fühlte mich nicht mehr »normal«. Was für ein schlimmes Gefühl. Doch dort bekam das Wort Normal eine neue Bedeutung. Man half mir zu erkennen, dass ich nicht schuld war, sondern andere die Verantwortung dafür trugen, dass ich mich so fühlte. Mir wurden in dieser Klinik die Augen geöffnet und nun schaute ich nicht mehr weg. Wenn »ich« nicht etwas ändern würde in meinem Leben, änderte sich auch nichts.
Aus meiner Sicht: Diese Reha war ausschlaggebend dafür, um überhaupt erkennen zu können, dass mein Kindheitstrauma mit den Depressionen und der Angst- und Panikstörung zusammenhängt. Ich habe dort einiges dazugelernt, um meine Krankheiten besser zu verstehen und zu akzeptieren, dass sie nun ein Teil von mir sein werden. Ein schmerzlicher Prozess aber auch ein erlösender. Zum ersten Mal hatte ich Menschen mit den gleichen Krankheiten kennengelernt und fühlte mich nun nicht mehr so allein damit und konnte neue Kraft schöpfen. Ich bekam wieder Mut, einige meiner Probleme anzugehen. Diese Reha und ganz besonders der Therapeut, der mich dort betreute, waren richtungsweisend für meinen Neuanfang.
Der zweite große Zusammenbruch
Monate nach der Reha schaffte ich es endlich, mich aus einer toxischen Ehe zu lösen und trennte mich. Zum zweiten Mal in meinem Leben hatte ich alles verloren was mir wichtig war – eine Familie. Meine Angst kam zurück, aber diesmal mit gewaltiger Wucht. Ich bekam zum ersten Mal in meinem Leben Panikattacken; ohne zu wissen, was das ist, dachte ich an einen Herzinfarkt. Ich dachte bei jeder Attacke, dass ich sterben werde. Die nächsten Wochen und Monate kamen diese Attacken immer öfter vor. Beim Einkaufen (ich traute mich nicht mehr in die Läden), im Auto, auf der neuen Arbeit. Ich versuchte dort irgendwie noch zu funktionieren. Nach »außen« lächelte ich das lieber weg, doch ich schämte mich sehr dafür. Eine Spirale von Vermeidungstaktiken setzte sich so in Gang, die mit der Zeit immer schlimmer wurde. Ich dachte damals das es nicht mehr schlimmer kommen könnte. Doch nun begann die Angst vor der Angst. Ein echter Teufelskreis. Ich bekam dadurch auch noch schwere Schlafstörungen dazu und jede Nacht zuckten mir so stark die Beine, dass es schmerzte. In meinem Kopf grübelte es ständig. Ich konnte ihn nicht mehr abschalten. Meistens kam ich nur auf zwei bis vier Stunden Schlaf in der Nacht. Und manchmal konnte ich auch gar nicht schlafen. Das ging noch zwei Jahre so weiter. In dieser Zeit lernte ich die App und Herrn Tschinke kennen (▸ Kap. 2.4.1 Sichtweisen der Betroffenen).
Meine zweite Therapie: Die Verhaltenstherapie über zwei Jahre
Einen freien Platz fand ich recht schnell bei einem Psychologen. Er hat sich mit sehr viel Einfühlungsvermögen mein Vertrauen erarbeitet. Er musste mich oft wieder aufbauen, weil es in dieser Zeit viele Rückschläge, Schicksalsschläge und Tränen gab. Er hat mich während des Scheidungsprozesses unterstützt. Wir arbeiteten intensiv an meiner Depression und an meiner Angst- und Panikproblematik. Oft war auch das Trauma aus der Kindheit unser Thema – alles hing miteinander zusammen. Er hat nie aufgehört mir meine Ängste immer und immer wieder zu erklären. Er hat mich auch beim Einspruch über das Gutachten des Gutachters (▸ Kap. 6.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen) für die zuerst abgelehnte Rente unterstützt. Ohne Ihn hätte ich mich das nicht getraut. Am Ende bin ich dann weit weg in eine andere Stadt gezogen, um woanders einen Neuanfang zu versuchen. Er hat mir in diesem Prozess immer wieder Mut gemacht. Diese Therapie habe ich bis zum Ende (trotz des Umzuges) bei ihm weitergemacht. So wichtig war mir diese Therapie. Er hat mit mir an vielen meiner Lebens-Baustellen gearbeitet und mir so sehr geholfen. Ich bin unendlich dankbar für diese Zeit. Ich bin dankbar an einen so guten Therapeuten geraten zu sein (mehr dazu ▸ Kap. 11.1 Erlebnisse und Wünsche der Betroffenen).
Aus meiner Sicht: Die Verhaltenstherapie mit meinem Therapeuten hat mich ein ganzes





























