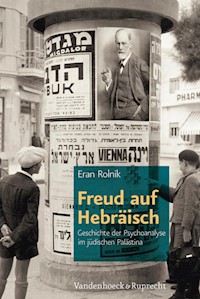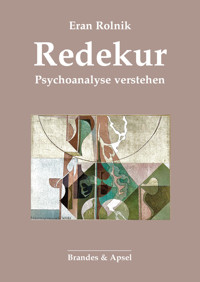
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Brandes & Apsel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Redekur verbindet ein breit angelegtes theoretisches Nachdenken mit einem inspirierenden klinischen Tagebuch, die beide ein neugieriges, skeptisches und liebendes Verhältnis zur Praxis, zur Theorie und zur Geschichte der Psychoanalyse verkörpern. »Jeder Analytiker bildet mit zunehemender klinischer Erfahrung seine eigene Behandlungstheorie aus und entwickelt sie stetig weiter. Kaum einmal findet man ein so persönliches Buch, in dem ein Autor seine eigene klinische Praxis so lebendig und meisterhaft vermittelt wie Eran Rolnik. Bei der Lektüre werden wir in seinen analytischen Behandlungsraum hineingezogen und in seine Art, wie er mit den Problemen der Patient*innen umgeht, wie Konzepte und Theorien für ihn hilfreich geworden sind und wie er sie sich angeeignet hat. Dabei gerät der analytische Lesende unversehens in einen inneren Dialog mit dem Autor, der ihn anregt, seine eigene Praxis zu reflektieren. Ein einzigartiges Buch!« (Werner Bohleber, ehem. Herausgeber der Psyche)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eran Rolnik
Redekur
»Gerade eben habe ich angeregt, nicht davor zurückzuschrecken, auch Patienten mit frühem Trauma Deutungen vorzuschlagen. Ich sagte, dass auch posttraumatische Patienten keine Embryos sind, und jetzt rate ich Ihnen, die Deutung nicht an die höheren Ebenen zu richten, sondern die niedrigste Ebene zu suchen, auf welcher der Patient mit Ihnen kommuniziert. Heißt das nun, dass ich nicht konsequent bei meiner Technik bleibe? Vielleicht. Aber so verstehe ich die Psychoanalyse. Ich denke, es kommt ziemlich selten vor, dass in der Behandlungsstunde der von uns bevorzugte theoretische Denkansatz genau mit der uns anleitenden klinischen Theorie übereinstimmt.« (Eran Rolnik)
Redekur enthält eine Zusammenstellung von 13 psychoanalytischen Gesprächen, die der Psychoanalytiker und Psychiater Eran Rolnik im Verlaufe der Covid-Pandemie mit Psychotherapeuten geführt hat. Es ist ein einmaliger, mehrstimmiger erlebnispädagogischer Text, der die feinsten Nuancen der analytischen bzw. psychotherapeutischen Begegnung berührt. Grundbegriffe und Streitdebatten, die sich manchmal in begriffliche Elfenbeintürme zurückgezogen haben, werden hier mit einem neuen, frischen Blick aus der Perspektive eines erfahrenen Klinikers, Forschers und Lehrer betrachtet, auch über die Grenzen der theoretischen Phantasie hinaus. Die Theorie ist für Rolnik zwar zentral für sein klinisches Wirken, legitimiert sich aber nicht als eigenständige Philosophie, losgelöst vom freien Geist der Psychoanalyse als Praxis und Ethik. Er kennt keine »heiligen Kühe« und sieht sich im Umkehrschluss auch nicht veranlasst, Denker als irrelevant zu disqualifizieren. Seine Verpflichtung gilt der therapeutischen Rede seiner Patienten sowie der Offenheit gegenüber den Weiten des Unbewussten im möglichst freud’schen Sinne.
Redekur richtet sich an Therapeuten und Patienten sowie an Wissenschaftler und Studenten; sie verbindet ein breit angelegtes theoretisches Manifest mit einem inspirierenden klinischen Tagebuch, die beide ein neugieriges, skeptisches und liebendes Verhältnis zur Praxis, zur Theorie und zur Geschichte der Psychoanalyse verkörpern.
Dr. Eran Rolnik ist Lehrpsychoanalytiker und Supervisor in der Israelischen Psychoanalytischen Gesellschaft, Facharzt für Psychiatrie und Doktor der Geschichte an der Universität Tel Aviv. Er praktiziert in einer Privatpraxis in Tel Aviv und gehört dem Lehrkörper des Max Eitingon Institute for Psychoanalysis an. Er ist Mitglied der Lenkungskommission des Studienganges »Freud und seine Nachfolger«, eines Programmes für weiterbildende Studien in Psychotherapie der Sackler Faculty of Medicine der Universität Tel Aviv, und der Kommission zur Geschichte der Psychoanalyse des Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Zahlreiche veröffentlichungen u. a. zur Geschichte der Psychoanalyse: Freud auf Hebräisch (2013) und Sigmund Freud – Briefe (2019).
Eran Rolnik
Redekur
Psychoanalyse verstehen
Aus dem Hebräischen übersetzt von David Ajchenrand
Brandes & Apsel
Deutsche Originalausgabe der 2022 bei Resling Publishing erschienenen hebräischen Ausgabe unter dem Titel Redekur – 13 Gespräche zur Psychoanalyse © Eran Rolnik.
All rights reserved.
Der Autor bedankt sich für die Unterstützung bei der Finanzierung der Übersetzung bei der Sigmund-Freud-Stiftung zur Förderung der Psychoanalyse e.V.
1. Auflage 2023
© Brandes & Apsel Verlag GmbH, Frankfurt a. M.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, Mikroverfilmung, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen oder optischen Systemen, der öffentlichen Wiedergabe durch Hörfunk-, Fernsehsendungen und Multimedia sowie der Bereithaltung in einer Online-Datenbank oder im Internet zur Nutzung durch Dritte.
Umschlag: Wolfgang Hildesheimer Original-Collage – Fragmentarisches 1986
DTP: Brandes & Apsel Verlag
Druck: STEGA TISAK d. o. o., Printed in Croatia
Gedruckt auf einem nach den Richtlinien des Forest Stewardship Council (FSC) zertifizierten, säurefreien, alterungsbeständigen und chlorfrei gebleichten Papier.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
www.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-95558-345-3
eISBN 978-3-95558-363-7
»Manchmal empfinde ich, daß es zwischen dem Analysierten und dem Nicht-Analysierten keine Möglichkeit der Verständigung gibt. Mit der Bezeichnung ›der Analysierte‹ meine ich noch nicht einmal den durch psychoanalytische Therapie Geheilten, sondern den, dem sie, über die eigene Person hinaus, Einblicke in die menschliche Seele vermittelt hat. Denn für den einigermaßen geschulten und intelligenten Analysanden enthält seine Analyse gleichsam Elemente einer Lehranalyse, indem sie, sich den Pfad hinab ins Unbewußte ertastend, Nebenwege aufzeigt, das heißt: das, was hätte sein können, aber in diesem Falle nicht ist.«
Wolfgang Hildesheimer, Die Subjektivität des Biographen
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1Psychotherapie in Gefahr
Kapitel 2Unbewusst
Kapitel 3Technik und Behandlungsrahmen
Kapitel 4Analytische Präsenz
Kapitel 5Leidenschaft und Widerstand
Kapitel 6Zuhören und Containing
Kapitel 7Übertragung, Enactment und Gegenübertragung
Kapitel 8Vom Zuhören zur Deutung
Kapitel 9Noch mehr vom Zuhören zur Deutung
Kapitel 10Der Wahrheitskarpfen
Kapitel 11Das psychoanalytische Objekt
Kapitel 12Urlaub, Trennung und Behandlungsabschluss
Kapitel 13Psychoanalyse als Weltanschauung
Literatur
Personenregister
Sachregister
Dieses Buch ist meinen Studenten und Patienten gewidmet.
Vorwort
Psychoanalyse zu lehren, das heißt, Studierenden, Kandidaten oder erfahrenen Kolleginnen und Kollegen Worte und Gedanken anzuvertrauen, ist ein bedeutender Teil meiner Identität als Psychoanalytiker, Psychiater, Forscher und Autor. Beim Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, im Verlaufe des ersten Lockdowns, nahm ich mir vor, die frei gewordene Zeit zum Schreiben zu nutzen. Das gewohnte Leben kam zum Stillstand, die Betriebsamkeit wich der neuen Gegenwart der Coronavirus-Pandemie. Sie war bedrohlich, lästig, erfüllte mich aber auch mit einem Gefühl von Dringlichkeit und Dankbarkeit. Es ist keine Alltäglichkeit, dass dem Menschen die Gelegenheit gegeben wird, zu spüren, wie ihn die Geschichte durchdringt. Dieses Gefühl habe ich dank Corona großzügig erfahren. Dann geschah etwas Unerwartetes: Ich stellte fest, dass es für mich besser war, die freie Zeit, die ich durch die Lockdowns gewann, mit dem gesprochenen Wort als mit Schreiben füllen. Die Erfahrung, Psychoanalyse im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen zu denken, hatte mir offensichtlich gefehlt.
Im März 2020 wandelte ich die Mittwochsseminare, die ich in der Praxis durchzuführen pflegte, in Videobegegnungen um und nannte diese digitale Begegnungsreihe »Psychotherapie in Gefahr«. Schon nach kurzer Zeit verwandelte sich das vertraute, intime Freud-Lektüreseminar in einen Studienkreis mit einigen Hundert Therapeuten, die sich im virtuellen Raum zu einer Reihe von theoretischen und klinischen Begegnungen trafen. Es nahmen Studierende (nicht nur der Fachrichtung Psychologie), Psychotherapeuten, Akademiker in leitenden Positionen und Anhänger der Psychoanalyse mit unterschiedlichen Hintergründen teil. In manchen Fällen schickte ich den Teilnehmern auch Artikel zur Lektüre, wobei die Diskussion zumeist bei Freud begann, sich um verschiedene psychoanalytische Fragen und Haltungen drehte und dazwischen auch auf Fragen einging, die mir während des Vortrags oder zwischen den Begegnungen per Chat oder E-Mail zugingen. Jede Begegnung dauerte anderthalb Stunden, in denen ich frei in die Kamera redete. Manchmal hielt ich kurz zum Verschnaufen inne und mein Blick streifte die Dutzenden Köpfe, die mir vom Bildschirm entgegenblickten.
Sie waren wirklich da, saßen zu Hause, in den leeren Kliniken oder unter freiem Himmel, im Wohnzimmer im Florentin-Viertel in Tel Aviv oder im Garten in Rosh Pina in Nordisrael, in Arbeitszimmern in Philadelphia, Chicago, London, Berlin oder San Francisco. Ich sprach über Themen, die mich und auch sie in normalen Zeiten beschäftigen, über Dinge, die ich für wichtig hielt für unerfahrene Therapeuten, und hoffte, dass sie auch die erfahrenen Kollegen noch interessierten, die am Seminar ebenfalls teilnahmen. Ich berief mich auf ältere Texte, die ich früher gelesen oder verfasst hatte, wagte Annahmen und ließ klinische und theoretische »Versuchsballons« steigen. Geschuldet ist dieses Buch auch ebendieser spezifischen raumzeitlichen und technologischen Konstellation.
Ob meine Ausführungen nun für erfahrene Psychoanalytiker oder für Psychologiestudentinnen bestimmt waren, die den Begriffen »Urszene« oder »projektive Identifikation« zum ersten Mal begegneten, jeder theoretische Gedanke, jedes klinische Dilemma und jede technische Streitfrage war nach meiner Empfindung von diesem historischen Moment geprägt, den uns die Pandemie bescherte. Vielleicht schwelgte ich in der Vorstellung, ich sei eine Art Freud, der mitten im Ersten Weltkrieg und auf dem Höhepunkt einer Grippeepidemie in Wien durch die schneebedeckten Straßen schreitet auf dem Weg zum Vorlesungssaal, um vor einem breiten Publikum Einführungsvorlesungen in die Psychoanalyse zu geben, vielleicht war ich von der Angst besessen, dass es sich um die »letzte Vorlesung« handelt. Pandemiezeiten sind auch eine Gelegenheit für Überzeichnungen.
Bei jedem Gespräch war ich jeweils bemüht, mich auf ein Thema zu konzentrieren – Psychotherapie und Ängste in Epidemiezeiten, Therapie via »Zoom«, das Unbewusste, Übertragung und Gegenübertragung, Deutung, Mitfühlen, Enactment, Widerstände, Behandlungsabschluss, psychoanalytische Weltanschauung etc.
Während der Lockdowns habe ich einige Dutzend Zoom-Veranstaltungen unter dem Titel »Psychotherapie in Gefahr« durchgeführt. Ganz ohne schriftliche Notizen und im Unterschied zur Vorlesung im Hörsaal oder zum Vortrag auf einer Konferenz ließ ich meinen Gedanken freien Lauf und behandelte die Themen in breiterem Zusammenhang. Ich befasste mich mit praktischen Grundproblemen der psychoanalytischen Psychotherapie, mit der Begriffsgeschichte und Streitdebatten – und auch mit dem heutigen Stand des psychoanalytischen Wissens. Es waren freie Assoziationen eines Klinikers, zugleich auch eines Historikers der Psychoanalyse über Theorie, Technik, Philosophie und Geschichte des psychoanalytischen Denkens, alle paar Minuten von Kollegen »gestört«, die Fragen stellten, Anmerkungen machten, Diskussionspunkte einwarfen. Das Ergebnis war eine Art psychoanalytischer Midrasch, eine Mischung aus theoretischer Reflexion und vertiefter Lektüre ausgewählter Texte der psychoanalytischen Literatur einerseits, und einem »klinischen Journal« mit praktischen Ratschlägen für Therapeuten aus der, wie erwähnt, zugleich persönlichen, gelehrsamen und diskursiven Perspektive andererseits. Einige dieser Vorlesungen vergingen wie im Fluge, ganz wie jene Traumstunden während der Analyse, bei denen sich der Analytiker in letzter Minute aus dem Halbschlaf rüttelt, um die Stunde pünktlich zu beenden.
Spät nachts, nach der Sitzung, habe ich mir manchmal die Aufnahmen angeschaut. Das Unbewusste meiner Gruppe und das meine blieben offensichtlich nie ganz ausgeklammert. Ich stellte fest, dass ich nicht immer einverstanden war mit dem, was ich kurz davor gesagt hatte, ja manchmal schien mich in der Hitze der Diskussion gleichsam ein Geist zu befallen, den ich in einem Artikel oder einer Vorlesung mit schriftlicher Vorlage vermutlich neutralisiert hätte. Allmählich gewöhnte ich mich an mein digitales Selbst und freute mich auf mein nächstes Treffen mit ihm und mit der Gruppe. Ich begann, über diese Zoom-Sitzungen als meine »Talking Cure« (Redekur) nachzudenken.
Bei dem Versuch, den Stimmen- und Ereignischor bei jeder Sitzung zu orchestrieren, begann ich, von den Aufnahmen Transkripte anzufertigen. Die Verarbeitung der aufgenommenen Sitzungen zu Texten ermöglichte mir auch, mich näher mit meinem psychoanalytischen Palimpsest auseinanderzusetzen. Ich war nicht überrascht festzustellen, dass Freud eine zentrale Rolle in meinen Vorlesungen einnahm – wenigstens daran hat die Corona-Pandemie nichts geändert –, doch ich erkannte auch, wie sehr sich meine Gedanken über die Psychoanalyse als Praxis und Ethik, als Lebenswandel und Erfahrung im Laufe der Jahre geändert haben. Aber noch wichtiger: Ich erkannte, wie sehr das Reden in die Kamera in demselben Raum, den ich mit den Patienten teile, seinen Widerhall in der Art findet, wie ich lehre, denke und rede. Das Reden aus dem Behandlungszimmer hinaus half mir, die objektive und die subjektive Dimension des psychoanalytischen Akts miteinander zu verbinden und unsere Gespräche in der Praxis zu verankern – in meiner vita activa als analytischer Therapeut. In einem Raum, in dem wenige Minuten zuvor eine Analysesitzung stattgefunden hatte, vor einer Kamera über Psychoanalyse zu reflektieren und zu sprechen und ein recht großes Therapeutenpublikum in Echtzeit daran teilhaben zu lassen, ist ein ganz besonderes Erlebnis.
Ein paar Worte noch zum Aufbau des vorliegenden Bandes: Das erste Kapitel »Psychotherapie in Gefahr« beruht auf der ersten Gruppensitzung, die zu Beginn des ersten Lockdowns stattfand. Anlässlich dieser Sitzung ordnete ich das Seminar in seinen historischen und erlebnisgeschichtlichen Kontexten ein: im alt-neuen Ereignis der Pandemie und in den verschiedenen Aspekten des Angstphänomens. Eine gekürzte Version des Vortrags erschien im April 2020 in einer Wochenendbeilage der Zeitung Haaretz. Die elf nachfolgenden Gespräche befassen sich mit ausgeprägt theoretischen und klinischen Fragen. Darin eingeflochten sind die Fragen und Anmerkungen der Seminarteilnehmer. Im 13. Gespräch, das diesen Band beschließt, betrachte ich das psychoanalytische Projekt erneut aus der Vogelperspektive durch Reflexionen zum Begriff »psychoanalytische Weltanschauung« und dessen mögliche Verbindungen zu politischem Denken und zur Demokratie. Frühere Versionen desselben trug ich auf der Konferenz »Bion in Marakesh« 2018 in Rom, in den Psychoanalytischen Gesellschaften von Philadelphia und Chicago 2019, in der Israelischen Psychoanalytischen Gesellschaft 2020 sowie auf der Gründungsveranstaltung des Studiengangs »Freud und seine Nachfolger« des Studienprogramms für Psychotherapie der medizinischen Fakultät an der Tel Aviver Universität im März 2021 vor. Rückblickend habe ich realisiert, dass es durch das letzte Gespräch auch möglich wird, die zuvor durchgeführten Seminare – trotz ihrer ausgesprochen persönlich-klinischen Ausprägung – als Teil des kulturwissenschaftlichen Forschungsprogram zu verstehen, dessen Anfang die Übersetzungen von Freuds Schriften ins Hebräische bilden, an denen ich als Übersetzer und Lektor ab 1994 teilnahm, und auch mein hebräisches Werk Osej Hanefaschot (Seelenagenten) (Am Oved, 2007), das in überarbeiteten Fassungen auch auf Englisch (Freud in Zion, 2012), auf Deutsch (Freud auf Hebräisch, 2013) und auf Französisch (Freud à Jérusalem, 2017) erschien.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Teilnehmern des Seminars »Psychotherapie in Gefahr« für inspirierende gemeinsame Monate des Gedankenaustauschs, der Lektüre und des Lernens bedanken. Mein Dank gilt auch den mehreren Tausend Mitgliedern der Facebook-Gruppe »Psychoanalysis in Israel«, auf deren fruchtbarem Boden auch mein vorheriges Buch Sigmund Freud – Michtawim [Sigmund Freud – Briefe] (2019; s. a. 2020) gedieh. Die Tiefenströmungen, die in dieser bemerkenswerten Diskussionsgruppe zirkulieren, trugen auch zur Entstehung der hebräischen Version von Redekur. 13 Gespräche zur Psychoanalyse bei. Ich bedanke mich bei David Ajchenrand, dem Übersetzer, und der Psychoanalytikerin Sibylle Drews, die die Übersetzung gegengelesen, das Literaturverzeichnis erstellt und die Publikation auf Deutsch unterstützt hat sowie bei der Stiftung zur Förderung der Psychoanalyse e. V. für die Unterstützung der Übersetzungskosten. Für die Reproduktion von Wolfgang Hildesheimer Original-Collage – Fragmentarisches 1986 – bedanke ich mich bei Inge Thurner und Christa Geitner.
Allen voran bedanke ich mich bei Nili Lubrani Rolnik, die Teile der Transkriptionsarbeit übernahm und mich, wie immer, auf Gedanken in meinen Worten hinwies, die mir verborgen geblieben waren.
Ich hoffe, dass die Anregungen und Fragen, die meine Seminarteilnehmer und ich im Verlaufe der virtuellen Begegnung einbrachten und Eingang in diesen Band fanden, nicht nur Zeugnis meines psychoanalytischen Bewusstseins ablegen, sondern auch von jenem anhaltenden historischen Moment, jenem Gefühl der fachlichen und menschlichen Schicksalsgemeinschaft, das die Kontinuität des zeitgenössischen psychoanalytischen Denkens in Pandemiezeiten ermöglichte.
Eran Rolnik, Tel Aviv/Poschiavo, Oktober 2022
1
Psychotherapie in Gefahr
Wie achtet man bei der Behandlung auf die Manifestationen eines historischen Ereignisses so gewaltigen Ausmaßes wie eine Pandemie? • Wie wirkt sich die Kamera auf das Behandlungsgespräch aus? • Was ist Angst? • Was ist der Todestrieb und wie schützt er uns vor dem Lebensschmerz? • Hat der analytische Therapeut eine gesellschaftliche Aufgabe? • Sind Psychoanalytiker Angsthasen? • Worüber sprachen Freud und der Dichter Rainer Maria Rilke während des Kriegs?
Ich möchte mit einer Anekdote beginnen, und zwar nicht aus der Frühzeit der Psychoanalyse, sondern aus dem Goldenen Zeitalter der amerikanischen Psychoanalyse. Es gab Zeiten in Amerika, in denen Psychoanalytiker gefragte Redner in allen möglichen Foren und auf Symposien waren. Ein solcher Star jener Epoche war der kalifornische Analytiker Ralph Greenson (von dem später bekannt wurde, dass Marilyn Monroe bei ihm in Behandlung gewesen war). Die Legende besagt – eigentlich ist es eine Geschichte, die seine Frau später erzählte – Folgendes: Greenson nahm 1960 an einem Podiumsgespräch in der Universität von Kalifornien über das Verhältnis von Psychoanalyse und Religion teil. Der Hörsaal war voll besetzt. Er sitzt also auf der Bühne am Tisch mit anderen Diskussionsteilnehmern, einem katholischen Priester, einem protestantischen Religionsvertreter und einem Rabbi – ganz wie in den Witzen. Die Diskussion nimmt ihren Lauf, und plötzlich ertönt ein lautes Donnern, die Lichter gehen aus und es herrscht völlige Dunkelheit im Hörsaal. Die Leute springen von ihren Sitzen auf und laufen wild durcheinander. Nach ein paar Minuten gehen die Lichter wieder an, und die Leute kehren allmählich auf ihre Plätze zurück. Greenson ergreift das Mikrofon und sagt: »Ich möchte nur festhalten, dass ich als einziger sitzengeblieben bin.«
Diese Anekdote lässt sich auf mancherlei Art interpretieren, etwa vor dem Hintergrund der Epoche, in der die amerikanische Psychoanalyse in einem gewissen Überlegenheitsgefühl schwelgte wie die Religion. Ein Interpretationsversuch könnte aber auch in Form der folgenden Frage erfolgen: Ist der Psychoanalytiker wirklich dazu bestimmt, als »Letzte sitzenzubleiben, wenn im dunklen Raum Panik ausbricht«? Ist das die gesellschaftliche Aufgabe als Analytiker? Greenson scheint Stolz darüber zu empfinden, dass er im Gegensatz zu den Religionsvertretern, die alle unter dem Tisch Schutz suchten, sitzenblieb.
Ich bin nicht sicher, ob wir das heute als Analytiker als Ideal empfinden würden, d. h. in jeder Situation die Fassung zu bewahren und sitzenzubleiben. Andererseits bin ich davon überzeugt, dass wir in der heutigen Zeit eine bestimmte Aufgabe haben. Nach meinem Verständnis haben wir tatsächlich eine Aufgabe, und diese besteht nicht nur darin, Menschen zu behandeln, sondern auch das Denken »unter Feuer« weiterzuentwickeln, wie Bion (1979) schreibt, also auch unter Bedingungen, unter denen die intellektuelle Auseinandersetzung kaum möglich scheint. Ich glaube deshalb, dass die Fragen, denen wir uns in unseren folgenden Begegnungen widmen möchten, über technische Fragen, wie man z. B. Psychoanalyse im Lockdown betreiben kann oder wie die Behandlungstechnik den Bedingungen einer Epidemie angepasst werden könnte, hinausgehen werden. Das sind durchaus wichtige Fragen, aber ich interessiere mich auch für Fragen wie folgende: Was können wir in einer solchen Zeit zusätzlich bieten, oder was kann uns diese Zeit über die Menschen und die therapeutische Begegnung lehren? Ich möchte die besonderen Umstände, in denen wir uns heute befinden, nutzen, um über die Dinge nachzudenken, die uns als Therapeuten auch in normalen Zeiten beschäftigen.
Unsere Disziplin, das dynamische therapeutische Denken, ist in vielerlei Hinsicht ein Denken, das sich in Notzeiten entwickelt. Wir sind uns dessen vielleicht nicht bewusst, doch ein Großteil der Theorien, an denen sich unsere Arbeit orientiert, sind Theorien, die sich »unter Feuer« entwickelt haben, also unter allen möglichen Arten von Erschütterungen und Angriffen von außen, die das psychoanalytische Denken in den 130 Jahren seines Bestehens begleitet haben. Ob wir über die Theorien von Freud, Reich, Ferenczi, Klein, Winnicott, Kohut, Bion oder Lacan debattieren, wir sollten auch die partikularen autobiografischen und zeitgenössischen Dimensionen des psychoanalytischen Denkens und der therapeutischen Praxis im Visier haben.
Fangen wir vielleicht mit der Ödipus-Geschichte an. Das Drama König Ödipus von Sophokles spielt sich in der Stadt Theben ab, die gerade von einer Seuche befallen ist. Die Seuche bringt das damalige medizinische Denken zum Ausdruck, das sich im Terminus »Miasma«, altgriechisch für »schädliche/bedrohliche Atmosphäre«, widerspiegelt. Die Lehre von den Miasmen dominierte die Medizin von Hippokrates bis zum 19. Jahrhundert, fast bis zu Freuds Zeit. Ärzte schrieben den Ausbruch von Seuchen wie Pest und Cholera Miasmen zu, das heißt, durch Fäulnis beinhaltende Luftpartikel von verseuchter Umwelt verursacht, etwa von verschmutztem Wasser.
Vordergründig klingt die antike Lehre von den Miasmen recht ähnlich wie die heutige epidemiologische Theorie, mit einem Unterschied: Sie ist völlig abstrakt und die Krankheitserreger werden nicht konkret benannt. In König Ödipus erhält das Miasma die religiöse Bedeutung der im Blutvergießen begründeten Unreinheit und Schuld. Auch die heutige Pandemie nimmt allmählich Ausmaße an, die über deren wissenschaftlich medizinische Bedeutung hinausgehen und wird vor unseren Augen mit religiösen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutungen aufgeladen und natürlich auch mit dem Schuldmotiv. Als das Mikroskop erfunden wurde, wurden Bakterien als Krankheitserreger entdeckt. Die Medizin erklärte die Lehre von den Miasmen damit als unwissenschaftlich. Doch ich möchte darlegen, dass das Miasma, das aus dem medizinischen Diskurs verschwunden sein mag, nun in unseren Kliniken nicht weniger präsent ist und vielleicht sogar noch präsenter als das Corona-Virus. Ähnlich wie die Drachen und der Ödipuskomplex hat das Miasma offenbar tiefe Wurzeln in der Seele und in der Kultur.
Deshalb kann man in diesen Tagen vielleicht die Weltuntergangspropheten – darunter Ungläubige und Gläubige – verstehen, die den Ausbruch der viralen Epidemie als Auflehnung der Erde gegen den Menschen interpretieren oder, präziser formuliert, gegen den Kapitalismus, der sie verschmutzt. Die Auseinandersetzung mit Epidemien erfordert einen mehrdimensionalen Ansatz. Als Wissenschaftler sind wir gehalten, sie wissenschaftlich und therapeutisch, praktisch und rational zu behandeln, als Analytiker diese rationalen Ebenen jedoch auch mit der Vorstellung und dem Symbolischen zu kombinieren, als das Erlebnis »Teilnahme an der Epidemie«, sich »epidemisieren«, im objektiven wissenschaftlichen Verständnis einzubetten.
Wir müssen lernen, die Dinge, denen wir in der jetzigen Zeit in der Praxis begegnen, als Fälle zu begreifen, die auf mehreren Bezugsebenen stattfinden, auf persönlichkeitspsychologischen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Ebenen. Doch wir haben da ein Problem: Einerseits treffen wir hier auf eine urzeitliche Kraft mit magischer oder mythischer Präsenz in der inneren Welt. Das Erleben der Epidemie ist in der Phylogenese des Menschen verwurzelt. Andererseits gibt es für Epidemien keine Erlebnisrepräsentation in unserer aktiven Erinnerung oder in jener unserer Eltern. Sie sind uns dann bekannt, wenn wir ihnen in der Literatur oder bei Kunstwerken begegnet sind, vor allem durch literarische und künstlerische Repräsentationen. Als Fachkräfte für psychische Gesundheit können wir somit einen nicht unerheblichen Teil der persönlichen und kulturellen Symptome mit den frühen Reminiszenzen von Epidemien in der Kultur verbinden. Alle möglichen Ängste im Zusammenhang mit »Reinheit« und »Ansteckungsgefahr« verbergen sich auch hinter manchen religiösen Bräuchen sowie hinter Zwangszeremoniell und Aberglaube. Angewohnheiten wie Spucken, Händewaschen, das phobische Verhältnis zu Blut und Menstruation sind offensichtlich Überreste einer Welt, in der Seuchen zum Leben gehörten – Epidemien der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit. Die Pessach-Hagada erinnert uns ebenfalls an Seuchen der antiken Welt. Alle diese Bildnisse scheinen mir jetzt aus den Tiefen des kollektiven Unbewussten der Menschheit aufzutauchen und sich mit den heutigen Bildnissen der Corona-Pandemie zu vermischen. Globalisierung, Kapitalismus, Zerstörung des Erdballs, das sind die heutigen, modernen Bilder, doch sie mischen sich mit den alten Seuchenbildnissen. Wie behandelt man ein mentales Ereignis, das zugleich mythisch und singulär ist? Keine leichte Aufgabe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Schauen Sie einen Moment die afrikanische Maske an, die hier hinter mir an der Wand hängt. Meine Patienten bemerken sie jeweils und reagieren darauf. Sie erscheint bereits seit mehreren Jahren in den Träumen der Patienten. Aber gerade weil diese Maske ein vertrauter Gast in den Gesprächen und Träumen der Patienten war, brauchte ich ein paar Wochen, bis ich realisierte, dass diese Maske, wenn sie in den Träumen des Patienten erscheint, bereits ein anderes Aussehen hat. Sie verkörpert nicht mehr Tarnung oder den Blick hinter die Kulissen, sondern etwas Neues. Meine Versuche, die Maske so zu interpretieren, als würde es sich um dieselbe Maske handeln, die vor zwei Monaten oder zwei Jahren in den Träumen erschien, erwiesen sich als eine Art Blindheit oder Verleugnung meinerseits der Transformation, die das Bild der Maske in unserer inneren Welt in der jetzigen Zeit erfährt.
Freud entwickelt seine erste Angsttheorie in einer Zeit weiter, in der die Angst im politischen und gesellschaftlichen Klima von Wien sehr präsent ist. Genau in den Monaten, in denen die Schulen und Universitäten geschlossen wurden, in der Zeit der Spanischen Grippe – wie jetzt hier – kehrte Freud zum Angstproblem zurück, das ihn seit den Anfängen seiner klinischen Arbeit beschäftigte. Er schreibt: »Das Angstproblem ist ein Knotenpunkt, an welchem die verschiedensten und wichtigsten Fragen zusammentreffen, ein Rätsel, dessen Lösung eine Fülle von Licht über unser ganzes Seelenleben ergießen müsste.« (Freud, 1916–17a, S. 408)
Die Angsttheorie, die der junge Freud in 1880er Jahren entwickelt hat, bietet eine revolutionäre, wenn auch etwas reduzierende Erklärung für körperliche Symptome von Ängsten. Diese Erklärung verbindet das Bedürfnis des Nervensystems nach möglichster Abführung von Spannung, verursacht durch Überreizung mit der Anhäufung nicht abgeführter Libido. Was will Freud seinen Patienten damit eigentlich sagen? »Eure Ängste haben einen Triebursprung, sie entstammen eurer unterdrückten Sexualität, der überbordenden Libido und vergiften euer Seelenleben.« Er weist auf die Ähnlichkeit der Angst und sexueller Aktivität hin: die Kurzatmigkeit, das Herzklopfen, ganz wie beim sexuellen Akt und wenn sich die Libido im Körper nicht entladen kann. Und Freud nennt eine ganze Reihe von Zuständen, die sexuelle Aktivität unbefriedigend machen. Dabei spricht er nicht nur von sexueller Abstinenz, sondern auch über Selbstbefriedigung, Coitus interruptus, über Zustände der Frigidität und Lustlosigkeit in der Liebe. Alle diese Dinge, die vordergründig als Entladung sexueller Spannung erscheinen mögen, führen eigentlich zu aufgestauter Sexualität, und diese Aufstauung wird, nach Freuds Worten, zu »Essig«. Die vergiftende Angst in der frühen Theorie Freuds ist die Libido, die sich in der Seele aufstaut – und verdirbt. Von diesem Punkt an beginnt sich die Unterscheidung zu entwickeln, die das psychoanalytische Denken prägt, nämlich zwischen der Angst als seelisches Ereignis mit mentalem Inhalt und psychischer Bedeutung und der Angst als eine Art körperliches, physiologisches Ereignis ohne symbolische Dimension. Der Angstbegriff wurde von Freud – genau wie der Triebbegriff – als bindendes Glied zwischen Körper und Seele konzeptualisiert. Noch heute können wir die Angsttheoretiker auf einer Skala einordnen, an deren einem Ende sich die Psychologen und Psychiater mit biologistischem oder sogar evolutionärem Angstverständnis stehen und am anderen Ende die Theoretiker des Sozialkonstruktivismus, das heißt die Theoretiker, die Angsterscheinungen weniger in individualpsychologischen Kontexten, sondern vielmehr in gesellschaftlichen, kulturellen und historischen Kontexten erkennen.
In dem Jahr, in dem Freud seine erste Angsttheorie präsentierte, also 1893, gibt der norwegische Maler Edvard Munch der Angst des modernen Menschen einen ersten expressionistischen Ausdruck in Form seines Gemäldes Der Schrei. Der Schrecken, den Munchs schreiende Gestalt zum Ausdruck bringt, ist gleichsam ein Vorbote für den Ausgang des 19. Jahrhunderts und den Auftakt zur modernen Epoche mit einem verheerenden Krieg, dem Ersten Weltkrieg oder wie er damals genannt wurde, dem »Großen Krieg«.
Im Großen Krieg wurden die kulturellen Grundbegriffe über die Ängste des modernen Menschen geprägt. Im Unterschied zu den Ängsten der vormodernen Epoche, die nur jene betrafen, die einer Gefahr selbst unmittelbar ausgesetzt waren, ist die Angst des modernen Menschen mimetisch. Die Angst ist viel ansteckender als die Epidemie selbst. Man braucht sich nicht in der Gefahrenzone aufhalten oder unmittelbar einer Gefahr ausgesetzt sein, um Angst zu erfahren. Es genügt, ein Bild zu betrachten, Radiosendungen zu hören oder Fernsehen zu schauen, um bei sich Angstreaktionen auszulösen. In unserer Zeit wird die Angst in kürzester Zeit zu einem Massenphänomen. Die Angst wird in Echtzeit von geübten Angstagenten, die sie für ihre wirtschaftlichen und politischen Zwecke einspannen, vielfach verstärkt weiterverbreitet.
Freuds späte Angsttheorie hat ihre Vorgängerin nicht vollständig abgelöst, sie jedoch auch in der Seele verortet, nicht nur im Körper, indem dargelegt wird, dass die Angst nicht nur ein Mittel zur Abführung von Essig gewordener Libido oder von anderen unerträglichen seelischen Lasten ist, sondern eine Kapsel, eine Hülse, die Bedeutung und das Wissen des Subjekts über sich selbst in sich trägt, und dieses Wissen wandert im Seelenraum und wartet auf eine Gelegenheit, es zu denken, und wenn es nicht gedacht werden kann, wird es zum Symptom, genau wie ein Traum oder ein Zwangssymptom. In der späten psychoanalytischen Angsttheorie hat die Angst also eine doppelte Funktion: das Ich vor konkreten Gefahren wie Schmerz, Verlust oder Hunger zu schützen, aber auch eine Funktion bei der kognitiven und emotionalen Entwicklung, nämlich dem Ich das Bestehen einer seelischen Existenz jenseits des Bewusstseins anzuzeigen. Der Ursprung der Angst, und an diesem Punkt kommen wir als Therapeuten zum Zug, liegt gleichzeitig innerhalb und außerhalb der Menschen. Dies, weil die Angst jenem triebhaften oder phantasmatischen Element entstammt, das vom Subjekt als fremd, als »Außer-Ich« wahrgenommen wird. Die Angst ist in dieser Hinsicht ähnlich wie die kindliche Sexualität. Sie ist traumatisch. Weshalb ist sie traumatisch? Sie ist traumatisch, weil sie gleichzeitig vom frühesten Entwicklungsstadium an von innen und von außen auf die menschliche Seele einwirkt, noch bevor der Mensch die geistige oder kognitive Fähigkeit erlangt, sie zu verstehen und zu deuten und ihr symbolischen Ausdruck zu geben.
Epidemiezeiten sind Hochzeiten des Todestriebs
Die Bedeutsamkeit der psychoanalytischen Traumatheorie liegt darin, dass sie den bekannten medizinischen Traumabegriff verwendet, ihm aber eine neue psychologische Bedeutung verleiht. Die freudianische Schule der Psychoanalyse »misst« die äußere Einwirkung auf das Subjekt nicht, sie legt ihr Augenmerk vielmehr auf jenes besondere Zusammentreffen zwischen der Kraft und dem Vorgang, die vom Subjekt ausgehen, und der Kraft, die von außerhalb des Subjekts kommt. Das Trauma im psychoanalytischen Sinne ist ein seelisches Ereignis, das wir nur schwerlich im historischen Raum verorten können. Es fällt genauso schwer, seinen Anfangspunkt zu erkennen wie seinen Endpunkt. Das Trauma ist ein anhaltendes seelisches Ereignis. Das gilt auch für unsere Perspektive als analytische Therapeuten beim Therapieren der Ängste unserer Patienten.
Nicht-analytische Psychologen weisen gerne auf den Unterschied zwischen Furcht und Angst hin. Sie argumentieren, die Angst sei irrational, die Furcht rational. Das Virus kann uns umbringen. Daher fürchten wir uns vor ihm. Diese Unterscheidung ist freilich unbefriedigend für analytisch denkende Therapeuten. Sie lässt außer Acht, dass die fantasmatische Dimension auch eine vermeintlich rationale Furcht aufweist. Denken Sie an ein Kind, das sich vor Hunden fürchtet. Empfindet es Furcht oder Angst? Sie mögen sich auch an den kleinen Hans erinnern (1909b). Er hat Angst vor dem Pferd. Ist das Pferd für den kleinen Hans gefährlich? Offenbar ja, Hans kann vom Pferd getreten werden. Aber unser Hans fürchtet sich nicht vor dem Pferd, weil es ihn treten könnte, sondern wegen dem, was das Pferd symbolisiert: die Kastration. Das heißt, der kleine Hans fürchtet sich vor dem Pferd genauso, wie er sich vor ihm ängstigt. Und auch wir fürchten uns vor der Krankheit, vor der Epidemie, so wie wir mit gutem Grund Angst davor haben. Unsere Arbeit besteht darin, die Patienten dazu zu bringen, die Furcht möglichst von der Epidemie abzukoppeln und in den Bereich ihrer Projektionen überzuleiten, damit sie sich auf paradoxe Weise zu einer Angst »wandelt« und damit eine tiefere subjektive Bedeutung erhält. Je mehr sich der Patient traut, Verantwortung und Interesse auch für Ängste mit realem Hintergrund zu übernehmen, desto besser kann er mit seinen unbewussten Ängsten umgehen. Die Fähigkeit, eine Angst zu regulieren und umzuwandeln, ist ein Entwicklungserfolg, auf individueller und auch gemeinschaftlicher oder kultureller Ebene. Wir können die Angst unterschiedlich benennen, etwa mit Sorge, Kummer, Trauer, Reue, Schuld oder gar mit Neugier und Bewunderung. Es gibt auch Menschen, die vom Schaden fasziniert sind, den diese Epidemie anrichtet. Sie geben es nicht gerne zu, aber sie sitzen von morgens bis abends in einem Zustand emotionaler Erregung vor dem Fernsehgerät. Wenn wir ihnen helfen, die Bedeutung dieser Erregung zu erkennen und sie von der allgemeinen Etikette – Angst – befreien, helfen wir ihnen bereits, diesem Vorgang eine Bedeutung zu geben. Die Fähigkeit, Ängste zu regulieren und umzuwandeln, bestimmt die Grenzen der Selbstbewusstwerdung und des Vermögens, die Umgebung und die Welt zu erfahren. Das Verhältnis zum Unbewussten – unsere Fähigkeit, die Art von Ängsten in der Phantasiewelt in Echtzeit zu erkennen und zu verstehen – bestimmt schließlich das Verhältnis zur Realität, zum Fremden und zum Anderen. Sie bestimmen die Haltung, die wir beim Zusammentreffen mit dem Unbewussten in uns und auch außerhalb einnehmen – und letztlich auch das Vermögen, sich einer historischen Realität anzupassen und als Individuum und Gruppe auf Ziele in der Realität hinzuarbeiten, die von unserem Verhältnis zu den unbewussten Ängsten und Phantasien abgeleitet sind.
Wovor versuchen wir uns seit unserer Geburt zu schützen? Wir haben »Geburtsangst«, ein umstrittener Begriff, der wahrscheinlich zutrifft, obwohl er Freud widerwärtig erscheint. Das ist vermutlich der erste große Angstausbruch, der das »Ich« bei der Geburt befällt. Danach empfinden wir die Angst der Trennung vom Objekt, die Angst vor dem Verlust des Objekts oder, genauer gesagt, die Angst vor dem Verlust der Zuneigung des Objekts, das heißt die Angst vor der Beeinträchtigung des Objekts als Objekt der Zuneigung.
Diese Ängste werden in einer etwas längeren Aufzählung traumatischer Erfahrungen ausgeführt, die uns von der Geburt bis zum Tod begleiten: das Geburtstrauma, der Verlust der Mutter, die Kastrationsangst, der Verlust der Zuneigung des Objekts und – besonders wichtig – der Verlust der Zuneigung des »Über-Ich«, das heißt, die Angst vor dem Gewissen. Ich glaube, die Angst vor dem Gewissen lässt sich jetzt schon sehr stark aus dem öffentlichen Diskurs heraushören. Schuld. Schuld. Schuld. Wir haben das selbst verschuldet. Wir haben uns versündigt, vergangen, sind vom rechten Weg abgekommen, haben uns töricht verhalten, deshalb wurden wir bestraft. Nun mag man fragen: Und was ist mit der banalen und »selbstverständlichen« Angst vor dem Tod? Kann man das, was jetzt um uns herum geschieht, ohne sie verstehen?
Die Haltung, die die Psychoanalyse für das bereithält, was sich Todesangst nennt, ist alles andere als intuitiv. Man könnte sie mit den Worten von T. S. Eliot zusammenfassen, »in meinem Anfang ist mein Ende«. Der Mensch hat – aus der Sicht der freudianischen Psychoanalyse – keine Angst vor dem Tod, der ihn erwartet, sondern von dem bereits eingetretenen Tod. Das Unbewusste glaubt nicht an seine Endlichkeit. Auf rational-kognitiver Ebene können acht- oder zehnjährige Kinder zwar schon verstehen, was Tod bedeutet, doch im Unbewussten ist der Tod nie »dominant«. Wir empfinden manchmal Furcht vor dem Tod, wir alle empfinden sie im Moment, aber wir neigen auch dazu, die unmittelbare Furcht vor dem Tod mit der Todesangst zu verwechseln. Wie hat sich die Angst vor dem Tod in unserer Seele festgesetzt? Diese Frage ist umstritten. Mag sein, dass die Angst vor dem Tod dem Todestrieb am nächsten kommt, dem der Säugling in seinen ersten Tagen begegnet. Das heißt, wir haben eine Art protomentale Erfahrung oder möglicherweise eine Erfahrung im frühen Säuglingsalter mit dem Todestrieb. Vielleicht ist in unserer Seele eine Erfahrung mit der Ohnmacht und dem seelischen Zusammenbruch festgeschrieben. Ich glaube, es lohnt sich dieser Tage, den Begriff Todestrieb etwas näher anzuschauen, denn er hilft sehr dabei, davon abgeleiteten Weltschmerz und zahlreiche andere Phänomene – normaler und pathologischer Art – zu verstehen. Neben der Lebenslust und -bejahung nistet in uns auch ein Trieb, der von Geburt an nicht nur gegen die Lebenstriebe wirkt, sondern sich auch als Alternative und Schutz gegen Weltschmerz anbietet.
Der Todestrieb manifestiert sich im Seelenleben auf verschiedene Weise, und es wäre falsch, ihn einzig mit Verhaltensweisen zu identifizieren, die auf verlustig gegangenen Lebenswillen hindeuten. So wie es unzählige Manifestationen und Erscheinungsformen dessen gibt, was wir »Leben« nennen, gibt es eine riesige Vielfalt von Verhaltensweisen, unbewussten Wünschen und mentalen Funktionsweisen, die Konflikte mit dem Leben zum Ausdruck bringen. Der Todestrieb kann durch allmählichen Verlust des Verstandes, Passivität und Wiederholungszwang zum Ausdruck kommen oder auch durch Zerstörung des Denkens und der Aufnahmefähigkeit. Er kann auch eine Situation schaffen, in der die Abhängigkeit vom Guten von der Lähmung des guten Objekts zunichte gemacht wird, was sich in ständigem Schwanken zwischen Leben und Tod äußert.
In Pandemiezeiten hat der Todestrieb, so scheint es mir, »Konjunktur« – möglicherweise noch mehr als in Kriegszeiten. Sie werden unter Ihren Patienten – bestimmt unter den jungen Patienten, aber nicht nur – solche finden, die die Bedrohung durch die Epidemie und die Krankheit in eine gewisse Gleichgültigkeit oder Hypomanie verfallen lässt. Einige von ihnen liefern sich einem megalomanen Untergangsexzess aus. Sie sagen dann zum Beispiel: »Covid gefährdet nur Alte und Schwache. Ich bin jung und gesund, mir wird schon nichts passieren.« Menschen wenden sich nicht deshalb dem Todestrieb zu, weil sie sterben wollen, sondern weil sie sich davon Schutz vor dem Weltschmerz versprechen – vor dem Überhandnehmen des Gefühls der Verletzlichkeit, der Ohnmacht und der Abhängigkeit.
Bei Virginia Woolf finden sich schöne Schilderungen solcher Stimmungen. Bei ihr persönlich nahm der Flirt mit dem Todestrieb ein schlechtes Ende, doch sie hinterließ uns faszinierende Schilderungen des Verhältnisses mit dem Todestrieb. In Orlando, dem biografischen Roman des gleichnamigen Protagonisten, der Raum und Zeit durchschreitet, beschreibt sie seinen ausgedehnten Schlaf. Er schlafe sehr lange, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Genau wie viele unserer Patienten. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass die Epidemie eine gewisse Lähmung auslöst, Müdigkeit und Lust zum Schlafen? Ich denke, es wäre falsch, diese Lethargie nur auf Angst zurückzuführen. Sie ist meiner Meinung nach auch Ausdruck des Todestriebs, Ausdruck des Willens, das Denk- und Fühlsystem auszuschalten. Der Todestrieb kann verschiedene eigenartige Empfindungen von Vergnügen auslösen, die der Lebens- und der Sexualtrieb nicht hervorrufen können. Und vielleicht, wie Virginia Woolf über Orlando schreibt, »ist es so um uns bestellt, dass wir den Tod täglich in kleinen zugemessenen Mengen nehmen müssen, weil wir sonst mit dem Geschäft des Lebenmüssens nicht zurechtkämen?« Es kommt meines Erachtens nicht von ungefähr, dass viele Menschen davon berichten, dass ihnen dieses Gefühl der Lähmung und sogar die sie derzeit befallende Gefühlsabstumpfung Vergnügen bereitet. Ich lese in diesen Tagen wieder den Zauberberg von Thomas Mann. Auch das Sanatorium für Tuberkulose-Kranke, in dem der Romanheld Hans Castorp sieben Jahre lang feststeckt, scheint eine Art Schauplatz mondsüchtiger Faszination vom Todestrieb im frühen 20. Jahrhundert zu sein oder mit den Worten Manns: »Eine Einrichtung zur höchst gefährlichen Nachverfolgung der Geheimnisse des Lebens« (Mann, 1939). Der junge Castorp wird von der Tuberkulose geheilt, kehrt nach Hause zurück und nimmt auf den letzten Seiten des Romans noch seine nächste historische Rolle als deutscher Soldat ein, der in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs zu überleben versucht.
Freuds Begegnung mit Rilke
Freuds kurzer Aufsatz »Vergänglichkeit« ist ganze drei Seiten lang, aber unglaublich viel Lyrik, Weisheit und Menschenliebe steckt in diesem kurzen Text. Es war der erste Text von Freud, den ich, noch als Arzt im Praktikum, ins Hebräische übersetzt habe. Aber lassen wir das Sentimentale. Es ist eine erste Skizze von Freuds Theorie der Trauer und der Depression, die Ihnen aus Trauer und Melancholie (1916–17g) bekannt sein dürfte. Die Abhandlung ist auf dem Tiefpunkt des Ersten Weltkriegs entstanden, als die Welt wirklich in Trümmern lag. Die Menschen hatten damals weniger den Überblick über das, was um sie herum geschah, als wir ihn heute in Echtzeit haben; aber die Zerstörung der Welt, wie sie 1915 bekannt war, wurde von den Zeitgenossen als erschütternder als alle anderen ihnen erinnerbaren Kriege wahrgenommen. Sie zogen in den Krieg mit Vorstellungen von Raum und Zeit des 19. Jahrhunderts und kehrten nach vier Jahren mit tiefen Wunden wieder zurück, direkt in die Moderne. Das ist der Hintergrund des Gesprächs, das Freud mit dem Dichter – vermutlich Rilke, aber auch das ist umstritten – über die Frage führt, inwiefern der Verlust der Zuneigung des Objekts als vergängliches Wesen unsere Beziehung zur Welt beeinträchtigt. Ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion in klinischer Hinsicht, keine abgehobene philosophische Auseinandersetzung. Sie hebt zudem eine der wichtigsten Aufgaben des Klinikers in der jetzigen Zeit hervor. Der Verlust ist eine Gelegenheit, unser Verhältnis zu Objekten in der äußeren Realität und zum inneren Objekt zu prüfen. Und das ist, was Freud dort mit Rilke unternimmt. Er stellt fest, dass Rilkes Beziehung zum inneren Objekt narzisstischer Natur ist, das heißt, eine Beziehung, die mehr auf Identifikation mit dem Ähnlichen fußt als auf Identifikation oder Auseinandersetzung mit dem Verschiedenen. Freud »diagnostiziert«, dass es seinem Gesprächspartner, dem melancholischen Dichter, schwerfällt, das nicht perfekte Sein des Objekts, die Tatsache des von ihm Getrenntseins und dessen Vergänglichkeit zu akzeptieren. Unsere Beziehung zum internalisierten Objekt prägt unsere Beziehung zum reellen Objekt – dem geliebten Menschen – und bestimmt auch, wie wir auf den Verlust des reellen Objekts reagieren, ob es sich um einen vorübergehenden Verlust handelt wie eine Trennung oder um einen permanenten Verlust, der Trauer erfordert. Die Unterscheidung, die Freud zwei Jahre später in der bedeutenden Schrift Trauer und Melancholie trifft, ist relativ streng. Im Gespräch mit Rilke klingen die Dinge noch nicht so ausgeprägt, deshalb verströmt es auch Optimismus. Freud skizziert mit Meisterhand den Zusammenhang zwischen der Beziehung zum internalisierten Objekt – das Ausmaß der erreichten Distanz, das Ausmaß der darauf gerichteten Aggression, unsere Einstellung zur Abhängigkeit von diesem Objekt in der Realität, von einem Objekt, das uns sowohl Schmerz als auch Vergnügen bereitet, also unsere Ambivalenz dem Objekt gegenüber – und der Art, in der wir den Untergang des Objekts und die Trennung von ihm erleben.
Der Aufsatz endet mit einer erstaunlich optimistischen Note. Freud verleugnet den unvermeidlichen Schmerz des Verlusts des Liebesobjekts nicht, glaubt aber an die Fähigkeit der Seele des jungen Menschen, Ersatz zu finden, die Beziehung zum Objekt, das ihn verlassen hat, zu heilen und sich zu trösten. Trost macht es auch möglich, mit der jetzigen Krise fertig zu werden und mit den unvermeidlichen Verlusten, die wir wohl werden betrauern müssen. Ich denke, wir sollten dem Thema Trauer bei der Arbeit mit Patienten in der jetzigen Zeit hohe Priorität einräumen, auch mit denen, die es nicht spontan ansprechen. Die intuitivste Wahl könnte auf die Trennung von der Behandlung, die veränderten Behandlungsbedingungen oder den Abbau von der direkten Begegnung zur Zoom-Begegnung fallen. Ich würde sagen, das wäre die Gelegenheit, das Werkzeug dort anzusetzen und die Trauer zu verarbeiten. Wem Trauer und Sehnsucht schwerfällt, riskiert den Kontakt zum guten Objekt auch in normalen Zeiten zu verlieren, etwa wenn einem das Objekt Leid zufügt oder einen sonstwie enttäuscht. Das ist übrigens auch eine Gelegenheit, mit den Patienten die Unterschiede zwischen Sehnsucht und Nostalgie zu ergründen. Bei der Nostalgie handelt es sich offensichtlich um eine Projektion des Ich-Ideals, eines idealisierten Objekts, das heißt um ein Objekt der Zuneigung narzisstischer Ausprägung. So ist das mit den Psychoanalytikern, sogar in Pandemiezeiten beurteilen sie die Sehnsucht nach der »Welt von gestern« misstrauisch.
Warum gab ich unserem Seminar den Titel »Psychotherapie in Gefahr«?
Ich glaube, die Antwort darauf dürfte nun klarer sein. Ich habe versucht, mit dem Titel den Gedanken zu vermitteln, dass es nicht nur um die »Psychotherapie in Gefahrenzeiten« geht, was in der jetzigen Zeit nicht sonderlich erwähnt werden muss, sondern dass wir gerade eine Zeit durchleben, in der die Fähigkeit mancher Patienten, eine Psychotherapie zu durchlaufen und selbst das psychotherapeutische Projekt im weiteren Sinne in Frage gestellt wird. Diese Gefahr wird meiner Meinung auch dann weiterbestehen, wenn wir über einen Impfstoff gegen das Virus verfügen werden. Es ist ein Element bei unserem Gespräch und bei der zwischenmenschlichen Begegnung hinzugekommen, das meines Erachtens, wie erwähnt, in der Phylogenese der Menschheit bereits latent und verdrängt vorhanden war; aber ist es einmal präsent, wird es uns nicht mehr so schnell wieder verlassen. Es wird die zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen und entfaltet sogar eine etwas größere Wirkung als jene, die einigen von Ihnen vielleicht noch von der Aids-Epidemie bekannt sein dürfte. Als ich in den 1980er Jahren Biologie studierte, hatten wir einen Dozenten, der sich über die Aids-Hysterie mokierte, die uns alle befiel: »Ihr habt nichts zu befürchten. Als Forscher kann ich euch versichern, dass derzeit mehr Menschen von der Aids-Epidemie leben als daran sterben.« Ich kann mich erinnern, wie sehr uns diese Aussage empörte. Wir waren jung und Aids hat unsere Einstellung zu Sex stark verändert. Aids wirkte sich nicht nur auf die Bevölkerungsgruppen aus, die den Daten zufolge stark gefährdet waren. Es beeinflusste auch die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Empfindung der eigenen Sexualität generell.
Auch die Covid-Pandemie wird sich meiner Meinung nach langfristig auf unsere Objektbeziehung und unser Verhältnis zur Welt auswirken. Warum sie das tun wird? Da tappe ich noch ein wenig im Dunkeln und möchte erste Denkansätze dazu mit Ihnen teilen. Die Welt ist verrückt geworden. Was bedeutet das? Die Realität bestätigt all das, von dem wir dachten, es existiere nur in der unbewussten Fantasie. All das wird vor unseren Augen Wirklichkeit. All die Vorstellungen von Ansteckung, erschreckende Fantasien von Durchlässigkeit, alle unsere psychotischsten Fantasien finden unter diesen extremen Bedingungen nun alle Bestätigung. Und es ist sehr schwer, unter diesen Bedingungen ein Behandlungszimmer für Analysen zu führen oder Behandlungen nicht konkreter Art durchzuführen. Wir werden später darauf zurückkommen, wenn wir näher auf die Klinik eingehen. Sie mögen den Unterschied bemerkt haben zwischen den Patienten, die ihre Behandlung aus praktischtechnischen Gründen beenden oder unterbrechen, und Patienten, die plötzlich verschwinden, eine Art Ghosting vollziehen, weil sie befürchten, bei einer Behandlung unter den gegebenen Bedingungen erhöhten Drucks den Verstand zu verlieren.
Ist das eine Selbstrettungsaktion? Ich denke, wir werden neue Fertigkeiten entwickeln müssen: Wo loslassen, den Patienten gehenlassen, Druck zurücknehmen, und wo dem Patienten, der die Therapie beenden möchte, etwas resoluter gegenübertreten im Gedanken, dass das der Zeitpunkt ist, ihm zu helfen, an sich zu arbeiten. Doch nicht jeder Patient reagiert gleich. Sie haben bestimmt schon festgestellt, dass gerade Ihre regressiven Patienten, die schwierigsten Borderline-Patienten, nun aufblühen. Aus ihrer Sicht kommt die Welt ihrem Innenleben endlich ein Stück weit entgegen, beginnt, sich ihrer Lebensweise anzugleichen. Sie sind wunderbar und in der jetzigen Welt am gesündesten. Leute, die in normalen Zeiten kaum funktionieren, sind im vergangenen Monat wahrlich aufgeblüht. Menschen, die sonst sehr gut funktionieren und deren Leben in geordneten Bahnen verläuft – Ärzte, Professoren – ist das hingegen komplett zuwider. Sie können diese äußere Manifestation des Innenlebens kaum aushalten und es fällt ihnen schwer, in Behandlung zu sein. Wir müssen also wissen, wann wir jemandem einen Gefallen tun, wenn wir ihm Psychotherapie vorschlagen, und wann wir den Patienten damit tatsächlich überfordern.
»Taugt« das Unbewusste für den Bildschirm?
Bis neulich stand ich dynamischen Behandlungen per Video eher skeptisch gegenüber, doch die Entwicklung geht in diese Richtung und wenn uns noch der letzte Ansporn gefehlt hat, die Patienten und Therapeuten dazu veranlassen könnte, Behandlungen per Video der unmittelbaren Begegnung in der Praxis vorzuziehen, haben wir ihn jetzt mit der Pandemie erhalten. Die technischen Möglichkeiten, die uns begleiten, rechtfertigen sich nun endgültig und das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Es besteht meiner Meinung nach auch kein Anlass dazu. Natürlich gibt es Patienten, die sich »hinter der Kamera verstecken«, aber es sind dieselben, die sich vorher »hinter der Analyse-Couch« versteckt haben. Wir wissen, dass sich Patienten durchaus zu verstecken wissen, auch wenn wir sie jahrelang fünfmal pro Woche treffen. Es gibt nichts bei einer therapeutischen Begegnung, was nicht als Abwehr dienen könnte. Inwiefern ist die Kamera ein solches versteckendes Element? Ich bin mir da nicht mehr so sicher wie früher. Man darf nicht vergessen, dass das, was vor allem aus der Sicht von Therapeuten und Patienten einer bestimmten Generation als Verrat an der Sache gilt, den Therapeuten (und Patienten), die während der Internetrevolution aufgewachsen sind, weit weniger revolutionär vorkommt, auch wenn es sehr viele Variablen gibt, von denen wir noch nicht wissen, wie sie sich auf die Behandlungsbegegnung auswirken, bei der die therapierende und die therapierte Person sich nicht im selben Raum befinden, ja oft nicht einmal in derselben Zeitzone.
Ich gebe ihnen das Beispiel einer Analyse, die seit 15 Jahren andauert. Jedes Mal, wenn ich versuche, die Therapie zu Ende zu bringen im Gedanken, dass eine gute Therapie irgendwann enden sollte – und vorzugsweise vor dem Tod des Therapeuten oder des Patienten, in diesem Fall eine Patientin –, jedes Mal, wenn ich also versuche, auf das Ende hinzuleiten, kommt es zu einer tiefen Regression und die Behandlung geht weiter. Zwischen mir und der Patientin besteht in dieser Frage eine Meinungsverschiedenheit. Da kam die Pandemie und die Patientin schlug mir aus eigenem Antrieb vor, auf Zoom auszuweichen. Und auf einen Schlag wurde die Trennung zwischen uns, die mir zuvor unmöglich schien, denkbar. Sie zeigt mir alle möglichen Gegenstände in ihrer Wohnung, »hier ist das und hier jenes«, und plötzlich springt eine Katze vor die Kamera. Die Wirklichkeit in extremis. Sie und ich haben gemerkt, der Abschied hat begonnen. Dank Zoom sind wir gleichzeitig zusammen und allein. Dank der Kamera wird sie nun vermutlich die wichtigste therapeutische Arbeit vollbringen, die sie bis jetzt jahrelang mied, nämlich sich von ihrem Therapeuten zu trennen. Ich bin der Meinung, dass es ohne Trennung keine erfolgreiche Therapie geben kann. Aber Sie haben gefragt: »Wie setzt man Therapien per Zoom fort?«, und ich bin der Frage ein wenig ausgewichen und habe gesagt, dass wir dank Zoom in der Lage sind, Therapien zu beenden und sie so erfolgreich werden zu lassen.
Es besteht die Gefahr, dass Therapien, die erst begonnen haben und zu früh auf Video ausweichen, in die Oberflächlichkeit und Verfälschung abgleiten, aber nicht zwingend. Ich bin dafür – das ist meine Intuition –, auf die Kamera zu verzichten. Die telefonische Therapie von früher kommt einem intimen Gespräch näher als die Therapie von Angesicht zu Angesicht per Video. Etwas am Reden zum Bild, das auf dem Bildschirm erscheint, hebt uns auf eine oberflächliche Ebene im Gespräch und erschwert die Vertiefung, ja erschwert die Begegnung. Beachten Sie, dass die meisten Patienten und vielleicht auch die Therapeuten bei einem Zoom-Gespräch auf dem Bildschirm sich selbst anschauen und die Kamera als Spiegel benutzen, was genau das Gegenteil jener »Selbstvergessenheit« ist, die ein Therapiegespräch fördern soll. Auch das Fehlen des Körpers im Behandlungszimmer wirkt sich meiner Meinung nach negativ auf die Qualität der Begegnung aus. Es ist mir wichtig, dass die Patienten, deren Behandlung per Zoom stattfindet, eine Möglichkeit finden, mich hin und wieder in der Praxis zu treffen. Die Verwendung der Computerkamera führt dazu, dass sich der Blick auf den Gesichtsausdruck des Gegenübers konzentriert. Ich fühle mich nicht gut dabei, den Patienten eine ganze Stunde lang ununterbrochen ins Gesicht zu blicken, wobei jede Abwendung des Blicks zumeist als Desinteresse interpretiert wird. Die permanente Nahaufnahme ist mir zu intensiv.
Was macht ein erfolgreiches Therapiegespräch aus? Das hängt natürlich von unzähligen Faktoren ab. Eine psychische Behandlung ist nicht wirklich ein Dialog, sondern eher ein Monolog in Gegenwart eines Mitmenschen. Und dieser Mitmensch stört diesen Monolog manchmal, das ist seine Aufgabe. Aber sobald ein Bildschirm vorhanden ist, wird die Sache zu sehr zum Dialog. Eine analytische Therapie, die diesen Namen verdient, ist nach meinem Verständnis nicht sehr dialogisch. Ein zehnminütiges Schweigen ist keine Sondererscheinung bei einer Therapiesitzung. Es verleiht einer bedeutenden Sache eine bestimmte Gegenwart und kann dem Therapeuten und dem Patienten in mancherlei Hinsicht dienen. Bei einer digitalen Sitzung erlebt man ein auch nur kurzes Schweigen als Kurzschluss in der Kommunikation. Das ist vermutlich ein weiterer Grund dafür, dass es schwierig ist, therapeutische Ereignisse im Fernsehen oder filmisch zu repräsentieren. »Gefilmte Therapien« neigen zu klischeehaften Darstellungen in Bild und Ton, selbst wenn die Szenen gut geschrieben sind und auch wenn sie jemand geschrieben hat, der sich mit Psychoanalyse auskennt und Erfahrungen damit gesammelt hat. Die Kamera erzeugt die Illusion, als würden Gefühlsmanifestationen oder das Schweigen das therapeutische Geschehen definieren. So raffiniert, feinfühlig und metaphorisch der Film sein mag, die Kamera zeigt uns den weniger wichtigen Teil der Therapiesitzung, eben was das Auge sehen kann. Die Kommunikation zwischen dem Therapeuten und Patienten ist für den außenstehenden Betrachter verbal, aber in Wirklichkeit findet sie überwiegend im Unbewussten statt, dem Blick und dem Sehsinn kommen dabei eher kleine Rollen zu. Ich bezweifle nicht, dass das Unbewusste per Bildschirm vermittelt werden kann, aber das ist ein Bereich, der mir noch zu wenig vertraut ist. Der Häufigkeit der derzeitigen Anfragen nach zu schließen, werden Sie in wenigen Jahren zu Theoretikern der Therapie via Zoom.
Ich glaube übrigens, dass das Unbewusste sich wunderbar schriftlich, in Briefen übermitteln lässt. Ich habe das, Sie mögen sich erinnern, in Texten über Freuds Briefe dargelegt (Rolnik, 2019, 2020). Er hat die Selbstanalyse nicht zufällig so schriftlich durchgeführt und blieb danach im Zuge der Entwicklung seines analytischen Denkens mit vielen Menschen gleichzeitig in Briefkontakt. Sind die neuen Technologien, mein jetziges Gespräch mit Ihnen – Sie sehen ja, dass ich frei mit Ihnen spreche –, den Assoziationen ähnlich, die ich hatte, als wir uns noch hier in der Praxis zu Seminaren trafen? Ich sehe durchaus gewisse Vorteile im Gespräch vor der Kamera. Die meiste Zeit bin ich mir nicht bewusst, dass ich vor Dutzenden von Leuten rede und mein Vortrag fällt befreiter aus als im Hörsaal. Ich bin nicht sicher, ob der Patient den Therapeuten auf dem Bildschirm ähnlich benutzt, wie wenn sich der Therapeut im selben Zimmer aufhalten würde. Doch so ist es nun mal. Es gehört zur freudianischen Tradition, technische Neuerungen anzunehmen und sie nicht als Bedrohung zu sehen. Wenn Freud heute leben würde, hätte er zweifellos einen Blog und eine Facebook-Seite. Er hätte sich meines Erachtens auch nicht von den sozialen Medien ferngehalten und wir hätten die eine oder andere Debatte über so heiß diskutierte Themen wie Pornografie oder Gewalt gegen Kinder und gegen Frauen, wobei er sich vermutlich politisch viel weniger korrekt, dafür umso origineller und weitsichtiger geäußert hätte.
Wir müssen lernen, so viel wie möglich von dem Gelernten und das für die neue Zeit Wesentliche und Richtige weiterzugeben. Hinter uns liegen 130 Jahre Psychotherapie seit der Behandlung von Anna O. 130 Jahre lang haben wir Menschen zur »Redekur« getroffen. Nun ist die Zeit gekommen zu schauen, was davon über den Bildschirm weitergegeben werden kann und was nicht. Mit Purismus kommen wir nicht weit. Unsere Lehrer haben uns schon schief angeschaut, wenn wir neben den Analysen mit fünf Sitzungen pro Woche auch solche mit »geringer« Sitzungsdichte von drei Sitzungen pro Woche durchführen wollten. Sie sagten uns: »Mit drei Sitzungen pro Woche kann man nicht wirklich eine Analyse durchführen.« Jetzt sind wir daran, unseren Schülern zu sagen: »Eine digitale Psychotherapie ist keine richtige Therapie.« Und sie tun dann das, was getan werden muss, um in der Gegenwart zu leben, und werden sich bemühen, daraus eine ernsthafte Sache zu machen. Gerade Analytiker gehören übrigens zu den Vorreitern im Bereich der Verwendung von Ferntherapie. Ich war vor zwei Jahren bei der psychoanalytischen Gesellschaft in Chicago zu Gast und konnte feststellen, dass die meisten Praktikanten dieser traditionsreichen ehrwürdigen Gesellschaft… chinesische Therapeuten sind, deren Lehranalysen per Video stattfinden.
Wir werden weiterhin auch dann als Analytiker funktionieren müssen, wenn draußen ein Virus wütet. Das ist meiner Meinung nach möglich, und ich ziehe das der Möglichkeit vor, den Laden dichtzumachen, denn, wie ich zuvor erwähnt habe, ich denke, dass wir in diesen Zeiten durchaus etwas beisteuern können.
Man hat das Gefühl, dass die Welt verrückt geworden ist. Was hat der Analytiker heute für eine gesellschaftliche Aufgabe?
Es ist wichtig, dass wir einen Dialog unter uns führen und vertieft von Therapeut zu Therapeut über das heutige Geschehen reden. Das scheint mir vordringlicher, als unser Denken hastig auf die Außenwelt zu richten oder Blitzanalysen über das Geschehen in der öffentlichen Sphäre zu bieten. Eine gute Therapie therapiert in der Regel mehr als nur eine Person. Denken Sie doch nur daran, wie lange es gedauert hat, der Welt die kindliche Sexualität zu erklären. Es dauerte ungefähr 100 Jahre, bis der Analytiker öffentlich über die mörderischen Impulse der Mutter ihrem Baby gegenüber oder ihr sexuelles Begehren nach ihrem Baby dozieren konnte. Es dauert jeweils lange, bis analytisches Wissen etwa für Artikel über Paardynamik in Tageszeitungen verwendet werden kann. Die Ideen sind schwer verdaulich. Sie sind für den Analytiker selbst schwer verdaulich, und es fällt ihm bestimmt nicht leicht, sie draußen kundzutun. Es kommt nicht von ungefähr, dass Bion gesagt hat, wenn Sie als Analytiker keine Angst haben, dem Patienten zu sagen, was Sie ihm sagen wollen, dann sagen Sie es ihm besser nicht (Bion, 1973). Eine Deutung, die diesen Namen verdient, macht auch dem Analytiker Angst. Das gilt auch für die Fragen, die wir in einem Fernsehinterview beantworten sollen. Unsere gesellschaftliche Aufgabe besteht also darin, die vertiefte analytische Therapiearbeit mit den Patienten durchzuführen und hin und wieder zu versuchen, etwas davon in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Unser Beitrag – um wieder an die Anekdote zu Ralph Greenson anzuknüpfen, mit der ich dieses Kapitel begonnen habe – kann sich auch darauf beschränken, den Verstand zu behalten und uns selbst daran zu erinnern, dass die Einflusssphäre des Analytikers viel weiter reicht als die acht Patienten, die er täglich trifft. Dem sollte jeder Therapeut Rechnung tragen. Auch wenn Marylin Monroe nicht zu seinem Patientenkreis gehört.
Es würde Ihnen vielleicht helfen, die Debatte über die gesellschaftliche Rolle des Analytikers in einem breiteren Zusammenhang zu sehen, wenn ich daran erinnere, dass es Jahre gedauert hat, bis die Analytiker begonnen haben, Wesentliches über den Nationalsozialismus oder über die Psychotherapie in totalitären Staaten zu sagen. Über diese Sache wurde weitgehend geschwiegen. Es dauerte also so lange, nicht weil die Psychoanalytiker besonders ängstlich wären, einige sind es wirklich, sondern weil eine schwer überbrückbare Diskrepanz besteht zwischen dem psychoanalytischen Denken und dem, was der Normalbürger von allen möglichen psychologischen Experten zu hören gewohnt ist, Experten, die nicht psychoanalytisch denken, sondern lieber über Gehirnfunktionen reden. Wir haben noch viel Arbeit vor uns mit den Berufskolleginnen und -kollegen. An Seminaren in öffentlichen psychiatrischen Kliniken nehme ich oft mit einem unguten Gefühl teil. Auch in solchen Foren kostet es mich jeweils sehr viel Energie, in psychoanalytischen Begriffen über Trauma, Masochismus, Sucht und Selbstmord zu reden. Vielleicht machen es die Einflüsse der Gehirnforschung und bestimmter kulturell bedingter Denkansätze schwer, in öffentlichen Kliniken psychoanalytisch zu argumentieren und auch verstanden zu werden. In der jetzigen Zeit also mit Erklärungen über archaische Ansteckungsängste vorzupreschen, scheint mir etwas verfrüht.
Wir sollten auch beachten, dass gerade unser Beruf in dieser Zeit nicht ganz ungefährlich ist. Das Image des privilegierten außerirdischen Wesens, das sich in seiner Praxis verkriecht und nicht in der »wirklichen Welt lebt«, Sie kennen es, erfährt in dieser Zeit einen Wandel. Mit anderen Menschen, die uns anstecken können, so nahe zusammenzusitzen – der Psychotherapeut lebt momentan ziemlich gefährlich. Unsere Patienten und ihr Unbewusstes haben unsere starken Angstmomente zweifellos wahrgenommen. Einige von ihnen empfinden eine große Nähe zu uns. Ein Gefühl der Schicksalsgemeinschaft mit dem Therapeuten kann psychotherapeutische Behandlungen begünstigen. Andere, etwa perverse Patienten, missbrauchen diese Nähe. Sie haben uns quasi halbnackt gesehen. Jeder Patient schneidet sich von dieser Notsituation etwas für sich ab. Die größte Gefahr besteht darin, dass wir aufhören könnten zu denken und zu deuten und kein Interesse mehr an Traumdeutung zeigen. Es besteht die Gefahr, dass wir uns nur noch mit der äußeren Realität beschäftigen und damit, wie man mit ihr zurechtkommen kann, dass wir Empathie für die Seiten empfinden, mit denen man sich leicht identifizieren kann und wir ihnen gegenüber empathisch sind. Identifikation, Empathie und Unterstützung spielen in der analytischen Psychotherapie bekanntlich eine wichtige Rolle, doch unsere Fachkompetenz liegt darin, Empathie gegenüber den Seiten und seelischen Bereichen zu zeigen, denen der Patient und die Gesellschaft generell nur schwer Empathie entgegenbringen können. Diese Aufgabe, »das betäubende Gefühl der Realität« (Bion, 1961, S. 108) zu widerstehen, nimmt uns niemand ab.
Der öffentliche Raum ist voll von Projektionen. Bereits jetzt ist die Luft meiner Meinung nach stärker von Projektionen als vom Virus belastet. Und diese Projektionen werden uns noch lange begleiten, auch nachdem ein Impfstoff entwickelt sein wird oder nachdem das Virus verschwinden und die Pandemie enden wird. Nicht ohne Grund habe ich unser Gespräch heute mit dem Miasma, der schlechten Atmosphäre im öffentlichen Raum, eröffnet. Es ist nicht nur das Virus, sondern es sind unsere Projektionen darüber, die den Raum verunreinigen und uns, unser Seelenleben gefährden. Es erwartet uns viel Arbeit bei der Entgiftung des öffentlichen Raums von den Projektionen, bis wir uns in ihm wieder sicher fühlen.
10. April 2020
2
Unbewusst
Zu den Besonderheiten des unbewussten Systems • Wie heilt die Analyse und können Gefühle unbewusst sein? • Was sind Deckerinnerungen? • Zur Aufregung, die die Begegnung mit der Therapeutin außerhalb des Behandlungszimmer bewirkt • Über die Pünktlichkeit und einen Patienten, der sich weigerte, von der Couch aufzustehen, als der Raketenalarm ertönte • Meine Gedanken zur Psychoanalyse und zur Gehirnforschung • Erinnern wir uns an ein schönes Diktum von Nietzsche, das die Therapeuten kennen sollten
Eines Tages fuhr ich in einem Gemeinschaftstaxi durch die Stadt. Ich sitze da und bin in meine Gedanken versunken. Neben mir, zwei Sitze weiter, sitzt jemand, der mich anschaut, und ich erwidere seinen Blick mit verträumten Augen, da fällt bei uns beiden der Groschen. Hey, das ist ja mein Analytiker! Das war ganz wie eine Szene aus einem Traum. Er brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, dass er neben seinem Analytiker sitzt und ich ebenso, um zu merken, dass das der Patient ist, den ich schon einige Jahre mehrmals pro Woche treffe. Jeder von uns brauchte den Blick des Gegenübers, um ihm zu bestätigen, dass wir uns schon kennen. Wir nickten einander zu, doch diese Begegnung hatte eine komplett träumerische Qualität. Als würden wir im engen Gemeinschaftstaxi etwas von der Art der Begegnung des Bekannten-Unbekannten fortsetzen, die wir damals in der Analyse durchführten.
Einmal angenommen, Sie hätten sich für den Kurs »Einführung in die Psychoanalyse« eingeschrieben, den Freud im Winter 1915 in der Universität Wien gab. Sie wären in den Genuss von 28 spannenden Vorlesungen gekommen, die sich über zwei Semester erstreckten. Der Dozent hätte Ihnen Schritt für Schritt eine kohärente Theorie des Seelenlebens vorgestellt. Erst in der 22. Vorlesung wären Sie zum ersten Mal dem Begriff »Libido« begegnet. Vorher hätten Sie von Phänomenen gehört wie Traum, Fehlleistungen und hysterischen Symptomen, deren Erklärung sich nur zweier Begriffe bedient – »seelischer Konflikt« und »Unbewusstes«. Freud widmete in dieser Vorlesungsreihe, die später unter dem Titel Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1916–17a) bekannt wurde, drei Monate lang Vorlesungen über die Traumtheorie. In diesem Kurs hätten Sie fast nichts von Libido, Sexualität oder Übertragung gehört. Zum Beispiel in der 22. Vorlesung hätte Ihnen Freud von einigen heiß umstrittenen Punkten auf dem Feld der Psychoanalyse berichtet und Ihnen geraten, die theoretischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Wissenschaftlern nicht allzu ernst zu nehmen. Es handle sich zumeist um leere Debatten, die zu keiner Erkenntnis führten, weil sie darauf begründet seien, dass jeder sich nur einen Teil der Wahrheit aussuche und diesen vehement verteidige. Freud hätte Ihnen etwas Geschichte der von