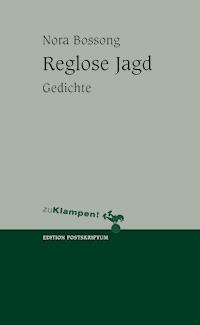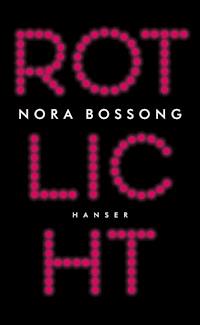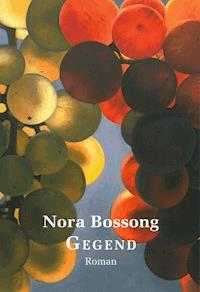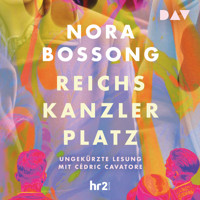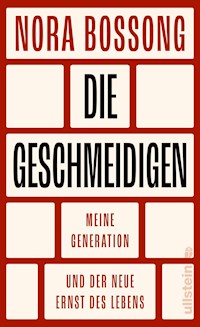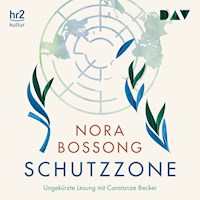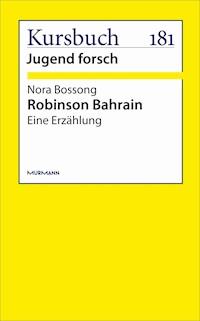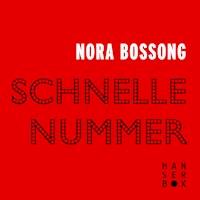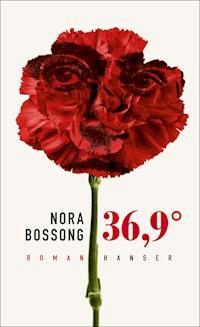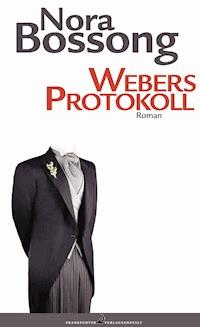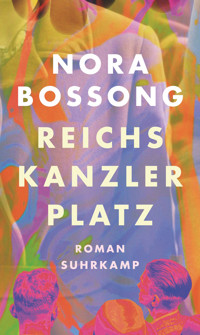
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein furchtloser Roman über Mittäterschaft und darüber, wie aus dem kleinen Bösen das große Böse wächst. Kann man denn über das ›Dritte Reich‹ erzählen? Die Frage wird oft gestellt, nicht zu Unrecht. Nora Bossong beantwortet sie mit diesem großartigen Buch, indem sie es tut – vielschichtig, besonnen und erbarmungslos.« Daniel Kehlmann
Als Hans die junge und schöne Stiefmutter seines Schulfreunds Hellmut Quandt kennenlernt, ahnt er noch nicht, welche Rolle Magda in seinem Leben spielen wird, für ihn persönlich, aber auch Jahre später als fanatische Nationalsozialistin und Vorzeigemutter des »Dritten Reichs«. Noch ist die Weimarer Republik im Aufbruch und Hans so heftig wie hoffnungslos in Hellmut verliebt. Doch nach einem Unglücksfall beginnen Hans und Magda eine Affäre, von der sie sich Trost und Vorteile versprechen: Sie will aus ihrer Ehe ausbrechen, er seine Homosexualität verbergen. Erst als Magda Joseph Goebbels kennenlernt und der NSDAP beitritt, kommt es zwischen Hans und ihr zum Bruch. Während Magda mit ihren Kindern bald in der Wochenschau auftritt, gerät Hans zunehmend in Gefahr. Ein Roman, der über zwanzig Jahre den Weg zweier Menschen und eines Landes erzählt, der nicht unausweichlich war.
Nora Bossong zeichnet in ihrem neuen Roman das intensive Porträt der Frau, die Magda Goebbels wurde, und ihres jungen Liebhabers. Zwei Menschen in der Maschinerie der historischen Ereignisse, unterschiedlich verstrickt, unterschiedlich schuldig geworden. Auch an sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Nora Bossong
Reichskanzlerplatz
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2024.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung eines Motivs von picture alliance/Fotoarchiv für Zeitgeschichte (Köpfe) und eines Motivs von Midjourney (Hintergrund)
eISBN 978-3-518-78023-7
www.suhrkamp.de
Motto
Was Ihr seid – das waren wir
Was wir sind – das werdet Ihr
Schriftzug beim Friedhof Pritzwalk
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
1919
-
1927
Madame Quandt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
1927
-
1931
Reichskanzlerplatz
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1933
-
1938
Die erste Frau
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
1943
Geordnete Verhältnisse
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Juli
1944
Was wir sind
I
II
III
IV
Quellen
Informationen zum Buch
Reichskanzlerplatz
Bitte schreiben Sie uns
Ihre Meinung per E-Mail an
oder per Post an den
Suhrkamp Verlag, Torstraße 44,
10119 Berlin
Sie sind damit einverstanden,
dass Ihre Meinung ggf. zitiert wird.
Leseexemplar
Bitte keine Rezensionen vor dem 10.08.2024
1919-1927
Madame Quandt
I
Lange hatte ich keine Vorstellung vom Tod. Die Geschichten, die meine Eltern mir als Kind erzählten von Wolken und Engeln und Flammen und Teufeln, blieben mir so fern, dass ich nicht einmal Angst davor hatte. Vielleicht, weil meine Großeltern schon vor meiner Geburt gestorben waren, konnte ich die Bedeutung dieses vollkommenen Verlusts einfach nicht verstehen, und dass mein Vater am Ende meines ersten Schuljahrs einige Tage lang nur noch zart mit dem Leben verbunden gewesen war, hatte meine Mutter gewissenhaft vor mir verborgen.
Auch das, woran ich heute denke, ist wohl nicht mehr als eine Hilfskonstruktion. Ich denke an Hellmuts Mutter. Sie starb kurz nach dem Krieg an der Spanischen Grippe, und ich habe sie nie kennengelernt. Hellmut kam erst einige Monate später in unsere Klasse, blass und schmal, als sei er selbst erkrankt. Der Tod seiner Mutter war das Erste, was wir über ihn wussten, das Zweite war, dass sein Vater ein großes Unternehmen führte, und in der Pause wurden wir von unserem Lehrer geschickt, ihm unser Beileid auszusprechen, man wusste nicht so recht ob für das eine oder das andere.
Meiner Mutter imponierte der Name der Familie, obwohl mein Vater meinte, im Generalstab habe noch nie jemand von einem Quandt gehört. Sie drängte mich, auch einen Kondolenzbrief zu schreiben, aber auf dem Papier fand ich keine passenden Worte. Hellmuts Mutter war ja nicht fürs Vaterland gestorben, wie einige Väter, die aus dem Krieg nicht zurückgekommen waren, ihr Tod ergab überhaupt keinen Sinn. Das schrieb ich und zerriss das Blatt wieder, es klang wie ein Vorwurf.
Ich zeigte Mutter den zugeklebten und adressierten Umschlag mit dem schwarzen Trauerrand, und sie schickte mich mit fünfzehn Pfennig fürs Porto los. Draußen warf ich den leeren Umschlag in einen Mülleimer. Vom Geld wollte ich eine Rippe Schokolade kaufen, zögerte aber und ließ es später einem der Kriegsinvaliden in seinen Blechtopf fallen. Ich dachte, so käme ich vielleicht mit dem Gewissen davon.
Trotzdem vermied ich es, mit Hellmut allein zu sein. In der Turnumkleide gehörten wir beide zu den Langsamsten. Waren nur noch drei oder vier Jungen in dem nach Talkumpuder und Kinderschweiß müffelnden Raum, dachte ich, die anderen könnten mich mit Hellmut zurücklassen. Sagte ich dann nichts, wäre es, als würde ich mein eigenes Versäumnis gutheißen; sagte ich etwas, erinnerte ich Hellmut wieder an den Verlust seiner Mutter. Je länger die Zeit der Kondolenz vorbei war, bald sechs Monate, dann schon mehr als ein Jahr, desto peinlicher wurde es. Ich verließ die Umkleide meist mit offenen Schnürsenkeln.
Dann kam die Woche nach den Osterferien, Hellmuts Ankunft am Arndt-Gymnasium jährte sich zum zweiten Mal, und obwohl ich erst zwölf war und von Politik nichts verstand, spürte ich die Hitzigkeit auf dem Schulhof. Kurz vor den Feiertagen hatten die Kommunisten mit Schusswaffen und Sprengstoffanschlägen einen Umsturz versucht. Reichspräsident Friedrich Ebert hatte den Ausnahmezustand verhängt, und fast zweihundert Menschen waren bei den Unruhen erschossen worden. Ich dachte wieder an den Tod und wie absurd und endgültig er sein musste.
Als Hellmut sich im Unterricht zu mir umdrehte, fühlte ich mich unwohl. Ich riss ein Blatt Papier aus meinem Heft und schrieb den Kondolenzbrief. Es ging mit einem Mal ganz leicht. Ich schrieb, dass ich ihm schon lange hatte schreiben wollen, aber nicht die richtigen Worte gefunden hätte. Ich schrieb, dass es die richtigen Worte vielleicht gar nicht gäbe, er aber dennoch wissen solle, dass mir seine Trauer nicht egal gewesen sei. Ich hätte sie ihm gern etwas leichter gemacht und zugleich gewusst, dass das nicht möglich war.
In der Pause ging ich auf ihn zu. Er sprach mit zwei Jungen aus einer höheren Klasse, die wie er unter der Woche als Internatsschüler im Haus Wettin wohnten, und sah sich nur unwillig zu mir um. Ich sagte, es täte mir leid, und reichte ihm den Zettel.
Natürlich verstand er nicht, was ich meinte, es war ja schon so lange her. Die beiden Älteren feixten, und meine Ohren liefen heiß an. Dann, wie um mich zu retten, klarte sich Hellmuts Gesicht auf, und er versicherte mir, es sei nicht so schlimm, sie wären schließlich im Skiurlaub gewesen, und wir könnten an einem anderen Tag den Lernstoff nachholen. Er wandte sich wieder ab, ich aber blieb hinter ihm stehen und sagte halblaut: Morgen?
Nein, Sonntag, gab er zurück, und wohl nur, um mich loszuwerden, fügte er hinzu: Da bin ich zu Hause.
II
Später habe ich mich gefragt, warum er die Verabredung nicht einfach zwischen zwei Unterrichtsstunden wieder auflöste. Vielleicht hielt er es für abwegig, dass ich wirklich vor der Villa seines Vaters stehen könnte. Damals dachte ich darüber nicht nach, sondern berichtete meiner Mutter davon wie von einer guten Note. Sie legte mir meinen besten Anzug raus und gab mir Geld für Blumen. Aber keine Rosen, schärfte sie mir ein, und am Sonntag überreichte ich Hellmuts Stiefmutter einen Nelkenstrauß. Ich wusste noch nicht, dass sie als Kommunistenblumen galten, und seine Stiefmutter ließ sich nichts anmerken. Mir fielen ihre großen, kühlen Augen auf, und ihr Gesicht erinnerte mich an die Marmormadonna, die ich auf einer Florenzreise mit meinen Eltern gesehen hatte.
Weil sie so gut Französisch sprach, nannte Hellmut sie Madame Quandt. Mutter werde ich nicht zu ihr sagen, damit du es weißt. Mir schien Mademoiselle passender, aber das ging natürlich nicht, schließlich war sie verheiratet, und auch noch mit dem Herrn des Hauses. Vor drei Monaten hatte die Hochzeit stattgefunden. Sie war keine sieben Jahre älter als Hellmut. Im November würde sie zwanzig werden; wir hatten April.
Hellmut führte mich in seinem Zimmer an den Regalen vorbei, in denen sein Spielzeug wie in einem Kaufhaus ausgestellt war. Kaum etwas sah benutzt aus. Er sei jetzt natürlich zu alt dafür, erklärte er und nahm eines der Modellautos herunter. Aber wir könnten hinausgehen und die Autos im See versenken. Das würde Madame Quandt verlegen machen, weil sie nicht wusste, ob sie ihn ausschimpfen dürfe.
Ich folgte ihm gehorsam und zerschlug den Romano-Rennwagen auf dem Parkweg. Die Felge splitterte, und ein Gummirad rollte in den Rasen. Als ich aufblickte, bemerkte ich, dass der April hier bereits wie Frühsommer aussah. Die Bäume blühten violett und purpur, und die Rabatten waren mit sternblättrigem Blau überzogen. Dahinter, auf dem sandigen Babelsberger Grund, stand die Villa mit ihren zahllosen Fenstern und Dachvorsprüngen, sauber, leblos und monströs.
Mein Brief sei seltsam gewesen, sagte Hellmut und trat nach dem Romanowagen. Eigentlich kitschig. Ich sah auf die Rauten der Wegplatten und wollte mich entschuldigen, aber Hellmut fuhr fort: So sei man nicht in Kondolenzbriefen. So ehrlich. Da logen die Leute vor lauter Hilflosigkeit noch mehr als sonst. Vielleicht, fügte er hinzu, habe es ihm gefallen, aber sicher sei er sich nicht.
Am Ufer zeigte er mir, wie man mit einem Käscher nach Fröschen jagte. Mit einer schnellen Bewegung aus den Schultern ließ er das Netz ins Wasser dippen. Ein Frosch blieb zappelnd hängen, und Hellmut hielt ihn mir vors Gesicht. Das Tier spreizte seine schlangenhaften Beine und glotzte mich an. Ich fand hübsch, wie Hellmut lachte, auch wenn vielleicht etwas Bösartiges darin lag. Dann verlor er das Interesse an dem Tier, warf es ins Gebüsch und stocherte mit dem Stiel des Käschers im Froschlaich, bis die kleinen Blasen über den See trieben.
Weißt du, wie sie früher hieß?, fragte er unvermittelt, und ich kann nicht mehr sagen, woher ich den Namen kannte, aber ich antwortete: Ich dachte, Ritschel.
Hellmut lachte, wie er über den Frosch gelacht hatte.
Davor, sagte er.
Ich verstand nicht, was er meinte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Madame Quandt schon einmal verheiratet gewesen und bereits Witwe war. Natürlich war durch den Krieg vieles möglich, Madame Quandt konnte mit sechzehn die Nachricht erhalten haben, dass ihr Mann gefallen war, aber es passte nicht zu meinem flüchtigen Bild von ihr, das mir rein und schwebend erschien wie das der Jungfrau Maria.
Davor hieß sie Friedländer, sagte Hellmut.
Ist sie Jüdin?, fragte ich.
Ihr Stiefvater ist Jude, und einen besseren Namen hat sie nicht abbekommen. Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: Wir haben nichts gegen Juden, aber in der eigenen Familie muss es ja nicht sein. Die Leute reden. Und wir müssen eben immer auch an die Geschäfte denken.
Er sah in diesem Moment älter aus, wie ein kleiner Erwachsener, und ich stellte mir vor, wie er mit Zigarre und Cognacschwenker in einem Chesterfield-Sessel saß und mit der Glut aufs Fenster wies. Jahre später, als ich von Quandts Übernahme der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik hörte und dann auch vom Bau der Baracken auf dem Betriebsgelände der AFA, habe ich wieder an dieses Bild von Hellmut mit Zigarre denken müssen, und ich habe mich gefragt, ob er es wohl anders gemacht hätte als sein Vater und sein Bruder.
Er erzählte noch etwas von Madame Quandt, dass sie in einem katholischen Internat aufgewachsen war, bei Nonnen, die sie von morgens bis abends hatten knien und beten lassen, und dass sie mittlerweile protestantisch war wie alle in der Familie Quandt. Sie wechselt so oft ihren Namen und ihren Glauben, sagte Hellmut, was weiß ich, was sie in Wirklichkeit ist. Vermutlich kann sie das nicht mal selbst sagen. Weißt du, sagte er leise, Mama hätte gemerkt, dass Madame Quandt auch unseren Namen nur wie eine Maske trägt.
III
Aufgewachsen bin ich in einer heilen Welt. Das zumindest habe ich während meiner Kindheit geglaubt. Sie erstreckte sich auf 230 Quadratmetern, die vom Geruch frischen Kakaos und alten Flieders durchflutet und nach oben hin von Stuck begrenzt waren. Meine Mutter liebte französische Romane und mein Vater das Knistern des Plattenspielers. Den meisten meiner Klassenkameraden hatten die Kriegsnachrichten die Väter ersetzt, und selbst als später einige dieser Väter zurückkehrten, füllten sie die Familien nicht mehr auf. Außer in den wenigen Wochen zum Ende meines ersten Schuljahrs hatte mir nie jemand gefehlt.
Überall in der Wohnung fanden sich Fotografien von Vater in Offiziersuniform, und manchmal dachte ich, dass sie nicht das Abbild von Vater wären, sondern Vater das Abbild der Fotografien. Über dem Ehebett meiner Eltern hing ein Porträt von Wilhelm II. mit Pickelhaube und im Salon ein Foto meiner Großeltern, das letzte Zeichen der vorangegangenen Generation. Das Sepia war schon so vergilbt, dass ich nur noch den dunkelhaarigen Dackel in der Mitte des Bildes gut erkennen konnte. Er hieß Waldemar und gehörte wie alles auf dieser Aufnahme bereits der Geisterwelt an.
Auf dem Boden des Berliner Zimmers erwachte er zu neuem Leben, denn meine Eltern hatten mir zum fünften Geburtstag einen Stoffhund geschenkt, der lange Jahre nicht von meiner Seite wich. Das Berliner Zimmer war Annies Reich, und es besaß nur ein einziges, kleines Fenster. Selbst im Sommer brannte elektrisches Licht, unter dem unsere Zugehfrau summend bügelte und nähte und sich von mir mit den Holzschienen meiner Eisenbahn einzäunen ließ. Aus ihren Stoffresten baute ich Waldemar ein Körbchen und las ihm aus meinen Kinderbüchern vor, was ich, als ich das Alphabet noch nicht vollständig beherrschte, halb aus meiner Erinnerung, halb aus meiner Fantasie heraus tat. Neben dem Zimmer stand eine Kammer leer, in der ich Fundstücke für Waldemar hortete, was auch immer er mit Paketschnur, Eicheln, einer zerbrochenen Wäscheklammer anfangen sollte. Niemand sagte mir, dass die Kammer eigentlich für mein Geschwister gedacht war, das nie auf die Welt gekommen ist.
Abends erkundigte Vater sich nach meinen Spielen mit einem Ernst, als nähme er sie ebenso wichtig wie die Arbeit an seinem Schreibtisch, und erst später habe ich verstanden, dass auch sie nichts anderes als Kinderspiele eines Erwachsenen war. Morgens um acht Uhr bezog er seinen Platz hinter dem gewaltigen Kirschholzschreibtisch seines Arbeitszimmers. Dort thronte er neun Stunden und studierte Zeitungen, Schachpartien, historische Schlachtpläne, nur unterbrochen von den Mahlzeiten, um zwölf Uhr Mittagessen, um halb vier Tee mit Bisquit. Vater liebte die Pünktlichkeit, denn sie war alles, was ihm von seiner militärischen Laufbahn geblieben war. Draußen wütete der Weltkrieg, und hier drinnen spielten zwei Jungen einen Alltag nach, der nicht mehr oder noch nicht ihrer war.
Vaters eigentliches Leben hatte vor meiner Geburt stattgefunden, und es schien mir so geheimnisvoll und aufregend wie die Abenteuer in den Heftchenromanen, die ich meinen Eltern hin und wieder abtrotzte. Es spielte im Jahr 1900, und es gab darin Boxer und eine Kaiserinwitwe namens Cixi, die ich mir von Seidenbahnen wie von einem Kokon umschlossen vorstellte, während die Boxer vor meinem inneren Auge wie eine Armee aus unzähligen Jack Johnsons in den Ring stiegen, um Weltmeisterschaft nach Weltmeisterschaft zu gewinnen.
Vater hatte damals das deutsche Kaiserreich in China verteidigt, und das hatte ihn zwei Finger der rechten Hand gekostet. Mutter liebte es nicht, wenn er von dieser Zeit erzählte, bestimmt, dachte ich, weil sie damals noch keinen Anteil an seiner Geschichte hatte und es jemand anderes an seiner Seite gegeben haben musste, ich kannte nicht einmal einen Namen.
Auch ich wollte General oder wenigstens Boxer werden, doch meine Eltern hielten nichts davon. An einem Märzmorgen im Jahr 1915, an dem Vater in einem Lazarettbett an sich heruntergesehen und die Vögel draußen dazu zwitschern gehört hatte, war mein Schicksal besiegelt worden. Ich sollte Diplomat werden, und deshalb fuhren wir im Sommer nach Nizza, Lausanne oder Florenz, wo meine Eltern mich mit der Schönheit gotischer Kirchenfassaden und der Weite des Mittelmeers vertraut machten und später, als ich aufs Gymnasium ging, ein Privatlehrer mich in Französisch und Italienisch unterrichtete. Meine Eltern warteten in Cafés auf mich, umgeben von Springbrunnen, Karyatiden und eleganten Kellnern, bis ich ihnen am Nachmittag meine Fortschritte Wort für Wort berichtete. Sogar das Porträt des Kaisers wich einer Vedutenmalerei des Ponte Vecchio, kurz nach der Abdankung des Monarchen.
Englisch sollte ich ebenfalls lernen, aber Vaters Rheuma verhinderte einen längeren Aufenthalt auf den Britischen Inseln, obwohl ich glaube, dass es in Wahrheit an Mutter lag, die nicht auch noch den Sommer im Regen verbringen wollte. Überhaupt diente Vater ihr häufig als Vorwand. Wenn sie eine Einladung von Bekannten, deren Einfallslosigkeit und zähe Abendgestaltung sie tagelang beklagte, schließlich mit Verweis auf Vaters Gesundheit absagte, schwang doch ein leiser Vorwurf mit, und Vater spielte folgsam die Rolle des schuldigen Kranken, galt ihm ja Gehorsam ohnehin als die oberste Tugend.
Einmal trafen wir auf einem Spaziergang Vaters früheren Adjutanten Faulberger, der mittlerweile Major im neugegründeten Reichswehrministerium war. Sie unterhielten sich über den einstigen Frontverlauf in Frankreich, über Generalfeldmarschall Mackensens Triumph in der Schlacht bei Tannenberg, und Vater erläuterte, was aus seiner Sicht seit dem Versailler Vertrag nötig war. Nach wenigen Sätzen unterbrach Major Faulberger ihn in sanftem Ton.
Mit Verlaub, Herr General, Sie reden von einer anderen Armee. Von der heutigen verstehen Sie nichts mehr.
Vater sah ihn konsterniert an. Mehr, als Sie denken, entgegnete er. Ich habe noch alle Sinne beisammen.
Als wir weitergingen, kamen wir an einem Hoftor vorbei, durch das monoton metallisches Hämmern drang. Vater starrte auf die drei Männer, die rittlings auf einer Kanone saßen und dabei waren, sie zu zerlegen. Er zog eine Miene, von der ich nicht sagen konnte, ob sie bestürzt oder belustigt war. Im nächsten Moment hatte er sich wieder unter Kontrolle und nickte im Takt der Hammerschläge. Das ist schon richtig, erklärte er. Mindestens folgerichtig.
Später, als wir wieder daheim waren, beobachtete ich vom Berliner Zimmer aus, wie er im Flur den Garderobenschrank öffnete. Minutenlang stand er dort reglos vor seiner alten Uniform, dann streckte er die Hand aus und fuhr über die Schulterstücke. Damals schien mir sein Blick leer, heute aber meine ich jene verwunderte Trauer darin zu erkennen, mit der man einem Menschen nachsieht, von dem geliebt worden zu sein man einmal irrtümlich geglaubt hat. Als Schritte im Salon zu hören waren, schloss er die Tür schnell und lautlos und stützte sich mit den Fäusten auf die Anrichte. Im Salon schlug die Pendeluhr sechs Mal, und ich dachte zum ersten Mal, wie stickig und still es bei uns doch war.
IV
Natürlich weiß ich es nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, dass es Madame Quandts Wunsch war, mich wieder in die Villa einzuladen. Es war Ende Mai, und als sie im Entree auf mich zukam, um den Strauß entgegenzunehmen, diesmal Pfingstrosen, lächelte sie, als habe sie sich seit Tagen auf diese Blumen gefreut.
Ihr Gesicht war heiterer, ihre Augen leuchteten, und war sie mir im April noch vor der Kulisse der Empfangshalle erschienen wie ein Bild, das man aus einer Illustrierten ausgeschnitten hatte, nahm sie jetzt vom Raum um sich Besitz. Eigentlich kann es kaum sichtbar gewesen sein, es war ja noch fast ein halbes Jahr bis zu Haralds Geburt, und doch erinnere ich, seit diesem Tag gewusst zu haben, dass sie schwanger war. Es war, als habe sie mit dem Fötus, der sich in ihrem Bauch eingenistet hatte, in diesem Haus Halt gefunden, eine Berechtigung, zu bleiben.
Die Fenster des Salons gingen zum See. In die Kälte aus verchromten Möbeln hatte jemand drei Fotografien eines einfachen Dorfs gehängt. Das war Pritzwalk, der Geburtsort des Quandt’schen Vermögens. Madame Quandts Seidenkleid nahm sich davor exotisch aus. Es war wie ein Kimono in der Taille gebunden, und ihre Bewegungen darin wollten unbedingt Dame sein. Sie zeigte eine gütige Strenge, während sie die Anordnung des Kaffeeservice begutachtete, und zugleich schien noch das Mädchen durch, das gerade erst die Schule verlassen hatte.
Sie musste so etwas wie eine Schauspielerin sein. Das dachte ich nicht, weil sie so schön war wie die Frauen auf der Leinwand. Natürlich war sie auch das, aber dafür hatte ich keinen Sinn, obwohl ich schon fast dreizehn war. Ich betrachtete Frauen noch immer unbefangen wie ein Kind, und vielleicht sah ich deshalb, dass Madame Quandt eine Rolle spielte, während die anderen ihre Augenfarbe, changierend zwischen Grau und Eisblau, ihr dickes blondes Haar, ihr ebenmäßiges Gesicht bemerkten und hingerissen waren.
An der Kaffeetafel saß Hellmuts jüngerer Bruder Herbert mir gegenüber. Wegen eines Sehfehlers ging er seit einem Jahr nicht mehr in die Schule, sondern bekam Privatunterricht, und seine Zukunft hatte Herr Quandt bereits auf einem Gutshof eingerichtet, oben in Mecklenburg, weit weg von Berlin. Herbert konnte keine Farben unterscheiden, und ich sah verstohlen auf seine Augen, die mir wässrig, ja verquollen vorkamen. Je länger ich beobachtete, wie sie unter den Lidern träg hin und her wanderten, desto mehr schien mir, als verbliche auch für mich der Raum. Er verlor an Tiefe, und die Umrisse der Möbel und Menschen traten schärfer hervor. Wie anders Herbert zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem unterscheiden musste, dachte ich fasziniert, wie genau er wohl manches ausmachen konnte, gerade weil anderes für ihn nicht zu sehen war.
Die Stille, mit der man hier seinen Tee trank und dabei die prächtige Aussicht auf den See ignorierte, schüchterte mich ein. Ich blickte auf die Fotografien an der Wand und sagte mir, dass mein Vater immerhin schon mit Adligen und Ministern und mit adligen Ministern Umgang gehabt hatte, und wenn meine Familie zwar durch das fehlende Millionenvermögen von den Villenvororten getrennt war, so hatten wir doch seit Generationen unseren sicheren Platz in der Berliner Gesellschaft, anders als die Quandts aus Pritzwalk.
Als Madame Quandt mich fragte, ob mein Vater auch so viel auf Reisen sei wie ihr Mann, erzählte ich ihr von dem Orden. Vater hatte ihn als Entschädigung für die beiden Finger erhalten, die noch in Peking lagen. Das war im letzten Jahrhundert gewesen, vor meiner Geburt, und ich hatte Sorge, sie könnte es für etwas Belangloses halten. Seit dem Weltkrieg war das Eiserne Kreuz ja fast so gewöhnlich wie Zeige- und Mittelfinger der linken Hand, und die Invaliden saßen auf der Straße vor ihren Blechschalen, das Kreuz an ihren Lumpen, und warteten darauf, dass ein Schuljunge mit dem Klirren fallender Münzen Ablass für irgendeine Feigheit kaufte.
Ich suchte nach dem Namen von Vaters Orden, aber er fiel mir nicht ein. Madame Quandt muss mir meine Unruhe angemerkt haben. Sie beugte sich zu mir herüber und berührte meinen Arm. Ihre Hand war warm und trocken, und ich hätte mir gewünscht, sie ruhte dort ein wenig länger. Pour le mérite?, fragte sie in elegant tänzelndem Französisch, und zum ersten Mal schien mir, dass sie keine Rolle spielte, sondern wirklich sie selbst war.
V
Mehr als die Größe und der Reichtum beeindruckte mich an Hellmuts Zuhause, dass alle so jung waren. Meine Eltern waren alt, sie redeten alt, sie rochen alt, und auch wenn mir Annie einzureden versuchte, dass es nur das Fliederparfum war, das mein Vater über Gebühr benutzte, so konnte sie doch nicht hinreichend erklären, warum ich keine Großeltern mehr hatte und weshalb mein Vater das Haus nicht verließ, um zur Arbeit zu gehen wie die Väter meiner Klassenkameraden, jene zumindest, die noch am Leben waren. Natürlich, es hinderte ihn seine versehrte Hand, aber so ganz ließ es sich damit nicht begründen.
Vielleicht lag es auch an Neuve-Chapelle. Vater war von dort im März 1915 zurückgekehrt und für den Rest des Krieges beurlaubt worden. Seither verabscheute er den Krieg, und mehr noch verabscheute er den Frieden, in dem man die Versehrten bemitleidete, und im Stillen verabscheute er womöglich auch Mutter, die so tat, als habe sich nichts verändert. Sie war eine zarte Frau, von der Annie behauptete, dass sie an einem zweiten Kind gestorben wäre. Meinem Geschwister aber war die Granate von Neuve-Chapelle zuvorgekommen, die so gesehen Mutters Leben gerettet hatte. Das war alles, was man Gutes über die Granate von Neuve-Chapelle sagen konnte.
Einmal sah ich durch die angelehnte Badezimmertür Vaters Kraterlandschaft. Er saß auf einem Schemel, und Mutter hockte vor ihm und fuhr mit einem Lappen über die sehnig verkohlte Haut seiner linken Hüfte. Er stank, sogar von der Tür aus konnte ich es riechen, nach zwanzig Minuten im Lavendelbad stank er noch immer, er würde sein Lebtag nicht mehr aufhören zu stinken, und ich hörte ihn sagen, wie unbarmherzig die deutschen Schwestern gewesen waren mit ihren wippenden Hauben und dem roten Kreuz auf ihrer Brust, die ihn im März 1915 gerettet hatten. Mutter kämpfte seither mit seinem mächtigen Körper, und mehr als sie kämpfte Vater damit, und ich erschrak, als mir bewusst wurde, was er sich gerade gewünscht hatte.
Nach Neuve-Chapelle, den Schwestern und der drei Jahre später folgenden Niederlage wollte Vater den Kaiser nicht zurück, vielleicht verabscheute er insgeheim auch ihn. Wir waren liberal-konservativ, was bedeutete, dass Vater General Ludendorff so wenig wie den Sozialdemokraten über den Weg traute. Er wählte Stresemann und die DVP und erläuterte bei unseren Sonntagsspaziergängen im Grunewald seine Gründe, nach denen weder Mutter noch ich gefragt hatten.
Gerade in einer Zeit, in der vieles im Umbruch, wenn nicht bereits zusammengebrochen sei, komme es auf Kontinuität ebenso wie auf Erneuerung an, belehrte er uns. Ein wenig Zentralismus war aus seiner Sicht unerlässlich, um ein stabiles Ganzes zu erhalten, und ein wenig Wahlrecht schadete nicht, solange jene, die es wahrnahmen, etwas von den Dingen verstanden. Er schritt erhobenen Hauptes ein Stück vor uns her, seine acht Finger hinter dem Rücken verschränkt. Ob er der Ansicht war, dass meine Mutter etwas von den Dingen verstand, blieb offen. Sicher kam ihm nicht in den Sinn, sie könnte etwas anderes wählen als er, und er hatte auch nicht ihre verschlagene Miene bemerkt, als sie zum ersten Mal aus einer Wahlkabine getreten war.
Vater betonte, er stünde der neuen Regierungsform aufgeschlossen gegenüber, oder wie er sagte: gehorsam interessiert, aber er lebte doch eigentlich in der Zeit vor dem Weltkrieg, als es noch einen Generalfeldmarschall und deutsche Kolonien gegeben hatte und man den wichtigsten Mann im Staat beim Vornamen kannte wie einen wirklichen Herrscher und nicht wie einen Büroangestellten als Herrn Soundso, der kurz darauf von einem anderen Herrn Soundso ersetzt wurde. Die Kolonien waren nun dem Völkerbund unterstellt, Wilhelm II. trug einen Vollbart und lebte in den Niederlanden, und die Hierarchie endete mit zwei Sternen auf den Epauletten. Mein Vater bewertete all das als richtig oder doch zumindest als folgerichtig. Die Kaisertreuen nannte er zurückgeblieben, die Völkischen waren ihm entschieden zu dumpf. Die Räterepublik wiederum führte ins Chaos, das Chaos kannte nur Armut und Untergang, und sorgenvoll blickte er nach Russland, das ungefähr in Richtung des Biergartens lag, wo ich mir eine Fassbrause erhoffte.
Was für Soldaten gelte, fasste er seine Überlegungen zusammen, das gelte in gewisser Weise auch für Staatsformen. Man müsse zwischen Freund und Feind unterscheiden, aber auch zwischen Verwundeten und Gefallenen. Den Verwundeten versuche man zu bergen, den Gefallenen müsse man im Zweifelsfall zurücklassen, um sich selbst aus der Schusslinie zu bringen. Man habe ihn zu ehren, dürfe aber nicht zu lange um ihn trauern. Man mag es sich anders wünschen, schloss mein Vater, aber Wünsche sind etwas für Geburtstagskarten. An einer gefallenen Staatsform festzuhalten, ist nur etwas für Nostalgiker, und der Tod ist in jedem Fall eindeutig.
VI
Herrn Quandt traf ich ein einziges Mal. Es war Hellmuts vierzehnter Geburtstag, ein knappes Jahr nach meinem ersten Besuch in der Villa, und sein Vater war von seinen wichtigen Tätigkeiten in der Stadt herbeigeeilt, um vor der versammelten Gruppe pubertierender Gymnasiasten einen kurzen Vortrag über Pflicht und Freude zu halten. Sein Kopf war ein weißer, runder Mond, der über einem dunkelblauen Anzug schwebte, distanziert und gutmütig. Er sprach von Textilien, denn die waren der Grund seines Reichtums, der Villa, des grünscheckigen Gartens vor den gewaltigen Fenstern.
Die gesamte kaiserliche Armee, vom einfachen Soldaten bis zum General, vom Heimkehrer über den Versehrten bis zum Gefallenen, ja sogar die Fahnenflüchtigen hatte Herr Quandt ausgestattet, und auch mein Vater war, ehe man ihn wenige Monate nach Kriegsbeginn ehrenhaft in den Ruhestand versetzt hatte, in den Stoff aus der Fabrik Günther Quandt, Pritzwalk, gekleidet gewesen. So genau wie an diesem Nachmittag hatte ich noch nie über den Körper meines Vaters nachgedacht, und es verwirrte mich. Er hatte für mich immer vor allem aus Uniform bestanden, aber dass diese Uniform gar nicht zu Vater, sondern zu Herrn Quandt gehörte, wurde mir erst jetzt klar. Vater selbst begann erst darunter.
Was genau die Freude war, von der Herr Quandt uns berichten wollte, bekam ich darüber gar nicht mit. War es das Geld, oder war es der Umstand, dass ein guter Kaufmann über den Dingen stand, über Sieg und Niederlage, dass für ihn eine verlorene Schlacht immer auch bedeutete, dass neue Uniformen benötigt wurden? Am Ende kam Herr Quandt noch auf Gott zu sprechen und dass der wahre Dienst an ihm das betriebsame Schaffen sei, und dann musste er auch schon wieder los, denn Gott ließ man nicht warten. Er drückte seinem Sohn die Hand, seine Frau überflog er nur wie eine Zahlenkolonne in den Rechnungsbüchern.
Madame Quandt hatte sich an diesem Tag herausgeputzt, ihr flaschengrünes Kleid knisterte leise, wenn sie sich bewegte, dazu trug sie Perlenschmuck und einen schmalen Haarreif, aber das hatte Herr Quandt nicht einmal wahrgenommen. Immerhin der kleine Nestor starrte sie unentwegt an. Eine Weile blickte sie auf die geschlossene Tür, als könne sie darauf das Nachbild ihres Mannes erkennen. Ihr Gesicht verlor die kühle Eleganz, ohne die es offen in seiner Kindlichkeit lag.
Eine Minute seines Vaters koste mehr Geld als das ganze Jahr eines Arbeiters, erklärte Hellmut, und ob wir uns vorstellen könnten, wie es sei, jeden Morgen in solchen Minuten aufzuwachen. Er baue an einem Imperium, und so etwas vertrage keine Verschwendung. Als ich sagte, auch mein Vater habe einmal an einem Imperium mitgewirkt, blickte Hellmut mich belustigt an. Doch nicht mit dem Kaiser, sagte er. Mit Staaten baut man keine Imperien mehr auf.
Früher waren die Geburtstage heiterer, bemerkte die Haushälterin, als sie eine Schale Würstchen hereintrug. Madame Quandt hob nur die Brauen. An so einem Tag merkt man, wie sehr die Mutter fehlt, sagte die Haushälterin leise zu ihr. Sie rückte die Schale auf dem Tisch zurecht und lächelte uns reihum an. Kurz darauf zog Madame Quandt sich lautlos zurück, sogar der Stoff ihres Kleides unterließ es zu knistern.
Als ich etwas später von der Toilette zurückkam und aus Versehen nicht links, sondern rechts in den Flur einbog, sah ich sie hinter einer der verglasten Türen in einem Clubsessel, den nicht sie, sondern wie alles im Haus ihre Vorgängerin oder die Vorgängerin ihrer Vorgängerin ausgewählt hatte. Sie saß so allein, als habe sich die ganze Welt von ihr abgewandt, und ich hätte mich gern zu ihr gesetzt, meine Hand auf ihren Arm gelegt, aber sie war sieben Jahre älter als ich, und auch wenn sie in diesem Moment verletzlich wirkte, sie hätte meine große Schwester sein können, und sie war bereits verheiratet. Sie gehörte dem Kreis der Erwachsenen an, und wir, Hellmut und ich, sein jüngerer Bruder Herbert und all die Jungen im Salon, waren durch einen tiefen, unsichtbaren Wald davon getrennt, der sich in den nächsten Jahren lichten würde, um uns hindurchzulassen, aber niemand konnte so genau sagen, wann.
Madame Quandt blickte auf und sah mich durch die Glasscheibe hindurch an. Ihre Lippen formten ein Wort, aber ich verstand nicht, welches es war. Eilig ging ich den Flur hinunter und gesellte mich wieder zu den anderen. Der Fruchtpunsch wurde gerade in pompösem Kristallglas in den Salon gebracht. Ich dachte nicht weiter über sie nach.
VII
Gern hätte ich damals geglaubt, dass Hellmut und ich Freunde waren, aber insgeheim wusste ich, dass es so weit nicht ging. Hellmut akzeptierte mich, weil es einfacher war, als mich wieder loszuwerden. Wenn ich zusammen mit anderen Jungen zu ihm eingeladen wurde, dann doch nur, weil die Zahl der Gäste noch nicht stimmte, und wenn er mir von einer Spazierfahrt mit seinem kleinen Bruder Harald erzählte, dann wusste bereits die halbe Klasse davon.
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht einmal, ob mir wirklich schon etwas an Hellmut lag. Dachte ich an unsere Treffen, dann faszinierte mich die weitläufige Villa doch mehr als unsere Unternehmungen, und sah ich ihm nach Schulschluss hinterher, interessierte mich vor allem der rote Maybach, der ihn manchmal am Freitag abholte. Es war ein anhaltender Streit zwischen uns Schülern, ob das nun eines der neuartigen Modelle mit Roots-Kompressor war, wie sie bei der Automobilausstellung präsentiert worden waren, und es ärgerte mich, dass auch ich es nicht wusste.
Hellmut verschwand hinter seinem Familiennamen wie das Licht einer Kerze im Laternenschein, und ich meinte, eine größere, bessere Welt zu betreten, wenn ich die von konischen Buchsbäumen gesäumten Stufen der Villa hinaufging. Sobald mich Madame Quandt im Entree empfing, war ich vollständig der Beletage entkommen, in der mein Vater einer alten Zeit nachtrauerte, auch wenn er der neuen gehorsam interessiert salutierte. Es war, als könnte ich durch eine Freundschaft mit Hellmut alles gutmachen, die Kraterlandschaft meines Vaters, das fehlende Geschwisterkind, den Ruhestand meiner Eltern, der im Gleichklang unserer Pendeluhr seine Farben verlor. Und dann kam die Gelegenheit mit Karl.
Karl war der Schüchternste in unserer Klasse. Sein Vater war nicht aus dem Krieg zurückgekommen, ein Stiefvater hatte sich nicht gefunden, und am Wochenende musste er neben seiner Mutter hergehen, als wären sie ein Ehepaar. Während die meisten von uns bereits den Stimmbruch hinter sich hatten, sang er immer noch so hell und rein wie ein kleiner Junge. Darum nannten wir ihn den Eunuchen.
Zuerst benutzten wir den Namen nur, wenn er nicht in der Nähe war, aber am Ende des Schuljahrs waren wir gereizt von den Prüfungen, von den drohenden Noten, den Rügen der Lehrer, und gerade hatten wir auch noch eine Stunde bei Doktor Klausner gehabt. Klausners Oberlippe war immer von Speichel benetzt, und er schmunzelte, wenn er einen von uns nach vorne kommen ließ, um ihn in all seinem Nichtskönnen bloßzustellen. Es war nur Musik, was er unterrichtete, und vermutlich war das sein Problem. Karls Problem war, dass Klausner ihn gerade vor allen gelobt hatte.
Wir standen am nördlichen Rand des Schulhofs und aßen unsere Pausenbrote. Karl kam mit seinem vorsichtigen Lächeln und einer durchweichten Brottüte auf uns zu, und da sagte Caspar, oder vielleicht war es auch Hellmut gewesen, dass der Eunuch im Anmarsch sei. Karl blieb stehen und blickte zu Boden, drei oder vier Schritte von uns entfernt. Er zögerte nur einen Augenblick, aber es fühlte sich endlos an. Dann korrigierte er seine Richtung und ging mit gesenktem Kopf an uns vorbei.
Einer der Aufseher hatte die Sache mitbekommen, und auch wenn es vielleicht doch Caspar gewesen war, fiel der offizielle Verdacht auf Hellmut. In der nächsten Unterrichtsstunde musste er vortreten, und ohne das Wort Eunuch auszusprechen, schwang es peinlich lautlos in jedem Satz unseres Lehrers mit. Wir waren fast erleichtert, als endlich der Rohrstock zum Einsatz kam. Hellmuts Gesicht war bleich, und ich meinte, schon nach dem ersten Schlag Tränen in seinen Augen zu sehen. Ich schaute zu Karl hinüber. Er zog bei jedem Hieb seinen Kopf tiefer zwischen die Schultern.
Gern würde ich behaupten, dass ich Mitleid mit Karl hatte, wenigstens im Nachhinein. Ich bin ehrlich. Er war das schwächste Glied, und ich empfand nichts für ihn, weil die Schwächsten, so wurde es uns beigebracht, nicht dafür da sind, etwas für sie zu empfinden. Sie schweißen uns nur zusammen. Sie machen es uns leichter aufzustehen, so wie ich beim vierten Schlag aufstand und mit hoher, fistelnder Stimme sang: Wenn das meine Mutter wüsste.
Die ganze Klasse, mit Ausnahme von Karl, brach in Lachen aus. Und dann lachte auch Karl, mitgerissen wie ein Stöckchen von der Strömung. Damit endete Hellmuts Bestrafung, wir waren einfach nicht mehr zur Ruhe zu bringen. Später wurden Hellmut und ich zu Direktor Kremmer geschickt, aber es war bloß eine Verwarnung, und als wir danach zu zweit durch die leeren Gänge des Schulgebäudes gingen, boxte er mir anerkennend gegen die Schulter.
VIII
Am Anfang war es nur der Schlag auf den Rücken, mit dem Hellmut mich am Schultor verabschiedete. In den Gesichtern der Umstehenden bemerkte ich einen Ausdruck, den sie mir früher nie zugestanden hatten. Vielleicht war es Anerkennung, vielleicht auch Neid. Bald warf Hellmut mir während des Unterrichts, wenn Doktor Kuffsteiner zu einer langen Exkursion durch den Gallischen Krieg