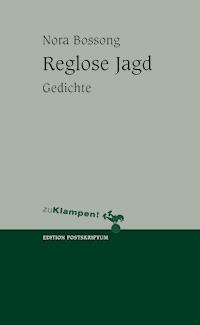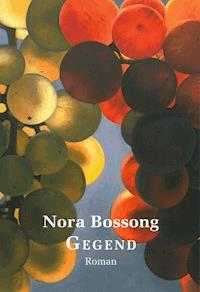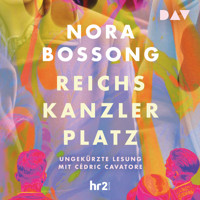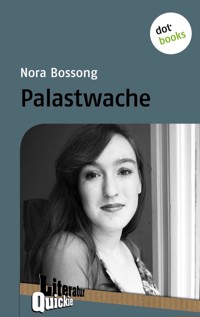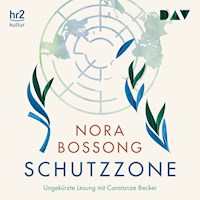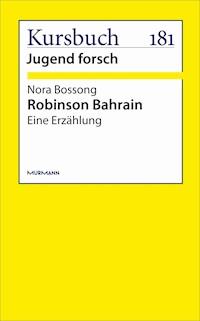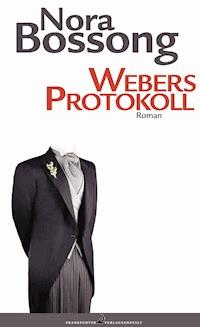
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kunstvoll über mehrere Zeitebenen konstruierter Roman über einen deutschen Diplomaten unter Hitler und in einem Nachkriegsdeutschland, in dem jeder das Vergangene vergessen machen will. Konrad Weber ist stellvertretender Leiter des deutschen Generalkonsulats in Mailand, 1943 eine scheinbar friedliche Enklave, die ihn vor dem Alltag der nationalsozialistischen Diktatur und dem Krieg schützt. Nach der Pensionierung seines Vorgesetzten wird ihm zunächst ein im diplomatischen Dienst unerfahrener, weit jüngerer NS-Gefolgsmann vor die Nase gesetzt. Dieser deckt Unstimmigkeiten in den Rechnungsbüchern auf, die in den Verantwortungsbereich Webers fallen. Wendler, ein Bekannter von Weber, hilft ihm nicht ohne eigenen Vorteil aus der verfahrenen Situation und vermittelt ihm ein riskantes Geschäft. »Der Roman erzielt eine raffinierte Vieldeutigkeit, die sich auch nach wiederholter Lektüre nicht erschöpft. Die Beobachtungs- und Kombinationsgabe der Autorin ist selbst einer Schachmeisterin würdig […].« FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG »Nora Bossong ist die wohl begabteste Erzählerin und Lyrikerin der jüngsten Autoren-Generation und Webers Protokoll ein Roman, dessen historisches und stilistisches Bewusstsein die Bemühungen vergleichbarer Jungautoren blass aussehen lässt.« NEUE ZÜRCHER ZEITUNG »Ein spannender, fulminanter Roman. Die Sprache lebt ungemein, es ist phantastisch, wie viele Stimmen man in Webers Protokoll hört. Ein magischer Roman.« SWR 2
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Widmung
Erster Teil. Zürich, Mailand und andere Orte.
Erstes Kapitel. Bonn.
Zweites Kapitel. Mailänder Normalitäten.
Drittes Kapitel. Vakuum.
Viertes Kapitel. Boten.
Fünftes Kapitel. Devisen.
Sechstes Kapitel. Mohrmann.
Zweiter Teil. Rom, der Vatikan, weiterhin Mailand.
Siebtes Kapitel. Rom.
Achtes Kapitel. Verschuldungen.
Neuntes Kapitel. Kardinalfehler.
Zehntes Kapitel. Frottee.
Elftes Kapitel. Wendler.
Zwölftes Kapitel. Letzte Tänze.
Dreizehntes Kapitel. Ämter und Würden.
Epilog
Nora Bossong
WEBERSPROTOKOLLRoman
1. Auflage 2009
© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH
Frankfurt am Main 2009
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung und Umschlaggestaltung: Laura J Gerlach
Bildquelle: Robert Levin / CORBIS
eISBN: 978-3-6270-2159-7
Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht.
Zarah Leander
Ich stelle mir seine Augen vor an jenem Tag, an dem er überlegt, noch einmal zum Arzt zu gehen, zu sagen: Sehen Sie doch, ich hatte recht. Sehen Sie es denn nicht? Die Augen sind blutlos, bewegen sich kaum mehr, die Farbe ist aus der Iris in tiefer liegende Kapillaren gesickert.
Es könnte ein Uhr mittags sein, ein kalter, aber sonniger Tag, als Weber sich auf den Weg macht, um seine letzten Spuren zu beseitigen. Weber im Jackett, Krawatte sorgfältig gebunden, tritt aus einem Hauseingang, ein in seiner grauen Kleidung kaum sichtbarer Mann, Aktentasche in der Hand, schwarzes Leder.
Weber, Sie wollen doch nicht, dass man schlecht über Sie denkt.
Er blickt die Häuserfassade hinauf, hell getünchte Steine, die das Sonnenlicht reflektieren, es könnte gestern schon so ausgesehen haben, es könnte im letzten Jahr so ausgesehen haben, Weber erinnert sich nicht. Er kann sich nicht gut erinnern.
Er hört die Stimme seines Arztes:
Lieber Herr Weber, so leid es mir tut, ich kann nichts finden.
Das Licht schlägt gegen die Häuser, er reibt sich mit der Hand über die Augen, reibt gegen ein Brennen an, das, wie er überzeugt ist, das Innere seiner Glaskörper zerstört. Und er ist sich sicher: Im Zentrum seines Sehnervs bestimmt eine Krankheit seine Wahrnehmung, schränkt seine Handlungen ein, seit Jahren.
An einer Ampel muss Weber warten. Neben ihm ist eine Auslage mit Obst und Gemüse aufgebaut, er nimmt eine Ingwerwurzel in die Hand, ohne zu erkennen, was es ist, betrachtet sie, ein Experte, dem ein Gegenstand aus einem anderen Fachgebiet vorgelegt wird. Ingwer kennt er nur geschält und zerraspelt, als Verfeinerung von Orangenmarmelade. Vielleicht kommt ihm etwas mit alten Bäumen in den Sinn oder der Geruch von Druckerschwärze, doch das ist nicht gesagt. Er legt den Ingwer zurück. Dann geht er weiter.
Als er die Straße überquert, hupt ein Taxi an ihm vorbei. Weber zuckt zusammen, aber nicht mehr, als man bei einer Filmszene erschrecken würde. Er streicht sich über die mit Haarwasser zurückgekämmten Locken, in der Stirn Locken, leichte Wellen, zurückgeworfen, die übereinanderfallen, sich wieder vorwälzen. Wellen über Wellen. Ein Rauschen in Webers Kopf:
„Ich kann, so leid es mir tut, nichts finden, ich werde auch morgen nichts finden und nächste Woche “ – der Arzt wischt mit dem Ärmel seines Kittels über den Schreibtisch –, „für nächste Woche glaube ich auch nicht daran.“
Auf der anderen Straßenseite stellt Weber die Tasche auf eine Mauer, sieht sich um, der Bürgersteig ist leer. Am Himmel hat ein Flugzeug Spuren hinterlassen, weiße Schraffuren auf Blau. Eine Maschine aus Rom, denkt Weber. Bestimmt aus Rom.
Seinem Portemonnaie entnimmt er einen winzigen Schlüssel, den er in das winzige Schloss der Aktentasche zu stecken versucht. Der Schlüssel gleitet ihm aus den Fingern, das Klirren auf dem Fußweg ist kaum hörbar. Er bückt sich, ein leichter Schwindel fließt durch seinen Kopf, er tastet über den Boden, liest den Schlüssel auf, stochert mit ihm im Schloss, lässt die Schnallen aufschnappen. Er erinnert sich an nichts.
In seinem Kopf ein Ballsaal, tausend Stimmen reden um ihn her, aber niemand spricht mit ihm, draußen regnet es, es könnte später September sein, und Mädchen auf hohen Absätzen balancieren Tabletts voller Gläser durch den Raum. „Darf es für Sie noch ein Sekt sein?“
Weber, auf einem Frankfurter Bürgersteig stehend, von einem Wall aus Verkehrslärm umgeben, blickt in seine Tasche hinein. Aber dass es Erinnerung gibt, ist ja nicht wahr, man stellt sie sich nur vor, ist Weber überzeugt. Er blickt in seine Tasche hinein, und ich blicke auf, blicke den uralten Diplomaten an, der mir mit einem leeren Sektglas in der Hand gegenübersitzt, im Nebensaal eines Hotelrestaurants, in den wir uns zurückgezogen haben. Hinter ihm eine Fensterfront, und er und die Front passen so wenig zusammen, es sieht wie eine Rückprojektion aus, ein Filmtrick, bei dem sich um die Figuren schwarze Linien ziehen und sie niemals ganz in ihre Umgebung hineinwachsen. Das sind die Tricks der sechziger Jahre, denke ich.
Der uralte Diplomat lacht und hebt sein Glas. „Auf Ihr Wohl, Fräulein! Und so also stellen Sie sich Weber vor? Sie können nicht anders, Sie, die Sie Weber nie trafen. Wie sollte er für Sie mehr sein als bloße Rhetorik? Aber vielleicht stapeln Sie hoch, vielleicht ist er für Sie nicht einmal das, nur ein Fragment, und ich soll Ihnen die fehlenden Worte einflüstern?
Eines kann ich Ihnen gern verraten: Wenn Sie die Widersprüche nicht ertragen, wenn Sie sich lieber in ein Urteil verkriechen, dann halten Sie dem Ganzen sicher nicht stand. Nicht heute, nicht morgen und schon gar nicht gestern.“
Ich zucke die Schultern, lasse den Uralten mit den Fingern auf der Stuhllehne klappern und stelle mir ein Paar Schuhe vor.
In den verspiegelten Türen ein Paar Lackschuhe, die zu weit auseinanderstehen. Breitbeinig, denkt Weber, und dann, als sie über das Parkett in Richtung Buffet trampeln, denkt er: Militärstiefelgang. Er sieht sich um, sieht aufs Original der gespiegelten Szene, Köpfe, manikürte Finger, die durch die Luft schnipsen, Mehring, Kobus, Fräulein Schnoop.
Palmer aber kann er nicht finden.
Weber blickt hinauf zu den Lüstern, die sich langsam in Bewegung setzen, sich über seinem Kopf, vor seinen Augen drehen, oder ist das der Boden, der einen Walzer um die eigene Achse tanzt? „Darf es für Sie noch ein Sekt sein?“ Der Ballsaal dreht sich, und die Lüster drehen sich, grinsen auf ihn hinunter, auf Weber, der sich nicht auf den Beinen halten kann, der sich auf einen Stuhl zu stützen versucht und strauchelt und Kobus’ Stimme hört: „Weber, was ist los?“ Die Lüster lachen, oder die Menschen lachen, oder zwei Gläser stoßen aneinander. In seinem Kopf wird der Ballsaal enger, dunkel, ein Punkt, der keine Bedeutung hat.
Weber auf dem Bürgersteig fährt mit den Fingern über die Scheine, zählt das Geld. Leise klickt das Schloss wieder ein. Aus seiner Innentasche zieht er seinen Kalender hervor, schlägt ihn auf, betrachtet den Eintrag für diesen Tag. Oder betrachtet er eine leere Zeile, den Tintenfleck, den er aufs Papier kommen ließ, ehe er es sich anders überlegte und nichts eintrug?
Es ist beinahe Frühling, ich stelle mir vor, dass es ein erster, wenn auch kalter Vorfrühlingstag sein muss, Anfang der sechziger Jahre. Licht fällt über erstes Grün, ein Kind läuft in kurzer Hose an Weber vorbei, ein Mann hängt einen Blumenkasten an eine Balkonbrüstung, und Weber schlägt den Kalender zu, steckt ihn zurück in seine Innentasche, setzt seinen Weg fort, vorsichtig, beinahe suchend. So genau sind ihm die Straßen nicht vertraut, durch dieses Viertel hat er sich früher fahren lassen, es ist zu weit entfernt von seiner Wohnung, als dass er es problemlos zu Fuß erreicht hätte, nur heute, ausnahmsweise, läuft er, denn er will mit niemandem sprechen, will keinem Fahrer Adressen nennen. Die Straßen starren ihn an, als wären sie aus einer fremden Stadt hier hineingesetzt, als begegnete er ihnen heute zum ersten Mal.
Schritte hinter ihm. Weber geht schneller, obwohl er nicht schnell gehen sollte, er verträgt die harte Luft nicht, die er beim Laufen hektisch in sich hineinsaugt. Hinter ihm Militärstiefelgang, ist Weber sich sicher. Er hat einen trockenen Mund, seine Augen brennen. Er biegt ab, die Schritte folgen, er bleibt stehen, sieht sich um. Ein Mädchen überholt ihn.
Er blickt hinauf in den Himmel, der blau und kalt über ihm hängt. Warum aus Rom?, überlegt er. Warum ausgerechnet Rom?
Es ist Rosenkranzfest, 9 Uhr an einem Sonntagmorgen, es ist der 5. Oktober 1958, und der Papst erscheint auf dem Balkon des Castel Gandolfo, ein kranker Knochenmann.
Weber sähe gern so aus, aber leider, Weber sieht ganz und gar anders, Weber sieht gesund aus, viel zu gesund für sein Alter, und warum ist in seinen Augen nichts zu erkennen von den Nadeln, die gegen die Netzhaut pochen? Überbleibsel einer Kriegsverletzung, einer zumindest während des Krieges beigefügten Verletzung, nicht an der Front zwar, aber was, denkt Weber, spielt das für eine Rolle, noch immer ist jene Entzündung nicht verheilt, ist derzeit schlimmer denn je, dieses Stechen –
Die helle Stimme des Papstes hallt in den Hof, es könnte ergreifend sein, dieser abgezehrte Mann, der mit dem Rest seiner Kraft zu den Menschen dort unten spricht, aber dann:
dieser Schluckauf!
Wie ein Säufer klingt der Papst, dieser asketische Greis, er hält seine Predigt vor einer Gruppe plastischer Chirurgen und schluckt auf, als hätte er sich zum Frühstück mit Champagner besoffen.
Weber ist auf dem Weg zu seinem letzten Termin. Seine Miene verrät nichts, nicht der Gang, es ist ein unauffälliger Mann, der am Mailänder Friedhof vorbeigeht, auf den Platzspitz in Zürich zu, durch die Berliner Rauchstraße Richtung Tierpark, dem Geschrei in den Gehegen entgegen –
Aber welches Geschrei? Nein, ganz und gar tierstill ist es, nur der Verkehr brummt neben ihm her. Weber befindet sich ja gar nicht in Mailand, nicht in Zürich und auch nicht in Berlin, er geht durch die Frankfurter Innenstadt, am Ende der Straße kann er den Hauptbahnhof sehen. Es könnte ein gewöhnlicher Wochentag sein, ein Weg zur Arbeit, die Unterlagen geordnet, der Tag schon jetzt auf dem Index der ersten Seite ablesbar. Weber allerdings hat sein Amt verlassen, ein Botschaftsrat a. D. ist er, so stünde es in seiner Akte.
Weber vor dem Hotel, die Stufen zur Eingangstür mit Teppich bedeckt, ein Boy reibt seine weißen Handschuhhände aneinander. Als er Weber bemerkt, strafft er seine Haltung, bereit, Gepäck abzunehmen. Weber aber hat nur seine Aktentasche dabei, ist zudem kein Gast, hat nicht vor, lange zu bleiben. Der Mann nickt ihm zu, seine Handschuhhände weisen die Stufen hinauf.
Einen Moment zögert Weber, den Teppich zu betreten. Dann setzt er seinen linken Fuß vor, folgt der Geste des Mannes, schleppt sich die Stufen hinauf, seine Augen brennen, er drückt sich in die Drehtür, wird hineingespült ins Foyer.
Das Glänzen eines Foyers, glänzende Gesichter überall, glänzend blond gebändigtes Haar, schwarze Anzüge, Abzeichen. „Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen, der Herr?“ Weber fährt herum, ein klappriger Kellner blickt ihn an, träg schlupfen die Lider auf und zu.
Weber bestellt Ceylon-Tee, und der Kellner schlurft unendlich langsam davon, Weber sackt in einen Ledersessel, er will schlafen, er ist ausgesprochen müde.
Adesso non posso più.
Doch dann das:„Doktor Weber?“
Der junge Mann verneigt sich, geht dabei in die Knie, bringt sich auf Augenhöhe mit dem sitzenden Weber, er hat feine Gesichtszüge, hübsch wie ein Mädchen, denkt Weber. Nein, eigentlich hübscher.
„Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, Doktor Weber.“
Weber reibt sich über die Augen, streicht sein Haar zurück, absurd, was er sich da vorgestellt hat, hübsch wie ein Mädchen, was denkt er sich denn? Er steht einer Frau gegenüber, einer gewöhnlichen Frau, die hinter dem Rezeptionstresen im Gästebuch blättert.
„Nein, Herr Wendler logiert nicht bei uns“, erklärt sie ihm.
Ob sie sich sicher sei, will Weber wissen.
„Ich kann gerne noch einmal für Sie die Reservierungen durchsehen.“
Heute früh sei er aus diesem Hotel angerufen worden.
„Ich werde nachsehen.“ Die Dame entschuldigt sich und verschwindet hinter einer Kirschholzwand, in der Fächer für die Zimmerschlüssel eingelassen sind, in einigen liegen zusammengefaltete Zettel und Kuverts. Weber lehnt sich vor und versucht einen Winkel zu finden, aus dem er die Namen auf den Kuverts lesen kann. Er schrickt zurück, als die Dame mit klickernden Schritten wieder auf ihn zustöckelt.
„Ich bedaure, es ist auch niemand mit diesem Namen vorgemerkt. Darf ich etwas ausrichten, falls der Herr sich bei uns meldet?“
Weber zieht ein Silberetui aus der Innentasche seines Jacketts, nimmt eine Visitenkarte heraus, er knickt den rechten Rand nach vorn, wie er es seit seiner Zeit als Attaché gewohnt ist, der zu Besuchende muss bei Empfang einer solchen Karte die Visite als stattgefunden betrachten.
Allerdings: Er, Weber, ist kein Diplomat mehr, und dieses Treffen, weiß Weber, lässt sich nicht ins diplomatische Protokoll zwängen. Er ist hier auch nicht als Stellvertreter eines Staats, er ist hier in eigener Sache. In seiner Hand zerknittert Pappe, ein Kärtchen, auf dem sein Name steht und sein ehemaliges Amt, Dr. Konrad Weber, Botschaftsrat I. Klasse, so viel wert wie ein abgelaufener Coupon.
„Darf ich eine Nachricht notieren?“
Weber wehrt ab, nein, nein, er glaube nicht, dass es nötig sei. Er tritt einen Schritt zurück, will das überhitzte Foyer verlassen, weg vom Lächeln der Rezeptionistin, die sich ihr gelbblondes Haar hinters Ohr streicht, eine, wie Weber denkt, beinah ordinäre Geste, er hat getan, was er tun konnte, niemand kann ihm einen Vorwurf machen, wenn er Wendler nicht antrifft, trifft er Wendler nicht an. Das ist nicht Webers Schuld. Er wendet sich ab, und sein Blick fällt auf die weiße Beschriftung der Glastür.
Er stellt seine Tasche ab, greift in seine Innentasche, holt seinen Kalender hervor, und zum Fräulein hinter der Rezeption gewandt: Ob dieses Hotel denn nicht der Frankfurter Hof sei?
„Nein, mein Herr, dies ist der Kaiserhof.“
Als Weber die Treppen hinunter auf die Straße zurückgeht, nickt ihm der Weißbehandschuhte zu. Weber duckt sich, wendet sich von dem Mann ab, der hinter seinem Rücken lächelt, ist Weber sich sicher, über ihn lacht und sich die weißen Finger reibt.
Pius vor einer Gruppe plastischer Chirurgen, breitet die Arme aus, er wird etwas Ergreifendes sagen, interpreti dei dolori comuni oder etwas in der Art, er hebt seine Hand, spreizt Zeige- und Mittelfinger ab zum Segen – und wird lächerlich gemacht vom eigenen Organismus, die Zeremonie von seinem Zwerchfell zerstückelt, der Segen verkommt zu einem von Schluckgeräuschen zertrümmerten Worthaufen, übers Mikrofon in die Lautsprecher gehickste letzte öffentliche Papstgeräusche.
In der Nacht lagen die Temperaturen knapp über fünf Grad, es könnte ein gewöhnlicher Wochentag sein, ein Weg zur Arbeit, die Unterlagen geordnet, der Tag schon jetzt auf dem Index der ersten Seite ablesbar.
Doch nichts als ein Botschaftsrat a. D. ist Weber, etwas, für das er keine Karten mehr braucht, keine Aufgabe hat, kein Protokoll für seinen Auftritt. Ein Amt ohne Amt.
Er ist nichts. Das heißt, er ist Weber.
Menschen strömen an ihm vorbei, Frauen mit auftoupierten Haaren, sein Kopf taucht unter zwischen all diesen Stimmen, wie soll er hier noch atmen können?
Weber, es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen: Sie sind gesund.
Er hört die schwankenden Balkone über sich wie Mastkörbe knarren, und die Takelage knarrt, eine Balkontür wird zugeworfen, jemand flüstert:
Adesso non posso più!
Der Knochenmann hat den Balkon verlassen, die Tür wurde hinter ihm geschlossen. Nicht nur er selbst, nein, wenn man ehrlich ist: Jeder ahnt, dass er es nicht mehr lange durchhält, das Papstsein, vielleicht schon begonnen hat, es nicht durchzuhalten, seit geraumer Zeit ein Kokon aus Gewändern, aus Brokat und Seide durch die Gänge des Castels getragen wird, durch die Gänge des apostolischen Palasts, des Petersdoms, auf Balkonen aufgestellt, und von Pius ist nicht mehr übrig als ein infantiler Mystiker, der mit Vögeln spricht und sonst mit niemandem. Dass er es nicht mehr lange durchhält, ist offensichtlich.
Aber warum sieht man es Weber nicht an? Sieht denn niemand, dass auch er nicht mehr kann, dass auch er vielleicht seit Jahren nicht mehr kann, nur noch, wie Pius, mit Vögeln sprechen will oder, wenn es denn sein muss, mit Annas Katze? Er hat zu einem Treffen zu gehen, man mutet ihm auch jetzt noch ein Treffen zu. Wenn wenigstens die Krankheit deutlich an ihm abzulesen wäre, wenn die anderen nur dächten: Jeder andere würde in seinem Zustand keinen Schritt mehr vor die Tür setzen. Aber dieser Weber! Dass er noch zu einem Termin geht!
Stattdessen haben sie ihn allein gelassen mit den Krankheiten. Alles an Weber, Haut und Haar und die Locke im Nacken, die sich gegen das Haarwasser sträubt, alles das hält nicht mehr durch, und vor vier Tagen hat Weber die Praxis seines Arztes verlassen.
„Herr Weber, so leid es mir tut, ich kann nichts finden. Und ich bitte Sie, nach all den Jahren, verzichten Sie in der nächsten Zeit auf Ihre Besuche bei mir. Ich werde auch morgen nichts finden und nächste Woche – für nächste Woche glaube ich auch nicht daran.“
Weber hat nicht genickt, nichts erwidert, hat beim Verlassen der Praxis die Tür zugeschlagen, und, von seinem Arzt vor die Tür gesetzt, ist er in die Kälte der Bethmannstraße getreten.
Der Uralte hebt protestierend die Hand: „Fräulein, ich hege doch Zweifel bei Ihrer Geschichte. Sehen Sie, es ist nun zufällig so, dass mir bekannt ist, zu welchem Arzt Ihr Weber ging. Am Stadtrand war das, und es ist mir nicht klar, wie er von dort aus auf eine Straße im Zentrum tritt.“
Da sitzt er vor mir, der uralte Diplomat, der Weber getroffen zu haben behauptet, sitzt vor dem Fenster mit seinen paar fahlen Fakten, die ich nicht überprüfen kann, und ich sitze vor ihm und erzähle ihm etwas, das viel mehr ist als die Adresse eines Arztes. Aber das will er nicht sehen, er schüttelt den Kopf, und ich komme nicht an gegen seine sturen Details.
„Mädchen, ich weiß nicht, mir kommen da Zweifel. Sehen Sie, in der Kirchgasse war das.“
Da sitzt er, lächelt mir mit mageren Lippen zu, hat nicht mehr zu sagen als die Namen von Straßen und will mir damit alles in Grund und Boden behaupten. Ich aber stelle mir vor:
Weber bleibt vor einem Schaufenster stehen, in dem schwarze Anzüge ausgestellt sind. Er betrachtet seine Augen in der Fensterscheibe, zwei rote Punkte, denkt Weber, und er kann an nichts anderes mehr denken, entzündet, in Brand gesteckt, zwei leuchtend rote Punkte müssten das sein. Aber auf der Scheibe ist nur die blassblaue, fast farblose Iris zu sehen, dahinter sechs Modepuppen in schwarzen Anzügen. Trauerkleidung, denkt Weber und wendet sich ab.
Die Luft riecht süßlich nach den ersten aufbrechenden Knospen, vor vier Tagen hat Weber die Tür seines Arztes ins Schloss krachen lassen, kein gewöhnlicher Tag ist das gewesen, so viel ist sicher, so weit jedenfalls, wie Aussagen sicher sind und nicht bloß ein Gebilde aus Luft und Verstand, kein Tag wie die anderen Tage, könnte es heißen, denn für gewöhnlich achtet Weber auf Lautlosigkeit. Er ist bemüht, nicht aufzufallen. Wendler hat es einmal so formuliert: „Niemand erinnert sich an die Unauffälligen, Weber. Ob sie da waren oder nicht – das ist gleichgültig. Für die Betrachter macht es keinen Unterschied.“
Weber ist auf dem Weg zu Wendler. Es könnte Zufall sein, dass sie einander wieder begegnen, ein spontaner Einfall Webers in dieser für ihn unverständlichen Woche oder in einer der Wochen davor.
„Das aber ist höchst unwahrscheinlich“, ruft mein uralter Diplomat. „Sie müssen bedenken, meine Liebe: Weber war ganz und gar nicht spontan, jede Überraschung hat ihn in Not gebracht, in Teufels Küche, wie man so sagt.“
Ich lehne mich zurück, bleibe ganz ruhig und erkläre: „Zu bedenken ist: Des Teufels Küche wird er betreten, sobald er bei seinem Bekannten eintrifft.
Webers Faust schließt sich fester um den Griff seiner Tasche. Ehe er die Straße überquert, sieht er sich nach einem Auto um, einem bleichen VW, einem grauen Mercedes, einem weißen Borgward, will all das hinter sich lassen, seine Geschichte und seine mit bleichen Wagen gesprenkelte Gegenwart. Sterben wäre eine Möglichkeit, aber die falsche, denn das reicht zum Verschwinden bei Weitem nicht aus. Weber wünscht ja nicht, dass die Welt für ihn aufhört, sondern er für die Welt, nie begonnen hat, schlicht: dass er aus dem Protokoll verschwindet.
Aber leider ist das mit dem Verschwinden nicht so leicht, wie Weber es sich wünscht. Mit dem Untertauchen in der Masse ist es lang nicht getan, zudem verabscheut Weber die Masse. All das genügt nicht: das Annehmen einer Rolle, das Erlernen einer neuen Sprache, das Angewöhnen fremder Bräuche, das Abtrainieren alter Gewohnheiten.
Seit Jahren hat die Zusammensetzung von Weber und Welt nicht mehr funktioniert. Ob Weber aus der Welt gefallen ist oder die Welt von Weber ab oder ob Weber sich selbst nicht mehr sicher ist, dass die Geschichte, die er als seine Vergangenheit erinnert, tatsächlich zu ihm gehört, lässt sich nicht sagen und kann wohl auch von Weber nicht gesagt werden, zumindest besteht eine Diskrepanz, die in einem weiter zurückliegenden Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen ihren Ursprung haben muss, denn es gibt doch Ursprünge, es gibt doch Erklärungen für etwas, insbesondere für Absonderlichkeiten“, sage ich.
Der uralte Diplomat hebt sein leeres Glas und schüttelt den Kopf. „Was Sie sich einbilden“, sagt er. „Meine Liebe, das ist zu leicht!“
Ich will etwas sagen, dem Alten entgegnen, aber ich weiß, ich bin hier nicht wichtig. Es ist Weber, der zu dem richtigen Hotel finden muss, Weber, um den ich mich zu kümmern habe, und ich schlucke meine Wut auf den Uralten hinunter.
Weber betritt das Hotel, blickt sich um, erkennt lederne Sessel, erkennt Spiegelflächen, es ist warm, von irgendwoher dringt enervierende Klaviermusik, so enervierend, dass Weber im Kopf das Wort enervierend ausformuliert. Er mustert die Menschen in der Lobby, die, ein Bein über das andere geschlagen, in die Luft oder n eine Zeitung starren.
Über den Teppich geht es sich wie über Sand, weich, anstrengend, Weber tritt vor die Rezeption, legt seine Hände, gefaltet, auf die Marmorplatte.
Er habe die Vermutung, erklärt Weber, dass in diesem Hotel ein Bekannter von ihm logiere, den am heutigen Mittag zu treffen er vereinbart habe.
„Und wie, bitte, lautet der Name?“
Es handele sich um einen Herrn Doktor, einen Mann der Wissenschaft, der Naturwissenschaft könnte man sagen. Und nach kurzem Zögern fügt Weber hinzu: Ein wirklich außerordentlicher Mann.
Er spürt den Marmor unter seinen Händen wärmer werden, hört die Klaviermusik, erklärt lauter: Jedoch sei er, Botschaftsrat Weber, sich gar nicht sicher, ob sein Bekannter tatsächlich hier wohne, unter Umständen sei alles ein Irrtum, für den er sich schon vorab entschuldige.
„Vielleicht wollen Sie mir den Namen Ihres Bekannten verraten?“ Weber nennt ihn, fügt hastig hinzu, er habe kaum Hoffnung, dass der Gesuchte sich tatsächlich in diesem Hotel aufhalte, wenn auch dieses ganz ohne Zweifel ein ausgezeichnetes Hotel sei und er seinem Bekannten nur von Herzen wünsche, in diesem Hotel zu logieren, wenn auch –
„Der Herr hat das Zimmer 203.“
Das Brennen in Webers Augen, er will mit seinen Händen darüberreiben, hält sie aber auf die Marmorplatte gepresst, will nicht auffallen.
Durch das Foyer, bemerkt Weber aus den Augenwinkeln, wird ein metallener, nein, ein durchsichtiger, ach was, ein Ding getragen, ein halbes Oval aus glänzenden Streben. Eine Frau in einem tulpenförmigen Kostüm trägt, auf Absätzen schwankend, einen leeren Käfig über den Teppichtreibsand.
Er sei sich nun gar nicht sicher, ob sein Bekannter um diese Zeit gestört werden wolle, fällt es Weber ein.
„Herr Wendler erwartet Sie. Zimmer 203. Zweite Etage. Die Fahrstühle befinden sich dort drüben.“
Irgendwo weit entfernt kreischt eine Tür, es ist so laut, glaubt Weber, dass er seine eigene Stimme nicht mehr vernehmen kann, die etwas erwidern will, wieder und wieder etwas erwidern will, auch die Stimme der jungen Frau hinter dem Tresen kann er nicht hören, Webers Kopf ist überfüllt mit dem Geschrei und Gekrächze und Gezisch von unzähligen Dingen, die vor seinen Augen auftauchen.
„Die Fahrstühle“, wiederholt die Empfangsdame, „befinden sich dort drüben.“
Er dreht sich um, die Frau mit dem Käfig ist verschwunden. Vielleicht nie da gewesen, denkt er. Es könnte ein gewöhnlicher Tag sein.
Erster Teil. Zürich, Mailand und andere Orte.
Erstes Kapitel. Bonn.
Die neue Hauptstadt also, kurz und klanglos, eine Stadt, die nichts ist, für nichts steht, an nichts erinnert, aus der weder sonderlich berühmte Söhne noch Töchter kommen, sieht man von Beethoven einmal ab. Schumann war hier nur in der Nervenheilanstalt. Ein Grau somit, in das man einen Verwaltungsapparat setzt und all das nun Hauptstadt nennt – eine, wie mein Diplomat findet, leicht euphemistische Bezeichnung für ein 30 Stockwerke hohes Gebäude in der Nähe von Köln. Aber das Hochhaus ist ja noch gar nicht gebaut, als Weber an einem Freitagmorgen, aus Zürich kommend, den Nachtzug verlässt. Bonn. Der Einzige, der, ist Weber sich sicher, bei dieser Wahl aufgeatmet hat, ist Mehring: „Alles, bloß nicht Frankfurt! Weimar war schlimm genug. Es ist ja kein Wunder, dass da keine Republik gelingen konnte. Alles verdorben von diesem harmonisierenden Klassiker! Und bei jedem Staatsbesuch zu seinem Gartenhaus.“
Es ist 1951, die Bundesregierung hat am 10. April die Wiederverwendung ehemaliger Beamter beschlossen, und Weber reist zum ersten Mal aus seinem Zürcher Exil in den Norden. Er ist müde. Im Fond des Taxis kann er nur einen trägen Blick auf die Häuser werfen, sie biegen ab, ehe er sich ein Detail eingeprägt hat. Das also ist Deutschland jetzt. Er hat es sich schlimmer vorgestellt. Näher.
Vor einem Neubau unweit des Regierungsviertels lässt Weber sich von dem Fahrer absetzen, betritt einen Vorgarten, in dem pflaumenfarbige Blumen einen Holzzaun hinaufwachsen, und bleibt vor den Stufen, die zur Eingangstür hinaufführen, stehen. Er dreht sich um und sieht das Taxi wegfahren. Kein Geräusch, nicht einmal das Glucksen einer Taube. Noch zögert er. Aus dem Nachbarhaus sieht er eine Frau in einem tulpenförmigen Kostüm heraustreten, sie nickt ihm zu, er senkt seinen Blick, betrachtet den schaukelnden Saum ihres Rocks. Dann steigt er die Stufen hinauf.
Er klingelt, aber nichts regt sich. Weber betrachtet die pflaumenfarbigen Blumen, die ihm bekannt vorkommen, aber ihm fällt ihr Name nicht ein, ebenso wenig, wo er sie schon einmal gesehen haben könnte.
Als er sich wieder umdreht, steht Rippler vor ihm in der geöffneten Tür und spielt mit einem Brieföffner.
„Weber! Gut siehst du aus! Das Schweizer Klima scheint dir zu bekommen.“
Er tritt beiseite und bittet Weber herein. Sie stehen sich einen Moment lang gegenüber, Rippler, einen halben Kopf kleiner als Weber, ein Geruch von Seife umgibt ihn, und Weber ist sich nicht sicher, ob dies schon früher so gewesen ist; ein Kindergeruch, denkt er. Ripplers Gesicht ist grau geworden. Weber fühlt sich zu dicht bei ihm, unangemessen nach all den Jahren, und auch Rippler weicht vor Weber zurück in das Innere seiner Wohnung.
Ob er sich noch an Bauer erinnere, fragt Weber. Der sei damals auch in der Wilhelmstraße gewesen, nicht bei ihnen, sondern, wenn er, Weber, sich nicht irre, im Referat IV. Gerade heute habe er Bauer im Zug getroffen.
Helligkeit flutet um ihn, sie fällt aus einem Oberlicht auf sie herab, wird von allen Seiten reflektiert, die Wände der Garderobe, in die Rippler ihn geführt hat, sind lückenlos verspiegelt. „Bitte, hier kannst du ablegen.“ Weber sieht sich vor sich stehen, einen zu hellen Mantel in der Hand. Ja, tatsächlich, der Mantel ist zu hell – oder ist es der Lichteinfall, der Weber täuscht?
Bauer wolle sich auf einen Auslandsposten bewerben, fährt Weber fort, und beinah hätte er seinen Mantel an das Spiegelbild des Kleiderhakens gehängt. Er sieht sich zu Rippler um, der aber hat es nicht bemerkt.
Bei Bauer sehe er, was einen Auslandsposten anbelangt, keine Chance, da werde Rippler ihm doch recht geben.
Rippler nickt und führt Weber durch einen weißen Flur, durch einen weißen Salon in ein weißes Kaminzimmer, streicht im Vorbeigehen über die Möbel.
Nicht nur aus fachlichen Gründen, führt Weber aus. Nein, da seien einige Sachen nicht ganz in Ordnung gewesen. Bauer sei ja ab 41 in Polen gewesen – Rippler verstehe, was er damit meine, er wolle nur sagen – er wolle nichts unterstellen, wolle nur sagen –
„Gewiss, mein Lieber, gewiss.“ Rippler deutet auf einen Holzsessel, dessen Armlehnen zu weißen, buckelnden Katzen geschnitzt sind. „Spezialanfertigung aus Mailand! Weber, ich sage dir, preiswert war das nicht. Aber man muss auch zu leben wissen.“
Elegant sei das, betont Weber, elegant! Und so zeitgemäß! Die ganze Einrichtung kommt ihm kalt und gewöhnlich wie ein Arztkittel vor, und dieser Sessel ist die falsch dazu ausgewählte Krawatte.
„Setz dich doch“, fordert Rippler ihn auf. „Zigarre?“
Nein, er rauche nicht –
„Aber natürlich, ich vergaß.“
Weber blickt aus dem Fenster, Blätter wälzen sich im Wind übereinander, Wellen aus Grün, und dahinter hört Weber Stimmen, er sieht jemanden, der auf ihn zukommt, er blickt Palmer entgegen, dem stramm zurückgekämmten Haar, dem Militärstiefelgang.
„Darf ich Ihnen eine Zigarre –“ Er rauche nicht.
„Dann lasse ich Ihnen einen Schluck vom Champagner –“ Er trinke auch nicht.
„Tun Sie denn überhaupt etwas, Weber?”
„Er ist Protestant. Die haben ja ihre eigenen Regeln.“
„So, Protestant?“ Palmer zieht eine Braue hoch, reicht Webers Frau ein Glas Champagner und prostet ihr zu. Beinah beiläufig: „Und wie halten Sie es mit Ihrem Glauben, Weber?“
Anna an seinem Arm, Palmer vor sich, weiß Weber nicht, was er antworten soll. Er tanzt auf einer Champagnerperle, die aufsteigt und jeden Moment zerplatzen wird.
„Weber, was ist mit dir? Kann ich dir etwas zu trinken anbieten? Einen Aperitif? Ein Glas Sekt? Das regt den Kreislauf an, glaub mir.“
Nein, nein, keinen Sekt, murmelt Weber. Wasser, bitte. Er fühlt seine Hände sich fest um die buckelnden Katzenrücken klammern. Er will aufstehen, aber tatsächlich, sein Kreislauf ist schwach, und er sackt wieder zurück in diese Karikatur des Hammurapi-Throns.
Rippler klirrt mit Karaffen, mit Gläsern und mit den ins Glas geschliffenen Lichtflecken, es klingt hell, sphärische Töne, ein bisschen Scriabin vielleicht, überlegt Weber, da dreht sich Rippler um, reicht ihm ein Glas, ruft: „Prost, Weber! Auf die alten Zeiten!“ Die Gläser schlagen aneinander.
Welche Zeiten, fragt Weber.
Rippler antwortet nicht, stürzt sein Getränk in einem Zug hinunter.
Am Telefon, von einem Kratzen in der Leitung unterbrochen, von einer im Wind wankenden Telefonleitung irgendwo zwischen Bonn und Zürich, hatte ihm Rippler versichert: „Weber, das wird ein Leichtes. Du glaubst nicht, wie schwer es für die ist, Leute zu finden, die auch nur halb so qualifiziert sind wie du.“
Worauf Weber antwortete, er hoffe das, oder antwortete, es wäre sehr wünschenswert, oder – aber das nur einmal, als er sich in der seltsamen Montagsstimmung befand, gerade vom Arzt zurückgekehrt – flüsternd: Es sei ja nur gerecht.
Auch vor wenigen Tagen noch, bei ihrem Telefonat kurz vor Webers Abfahrt. „Das wird ein Leichtes, Weber!“
Jetzt ist Rippler stumm. Weber versteht nicht, warum er nicht mit einfällt in seinen Vortrag, warum er nicht ruft: „Weber, das wird ein Leichtes!“ Hat all das Weiß um ihn her seine Sätze geschluckt? Ist es die Stadt, die nicht zulässt, laut zu sein?
Wie viele Volljuristen gebe es denn noch in Deutschland, fragt Weber. Und wie viele davon besäßen die nötigen Fähigkeiten, die sie theoretisch – und er betone: nur theoretisch! – befähigten, in den Auswärtigen Dienst einzutreten? Sprachen, das sei ja noch leicht. Aber wer habe hinreichende Kenntnis von der europäischen Wirtschaft? Wer besitze ein Verständnis für die Aufgaben eines Gesandten? Wer verfüge über die nötige Etikette? Wie viele mochten das wohl sein? Nicht viele. Und wie viele könnten sie davon de facto einstellen? Lächerlich. Die meisten hätten so im Dreck gepanscht, dass man sie nicht einmal nach Lateinamerika in irgendein Provinzkonsulat schicken könne, und wenn es im tiefsten Dschungel läge! Er, Weber, hingegen käme frisch aus der Schweiz, er habe Leute, die für ihn ausgesagt hätten, es müsse seiner Mailänder Personalakte beiliegen.
„Was in einer Personalakte steht, weiß man nie so genau.“
Nein, er sei sich sicher, schon damals habe man es zu Protokoll genommen. Wurde es in jenen Jahren gegen ihn verwendet, so könne es jetzt nur für ihn sprechen.
„Eines darfst du in der Tat nicht vergessen, mein Lieber“, fällt Rippler endlich in Webers Aufzählung ein. „Damals lag ein Haftbefehl gegen dich vor.“
Das Knistern der im Wind wankenden Telefonmasten, das Rauschen der schaukelnden Kabel, ein Ast, der gegen Ripplers Fenster stößt. Weber reibt sich mit der Hand über die Stirn, bittet, an dieses Faktum nicht erinnert zu werden. Die Tatsache, dass er als kriminelle Person gegolten habe, sei für ihn sehr enttäuschend, ja, er möchte sagen: erniedrigend gewesen.
„Weber, das waren Verbrecher, die dich so nannten!“
Er habe sich als Krimineller fühlen müssen.
„Es gab doch diesen Heldt“, bemerkt Rippler. „Wenn wir ihn als Zeugen für dich gewinnen könnten.“
Nein, das solle Rippler vergessen, ruft Weber und macht eine wegwerfende Handbewegung. Das sei alles Gerede. Aufgebauscht! Um Heldt solle sich Rippler nicht kümmern.
Er streicht sich übers Haar, drückt eine im Nacken abstehende Locke glatt und fügt leiser hinzu: Es müsse doch auch so genügen. Man wolle schließlich ein neues Amt aufbauen. Nicht nur, dass der Herr Bundeskanzler in diesem Punkt vollkommen unnachgiebig erscheine. Es sei schlicht ein Fakt, dass man einen ehemaligen SS-Mann nicht nach Paris schicken könne. Die ganze Abteilung Ribbentrop habe mit dem diplomatischen Geist wenig zu tun gehabt, präzisiert Weber. Da sei doch in Wahrheit keiner qualifiziert gewesen, außer darin, das Parteiprogramm herunterzubeten.
„Auch unter den Gesandten, Weber, waren nicht alle einwandfrei. Auch unter denen.“
Ja, gewiss, auch ihm, Weber, sei ein solcher Mann vorgesetzt worden. Ein Strammer aus der Partei. Er sei nur dazu da gewesen, ihn, Weber, zu kontrollieren. Nichts habe dieser Vorgesetzte allein machen können, keine juristische Ausbildung habe der genossen, und auch in allem Übrigen wären seine Fähigkeiten mehr als mangelhaft gewesen. So falsch könne man einen Posten kaum besetzen.
„Ich meine, Weber, auch unter den Alten.“
Das sei doch, als wolle man Äpfel mit Birnen vergleichen! Scheinbare Annäherungen, ja, möglicherweise, um zu verhindern, dass ein weiterer Posten verloren gehe, dass man weiter zurückgedrängt werde. Das sei Taktik gewesen, nicht Überzeugung.
„Wie du meinst, Weber, wie du meinst. Bei einigen der Alten sehe ich allerdings Schwierigkeiten voraus.“
Es habe Ungeschickte gegeben, ja.
„An welches Konsulat hast du im Übrigen gedacht?“
An ein Konsulat habe er eigentlich nicht gedacht, erklärt Weber. Er blickt zum Fenster, er streicht sich das Haar zurück, die abstehende Locke im Nacken. Eher an eine Botschaft.
Und dann sagt Weber: Rom.
Weber sagt mit einer Bestimmtheit: Rom, die ihn selbst überrascht. Und Weber erklärt: Italien. Weber erklärt: langjährige Erfahrung, ausgezeichnete Kenntnisse des Landes, perfekte Sprachkompetenz, Weber erklärt: Er oder keiner. Der Posten in Rom sei wie für ihn gemacht.
„Ja, natürlich, Rom –“ Rippler erhebt sich schwerfällig, geht zu seinem Schreibtisch hinüber, durchblättert Unterlagen. „Lass mich sehen, Rom, das dürfte B3 sein –“
B6 oder eine Besoldungsstufe darüber, erklärt Weber.
„B6?“ Rippler kratzt sich am Kinn. „Das ist happig. Vorher warst du – was genau? A14?“
Was spiele denn Damals für eine Rolle?
„Gut, gut.“ Rippler winkt ab. „B6? Bist du sicher?“
Er habe sich noch nicht genau informieren, habe zuerst mit ihm, Rippler, reden wollen.
„Abergläubisch, was, Weber?“
Aberglaube? Er sei alles andere als überzeugt, wirklich in den Auswärtigen Dienst zurückkehren zu wollen. Viel habe er über sich ergehen lassen müssen. So etwas sitze tief. Er, Rippler, könne das nicht nachvollziehen. Weber blickt aus dem Fenster, streicht sein Haar im Nacken glatt.
Rippler räuspert sich, durchblättert Unterlagen. „Weber, ich halte Rom für eine fabelhafte Idee. Wir werden uns gleich heute Abend umhören, ob schon jemand für diesen Posten in Erwägung gezogen wurde. Du wirst dich mit Blankenhorn unterhalten. Letztlich entscheidet er in Personalsachen. Der Herr Bundeskanzler vertraut ihm. Fürs Misstrauen hat er nicht genug Zeit.“
Weber betrachtet die Stadt durch das Fenster des Taxis, und er denkt, dass vieles nicht mehr zusammenpasst. Er sieht einen Prälaten der Nuntiatur, der versucht, vor diesen Neubauten einen Spaziergang zu machen. Aber es gelingt nicht, stellt Weber fest, der Prälat bleibt den Gebäuden fern, wie eine Figur, die man in einen Film kopiert hat.
Man könnte, fürchtet Weber, manches überholt haben. Man könnte das, was er für wesentlich hält, überholt haben, denkt er. Aber vieles funktioniert wie gewohnt. Weber kann seinen Chauffeur bezahlen, im Hotel, kaum dass er das Foyer betreten hat, schwirrt ein Angestellter ihm zu Diensten: „Darf ich Ihnen die Tasche abnehmen? In welchen Stock darf ich den Herrn fahren?“ Nein, er, Weber, ist noch nicht aus der Zeit gefallen, und ehe sich die Fahrstuhltür schließt, Weber mit dem Angestellten allein ist, dessen ganze Lebensaufgabe darin besteht, mit weißbehandschuhten Händen einen von acht Knöpfen zu drücken, erkennt Weber sein Gesicht auf einer verspiegelten Wand, die von Tiffanylampen matt erleuchtet wird. Er hört Stimmen, italienische, deutsche, englische Sätze, Lachen, Kichern, Husten.
Weber blickt auf die Spiegelung seines Gesichts: sein in der Stirn gewelltes Haar, seine Brauen aus Wellen, sein Kinn, sein Hals aus Wellen, kleine Wirbel, die sich überlappen, überschlagen, die Krawatte ins Wasser hineingebunden. Unter sich die Kacheln eines Pools, verspiegelte Rechtecke, dunkle Linien, die sein Gesicht zerschneiden. Die Augen Strudel. Weber betrachtet sein in den Wellen untergehendes Gesicht. Er hört Stimmen um ihn her, eine Flut aus Geräuschen und Verpflichtungen und die alte Gräfin:
„Herr Konsul, haben Sie schon Sir Richard getroffen? Ein fabelhafter Mann!“
Irgendwo bellt ein Hund, oder ein Auto bremst, eine Flasche Champagner wird knallend geöffnet, und Webers Gesicht zerfließt in einem nach Chlor stinkenden Becken.
Nein, Weber ist noch nicht aus der Zeit gefallen. Er hört den Liftboy atmen, er hört über sich das Rollen der Gewinde im Schacht. Das Lämpchen leuchtet die Zahl Sechs an die Fahrstuhlwand, die Tür gleitet auf.
„Etage sechs, der Herr.“
Als ob er das nicht selber sähe!
In seinem Zimmer findet Weber, wie er es gewünscht hat, zwei Flaschen mit stillem Wasser und ein Kännchen mit Öl, das er auf Reisen zur Beruhigung seines Magens in kleinen Dosierungen einzunehmen pflegt. Man kann nie sicher sein, ob sich die Restaurantköche tatsächlich an seine Diätvorschriften halten, wenn es auch immer und überall beteuert wird. Niemand weiß ja, wie schlecht es um ihn steht, alle meinen, es sei ein Spleen.
Als Weber in den Nebenraum geht, um sich für das Diner umzuziehen (Frack mit weißer Weste und Zylinder), klingelt das Telefon.
„Ein Ferngespräch für Sie.“
Aus Bremen?
„Nein, aus Mailand.“
Aus Mailand, wiederholt Weber, stützt sich auf die Schreibtischplatte, stößt einen Stapel Papiere um, die als wirrer Schwarm auf den Hotelteppich flattern.
Es täte ihm leid, er sei nicht zu sprechen. In Eile, wiederholt Weber mehrmals. Man solle dem Anrufer ausrichten, er sei nicht zu erreichen.
„Sind Sie sicher?“, fragt die Telefonistenstimme irritiert.
Er pflege sich im Allgemeinen über die Dinge, die er sage, sicher zu sein. Auch wenn dies veraltet sein möge, halte er, Weber, es doch nach wie vor für eine Tugend.
„Selbstverständlich, Herr Doktor Weber, natürlich. Verzeihen Sie die Störung.“
Weber hängt den Hörer auf die Gabel. Als er aufsieht, scheint ihm die Sonne direkt ins Gesicht. Er kneift seine Augen zusammen, reibt sich mit der Hand über die Lider. Ein pochender Schmerz, der sich von seinen Augen aus bis in die Stirnhöhlen ausbreitet. Mit geschlossenen Augen tastet er über die Schreibtischplatte, ein weiterer Papierstapel raschelt zu Boden, Weber tastet sich an der Wand entlang, unter seinen Füßen zerreißt Papier, sein Knie stößt gegen den Bettpfosten. Vorsichtig lässt sich Weber auf die Matratze sinken. Sein Puls geht zu schnell, spürt Weber, sein Mund ist zu trocken, in seinem Kopf dreht sich alles, und Weber ist sich nicht sicher: Ist er es, der schwankt, oder die Welt um ihn her, um Weber, um einen der letzten, nach alter Ordnung statisch ruhenden Flecken?
Ehe er das Hotelzimmer verlässt, um sich zu Rippler in die Limousine zu setzen und durchs künstlich erleuchtete Abendbonn zu fahren, telefoniert er nach Bremen.
Ob man Neues gehört habe.
„Nichts. Aber du wirst doch trotzdem hingehen, Konrad?“
Ob es keinen einzigen neuen Namen gebe, fragt Weber. Ob denn wirklich nichts zu erfahren gewesen sei.
„Ich sage es dir doch.“
Weber schlägt eine Mappe auf, fährt mit dem Finger die Namen auf einer Liste entlang.
Ob sie bestimmt bei den von ihm genannten Stellen angerufen habe.
„Konrad! Ich sage es dir doch.“
Weber kreist einige Namen ein. Dann schlägt er die Mappe zu, murmelt Unverständliches in den Hörer und legt auf.
Weber genießt das gleichmäßige Rauschen der Gespräche. Der fremde Dialekt, an den er sich in der Schweiz gewöhnt hat, ist verschwunden. Ein Lüster sprenkelt Licht über den Raum, und in den verspiegelten Türen, aus denen ab und an ein Kellner huscht, sieht er sie alle wieder, über das Parkett verteilt: Mehring, Kobus, Fräulein Schnoop. Weber stolziert über die Feier, seine Frackschöße flattern aufgeregt, ein Balztanz, bei dem Weber mit einem ganzen Schwarm anbändelt.
„Weber! Wie freue ich mich, Sie wieder bei uns zu sehen! Wagen Sie sich endlich vor in die neue Republik? Ich verspreche Ihnen, es hat sich einiges geändert.“
„Und, Weber, Geschäfte laufen? Bei der Treuhand in Zürich, habe ich recht?“
„Einfach fort waren Sie. Ich habe mich ja oft nach Ihnen erkundigt. Einfach verschwunden! So einen Schrecken können Sie mir doch nicht einjagen.“
„Ach lieber Herr Weber, man hat ja ab und an von Ihnen gehört. Sie sind jetzt im Devisenhandel tätig, nicht wahr?“
„Ist Ihnen klar, Weber, wie gut es Ihnen geht? Haben Sie gehört, was Gruber macht?“ Beerbeck, ein zierliches Männchen, das zu Webers Mailänder Zeit im Konsulat in Florenz tätig war, klackt mit seinen Zähnen.
Nein. Was mache Gruber jetzt, erkundigt sich Weber.
„Er ist in der Fischfutterbranche.“
Ach so? In der Logistik?
„Eher in der Feldforschung. So genau kann man das nicht sagen, Kopf und Rumpf sind auf der Höhe der Hackeschen Höfe aus der Spree geangelt worden, was der Rest macht, ist nicht bekannt. Fischfutter eben. Dabei hat er den Krieg überlebt. Zwei Wochen lang, dann hat sein Nachbar von irgendwoher Kapseln bekommen, und Gruber hat ein Vermögen dafür bezahlt, er muss mit dem Nachbarn zusammen das Sofa nach nebenan geschafft haben und das Vertiko und das Klavier, das nur leichte Schäden von einem Luftangriff abbekommen hat, ein paar Kratzer wie von einer Katze, und einen Teppich haben sie noch rübergeschafft, dafür hat er dann die Kapsel bekommen. Mehr war nicht zu holen. Das Silberbesteck hat irgendjemand mitgehen lassen, als Gruber zum letzten Mal im Bunker war, und bei der Gelegenheit sind die Bilder und die Spiegel und die Kristallgläser zerschlagen. Dieser dusselige Nachbar hat sich auf den Tausch mit dem Klavier eingelassen, dabei muss man sich doch fragen, wer zu der Zeit ein Klavier gebraucht hat, und hätte sich der Nachbar das gefragt, hätte man nicht Grubers Kopf und Rumpf aus der Spree ziehen müssen.“
In den verspiegelten Türen bemerkt Weber ein Paar Lackschuhe, die zu weit auseinanderstehen, breitbeinig, denkt Weber, und dann, als sie über das Parkett in Richtung Buffet trampeln, denkt er: Militärstiefelgang. Er sieht sich um, sieht aufs Original der gespiegelten Szene, Köpfe, manikürte Finger, die durch die Luft schnipsen, Mehring, Kobus, Fräulein Schnoop. Palmer aber kann er nicht finden.
„Aber wissen Sie, Winkler, den hat es noch blöder erwischt. Zwei Tage nach Kriegsende läuft er durchs Brandenburger Land und stößt auf zwei Russen, die ihn für einen getarnten Wehrmachtssoldaten halten. Die beiden haben noch nichts von der Kapitulation gehört und schreien ihn an, er solle stehen bleiben. Da unser lieber Winkler aber nie Russisch gelernt hat, ist er nicht sicher, was die beiden von ihm wollen, er schwenkt nach links, will ihnen ausweichen, da hat der Dünnere der beiden schon abgedrückt, und Winkler stolpert in den Dreck, wahrscheinlich hat er den Aufprall noch erlebt, vielleicht ist er aber schon im Fallen gestorben.“
Über ihm schwingt ein Kronleuchter, und Weber stellt sich Palmer vor, zwei zu weit auseinanderstehende Lackschuhe. Aber das kann nicht sein. Palmer! Er schüttelt den Kopf, er starrt auf den Boden, auf zwei weiße Leinenschuhe, die sich ihm nähern, und was haben Leinenschuhe auf diesem Empfang verloren?
„Erinnern Sie sich an Heldt? Wissen Sie, was aus ihm geworden ist?“
Weber blickt Beerbeck ins Gesicht – nein, unmöglich, denkt Weber, woher sollte Beerbeck Heldt kennen? Er sieht Wendler an, ist er sich sicher, das sind Wendlers Klavierspielerhände, die über das Buffet flirren. Über ihnen, an der Saaldecke, wachsen Streben aus dem Kronleuchter, Metallstreben, Käfigdraht, und Wendler, an einer Cocktailkirsche nuckelnd: „Hoffen wir, dass es ihm besser ergangen ist als Winkler und Gruber, nicht wahr, Weber?“
Weber nickt, ihm ist schwummrig, er sieht zur Decke hinauf, und über Wendlers tiefschwarzem Haar, das, ist Weber sich sicher, damals heller gewesen ist, über Wendlers in rabenschwarze Tinte getauchte Frisur schaukelt ein Käfig, in dem zwei Vögel übereinanderfallen.
Jemand greift Webers Arm und dirigiert ihn von seinem Gesprächspartner weg, und jetzt, aus der Entfernung, kann er es wieder klar sehen: Beerbeck ist das, eindeutig. „Nicht wahr, Helen Schnoop geht es heute ausgezeichnet. Seit der Heirat. Sind Sie nicht der Meinung?“, ruft er Weber noch zu. Beerbeck, natürlich! Was hätte Wendler hier auch verloren?
„Weber, was ist mit Ihnen, Sie haben doch früher nicht so Ihre Zeit vertrödelt“, flüstert Rippler ihm zu. „Beerbeck hat nichts zu sagen, rein gar nichts, bemüht sich selbst um Wiedereinstellung. Aber den, das sage ich Ihnen, kann man keiner Abteilung zumuten. Zu zynisch geworden – ach, Herr Keetenheuve, ich grüße Sie!“
Und sie ducken sich wieder in die Gespräche hinein. Weber schüttelt Hände, Weber tauscht Floskeln aus, Weber macht einen Witz, der seine humanistische Bildung hervorhebt, und schau einer an, der junge Daloff hat es nicht verstanden, und der soll jetzt als Legationssekretär nach Paris?
„Ja, und Herr von Zillner ist für Madrid vorgesehen. Es ist wohl niemand anderes in Frage gekommen.“
„Wissen Sie das noch nicht?“
„Es heißt, Wildbrand interessiere sich unter Umständen für den Posten. Nicht aussichtslos.“
„Herr Weber, was halten Sie eigentlich davon?“
„Man hört, Kobus könnte bald auf dem Weg in die Vereinigten Staaten sein.“
„Bonn, ja, über die Stadt kann man streiten. Aber habe ich Ihnen schon gesagt, wie froh ich bin, dass es nicht Frankfurt geworden ist? Was glauben Sie, wessen Geburtshaus man bei jedem Staatsbesuch hätte besichtigen müssen?“
„Haben Sie das nicht gewusst? Palmer ist jetzt in der Rechtsabteilung. Natürlich, kein schlechter Posten, allerdings geringer als die Konsularstelle in Mailand. Er soll ein wenig pikiert gewesen sein, dass er nicht befördert wurde. Hat ihm aber nichts genützt. B3 bleibt B3.“
Weber, perplex, fällt nichts anderes ein als zu stottern: Aber – das sei doch Palmer!
Weber, Sie wollen doch nicht, dass man schlecht über Sie denkt.
„Was wollen Sie, Weber, haben Sie gedacht, neue Diplomaten wachsen wie Unkraut zwischen den Trümmern? Werden uns von den Amerikanern per Luftpost geschickt? Sie waren zu lange in der Schweiz. Bekommt Ihnen die Bergluft überhaupt?“
Zürich, erklärt Weber, läge nicht allzu hoch.
„Was fangen Sie eigentlich mit Ihrer Geschichte an?“, fragt Mehring.
Welche Geschichte.
„Aber lieber Kollege!“, flüstert Mehring und reibt Daumen und Zeigefinger aneinander.
Er müsse entschuldigen, aber er wisse nicht, was Mehring meine. Weber hört entfernt die Stimme einer Frau, wie aus einem Schacht heraus: „Da muss ein Irrtum vorliegen –“
Mehring wendet sich ab, winkt eines der Mädchen herbei, das auf Stöckelschuhen Silbertabletts durch den Raum balanciert.
„Ein Glas Sekt, Weber?“
Weber schüttelt den Kopf, sucht den Rand der Feier nach Anna ab, die sich doch stets dort aufhält – aber Anna ist ja gar nicht mit ihm mitgereist, sie sitzt bei ihrem Vater in Bremen, häkelt Mützen für die Caritas!
„Die Schule, Weber! Ich sage nur: die deutsche Schule in Mailand.“
Weber riecht die Süße der aufsteigenden Sektbläschen, die den Raum ausfüllen, er hört das Klingeln der Glaskristalle am Kronleuchter, aneinanderklappernde Schnäbel, er sieht einen Schwarm aufsteigen, den Himmel draußen sich verdunkeln, hört einen Zug, der quietschend in einen Bahnhof einfährt, er dreht sich um. Er dreht sich, oder alles dreht sich um ihn.
Aber es ist doch nichts?