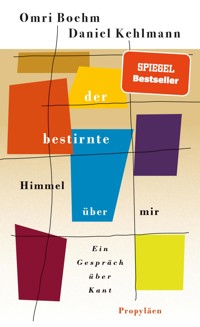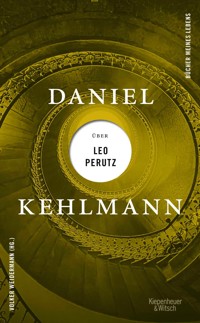7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Humor und Ironie, Götter, Genies, Schriftsteller und Hunde, über all das sprechen Daniel Kehlmann und Sebastian Kleinschmidt. Ein so amüsantes und erhellendes Gespräch, dass der Leser bei jedem Satz bedauern muss, nicht dabei gewesen zu sein. «Klug, unterhaltsam und witzig, gleichermaßen professionell wie privat, ein Rückblick und eine Vorschau.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) «Hier vereinen sich Humor und wissenschaftliche Intellektualität aufs Schönste.» (Spiegel online) «Erhellend ist dieses Buch, weil sich hier zwei kreative Intellektuelle auf Augenhöhe begegnen.» (Neue Zürcher Zeitung) «Wieder einmal zeigt sich, dass Kehlmann nicht nur kluge Romane zu schreiben versteht, sondern auch Kluges über die Kunst des Romans zu sagen hat.» (Die Welt) «Ein freundliches Duell und Duett zweier Gehirne.» (Neues Deutschland)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Ähnliche
Daniel Kehlmann/Sebastian Kleinschmidt
Requiem für einen Hund
Ein Gespräch
Inhaltsverzeichnis
Anmerkung
E-Mail, 9. 3. 08
E-Mail, 18. 3. 08
Tiere
Götter
Genies
Zählen und Erzählen
Humor
Fiktion und Geschichte
Der Tod
Schauspieler und Theater
Kindheit
Studium
Von der Arbeit des Schriftstellers
Ruhm
Dem vorliegenden Text liegt ein Gespräch für die Zeitschrift SINN UND FORM (Heft 6/2006) zugrunde. Auf Vorschlag von Andreas Rötzer wurde es im Februar 2008 in Berlin fortgesetzt.
Kehlmanns Hund war immer dabei.
E-Mail, 9.3.08
Lieber Herr Kleinschmidt,
nachdem er die ganze Zeit so aufmerksam bei uns saß, muß ich Ihnen jetzt eine traurige Neuigkeit mitteilen. Nuschki ist tot. Daß er nicht gesund war, wußten wir ja schon lange, aber die Lage verschlechterte sich vor einigen Tagen dramatisch. Er brach plötzlich zusammen, dann wurde ein schon weit fortgeschrittener Lebertumor diagnostiziert. Die Prognose war sehr schlecht, eine Operation nicht erfolgversprechend, und daher haben wir dann, auf Rat aller Ärzte, der Euthanasie zugestimmt. Ich war bei ihm, als er einschlief, als sein Herz zu schlagen aufhörte. Sie haben ja erlebt, was für ein außergewöhnlicher Hund er war, und Sie können sich vorstellen, wie es einem nahegeht, ihn nach so vielen Jahren Freundschaft verloren zu haben.
Ganz herzliche Grüße
Ihres Daniel Kehlmann
E-Mail, 18.3.08
Lieber Herr Kehlmann,
ja, das ist wahrlich eine traurige Nachricht. So sind wir beide in den Tagen unseres Gesprächs in Berlin für ihn vielleicht die letzte Begegnung mit einer Art Rudel gewesen. Sprechende Hunde sozusagen, er wird sich gewundert haben. Wie es im Himmelreich mit den Tieren bestellt ist, weiß ja keiner. Immerhin müssen sie nicht vorm Jüngsten Gericht erscheinen.
Ich grüße Sie herzlich
Ihr Sebastian Kleinschmidt
Tiere
Sebastian Kleinschmidt/ Beginnen wir mit den Hunden, den bewegungsfreudigsten Tieren. Sie bevölkern ja geradezu Ihre Bücher. Thorsten Ahrend, Ihr früherer Lektor bei Suhrkamp, bemängelte, es gäbe zu viele Hunde bei Ihnen. Das würde ich nie bemängeln. Ich freue mich über jedes Tier, das durch Ihre Texte hüpft, springt, klettert, schleicht, schwimmt, kriecht oder fliegt. Was findet man in der «Vermessung der Welt» nicht alles: polyglotte Papageien, Seeungeheuer, Krokodile, Vögel aller Art, elektrische Aale, Piranhas, Moskitos, einen Jaguar, Flöhe, Kopfläuse, Affen, Schlangen, Spinnen und natürlich Humboldts Hund, der besonders anrührend geschildert ist. Was macht die Welt der Tiere für einen Romanautor so anziehend? Und was hat das alles zu tun mit Ihrem Markenzeichen, der Ironie, dem Humor? Das Tier kann bekanntlich nicht lachen. Und doch ist die stumme Tierwelt so etwas wie eine ständige Ironisierung der Menschenwelt. Sie stehen da und sehen uns an, und wir stehen da und sehen sie an. Irgend etwas geht vor zwischen uns. Es wird doch mehr als nur das Bestaunen unseres wechselseitigen Schauwertes sein?
Daniel Kehlmann/ Viel mehr. Man kommt bei dem Thema nicht um den Begriff der Entfremdung herum. Wir fühlen uns ständig im falschen Leben eingesperrt, uneins mit uns selbst. Das Tier kennt diese Selbstentfremdung nicht. Deswegen sind Tiere auch immer graziös. Grazie heißt, in der Bewegung eins mit sich sein. In ihrer Gegenwart fühlen wir uns lächerlich, ungeschickt, hölzern.
sk/ Grazie ist das eine. Hinzu kommt das Aussehen, die Kleidung. Tiere sind im allgemeinen auch besser angezogen als wir. Man staunt immer wieder, es gibt keinerlei Geschmacklosigkeit in der Natur, oder nur in den seltensten Fällen. Ganz im Gegensatz zur Menschenwelt. Mit der aber hat es der Romanautor zu tun.
dk/ Romanschreiben ist das Ergründen der Widersprüchlichkeit des Menschen, also seines entfremdeten Daseins.
sk/ Sind Tiere nicht ein unentbehrlicher Spiegel, um das zu erkennen?
dk/ Vielleicht nicht unentbehrlich, aber sicher hilfreich. Und sie sind ja nicht nur putzig. Denken Sie an Insekten – das hat mit Idylle nichts mehr zu tun.
sk/ Die sind recht zahlreich in der «Vermessung der Welt». Gauß sagt mit Bezug auf Humboldts Bericht über die Moskitos am Orinoko, auf jeden Menschen kommen eine Million Insekten.
dk/ Insekten stehen für die eben nicht liebenswürdige, nicht nette, nicht hübsche Seite der Natur. Insekten sind kriegerisch, sie werden länger auf der Erde existieren als der Mensch. Daß die Natur eben nicht gutwillig ist, sondern fremd, unheimlich, unwirtlich und bedrohlich, das hat Humboldt immer wieder erschreckt. Eine Natur, die sich nicht darum schert, wie es uns geht, die keine milde, gütige Natur ist, sondern eine fressende und tötende. Die nichtgoethesche Natur. Die goethesche, das ist die «heilsam schaffende Gewalt», wie es im «Faust» heißt. Aber jene Gewalt, der das einzelne Menschenleben vollkommen gleichgültig ist, ist nicht eben heilsam. Das übersehen wir gern, da wir ja alle von der Romantik geprägt sind.
sk/ Es ist gar nicht zum Schaden der Humanität, daß ein großer Teil des uns umgebenden Seins nicht von Maßstäben der Gesittung beherrscht ist. Da geht einem erst so richtig auf, wie kostbar und wie fragil die eigene Welt ist.
dk/ Und ebenso, warum Zivilisation und Humanität immer auch gegen die Natur stehen. Ich finde es amüsant, daß die Österreicher sich zuerst sehr und dann nicht mehr freuten, als sie plötzlich wieder Bären im Land hatten. Die waren aus dem Osten gekommen, nachdem der Eiserne Vorhang hochgegangen war. Und relativ schnell wurde den Leuten in den betroffenen Gegenden klar, daß sie Bären, die abstrakt gesehen sehr nett sind, in der Praxis doch lieber nicht begegnen wollten.
sk/ Ein Bärenblick ist schließlich kein Hundeblick. Mit wilden Tieren ist nicht zu spaßen.
dk/ Ich habe einmal Löwen gesehen in freier Wildbahn. Deren Blick geht einem durch Mark und Bein. Der ist wirklich ganz anders als bei Löwen im Zoo. Wenn man mit dem Jeep in unmittelbare Nähe eines Löwen kommt, der eine Beute verzehrt, und der Löwe hebt den Kopf und sieht einen an – da ist nichts als Fremdheit und Feindschaft. Ich habe den Fahrer gefragt, was passieren würde, wenn ich jetzt aussteige. Er sagte nur: «Big problem!»
sk/ Wie weit waren Sie entfernt?
dk/ Zwei Meter vielleicht. Drei Löwen lagen um ein gerissenes Warzenschwein. Sie wuschen förmlich ihr Gesicht in seinem Blut.
sk/ Das erinnert mich an das Buch «Schiffbruch mit Tiger» des kanadischen Schriftstellers Yann Martell. Es handelt vom Umzug eines zoologischen Gartens per Schiff von Japan nach Europa. An Bord alles, was man sich nur vorstellen kann, Tiger, Löwen, Hyänen, Raubvögel, Mäuse, Elefanten usw. Und dann geht der schwimmende Zoo plötzlich unter. Fast alle ertrinken, bis auf den Sohn des Zoobesitzers, ein verletztes Zebra, einen Orang-Utan, eine Tüpfelhyäne und einen bengalischen Tiger. Die fünf schaffen es in ein Rettungsboot. Was dann passiert, erzählt der Roman. Es ist unglaublich.
Weil wir an dem Punkt wilde Tiere, gezähmte Tiere sind, will ich eine Stelle aus dem Buch zitieren. Es geht um das Klischee, daß die Leute immer denken, Tiere in freier Wildbahn seien glücklich:
Die Leute haben dabei meist ein großes, gutaussehendes Raubtier vor Augen, einen Löwen oder Geparden (das Leben eines Gnus oder Erdferkels ist weniger spektakulär). Sie stellen sich das wilde Tier vor, wie es nach dem Verzehr seines Opfers, das sich in sein Schicksal ergeben hat, einen Verdauungsspaziergang durch die Savanne macht, um nach dem viel zu reichlichen Essen kein Fett anzusetzen. Sie stellen sich vor, wie dieses Tier stolz und zärtlich für seinen Nachwuchs sorgt, wie die ganze Familie gemeinsam auf einem Baum sitzt, den Sonnenuntergang bewundert und zufrieden seufzt. Das Leben der wilden Tiere, glauben sie, ist einfach, edel und sinnerfüllt. Dann wird ein solches Tier von den bösen Menschen gefangen und in eine winzige Gefängniszelle gesperrt. Mit seinem ‹Glück› ist es vorbei. Es lechzt nach ‹Freiheit› und denkt nur noch daran, wie es entkommen kann. Verwehrt man ihm diese ‹Freiheit› zu lange, wird es zum Schatten seiner selbst, wird sein Willen gebrochen. So etwas glauben die Leute. Aber es ist nicht wahr.
dk/ Großartig. Ja, die meisten Menschen haben keine Vorstellung, wie es zugeht in freier Wildbahn. Es gibt übrigens bei Humboldt – dem echten, nicht meiner Romanfigur – sehr gute Schilderungen wildlebender Tiere, ich denke an die Stelle über den Lärm im nächtlichen Dschungel in den «Ansichten der Natur», wo er klar ausspricht, daß der Naturzustand ein ständiger Kampf um Leben und Tod ist.
sk/ Das meine ich, wenn ich sage, daß der Blick ins Tierreich eine Konkretisierung des Begriffs Menschenwelt ermöglicht, e contrario natürlich, aber nicht nur. Die Vielfalt von Tierarten veranschaulicht eine Vielfalt von Weltzugängen. Die einen folgen optischen Spuren, die anderen chemischen, die dritten akustischen. Im Vergleich zu den Tieren ist der Mensch fast ein Wahrnehmungskrüppel. An den Weltverhältnissen der Tiere kann man studieren, wie viele Weltverhältnisse es überhaupt gibt und geben kann. Ein Romanautor ist also gut beraten, wenn er eine solche Doppelperspektive einnimmt. Und Sie haben ja auch Ihre Freude daran, die Welt so zu sehen. Und ich als Leser freue mich mit. Und Ihr Hund unterm Tisch auch.
dk/ Mit dem Weltverhältnis des Hundes hat es etwas Besonderes auf sich. Der Hund ist das einzige Tier, das evolutionär auf den Menschen gesetzt hat. Er hat sozusagen auf ihn gewettet. Er wurde sehr früh sein Freund, und die beiden Spezies gingen den Weg gemeinsam. Das ist höchst faszinierend auch im Kontrast zu anderen Haus- und Nutztieren, zu Katzen, Pferden, Schweinen und Vögeln. Übrigens heißt das nicht, daß der Hund das klügste Tier ist. Manche Vögel sind viel intelligenter.
sk/ Ich könnte mit dem Hegel-Schüler Friedrich Theodor Vischer entgegnen: Es gibt nichts Dümmeres im Tierreich als Vögel.
dk/ Das ist ungerecht. Da kennt er keine Papageien. Papageien sind viel klüger als Hunde, nur sind sie nicht so auf den Menschen eingestellt. Vor Jahren hatten wir ein kleines australisches Zwergpapageienmädchen namens Lara. Die war unglaublich intelligent. Man ließ sie aus dem Käfig, sie flog ein paar Runden im Zimmer und knallte dann gegen die Fensterscheibe, wie das Vögeln immer wieder geschieht. Aber ihr passierte das nur einmal. Sie hatte sofort verstanden, was ein Glasfenster ist. Lara war sehr zutraulich. Wenn sie einem auf der Schulter saß und einen ansah, war man bezaubert. Sie ist leider gestorben. Sie hätte noch dreißig Jahre Leben vor sich gehabt. Papageien leben ja dreimal so lange wie Hunde. Ein Moment ist mir ganz unvergeßlich: Lara hatte den Kopf zwischen die Stäbe des Käfigs gezwängt, und plötzlich steckte er fest. Sie fing an, panisch zu flattern. Es war sehr gefährlich, der Hals war eingeklemmt, sie hätte sich das Genick brechen können. Es war schrecklich, weil ich nicht wußte, was ich machen sollte. Also habe ich Lara von hinten gefaßt und einfach nur gehalten. Normalerweise mögen solche Vögel nicht angefaßt werden. Sie geriet in höchste Panik. Und dann merkte ich, wie sie zögerte und überlegte und auf einmal zu flattern aufhörte und ruhig in meiner Hand lag und wartete. Sie hatte verstanden: Alleine schafft sie es nicht, und der einzige, der sie da jetzt rausbringen kann, bin ich. Das ist schon hohe Intelligenz. Dieses Vertrauen, das eben nicht wie beim Hund aus der Gewohnheit kommt, sondern aus dem Begreifen der Situation. Dieser Moment, als der Vogel aufhörte zu flattern und einfach wartete, angespannt aber ruhig, daß ich ihn befreie – das vergesse ich nie.
sk/ In Ihrem Buch gibt es eine wunderbare Stelle über Papageien, Papageien, die ausgestorbene Dialekte sprechen.
dk/ Das ist nicht erfunden. Die phantastischsten Dinge im Buch sind alle nicht erfunden. Das war der Aturenpapagei. Er konnte einige Worte in der Sprache eines ausgestorbenen Indianervolkes sagen. Niemand wußte mehr, was sie bedeuteten. Es gibt eine Ballade von Ernst Curtius über ihn.
In der Orinoco-Wildnis / Sitzt ein alter Papagei, / Kalt und starr, als ob sein Bildnis / Aus dem Stein gehauen sei.// Unten, wo die Wogen branden, / Hält ein Volk die ew’ge Ruh; / Fortgedrängt aus seinen Landen, / Floh es diesen Klippen zu.// Und es starben die Aturen, / Wie sie lebten, frei und kühn; / Ihres Stammes letzte Spuren / Birgt des Unterschilfes Grün.// Der Aturen allerletzter, / Trauert dort der Papagei; / Am Gestein den Schnabel wetzt er, / Durch die Lüfte tönt sein Schrei.// Ach die Knaben, die ihn lehrten / Ihrer Muttersprache Laut, / Und die Frauen, die ihn nährten, / Die ihm selbst das Nest gebaut:// Alle liegen sie erschlagen / Auf dem Ufer hingestreckt, / Und mit seinen bangen Klagen / Hat er keinen aufgeweckt.// Einsam ruft er, unverstanden, / In die fremde Welt hinein; / Nur die Wasser hört er branden, / Keine Seele achtet sein.// Und der Wilde, der ihn schaute, / Rudert schnell am Riff vorbei: / Niemand sah, dem es nicht graute, / Den Aturenpapagei.
sk/ Erstaunlich, und sehr schön. Aber auch unheimlich. Zu meinen Phantasien von einem angenehmen Alter gehört seit langem die Vorstellung: Einen Hund müßte man sich zulegen, und wenn keinen Hund, dann einen Papageien. Nicht daß ich viele Erlebnisse mit Papageien gehabt hätte. An eines aber kann ich mich erinnern, es war in Wustrow an der Ostsee. Ich ging in eine Kneipe, die ein Mann führte, der mal zur See gefahren war. Ich setzte mich in den Gartentrakt und wartete auf den Kellner, und plötzlich hörte ich aus dem Gebüsch schreien: «Ein Bier, ein Bier.» Das war ein Papagei.
Ich dachte immer, Papageien hätten nur mimetische Intelligenz. Doch der Unterschied zum Hund bleibt. Hunde verstehen, wie uns zumute ist, Papageien nicht. Andererseits verstand der Papagei von Wustrow durchaus, wonach mir war, nach Bier.
dk/