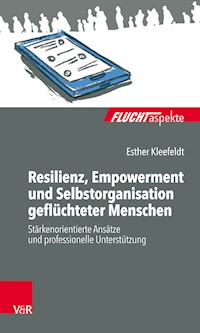
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fluchtaspekte.
- Sprache: Deutsch
Bergen Konzepte wie Resilienz, Empowerment und Selbstorganisation einen Mehrwert für die Arbeit mit geflüchteten Menschen? Oder können sie sogar Schaden anrichten, wie kritische Stimmen behaupten? Existiert innerhalb dieses Spannungsfelds ein Spielraum, der genutzt werden kann, um hilfreich zu begleiten? Falls ja, welche Einflussfaktoren gibt es? Sind sie in der Person angelegt oder umweltbedingt, statisch oder variabel? Einschneidende Lebensereignisse, insbesondere traumatischer Art, hinterlassen Spuren. Sie bleiben als Erinnerung, selbst dann, wenn sie keinen belastenden Einfluss mehr auf die Gegenwart haben. Gemeisterte Herausforderungen und überlebte Gefahren führen aber auch zu persönlichem Wachstum. Daher kann es nicht darum gehen, unverändert daraus hervorzugehen. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob es gelingt, neue Perspektiven zu entwickeln. Geflüchtete müssen ihr Leben im Exil, ihr Selbst- und Weltbild neu organisieren und eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellen. Helfende können dazu beitragen, Neuorganisationsprozesse anzustoßen, indem sie Voraussetzungen dafür schaffen, dass Selbsthilfe- und Selbstheilungskräfte ihre Wirkung entfalten können. Konzepte wie Resilienz, Empowerment und Selbstorganisation sind in diesem Zusammenhang hilfreich, wenn sie als Prozesse betrachtet werden und soziale, gesellschaftliche und politische Kontexte einbeziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geflüchtete Menschen psychosozialunterstützen und begleiten
Herausgegeben von
Maximiliane Brandmaier
Barbara Bräutigam
Silke Birgitta Gahleitner
Dorothea Zimmermann
Esther Kleefeldt
Resilienz, Empowermentund Selbstorganisationgeflüchteter Menschen
Stärkenorientierte Ansätze undprofessionelle Unterstützung
Vandenhoeck & Ruprecht
Herzlichen Dank an Anne Büttcher für ihre wertvollenRückmeldungen und kritischen Fragen zu diesem Buch.
Mit 3 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildung: Nadine Scherer
ISBN 978-3-647-90089-6
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage
www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Reihenredaktion: Silke Strupat
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Inhalt
Geleitwort der Reihenherausgeberinnen
1Vorwort
2Traumatische Lebensereignisse und ihre Folgen
2.1Traumatisch oder traumatisierend?
2.2Negative, neutrale und positive Folgen traumatischer Erlebnisse
3Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
3.1Salutogenese, Kohärenz und Sinnhaftigkeit
3.2Resilienz als positive Folge – Symptome als Resilienz
3.3Posttraumatisches Wachstum
4Resilienz
4.1Das Konzept der Resilienz
4.2Kann man Resilienz messen?
4.3Resilienzfaktoren
4.4Geflüchtete: traumatisiert, vulnerabel oder resilient?
5Empowerment und Selbstorganisation
5.1Empowerment als Förderung ungewöhnlicher Möglichkeiten
5.2Resilienz als Reorganisation alltäglicher Prozesse
5.3Hilfe zur Selbstheilung
6Stärkenorientierte Ansätze: Fluch oder Segen?
6.1Gesellschaftliche, politische und soziale Aspekte stärkenorientierter Ansätze
6.2Resilienz und Co.: Risiken und Nebenwirkungen
7Sinn und Unsinn stärkenorientierter Ansätze
7.1Die Frage nach dem Sinn des Lebens
7.2Nicht auf die Verpackung, auf den Inhalt kommt es an
7.3Ordnung im Chaos: Wie hängen die Konzepte zusammen?
7.4Was hilft, was schadet, was ist unnötig in der Arbeit mit Geflüchteten?
8Die praktische Arbeit mit stärkenorientierten Ansätzen
8.1Resilienz stärken?
8.2Einen Möglichkeitsraum schaffen
8.3Hilfreiche Haltungen und Herangehensweisen
9Resilienz, Empowerment, Selbstorganisation – Schlussfolgerungen
10Literatur
Geleitwort der Reihenherausgeberinnen
Im Bereich traumatischer Belastungen von Resilienz und Stärkenorientierung zu sprechen, ist ein gewagtes Unternehmen. Der Grat zwischen Ressourcenorientierung und der Gefahr, Traumabetroffenen die Verantwortung für ihr Wohlergehen selbst aufzubürden, ist schmal. Esther Kleefeldt gelingt es mit diesem Buch, eine spannende Analyse des Resilienz- und Empowermentskonzepts in Bezug auf die konkrete Arbeit mit Geflüchteten vorzustellen. Vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrung bei XENION, einem psychotherapeutischen Beratungs- und Behandlungszentrum für traumatisierte Flüchtlinge und Überlebende von Folter und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen, macht sie deutlich, wie sehr die Wirksamkeit der Resilienzfaktoren von der jeweiligen Lebenssituation abhängt.
Mit viel Respekt für die Dynamik der Traumafolgesymptomatik verfolgt die Autorin konsequent die Frage, wie ein Möglichkeitsraum zur Veränderung und zu posttraumatischen Wachstum behutsam hergestellt werden kann. Ihre Überlegungen bewegen sich dabei eng an salutogenetischen Konzepten und formulieren den »Kohärenzsinn« auf eine Weise, die »Vorwärtsbewegung hin zu einem neuen Gleichgewicht« ermöglicht. Das allerdings ist schwere Arbeit für alle Beteiligten. Zentral ist dafür eine konsequente Haltung des psychosoziale Unterstützungssystems, die in jeder Phase der notwendigen Hilfe die Selbstbestimmung und -wirksamkeit würdigt sowie die Selbstheilungskräfte fördert und als unabdingbare Teile des Prozesses im Blick behält.
Die von Esther Kleefeldt entwickelte »Formel«
lässt keinen Zweifel daran aufkommen, wie stark individuelle Ressourcen in den Kontext von gesellschaftlichen Bedingungen zu stellen sind und welchen wesentlichen Einfluss auf den Prozess der Resilienz die Interaktion mit der Umwelt hat. Folglich sind geflüchtete Menschen zugleich besonders vulnerabel, aber auch besonders resilient – eine »explosive Mischung«, die besondere Ansprüche an die Unterstützer/-innen stellt, einen Raum zu eröffnen, in dem Risiken minimiert und Chancen fachgerecht zur Verfügung gestellt werden müssen.
Wir würden uns freuen, wenn es gelingt, mit diesem Buch den gesellschaftspolitisch verantwortlichen Umgang mit dem Konzept der Resilienz zu fördern und Interessierten zur Verfügung zu stellen.
Dorothea Zimmermann
Silke Birgitta Gahleitner
Maximiliane Brandmaier
Barbara Bräutigam
1Vorwort
Das Leben ist so: Du wirst hineingeworfen wie in ein kaltes Wasser, ungefragt, ob du willst oder nicht. Du kommst lebend nicht mehr heraus.
Darüber kannst du:
a)unglücklich sein und ersaufen;
b)dich lustlos und frierend so lange über Wasser halten, bis es vorbei ist;
c)einen Sinn suchen und einfordern und dich grämen, wenn er sich nicht zeigt.
Oder du kannst:
d)dich darin voller Freude tummeln wie ein Fisch und sagen: »Ich wollte sowieso ins Wasser, kaltes Wasser ist meine Leidenschaft. Was für ein verdammt schönes Vergnügen, Leute!«
Und das wäre die Kunst, um die es hier geht.
(aus: Janosch, Wörterbuch der Lebenskunst, Gifkendorf 2016, © Janosch/Little Tiger Verlag, Gifkendorf)
Dieser Band handelt von Geflüchteten, die hohen Belastungen und traumatischen Lebensereignissen ausgesetzt waren und sind. Sie sind nicht einfach in kaltes Wasser geworfen worden. Sie sind untergetaucht worden und fast ertrunken. Aber nur fast. Sie haben überlebt und es bis nach Deutschland geschafft. Obwohl es oft uniform ausweglos erscheint, gestaltet sich das kalte Wasser in jeder individuellen Lebensrealität anders. Es stellt keine absolute Größe dar, sondern ein Kontinuum, auf dem sich alle Menschen tummeln. Das heißt nicht, dass die ungerecht verteilten Ausgangsbedingungen und von Menschen verursachten traumatischen Lebensereignisse hingenommen werden müssen oder sollten, sondern eben das genaue Gegenteil: Es gibt einen Gestaltungsspielraum, der genutzt werden kann – trotz alledem. Und das wäre das Thema, um das es hier geht.
2Traumatische Lebensereignisse und ihre Folgen
2.1Traumatisch oder traumatisierend?
Der Begriff Trauma stammt aus dem Griechischen. Er bedeutet Wunde. Ein psychisches Trauma ist also eine Wunde an der Seele. Nimmt man die Wundenanalogie als Grundlage, so kann man davon ausgehen, dass die Seele durch Ereignisse verletzt wird, die das Ertragbare, Verkraftbare übersteigen. Dann ist da eine Wunde, die Schmerz und Leid erzeugt. Die Seele besitzt wie der Körper Selbstheilungskräfte. Eine seelische Wunde kann heilen und tut dies auch im Normalfall. Hierfür benötigt sie jedoch gute Bedingungen: Ruhe, Sicherheit, soziale Unterstützung, unter Umständen professionelle Unterstützung. Liegen diese Bedingungen nicht vor, so findet keine Heilung statt. Die Wunde bleibt offen, schmerzt, wird vielleicht sogar größer und beeinträchtigt das Leben oft gravierend. Gelingt die Heilung jedoch, bleibt eine Narbe an der Seele. Diese verblasst mit den Jahren, vergeht aber nicht. Die Seele ist nie mehr dieselbe wie vor der Verletzung. Mit der Narbe kann man aber leben. Die meiste Zeit denkt man nicht an sie. Nur wenn der Blick zufällig auf sie fällt, wird man an ihre Geschichte erinnert. Vielleicht schmerzt sie auch bei Wetterumschwüngen etwas. Sie schränkt das Leben jedoch nicht mehr ein und verursacht kein Leid in der Gegenwart.
Trotz der eindeutigen Wortbedeutung ist psychisches Trauma ein in Praxis und Theorie schwer zu definierendes Konzept (Mlodoch, 2017). Unklar ist beispielsweise, ob mit Trauma das Ereignis oder die Folgen oder mal das eine, mal das andere bezeichnet werden. Nach der ursprünglichen Wortbedeutung ist die Wunde die Folge des Ereignisses. Oft wird jedoch davon gesprochen, ein Trauma erlebt zu haben, gemeint ist dann das Ereignis. Korrekterweise müsste man stets klar »zwischen traumatischer Situation, Trauma und Traumasymptomen unterscheiden« (Becker, 2014, S. 108).
Strittig ist auch, was als traumatisches Ereignis gelten kann oder sollte und was nicht. Papadopoulos (2006) beschreibt »adversity« (Widrigkeit), wie er es nennt, wie eine Krise, ein Ereignis oder Zustand, der instabil ist und Lebenspläne und Vorhaben abrupt beendet. Betroffene haben das Gefühl, dass dies das Ende ihres Lebens ist, sehen keine Möglichkeit, weiterzuleben. Nach derartigen Ereignissen kann das Leben nicht mehr so sein wie früher. Es besteht das Risiko, krank zu werden und daran zu zerbrechen. Es besteht aber auch die Chance, daran zu wachsen, über sich hinauszuwachsen (siehe Kapitel 3.3 zum posttraumatischen Wachstum). Was genau ist es aber, das traumatische von belastenden Lebensereignissen unterscheidet? Welches Ausmaß muss eine Belastung annehmen, um als traumatisches Ereignis zu gelten? Auch die diagnostischen Manuale ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) und DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) tun sich da schwer und haben ihre Definitionen jeweils vom DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) zum DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) und auch vom ICD-10 (World Health Organisation, 1993) zum ICD-11 (World Health Organisation, in Vorbereitung) verändert. Im aktuellen DSM-5 lautet die Definition: »Die Person war mit einem der folgenden Ereignissen konfrontiert: Tod, tödlicher Bedrohung, schwerer Verletzung, angedrohter schwerer Verletzung, sexueller Gewalt, angedrohter sexueller Gewalt, und zwar in einer der nachfolgenden Weisen (mindestens eine): Direkt ausgesetzt, als Augenzeuge, indirekt; erfahren, dass ein naher Verwandter oder ein Freund einem traumatischen Ereignis ausgesetzt war. Wenn dieses Ereignis ein Todesfall oder eine tödliche Bedrohung war, dann musste dieser bzw. diese die Folge von Gewalt oder eines Unfalles gewesen sein, Konfrontation mit Details von traumatischen Ereignissen (z. B. als Ersthelfer, Polizist …).« Der ICD-10 spricht von »einem belastenden Ereignis oder einer Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde«.
Einerseits umfassen Definitionen traumatischer Ereignisse eine Vielzahl von Ereignissen. Andererseits bergen sie die Gefahr, Betroffene als homogene Gruppe zu betrachten (Papadopoulos, 2006). Sie verleiten dazu, davon auszugehen, dass ein und dasselbe Ereignis bei unterschiedlichen Personen zu denselben Konsequenzen führt oder auf traumatische Ereignisse aller Art stets mit ähnlichen Symptomen reagiert wird. Das ist nicht der Fall. Jeder Mensch nimmt Ereignisse auf einzigartige Weise wahr, interpretiert sie auf seine Weise und reagiert darauf individuell. Traumatische Erlebnisse, so schwerwiegend sie auch sind, stellen immer nur einen Faktor unter vielen dar, die über die Konsequenzen bestimmen. Ereignisse können nicht von vornherein als traumatisch oder nicht traumatisch bezeichnet werden. Dies würde die pathologische Interpretation, dass alle von ihnen Betroffenen traumatisiert sind, gleich mit beinhalten. Stattdessen sollte besser von potenziell traumatisierenden Ereignissen (PTE) gesprochen werden (Bonanno, Westphal u. Mancini, 2011), die in Abhängigkeit von anderen Faktoren zu negativen Traumafolgen führen können, aber nicht müssen.1 Es gibt daher keine einfache Dichotomie zwischen traumaauslösenden Ereignissen und solchen, die dies nicht tun (sollten). Traumafolgen sind immer eine komplexe Funktion multipler traumatischer und nicht traumatischer Lebensereignisse und anderer Faktoren.
Ein sehr wichtiger Faktor ist die Flucht. Flucht ist immer ein einschneidendes Lebensereignis, oft traumatischer Art. Aber nicht jeder Geflüchtete leidet unter Traumafolgesymptomen und entwickelt eine Posttraumatische Belastungsstörung oder eine andere Traumafolgestörung. Psychische Reaktionen und Arten des Umgangs variieren enorm. So entsteht meist ein Gefühl der eklatanten Überforderung bei gleichzeitiger Anpassung an die neuen Lebensbedingungen. Pathologische Reaktionen sind nur eine von vielen möglichen Entwicklungen, die Geflüchtete im Exilland nehmen können.
Sollte Trauma als seelische Wunde dann überhaupt am Ereignis festgemacht werden? Wenn sowieso keine interindividuelle Vergleichbarkeit hergestellt werden kann, würde es dann nicht genügen, ausschließlich die Auswirkungen zu betrachten? In der Praxis macht es tatsächlich Sinn, mit Trauma als Folgen zu arbeiten. Denn es sind die Folgen, mit denen Geflüchtete zu uns kommen. »Trauma« sollte auch kein Etikett sein, das für alle Zeiten an einer Person klebt und diese charakterisiert. Es ist die normale Folge von unnormalen Ereignissen in der Vergangenheit und als solche veränderbar. Menschen »sind« nicht ein und für alle Mal traumatisiert, sondern sie leiden unter Traumafolgesymptomen, die mit der Zeit ab- oder zunehmen, sich verändern und ganz verschwinden können. Traumatische Ereignisse in der Vergangenheit bleiben als Erinnerung, kontrollieren aber nicht Gegenwart und Zukunft. Viele andere Faktoren tragen dazu bei, wie das Leben verläuft. Hierbei sollten Traumaerfahrungen und -folgen weder negiert noch kleingeredet werden. Vielmehr sollte ihnen ein sinnvoller, »gesunder« Platz im komplexen Gefüge zugewiesen werden.





























