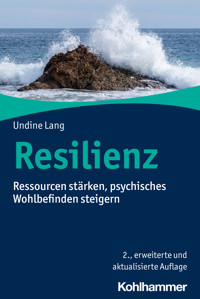
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Psychische Krisen sind normal, heute leidet jeder zweite Mensch im Lauf des Lebens an einer psychischen Erkrankung. In der Therapie stellt sich ein Paradigmenwechsel ein, bei dem es weniger um die Bekämpfung von Symptomen als vielmehr um die Stärkung von Ressourcen geht. Immer mehr Studien zeigen, dass die psychische Flexibilität, die Rolle der eigenen Werte, Achtsamkeit und Life-Style-Faktoren wie etwa das soziale Netzwerk den Verlauf psychischer Erkrankungen verbessern können. In diesem Buch werden neben der inneren Haltung wichtige Verhaltensaspekte und äußere Schutzfaktoren aufgezeigt, die helfen, die psychische und körperliche Gesundheit zu stützen. Für die 2. Auflage sind Erkenntnisse aus der Coronakrise zusammengefasst, die das Konzept der Resilienz bestärkt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Die Autorin
Prof. Dr. med. Undine Lang leitet die Klinik für Erwachsene und Privatklinik der Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel (UPK). Sie forscht und lehrt dort als Professorin für das Fach Psychiatrie und Psychotherapie.
Undine Lang
Resilienz
Ressourcen stärken, psychisches Wohlbefinden steigern
2., überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
2., überarbeitete Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-041186-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-041187-6
epub: ISBN 978-3-17-041188-3
Inhalt
Vorwort
Teil 1 Wie wirken sich Faktoren auf die psychische Gesundheit aus?
Einführung
Der Einfluss einer Krise: Wie wirkte sich die COVID-19-Pandemie auf die Resilienz aus?
Weiblichkeit
Die Umgebung
Das Land
Verdienst
Paarbeziehungen
Kinder
Der Arbeitsplatz
Die Stigmatisierung
Körperliche Gesundheit
Das Alter
Teil 2 Wie wirkt sich das Verhalten auf die psychische Gesundheit aus?
Einführung
Sport
Spiritualität
Kontakt zu Tieren
Ernährung
Vertrauen in die Therapie
Die Digitalisierung
Computerspiele
Hobbies
Entspannung und Meditation
Freundschaften
Schlaf
Licht
Die Rolle der Mimik
Teil 3 Wie wirkt sich die innere Haltung auf die psychische Gesundheit aus?
Einführung
Präsenz
Die Bewertung des Glücks
Entschärfen von Gedanken
Akzeptanz von Gefühlen
Umsetzen von Zielen
Verfolgen von Werten
Optimismus
Neugier
Dankbarkeit
Empathie und Altruismus
Aktive Entscheidungen treffen
Entscheidungen tragen
Humor
Vergeben können
Motivation
Umgang mit Krisen
Die Bewertung von psychischen Erkrankungen
Selbstbewusstsein
Lebenssinn
Danksagung
Literatur
Vorwort
Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens mindestens eine schwere Krise erleben. Nicht jeder, der eine Krise erlebt, wird auch psychisch krank. Psychische Erkrankungen betreffen bis zu 50 % der Menschen. Die psychiatrische Therapie ist heute sehr erfolgreich: Etwa 80 % der psychischen Erkrankungen können innerhalb von Wochen wirksam behandelt werden. Ein großer Teil dieser Erkrankungen wird im weiteren Leben nie wieder auftreten. Insbesondere die Psychotherapie hat in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt: Sie wirkt nachhaltig und verdoppelt bei den meisten Erkrankungen, wenn sie spezifisch eingesetzt wird, die Erfolgsrate der Behandlung. Psychotherapie führt auch bei körperlichen Erkrankungen zu einer Besserung.
Für Betroffene ist es nicht nur wichtig, dass ihre Krankheitssymptome bekämpft werden oder dass verhindert wird, dass diese wieder auftreten. Ein wichtiges Anliegen ist ihnen auch, dass sie ihre Stärken ausbauen können und dass sie diese überhaupt wahrnehmen. Dass ihre gesunden Anteile mehr in den Vordergrund rücken. Es ist also bedeutsam, dass der Fokus nicht nur darauf liegt, was durch Krisen verloren wird, sondern auch darauf, was Krisen bewirken können, welche Chancen sie beinhalten. Viele Betroffene möchten gerne weg von einem Defizitblick, der analysiert, was ihnen fehlt und was ihnen passieren könnte. Stattdessen wollen sie die Aufmerksamkeit lieber darauf richten, was sie erreichen können, was sie schaffen werden und was gesund an ihnen ist. Betroffene möchten wissen, wie sie selbst daran arbeiten können, widerstandsfähiger zu werden, stärker und glücklicher. Sie möchten gerne wissen, was sie selber tun können, um Rückfälle zu verhindern, Krisen besser zu meistern und ihr Wohlbefinden zu steigern. Ihnen ist bewusst, dass Wohlbefinden dabei nicht unbedingt immer die Abwesenheit von Symptomen bedeutet. Sie möchten wissen, was sie schützen kann, welche Umgebungsfaktoren sie vielleicht schwächen und wie sie aktiv zu ihrer Stabilität beitragen können. Viele Betroffene wünschen sich, dass psychische Erkrankungen genauso wahrgenommen und behandelt werden wie körperliche Erkrankungen und dass deren Behandlung entsprechend ganzheitlich und integrativ als Teil des normalen Lebens erfolgt.
Martin Seligman vertritt die Hypothese, dass ein Problem der Psychiatrie darin besteht, dass sie vor allem studiert und analysiert, was »falsch« mit den Menschen ist, anstatt sich darauf zu fokussieren, was Menschen richtig machen und was sie stark macht. Auch wir Ärzt:innen wissen, dass wir unseren Patient:innen nur bis zu einem gewissen Punkt helfen können und dass es besser und erfolgsversprechender ist, wenn Patientinnen und Patienten in der Behandlung mitarbeiten, mitdenken, mitverantworten und mitentscheiden, in dem Rahmen, in dem sie es vermögen. Gerade bei chronischen Erkrankungen ist es wichtig, dass Menschen ihren eigenen Weg finden und ihre eigenen Entscheidungen treffen, wie sie mit der Erkrankung umgehen wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man seine Biologie und seine Physiologie im positiven Sinn beeinflussen kann. Es ist wertvoll, Möglichkeiten zu haben und auf Angebote zurückgreifen zu können, die Menschen befähigen, sich ein Leben lang selbst an ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden zu beteiligen.
Geschrieben habe ich dieses Buch, um unser heutiges, durch wissenschaftliche Studien gesichertes Wissen zur Resilienz darzustellen und damit möglichst konkrete Hinweise dafür zu liefern, was uns Menschen helfen könnte, psychisch gesund zu bleiben. Resilienz heißt nicht, unverwundbar zu sein und keine Schwächen und keine Krankheitssymptome zu haben. Resilienz ist uns nicht gegeben oder genommen, sie ist vielmehr lernbar und hilft uns, Krisen einfacher zu überwinden.
Teil 1 Wie wirken sich Faktoren auf die psychische Gesundheit aus?
Einführung
Viele äußere Faktoren können Menschen vor psychischen Erkrankungen schützen. Das heißt nicht gleichzeitig, dass sie automatisch das empfundene Glück und Wohlbefinden beeinflussen oder definieren. Das heißt auch nicht, dass es automatisch ein Problem darstellt, wenn sie abhandengekommen sind oder fehlen. Diese Umgebungsfaktoren machen es einfach leichter, in Krisen zu navigieren und Probleme zu lösen. Sie ermöglichen uns mehr Optionen und mehr Spielraum, wenn Probleme auftreten. Sie stellen eine Art Backup dar, wenn im Leben Krisen auftreten, und stärken uns dann den Rücken. Wenn sich diese äußeren Umstände verändern, heißt das nicht automatisch, dass das Leben aus dem Ruder läuft, im positiven und im negativen Sinn. Sie sind wie eine Art Rettungsboot. Ein Schiff muss nicht kentern, wenn es über kein Rettungsboot verfügt. Wenn es aber kentert, kann ein Rettungsboot hilfreich sein. Im Vorfeld von Krisen wird die Wichtigkeit von Umgebungsbedingungen eher überschätzt. Eine neue Studie zeigte, dass Menschen die Bedeutung von Lebensereignissen wie Arbeitslosigkeit, Verlust des Partners, Krankheit, Scheidung, Heirat und Trennung im Vorfeld eher überschätzen und ihre Anpassungsfähigkeit an eine veränderte Lebenssituation eher unterschätzen, das heißt, sie gehen davon aus, dass sie sich an eine neue Situation nicht anpassen können (Odermatt und Stutzer 2019). Zu einem ähnlichen Schluss gelangt auch eine Untersuchung, die viele Jahre zurück liegt. Diese Beobachtung aus dem Jahre 1978 zeigte, dass sich das Leben von Menschen ein Jahr nach einer Querschnittslähmung oder ein Jahr nach einem Lottogewinn zwar gravierend verändert hatte, die grundsätzliche Lebenszufriedenheit erlangte jedoch wieder genau den Wert, den sie schon vor diesen einschneidenden Lebensereignissen hatte (Brickmann et al. 1978).
Wir streben also vieles im Leben an, was unser Leben letztlich nicht derart bereichert und stabilisiert, wie wir uns das im Vorfeld vorstellen. Umgekehrt sind Menschen sehr anpassungsfähig und die Zufriedenheit und das Wohlbefinden kann sich wie eine Klimaanlage immer wieder auf neue Umgebungsvariablen einstellen.
Was sind diese äußeren Variablen, die einen Schutz vor psychischen Krisen darstellen können? Allgemeine Krisen wie – exemplarisch betrachtet – die Coronapandemie fordern die Resilienz und schwächen die psychische Gesundheit, so gilt es auch für die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Einer der wichtigsten Schutzfaktoren vor psychischen Erkrankungen ist ein Arbeitsplatz. Wenn jemand keine Arbeit hat, kann das Risiko für Suizide um das Neunfache ansteigen. Auch glücklich verheiratet zu sein, schützt vor psychischen Erkrankungen, Männer mehr als Frauen. Frauen sind häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen als Männer. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen in der Stadt leben, ist es gut zu wissen, dass Grünflächen und ruhigere Zonen in Städten vor psychischen Erkrankungen schützen. Auch das Leben auf dem Land schützt die psychische Gesundheit. Körperliche Gesundheit ist ein weiterer Schutzfaktor: Körperliche Erkrankungen erhöhen das Risiko für psychische Erkrankungen und psychische Erkrankungen erhöhen das Risiko für körperliche Erkrankungen. Fortschreitendes Alter ist ebenfalls ein Schutzfaktor, auch wenn im Alter mehr psychische Erkrankungen vorkommen. Die höchste Lebenszufriedenheit erreichen Menschen statistisch betrachtet zwischen ihrem 65. und 74. Lebensjahr. All diese äußeren Faktoren bilden unser »Lebens-Setup«, sie können Gesundheitsrisiken darstellen, wenn sie wegbrechen und uns in Krisenzeiten stärken und vor psychischen Erkrankungen schützen.
Der Einfluss einer Krise: Wie wirkte sich die COVID-19-Pandemie auf die Resilienz aus?
In der Pandemie haben sich bekannte Resilienzfaktoren als wichtig erhärtet und es wurden Maßnahmen erarbeitet, die Resilienz zu verbessern.
Elisabeth arbeitet als technische Assistentin in einem Labor, sie lebt alleine und ihre große Leidenschaft sind ihre Pferde, die sie jedes Wochenende besucht, wenn sie zu ihren Eltern nach Frankreich auf einen Bio-Bauernhof fährt, wo sie aushilft.1In ihrem Beruf ist sie sehr exakt, sie arbeitet immer sehr akribisch und präzise und noch nie ist ihr ein Fehler unterlaufen. Versuchsanordnungen zu kontrollieren macht ihr Freude, es ist für sie eine Art Meditation, immer wieder Messungen zu optimieren, Geräte genau zu justieren und Messergebnisse aufs exakteste zu reproduzieren. Sie genießt ein hohes Ansehen im Labor, weil sie zuverlässig ist, ruhig und ausgeglichen und auch für andere Mitarbeiter:innen immer wieder komplizierte Aufgaben löst und diese dann übernimmt. Als die Pandemie beginnt, erlebt es Elisabeth wie den Beginn eines Filmes und über ihrem ganzen Leben breitet sich eine Unwirklichkeit aus, sie hat das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Zuerst kam dieses diffuse Gefühl von Angst, dann kamen die Corona-Regeln und Maßnahmen gegen die Pandemie und die Unmöglichkeit, den Grenzübergang zu passieren, sodass sie die Pferde nicht mehr besuchen konnte. Der Anfahrtsweg war einfach zu lang für einen Tagesausflug. Sie sah ihre Eltern nicht mehr. Einkaufen gehen war kaum noch möglich, da sie Angst hatte, Lebensmittel zu berühren, die bereits andere Menschen angefasst hatten. Im Labor begann sie nun schrittweise, ihre Arbeitsschritte mehrmals zu kontrollieren, die Flächen wurden mehrmals desinfiziert, die Geräte bediente sie nur noch mit Handschuhen, sie konnte Türklinken nicht mehr berühren aus Angst, sich zu infizieren und auch die Haltestangen in der Straßenbahn. Dazu kamen quälende und unnütze Gedanken, sie könnte Reagenzgläser zerschlagen und mit den Scherben andere verletzen, sie könnte Reagenzien ausschütten und andere verätzen oder sie selbst könnte andere Menschen infizieren und Keime aus dem Labor übertragen. Durch die Gedanken war sie wie blockiert, sie konnte sich kaum noch konzentrieren und um sich abzusichern führte sie Protokoll über alles, was sie machte und wiederholte fast alle Aufgaben ein Dutzend Mal. Für einen Moment schaffte es Elisabeth, ihre Angst durch diese Rituale zu reduzieren, die sie immer wiederholen musste, um sich für einen Moment zu entlasten. Am Anfang waren es Minuten am Tag, die sie durch die Wiederholung ihrer Sauberkeitsrituale verlor, doch je größer die Angst wurde, desto länger musste sie diese neutralisieren, indem sie immer wieder das Gleiche machte, es war wirklich stupide. Die Rituale weiteten sich auf mehrere Stunden täglich aus und sie konnte ihr Pensum kaum noch schaffen. Durch eine Medienkampagne erfuhr sie, dass viele Menschen in der Pandemie eine psychische Krise erlebten und sie rief bei der eingeblendeten Hotline an. Schon wenige Wochen nach Beginn der Symptome begab sie sich dann in eine ambulante Psychotherapie und schaffte es, ihre Symptome in den Griff zu bekommen.
In großen Untersuchungen bei bis zu 250 000 Teilnehmer:innen zeigten sich bei etwa einem Drittel der befragten Menschen während der COVID-19-Pandemie depressive Symptome, Angstsymptome, Stresssymptome oder auch Schlaflosigkeit (Wu et al. 2020).
In verschiedenen Untersuchungen wurden größere Bevölkerungsgruppen befragt, wie resilient sie mit der Krise umgehen können und dabei jene Faktoren analysiert, die in Resilienzfragebögen üblicherweise gemessen werden. Verschiedene Resilienzskalen wurden angewandt, allgemein wurden grundlegende Faktoren analysiert, die mit Resilienz verbunden werden.
Das beinhaltet zum Beispiel das Ausmaß der Kontrolle, die jemand über eine Situation zu haben empfindet. Auch spielen soziale Kompetenz und Unterstützung eine Rolle. Ein weiterer Aspekt ist, wie viel Vertrauen jemand in die Zukunft (oder auch die Mitmenschen) hat, hier ist auch Spiritualität ein Anker, nach dem gefragt wurde. Relevant für die persönliche Resilienz wurde auch der Zusammenhalt innerhalb von Familien versus dem Gefühl von Einsamkeit bewertet. Ob jemand Ziele hat und eigene Visionen für sein Leben spielt dabei eine Rolle genauso wie, ob er diese aktiv und selbstwirksam verfolgen kann. Auch Eigenschaften wie Gelassenheit, Akzeptanz von Veränderungen, Humor, Eigenständigkeit, Ausdauer oder Vernunft werden in Resilienzskalen evaluiert, wie Menschen konkret leben, ob sie eine Alltagsstruktur haben oder körperlich gesund sind. Eine große Rolle spielt, ob man seinem Leben einen Sinn zu geben vermag.
Allgemein zeigte sich während der Pandemie, dass das psychische Wohlbefinden sich verschlechterte je mehr die Betroffenen sich Sorgen um die Pandemie machten, je mehr Schutzmaßnahmen sie ergriffen und je höher ihr subjektives Ansteckungsrisiko war (Luo et al. 2021).
Je mehr sich Menschen über Corona in den neuen Medien informierten desto größer wurde ihr Stressempfinden (Luo et al. 2021). Ein »problematischer Facebook Konsum« kommt allgemein bei etwa 2–10 % der Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor und dieser korreliert mit mehr Angst, Depression und psychologischem Stress (Marino et al. 2018).
In der Pandemie konnte man auch beobachten, wie wichtig die Rolle des Schlafes für die Stressverarbeitung und psychische Gesundheit ist, so war der Schlaf ganz klar mit allgemeinen Resilienzfaktoren korreliert. Wie auch bei verschiedenen psychischen Erkrankungen bereits beschrieben, gingen Schlafstörungen einer eher schlechteren Stressverarbeitung während der Pandemie voraus (Lenzo et al. 2022).
Auch eine Reduktion der körperlichen Aktivität war mit mehr Stresssymptomen verbunden. Umgekehrt wurde bei einer Steigerung der körperlichen Aktivität weniger Stressempfinden beobachtet (Radino et al. 2022). Je größer die Reduktion der körperlichen Aktivität während der Pandemie war, desto mehr stressassoziierte Symptome traten auf. Menschen, die sich bereits vor der Pandemie wenig bewegten, zeigten größere psychologische Beeinträchtigungen. Interessanterweise konnte beobachtet werden, dass Menschen in der zweiten Welle der Pandemie – auch wenn sie sich wenig bewegten – resilienter waren als in der ersten Welle der Pandemie (Radino et al. 2022).
Wenn Menschen allgemein Unsicherheit schlecht ertrugen und wenig sozialen Support hatten, bzw. sich einsam fühlten, waren psychologische Beeinträchtigungen in der Pandemie stärker ausgeprägt (de Sousa et al. 2021). Während Einsamkeit und Langeweile also einen Risikofaktor während der Pandemie darstellten, schützte Extraversion in der Krise (Tutzer et al. 2021).
Männer schienen in der Pandemie resilienter zu sein als Frauen und ältere Menschen mehr als jüngere, was sich mit bisherigen Untersuchungen deckt. Andere Faktoren, die in früheren Studien mit erhöhter Resilienz einhergingen, schienen sich in der COVID-19-Pandemie jedoch nicht so stark oder gar nicht auszuwirken, zum Beispiel, ob jemand auf dem Land lebt, welche Ausbildung er/sie hat, das Einkommen sowie allgemeine Lebensumstände (Valiente et al. 2021).
Antonovsky hat in den 1980er Jahren das Kohärenzgefühl als wichtigen Faktor der seelischen Gesundheit definiert. Dieses Gefühl besagt, dass eine Person, die die Zusammenhänge des Lebens versteht, überzeugt ist, diese gestalten zu können und an den Sinn des Lebens glaubt. Auch während der Coronakrise zeigte sich, dass das Kohärenzgefühl mit dem subjektiven Wohlbefinden und weniger Belastung in allen Bereichen korrelierte (Matic et al. 2021).
Auch zeigte sich, dass Menschen, die über eine erhöhte Resilienz, Optimismus, Selbstbewusstsein oder auch Lebenszufriedenheit verfügten, weniger dazu neigten, in der Krise auf einen ungesunden Ernährungsstil zurückzugreifen (Robert et al. 2021). Ein positiver Beurteilungsstil, eine insgesamt hedonistische Einstellung, «sich seines Lebens zu erfreuen» und auch hedonistisches Lernen schützten eher vor psychischem Stress während der Pandemie (Daniels et al. 2021).
Zusammenfassend hat sich während der COVID-19-Pandemie gezeigt, dass verschiedenste Aspekte der positiven Psychologie, u. a. auch die Fähigkeit zur Präsenz, Freude, das Gefühl von Sinn und Optimismus vor psychischen Einbrüchen schützen (Lasota et al. 2021).
Was sind Quellen für eine bessere Bewältigung von Krisen? In der Pandemie konnten drei Ressourcen definiert werden, zum einen persönliche, zum anderen strukturelle und zum dritten beziehungsbezogene Faktoren. Ein positives Mindset, das Gefühl einer Bestimmung und Selbstfürsorge spielen bei der persönlichen Komponente eine Rolle. In Beziehungen sind es Altruismus, Teamwork, soziale Unterstützung durch die Familie und ein bestehender Freundeskreis, die einen Schutzfaktor darstellen. Am Arbeitsplatz wiederum ist es eine effektive Kommunikation, Leadership und eine effiziente Implementierung einer COVID-19-Policy. Gerade im Gesundheitswesen wurde der Wunsch laut, dass auf der persönlichen Ebene und Teamebene mehr für die Resilienz getan werden sollte (Brown et al. 2021).
Auch mit Mythen über Resilienz wurde während der Pandemie aufgeräumt. Einer dieser Mythen ist, dass ein Trauma immer in eine psychische Erkrankung mündet (PeConga et al. 2021). Beobachtungen, die acht Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center gemacht wurden ergaben, dass die überwiegende Mehrzahl der polizeilichen Ersthelfer (ca. 90 %) keine Traumafolgestörungen aufwies (Pietrzak et al. 2014, PeConga et al. 2020). Auch nach der SARS Pandemie berichteten nur 10 % des chinesischen Gesundheitspersonals über eine bleibende Symptomatik (Wu et al. 2009, PeConga et al. 2020). Obwohl die globale Pandemie COVID-19 in vielerlei Hinsicht Neuland war, lässt die Geschichte vermuten, dass langfristige Resilienz das häufigste Ergebnis sein wird. Bereits während den verschiedenen Wellen konnte eine zunehmende Resilienz beobachtet werden.
Als weiterer Mythos über Resilienz wurde definiert, dass diese gleichbedeutend mit einer stabilen, linearen Entwicklung der psychischen Gesundheit ist oder des Glücks (PeConga et al. 2020). Resilienz bedeutet jedoch nicht, dass jemand keine Trauer oder Verlustereignisse erlebt, sie beschreibt lediglich die Art, wie man mit ihnen umgeht. Jeden Tag einen Fuß vor den anderen setzen, aktiv Probleme lösen, soziale Unterstützung suchen, anderen mitteilen, dass man gerade Probleme hat, Ungewissheit tolerieren oder Hoffnung für die Zukunft entwickeln und sich einer veränderten Situation anpassen zu können sind typische Merkmale einer resilienten Reaktion (PeConga et al. 2020). Diese wurde auch durch viele Institutionen, Gesellschaften, Medien, neu entwickelte Hotlines und erarbeitete Resilienztrainings während der Pandemie aufgenommen und propagiert.
Ein weiterer Mythos nach PeConga et al. ist die Idee, dass Resilienz etwas ist, was man hat oder nicht hat. Resilienz wird tatsächlich am stärksten durch die Kultivierung von sozialer Unterstützung und adaptiver Sinngebung vorhergesagt, was darauf hindeutet, dass sie erlernt und erworben wird. Eine Krise kann also Resilienz erzeugen. Dies bedeutet für die Pandemie und zukünftige krisenhafte gesellschaftliche Herausforderungen (Kriege, Klimakrise, Biodiversitätskrise) dass Gemeinschaften Resilienz entwickeln können. In der Coronakrise zeigte sich, dass Hilfsbereitschaft entstand, es wurde gespendet, es fanden Danksagungen an das Gesundheitsfachpersonal statt und in Nachbarnetzwerken wurden Einkäufe für ältere Menschen getätigt etc. Es ist also im Rahmen der Krise soziales Kapital entstanden und konnte eingeschränkte Ressourcen abfedern und damit die Widerstandsfähigkeit gegen psychische Erkrankungen stärken.
Wenn gewöhnliche Quellen der Belohnung und Erfüllung abgeschnitten sind, können prosoziale Handlungen wie Toleranz, Unterstützung und Freundlichkeit die negativen Auswirkungen abfedern. Das Wertesystem kann und wird sich vermutlich im Kontext weiterer Krisen ändern (müssen). Dies kann auch für die Zukunft relevant werden, wenn zum Beispiel im Zuge der Klimakrise Reisen und Konsum reduziert werden müssen und kein Selbstzweck mehr sein können und wir unseren Umgang mit unserem gesunderhaltenden Ökosystem Natur hinterfragen müssen, die wir vielfach missbrauchen, zurückdrängen und vernichten.
In der Pandemie wurde erkannt, wie Resilienz effektiv in der Gesellschaft und Unternehmen erhalten werden kann, es wurde die soziale Unterstützung gefördert, stark gefährdete Menschen wurden besser erreicht und an die Maßnahmen hat man sich nicht nur gewöhnt, sondern ihnen auch etwas Gutes und ein Potenzial abgewinnen können.
Resümee
Die Coronakrise wirkte wie ein Katalysator. Die psychische Gesundheit wurde stärker thematisiert und die Sensibilität für gesunderhaltende Faktoren wurde erhöht. Auf verschiedenen Ebenen wurde erkannt und daran gearbeitet, wie die psychische Gesundheit von Menschen präventiv erhalten und verbessert werden kann.
1 Dieses sowie alle weiteren in diesem Buch abgedruckten Fallbeispiele sind fiktiv und von der Autorin auf der Grundlage ihrer langjährigen klinischen Erfahrung frei erfunden. Sollte es in einzelnen Punkten Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen geben, sind diese rein zufällig.
Weiblichkeit
Frauen leiden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an einer psychischen Erkrankung als Männer.
Michaela ist 36 Jahre alt und seit einigen Jahren als Finanzchefin erfolgreich in einem börsennotierten Unternehmen tätig. Ihr Beruf ist ihr absoluter Traumjob, sie hat einen sehr väterlichen und fürsorglichen Chef, und ihr Ehemann, der erfolgreich als Informatiker tätig ist, hat sie in ihrer Karriere bisher immer unterstützt. Michaela ist selbstbewusst und fröhlich, sie hatte nie psychische Probleme, sie hat viele Hobbies, ist sehr sportlich und hat eine gute Work-Life-Balance. Zusammen mit ihrem Mann ist sie in den letzten zehn Jahren immer wieder gerne verreist, war Segeln, Golfspielen, ist eine Weinliebhaberin und tanzt sehr gerne. Vor einigen Jahren hatte sie mit ihrem Mann vereinbart, dass sie während ihrer Ausbildung das Studium ihres Mannes finanziert und er dann später im Gegenzug die Kindererziehung übernimmt, damit Michaela direkt nach der Geburt in ihren Job, der ihr extrem wichtig ist, wieder einsteigen kann.
Nun hat Michaela vor drei Monaten ein gesundes Mädchen entbunden, ihr erstes Kind, und hatte eigentlich geplant, sofort wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Ihr Ehemann hat seine Arbeitsstelle pausiert und hat unbezahlten Urlaub genommen, das Paar ist damit auf das Gehalt von Michaela angewiesen. Als sich Michaela nun wieder auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz macht, bemerkt sie plötzlich einen starken Druck auf der Brust, ihre Atmung wird immer schneller, sie fängt an zu schwitzen, zu zittern und bekommt Herzrasen, weiche Knie und muss sich festhalten, um nicht umzukippen. Michaela hat so etwas noch nie erlebt und alarmiert den Notarzt. Der Notarzt bringt sie in die nächstgelegene Rettungsstelle. Dort wird eine ausführliche Diagnostik durchgeführt, EKG, Echokardiographie, Blutbild, EEG und eine Computertomographie. Danach kommt der konsiliarische psychosomatische Konsiliararzt zu Michaela und erklärt ihr, dass sie eine Panikattacke erlitten hat. Panikattacken seien sehr gut heilbar, bei 90 % der Menschen würde eine dreimonatige Psychotherapie wieder zur völligen Genesung führen, sagt er. Im ersten Moment ist Michaela eher erleichtert, dass weder Herz-Kreislauf, noch Schilddrüse, noch Lungenfunktion, noch Magen oder Darm irgendwelche Auffälligkeiten aufweisen. Michaela informiert ihren Arbeitgeber und nimmt sich vor, eine Woche später wieder in ihren Beruf einzusteigen. Als sie sich nach einer Woche erneut auf den Weg zur Arbeit begibt, kommt es jedoch an exakt derselben Stelle, nämlich an der Haltestelle der Straßenbahn erneut zu einer Panikattacke, die sofort beendet ist, als Michaela den Nachhauseweg zu Fuß antritt. Es ist, als ob die Panik verhindern will, dass Michaela arbeiten geht. In der Folge entwickelt Michaela eine immer größere Angst davor, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, da ihr die Panikattacken unerträglich erscheinen und sie diese um jeden Preis vermeiden will. Sie hat in dem Moment Angst, sie könnte tot umfallen oder zumindest bewusstlos werden. Die Angst verdoppelt sich also sogar: Die Angst kommt einerseits in diesen bestimmten Momenten, wo sie den Weg zur Arbeitsstelle antritt, und dann besteht zwischen diesen Momenten zusätzlich die Angst vor der Angst. Nach einigen Wochen fängt Michaela an, immer mehr Situationen zu vermeiden, an Arbeit ist gar nicht zu denken. Auch kommt es mit ihrem Ehemann zu Konflikten, da dieser anfängt, sich um die finanzielle Situation Sorgen zu machen. Ihr Arbeitgeber wird etwas ungeduldig und sie hat zusätzlich dem Baby gegenüber ein schlechtes Gewissen, wieder arbeiten zu gehen. Sie hat die Bindung zu ihrem Baby unterschätzt, als sie mit ihrem Mann ihre Zukunft geplant hatte.
Kurzerhand beschließt Michaela, sich in eine psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Dort wird sie deutlich entlastet, sie spricht endlich über sich, über ihre Gewissenskonflikte, über die Belastung, die die derzeitige Situation für sie auslöst, die finanzielle Verantwortung und Gefühle als Mutter und über die körperlichen Symptome, die ihre Angst verursacht, und über die ganze auslösende Situation. In nur wenigen Sitzungen kann die Panik wieder eingedämmt werden, Michaela lernt Entspannungstechniken und setzt sich wieder bewusst und in kleinen Schritten angstauslösenden Situationen aus. Dann wird gemeinsam mit dem Ehemann und dem Arbeitgeber eine Lösung für die weitere Zukunft vereinbart, nämlich, dass Michaela und er sich die Verantwortung für das Baby teilen. Ihr Mann steigt wieder auf Teilzeitbasis in den Beruf ein und damit kann sich Michaela um das Baby kümmern und trägt nicht die volle finanzielle Verantwortung. Die Panikattacken verschwinden so schnell, wie sie aufgetreten waren.
Etwa ein Fünftel der Bevölkerung erleidet im Lauf des Lebens eine Angsterkrankung oder Depression, diese beiden Krankheitsbilder sind die häufigsten psychischen Erkrankungen. Frauen leiden etwa doppelt so häufig an Depressionen und Angsterkrankungen als Männer, die Ursachen dafür sind nicht geklärt (Bromet et al. 2011).
Je männlicher Frauen sind, desto geringer scheint ihr Risiko zu sein, Angsterkrankungen oder Depressionen zu bekommen, je weiblicher Männer sind, desto höher scheint ihr Risiko (Angst 1999). Früher war die Alkoholabhängigkeit und der riskante Konsum von Alkohol bei Männern häufiger als bei Frauen, sie waren dreimal so häufig betroffen, hier haben jedoch die Frauen »aufgeholt« und sind in den jüngeren Jahrgängen ab etwa 1966 fast genauso häufig betroffen wie Männer (Slade et al. 2016). Bei den sehr selten in der Bevölkerung vorkommenden Psychosen gilt, dass Frauen zwar genauso häufig, aber anders und später erkranken. Hier scheinen hormonelle Faktoren eine Rolle zu spielen, sogenannte postpartale Depressionen und Psychosen treten durch die Hormonumstellung nach der Schwangerschaft auf. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die häufigsten psychischen Erkrankungen Frauen deutlich häufiger treffen und Frauen deutlich häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Insgesamt schätzen Frauen ihr psychisches Wohlbefinden im Vergleich zu Männern schlechter ein. Zusammengefasst sind Frauen also durch psychische Erkrankungen stärker belastet als Männer.
Eine Ursache dafür, dass Frauen eher zu Depressionen neigen, könnte sein, dass Frauen mehr grübeln als Männer, was einen Risikofaktor für Depressionen darstellt. Grübeln bedeutet, dass Gedanken immer wieder um das gleiche Thema kreisen und gleichzeitig unangenehm sind. Grübelnde Gedanken halten Menschen von dem täglichen Leben mit allen positiven und negativen Momenten ab und stellen sich wie eine Barriere zwischen die Betroffenen und ihr Leben. Frauen sind stärker in soziale Verpflichtungen involviert, sei es die Pflege eines Angehörigen, Sorge um die Kinder oder den Zusammenhalt der Familie. Die Pflege von Angehörigen ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von Depressionen. Frauen sind, da sie sowohl im Beruf als auch im Privatleben gefordert sind, häufiger Doppelbelastungen ausgesetzt. Ein weiterer Grund, warum Frauen häufiger psychisch krank werden könnten, ist, dass sie, statistisch betrachtet, älter werden. Obwohl Menschen im hohen Alter allgemein zufriedener sind, kommen Depressionen etwa in höherem Alter häufiger vor. Frauen sind tendenziell vorsichtiger als Männer und etwas weniger risikobereit. Es fehlt ihnen dadurch vielleicht manchmal der Mut, egoistische Entscheidungen zu treffen, was Depressionen zu einem späteren Zeitpunkt begünstigen kann. Dass bei Frauen die Diagnose Depression häufiger gestellt wird, liegt auch darin begründet, dass Frauen häufiger professionelle Hilfe bei Ärzt:innen suchen.
Im Arbeitsumfeld befinden sich Frauen in einem Spannungsfeld, wie Sheryl Sandberg, COO von Facebook und damit eine der mächtigsten Frauen der Welt, in ihrem Buch »Lean In: Women, Work, and the Will to Lead« beschreibt. Sie befinden sich in einem Dilemma, da sie sich nicht immer erlauben, erfolgreich zu sein und ihre Träume so proaktiv, selbstverständlich und selbstbewusst zu erfüllen wie Männer (Sandberg 2013).
Das fängt in der frühen Jugend an, wenn Jungen häufiger als Mädchen angeben, dass sie gerne Präsident werden würden. Mädchen stecken sich seltener hohe und ambitionierte Ziele. Sich Ziele zu stecken, schützt vor Depressionen. Jungen melden sich häufiger in der Schule, das heißt, dass sie schon früh zeigen, was sie können und dass sie selbstbewusster sind. Auch Selbstbewusstsein schützt vor Depressionen. Außerdem bestehen allgemeine Vorurteile gegenüber den Fähigkeiten von Mädchen und Jungen, sogenannte Stereotype. Ein Stereotyp ist beispielsweise, dass ein Mädchen schlechter rechnen kann als ein Junge. In einer Untersuchung hat man beobachtet, dass Mädchen, wenn sie vor einer Mathematikaufgabe ankreuzen müssen, ob sie weiblich sind oder männlich, schlechter abschneiden. Wenn also einem Mädchen bewusst gemacht wird, dass es ein Mädchen ist, kann es schlechter rechnen (Sandberg 2013, Danaher und Crandall 2008). Im späteren Leben streben Männer eher Führungspositionen an als Frauen und sehen sich eher als »visionär« und »bereit, Risiken einzugehen«, als »Führungspersönlichkeit« und »selbstsicher« (Sandberg 2013). Dadurch, dass Männer früher planen, eine Führungsposition einzunehmen, nehmen sie diese auch eher ein. Dieses Phänomen wird in der Psychologie eine »sich selbst erfüllende Prophezeiung« (»self-fulfilling prophecy«) genannt. Jemand kann seinen eigenen Erfolg prophezeien, wenn er selbst davon ausgeht, dass er Erfolg haben wird. Geht man in ein Bewerbungsgespräch und denkt »ich bin nicht qualifiziert genug«, dann wird man die Stelle eher nicht bekommen, obwohl man vielleicht die/der Beste für die Stelle wäre. Vermittelt man hingegen »ich bin der/die Beste für diese Stelle« und »die Stelle ist die beste Stelle für mich«, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit die Stelle bekommen. Nur ein Fünftel der sogenannten Millenial Generation nimmt sich weibliche Vorgesetzte zum Vorbild, Frauen werden als weniger motiviert wahrgenommen, weniger kompetent, ihr Erfolg als weniger erstrebenswert und sie finden sogar weniger Mentor:innen (Goux 2012, Ellemers et al. 2004, Hewlett et al. 2010, Sandberg 2013). Frauen haben statistisch betrachtet ein geringeres Einstiegsgehalt als Männer (Moss-Racusin et al. 2012).
Frauen haben es also bei der Erfüllung ihrer beruflichen Träume teilweise schwerer. Weil sie nicht selbstbewusst davon ausgehen, dass sie Karriere machen werden und weil sie nicht aktiv ihre Karriere bahnen, bleiben sie teilweise hinter ihren männlichen Kollegen zurück. Frauen werden durch Führungspositionen eher unbeliebter, Männer dagegen eher beliebter (Sandberg 2013, Heilman et al. 2012). Frauen wechseln seltener die Stelle, was ihnen Nachteile in der Karriere bringen kann (Lyness und Schrader 2006) und sie richten sich eher nach dem Karriereplan ihres Partners als umgekehrt (Sandberg 2013, Schiebinger et al. 2008). Auch steigen Frauen teilweise wegen der Karriere ihres Ehemannes (60 %) oder der Kinder (43 %) aus ihrem Beruf aus (Hewlett und Buck 2005, Sandberg 2013). Ein Ausstieg aus dem Beruf von zwei bis drei Jahren bewirkt wiederum häufig eine Gehaltseinbuße von im Schnitt etwa 30 % (Rose und Hartmann 2004, Sandberg 2013). Männer ermutigen Frauen eher nicht zu entsprechenden Karriereschritten, sie leiden sogar unter den Erfolgen ihrer Frauen (Ratliff et al. 2013).
Wenn sie eine Familie gründen und im Beruf erfolgreich sein wollen, denken Frauen oft nicht, dass sie alles haben, sondern, dass sie alles verlieren, d. h., sie haben Angst, ihre Familie, ihren Mann und ihre Eltern zu vernachlässigen, wenn sie im Beruf erfolgreich sind, und schlagen dann vielleicht von vornherein wichtige Karriereschritte aus. Insgesamt scheinen Frauen selbstkritischer zu sein, sie geben sich eher selbst die Schuld, wenn sie scheitern (Johnson und Helgeson 2002) und geben sich zum Beispiel in der ärztlichen Ausbildung schlechtere Noten obwohl sie objektiv betrachtet besser abschneiden (Lind et al. 2002). Weibliche Ärztinnen scheinen sogar eine geringere Sterblichkeit ihrer Patient:innen zu verzeichnen zu haben als ihre männlichen Kollegen (Tsugawa et al. 2016).
All diese Eigenschaften machen Frauen umgekehrt vermutlich zu guten Krisenmanagern weil sie Verantwortung übernehmen und integrativ sowie vertrauensbildend agieren. So werden Leitungspositionen eher an Frauen vergeben, wenn Unternehmen sich in einer Krise befinden. Korrespondierend zeigte sich während der Coronakrise, dass Länder mit einem weiblichen Staatsoberhaupt weniger kranke und schwere Fälle aufzuweisen hatten und mehr Ruhe bewahrten, als Länder mit einem männlichen Staatsoberhaupt. In einer Analyse des Kommunikationsstils konnte bei männlichen Führungskräften in der Coronakrise mehr warnendes, bedrohliches und ängstliches Verhalten beobachtet werden sowie Wettbewerbsgedanken und illustrative Gesten, während weibliche Führungskräfte eher Kooperationsbereitschaft signalisierten, Einfühlungsvermögen, Flexibilität, Optimismus und Augenkontakt aufnahmen (Grebelsky-Lichtman et al. 2020). Frühere Forschungen legen nahe, dass utilitaristische Antworten auf Dilemmata das Vertrauen in Führungspersönlichkeiten eher untergraben. Menschen zu opfern, um andere zu retten, verringert das Vertrauen, während die Maximierung des Wohlergehens aller gleichermaßen das Vertrauen stärken kann. In einem Experiment, das sich in über 22 Ländern auf sechs Kontinenten erstreckte, nahmen ca. 20 000 Teilnehmer:innen mit Selbstauskünften und Verhaltensmessungen teil. Analysiert wurde das Vertrauen in Führungskräfte, die in Dilemmasituationen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie utilitaristische oder nicht-utilitaristische Prinzipien vertraten. Unparteiische Wohltätigkeit erhöhte in dieser Untersuchung das Vertrauen (Everett et al. 2021). Das Vertrauen der Bevölkerung prädizierte während der Coronapandemie wiederum den Erfolg des Krisenmanagments.
De facto muss eine Karriere nicht einen »Verlust« im Privatleben bedeuten. Wenn man Kinder untersucht, die nicht ausschließlich von ihren Müttern erzogen wurden, haben sie keine Nachteile, weder im Sozialverhalten noch im intellektuellen Bereich noch in der Bindung zur Mutter (Sandberg 2013). Rein statistisch betrachtet wirkt sich eine Berufstätigkeit der Mutter nicht zwangsläufig negativ auf die mit den Kindern verbrachte Zeit aus. Untersuchungen zeigen, dass Eltern, die sich emotional nahestehen, die Entwicklung ihrer Kinder zwei- bis dreimal stärker positiv beeinflussen als die Betreuungszeit per se (Sandberg 2013). Wenn also Frauen auch Karriere machen und damit vielleicht glücklicher sind und Männer haben, die sie entlasten, wirkt sich das auch positiv auf die Kinder aus.
Resümee
Berufstätige Frauen haben mehr finanzielle Sicherheit, eine höhere Zufriedenheit, eine bessere Gesundheit und stabilere Ehen. Wenn Frauen und Männer gleich viel verdienen resultiert bei beiden Partnern eine höhere Zufriedenheit, glücklichere Beziehungen und weniger Scheidungen (Sandberg 2013, Price Cook 2006).
Es ist wichtig, Frauen zu ermutigen, ihr Leben und ihre Karriere frühzeitig in die Hand zu nehmen. Sie sollten ermutigt werden, in ihrer Karriere Risiken einzugehen (Sandberg 2013, Bertrand 2010) und nicht zu viele Kompromisse bei der Berufswahl aber auch im privaten Umfeld zu treffen. Insgesamt findet in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung statt, da viele jüngere Männer angeben, Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen, dafür ihre Arbeitszeit reduzieren und auch einen entsprechenden Beruf wählen, um ihre Partnerin zu unterstützen.
Die Umgebung
Menschen, die auf dem Land leben, sind eher vor psychischen Erkrankungen geschützt.
Noch vor etwa 50 Jahren lebte nur jeder dritte Mensch in der Stadt, bis zum Jahre 2050 wird nur noch jeder dritte Mensch auf dem Land leben. Die am stärksten wachsende Urbanisierung findet sich in China wo 100 Megacitys in den nächsten Jahren zu einem gesteigerten Bruttosozialprodukt beitragen werden. Auf den ersten Blick betrachtet sollte die Gesundheit von Stadtbewohnern besser sein als die der Landbevölkerung. In den Städten gibt es mehr Ärzt:innen, eine bessere Gesundheitsversorgung und nähere Kliniken der Maximalversorgung. Auch sind die allgemeinen finanziellen Bedingungen für Menschen in Städten besser. Darüber hinaus ist das Bildungsniveau statistisch gesehen in Städten höher als in der ländlichen Umgebung. Trotzdem weisen Menschen, die in Städten leben, ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen auf. Relevant ist vor allem der Anstieg des Risikos für Angsterkrankungen und Depressionen, da von diesen etwa ein Fünftel der Bevölkerung betroffen ist. Das Risiko, an einer Psychose zu erkranken, scheint sich in Städten im Vergleich zum Land für Männer sogar fast zu verdoppeln. Für das Risiko, an einer Psychose zu erkranken, sind die ersten 15 Lebensjahre bedeutsam. Das heißt, entscheidend ist, wo ein Mensch aufgewachsen. Neueste neurobiologische Erkenntnisse gehen der Ursache für dieses Phänomen auf den Grund. Es kann beobachtet werden, dass bei Städtern die Hirnregion, die für die Steuerung von Stress und Angst bei vorliegenden Stressereignissen verantwortlich ist, stärker aktiviert wird. Städter haben eine stärkere Angstreaktion in belastenden Situationen als Menschen, die auf dem Land groß geworden sind (Lederbogen et al. 2011, Lederbogen und Meyer-Lindenberg 2013). Auch allgemein geben Menschen in Städten an, dass ihr Wohlbefinden höher ist, wenn sie sich in Regionen mit mehr Grünflächen befinden (Trost et al. 2019).
Natürlich spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle, wenn wir von Häufungen psychischer Erkrankungen in Städten reden. Es gibt häufiger Infektionen, die die Gehirnentwicklung schädigen können, sowohl während der Schwangerschaft als auch im Kindesalter. Es gibt mehr Lärm, Drogen und mehr Giftstoffe, die sich auf schützende Faktoren wie beispielsweise einen gesunden Schlaf auswirken können. In einer Untersuchung wurde gezeigt, dass Verkehrslärm das Risiko für psychische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes erhöht und auch den Schlaf verschlechtert (Pirrera et al. 2010). Gerade kürzlich wurde bekannt, dass 16 % der Todesfälle weltweit auf Umweltverschmutzung und dabei vor allem auf verschmutzte Luft zurückgehen (Donkelaar et al. 2017). In der Schweiz sollen im Jahr 2015 alleine 4 000 Menschen an Erkrankungen verstorben sein, die von Schadstoffen verursacht wurden. In Städten spielen auch fehlende soziale Kontakte eine Rolle. Viele Menschen wandern in Städte ein, weshalb es zu Isolation und fehlendem Rückhalt der Menschen kommt, was als soziale Fragmentierung bezeichnet wird (Lederbogen et al. 2011, Lederbogen und Meyer-Lindenberg 2013). Psychiatrische Störungen treten bei Menschen mit Migrationshintergrund häufiger auf, unter anderem weil Migration das Sozialgefüge zerstört und das soziale Netzwerk, in dem jemand aufgewachsen ist, erschüttern kann. Dies gilt auch, wenn jemand vom Land, wo die sozialen Netzwerke sehr gefestigt und über Jahre gewachsen sind, in die Stadt zieht. Je größer die Unterschiede zwischen Ursprungskultur und neuer Umgebung sind, desto mehr psychischer Stress resultiert, da ein ganzes Wertesystem erschüttert werden kann. Neueste neurobiologische Erkenntnisse zeigen, dass Migration eine höhere Aktivierung bestimmter Hirnregionen bei sozialem Stress erzeugt. Diese Hirnregionen wiederum erhöhen dann in Folge das Risiko für psychische Erkrankungen. Das heißt, Migration erhöht die Empfänglichkeit für Stress und dann in der Folge die Wahrscheinlichkeit, unter diesem psychisch krank zu werden.
Wenn Stadtbewohner seit längerer Zeit in der Stadt leben, verkleinern sich bestimmte Hirnregionen. Im Mandelkern, dem Alarmsystem des Gehirns, haben Menschen, die in Großstädten leben, eine stärkere Aktivierung. Ihre Alarmanlage, die für die Ausbildung von Stresssymptomen verantwortlich ist, ist also »schärfer« gestellt als bei Menschen, die auf dem Land leben. Damit ist ihre Sensibilität für Gefahren erhöht und diese Sensibilität wiederum könnte für psychische Erkrankungen ein Risiko sein. Grünflächen in Städten wiederum können die psychische Gesundheit schützen (Lederbogen et al. 2011, Lederbogen und Meyer-Lindenberg 2013). In einer britischen Untersuchung zeigte sich, dass Menschen, die innerhalb von Städten in grünere Areale ziehen, bis zu drei Jahre nach dem Umzug eine bessere psychische Gesundheit aufwiesen (Alcock et al. 2014).
Hier entwickelt sich eine ganz neue Disziplin, in der Antworten auf die Klima- und Biodiversitätskrise, gesundheitspolitische, stadtplanerische und psychologische Erkenntnisse in die Entwicklung neuer Wohnumgebungen einfließen können, um die psychische Widerstandsfähigkeit des Menschen zu steigern und eine bessere psychische Gesundheit zu ermöglichen (Adli et al. 2017).
Resümee
Für die psychische Gesundheit ist es förderlich, in einem ruhigen, grünen, gepflegten und ländlichen Umfeld zu leben. Sicherheit finden Menschen darüber hinaus, wenn die Nachbarschaft aus ihnen bekannten, ähnlich gesinnten Menschen besteht, und damit ein gutes soziales Netzwerk am Wohnort vorhanden ist.
Das Land
Die Länder, in denen die Lebensbedingungen am besten sind, haben nicht die niedrigste Rate an psychischen Erkrankungen.
Tanja ist 56 Jahre alt, Grundschullehrerin, seit 24 Jahren mit ihrem Ehemann verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Sie lebte ihr ganzes Leben in einem kleinen Ort in Kanada, wo sie ihre Jugendliebe, ihren Mann, im Jugendchor kennengelernt und dann geheiratet hatte. Tanja ist sehr patent, pragmatisch und aktiv, sie hat einen Bauernhof ganz alleine renoviert, kümmerte sich nebenbei um ihre Eltern und die Eltern ihres Ehemannes und hatte eine große Fangemeinde bei ihren Schülern; sie bekam mehrfach Preise als beste Lehrerin. Sie engagierte sich stark in der Gemeinde, in der Kirche, in der Schule, bei den Pfadfindern, war Mitglied in mehreren Vereinen und genoss es sehr, im Kreise einer großen Familie mit einem starken Zusammenhalt an ihrem Wohnort verbunden zu sein. Psychische Erkrankungen gab es in ihrer Familie zu keinem Zeitpunkt. Nun hatte ihr Ehemann die einmalige Chance, in einem großen Automobilunternehmen eine Führungsposition zu bekommen, so dass sich das Ehepaar entschloss, für einige Jahre nach Stuttgart in Deutschland zu ziehen. Tanja war zwar nicht ganz begeistert von Deutschland, allerdings wollte sie ihren Mann in seiner Karriere unterstützen und andererseits dachte sie, dass eine neue Herausforderung ein wenig Schwung in ihre Beziehung bringen würde. In Deutschland fand sie sofort eine Anstellung als Dolmetscherin. Allerdings stellte sich heraus, dass ihr Ehemann durch seine neue Stelle sehr absorbiert war und keine Zeit für sie hatte. Tanja litt sehr darunter, dass ihr gesamter Freundeskreis nicht mehr bei ihr war, dass sie die gewohnte Natur nicht mehr vor der Tür hatte, dass die Mentalität der Menschen ihr fremd war, dass ihre neue Stelle wenig neue Kontakte und Netzwerke eröffnete und auch ihr Hobby, das Reiten, war für sie in der neuen Umgebung nicht mehr möglich, die Pferde fehlten ihr. Auch litt sie darunter, dass sie all die sozialen Ereignisse in ihrer Familie und ihrem Freundeskreis nicht mehr miterleben konnte, Geburtstage, Weihnachten, Feiern, Chorproben, Auftritte, die Geburt ihres Enkelkindes, da sie nicht rechtzeitig anreisen konnte. Sie störte sich an der Anonymität, sie sei einfach kein Stadtmensch. Auch fand sie irgendwie keinen Anschluss, sie wurde eher wie ein Exot behandelt und hatte das Gefühl, nirgends mehr dazuzugehören. Es fing dann langsam an, dass Tanja nicht mehr schlafen konnte. Sie lag lange Zeit wach, ihre Gedanken drehten sich im Kreis und frühmorgens wachte sie um 4:00 Uhr auf und konnte nicht mehr einschlafen. Sie fühlte sich dann den ganzen Tag energielos, legte sich immer wieder hin und brachte keine Kraft auf, Leute zu treffen und ihren Hobbies nachzugehen. Sie schaffte es auch nicht mehr, per Skype mit ihren Kindern zu telefonieren, aus Sorge, diese könnten merken, dass es ihr nicht gut ginge. Ihre Stimmung wurde immer schlechter. Sie konnte sich gar nicht mehr freuen und selbst für einfache Dinge, die sie immer gerne gemacht hatte, fehlte ihr die Energie. So ging sie nicht mehr zum Friseur, strickte nicht mehr, telefonierte nicht mehr und ging kaum noch einkaufen. Sie legte sich viel ins Bett und sah gar keinen Grund mehr aufzustehen. Schließlich drängte ihr Mann sie, sich ambulant psychiatrisch behandeln zu lassen. Sie nahm ein Antidepressivum ein, wodurch sie innerhalb von zwei Wochen wieder schlafen konnte, der Antrieb wurde besser, sie wachte morgens erholt auf und entwickelte wieder Interessen und Freude daran, sich mit anderen auszutauschen. Sie diskutierte lange mit ihrem Ehemann und ihrem Therapeuten über ihre Lebenssituation und beschloss schließlich, nach Kanada zurückzukehren. Dort setzte sie das Medikament schnell wieder ab und die Symptome der Depression sind nicht wieder aufgetreten.





























