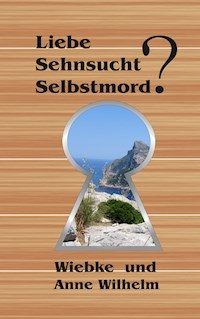Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk besteht aus drei Teilen, welche durch eine kurze Passage miteinander verbunden wurden. Es handelt von Molly und Mathew, welche ihre Liebe in Zeiten von Intrigen und Verrat beschützen und erhalten müssen. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit den beiden, denn die Mafia, Mord und Leid stehen bereits vor der Tür.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchbeschreibung:
Dieses Werk besteht aus drei Teilen, welche durch eine kurze Passage miteinander verbunden wurden. Es handelt von Molly und Mathew, welche ihre Liebe in Zeiten von Intrigen und Verrat beschützen und erhalten müssen. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit den Beiden, denn die Mafia, Mord und Leid stehen bereits vor der Tür.
Über die Autoren:
Anne und Wiebke Wilhelm sind Zwillinge und Autoren aus Leidenschaft. Sie wurden im thüringischen Neuhaus am Rennweg geboren und schrieben bereits im Teenageralter ihren ersten Roman und haben inzwischen mehrere Bücher herausgebracht. Ihre Werke verfassen sie zusammen und entführen sie gerne in geheime neue Welten.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Molly
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Epilog
Ferdinand
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Matthew
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Epilog
Prolog
In einem hell eingerichteten Raum, der ein Himmelbett, einen Tisch und zwei Stühle, sowie eine Frisierkommode enthielt, saß sie und starrte auf die Tischplatte auf der die Sonnenstrahlen, welche durch die rosa Vorhänge fielen, tanzten. Die Haare der Frau klebten in schwarzen, kurzen Strähnen an ihrem Kopf und waren nass vor Schweiß. Derweil hatte sie ihren nebelblauen Blick weiter auf die Tischplatte gerichtet. Langsam trieb ihr Geist im Strudel der Erinnerung, als die schwere Holztür des Raumes aufging und ein rothaariger Mann eintrat. Er betrachtete sie mit einem kurzen Lächeln, das sofort wieder erlosch nur um einen undefinierbaren Schmerz zu weichen. Sie betrachtete ihn kurz und bemerkte, wie er sein Bein nachzog, als er auf den leeren Stuhl, der ihr gegenüber stand, zuging. Seine Hände zitterten, als er das leere Sitzmöbel ergriff. Er setzte sich unbeholfen und schaute sie direkt an. „Hallo, Molly“, sprach er sie an. Sofort fixierten ihn große wässrige blaue Augen. Molly? Dieser Name. In einem anderen Leben hatte sie selbigen getragen. Doch das war längst vorbei. Heute war sie niemand mehr. Kein Mensch von Bedeutung. „Wie fühlst du dich?“, fragte der Mann freundlich. Die Frau starrte weiter, kein Wort kam über ihre Lippen. Sie studierte sein Gesicht. Er war kreidebleich und die Wangen waren eingefallen. Das feine blaue Netz seiner Adern und Venen zog sich über sein Gesicht und schien durch das fahle Weiß seiner wächsernen Haut. Müde Augen taxierten sie mit einem blutunterlaufenen Blick. Die einstmals feuerroten Haare waren an den Schläfen ergraut. Er zitterte. „Ich…weiß nicht, wie es dazu kommen konnte. Es tut mir aufrichtig leid“, stammelte er und griff nach seiner Tasche. „Ich habe dir etwas mitgebracht. Es fiel mir gestern in die Hände und ich dachte, du kannst dich dann erinnern an … na ja, eventuell hilft es dir.“ Er schaute sie wieder voll Liebe an. Doch keine Regung kam aus ihrer Richtung. Warum sollte sie mit diesem Mann sprechen? Sie war Niemand mehr und hatte kein Recht dazu ihren Schmerz zu teilen. Er beendete das Gespräch, indem er unbeholfen aufstand. „Bis Morgen dann.“, verabschiedete er sich von ihr und verließ das kleine Besucherzimmer.
Matthew seufzte. Im Flur stieß er auf einen hochgewachsenen jungen Mann in Pflegerkleidung. Dieser erkannte ihn sofort und sah genau am niedergeschlagenen Gesichtsausdruck, was geschehen war. „Hat sie immer noch nichts gesagt?“, fragte der junge Mann. Matthew nickte traurig und neigte das rote Haupt. „Lass den Kopf nicht hängen. Ihr Schockzustand hält sie noch immer fest umklammert. Jeder verkraftet das anders.“ Der Besucher nickte traurig und wandte sich ab, er würde heimgehen. „Pass auf sie auf, Sam“, flüsterte er, bevor der Besucher seinen schweren Gang fortsetzte. Wie von alleine lenkte er den Schritt zum Ausgang. „Jeder verarbeitet eine Tragödie wie diese anders“, wiederholte er die Worte des Pflegers in seinen Gedanken wie eine Art Mantra. Sam hatte Recht und er brauchte jetzt dringend einen tiefen Zug aus seiner Flasche Brandy.
Nur wenige Minuten nachdem der rothaarige Mann sie verlassen hatte, war Molly wieder in die Realität zurückgekehrt. Sie hatte das Bild, welches der Mann ihr mitbrachte auf das Bett gelegt und beobachtete es akribisch. Sie erkannte sich selbst und den rothaarigen Mann wie sie freudig in die Kamera lächelten. Auf ihrem Arm war ein Kleinkind zu sehen, welches genau wie sie rabenschwarze Haare und hellblaue leuchtende Augen hatte. Diese Aufnahme war schon viele Jahre her und fast schien es ihr, als wäre es in einer vollkommen anderen Zeit aufgenommen worden. Damals bestand ihr Leben aus reinste Harmonie und Glückseligkeit, doch das war alles vorbei. Ihre Träume durchzogen in letzter Zeit tausende alte Erinnerungen, aber diese waren alle vollkommen durcheinander. Sie betrachtete die Fotografie. Dieses Bild sollte ihr helfen ihre Erinnerungen zu ordnen? Vorsichtig strich sie mit den Fingern über das kühle Glas. Der rothaarige Mann würde wiederkommen, sie nicht im Stich lassen und alles Menschenmögliche unternehmen, um sie und ihren Verstand zu retten, das war das Einzige, was sie wusste. Langsam weiteten sich ihre Augen, als sich die Erinnerungen verschoben und auf einmal einen Sinn ergaben. „Matthew … bitte rette mich“, flüsterte sie leise und eine Träne kullerte über ihre Wange.
Molly
Prolog
Sie rannte den Gang entlang. Der Pfleger in seiner blütenweißen Arbeitsuniform war dicht hinter ihr. Auf dem Korridor flackerten spärlich angeordnete Lampen, die seltsames weißes Licht spendeten. Als sich der Gang teilte, wählte sie kurzentschlossen den Rechten. Der Pfleger beschleunigte seinen Schritt. Er sah, wohin sie rannte und wählte dieselbe Richtung. Verzweifelt drehte sie sich immer wieder um. Aber der Mann in der strahlend weißen Uniform war weiterhin hinter ihr und verfolgte sie erbarmungslos.
Die Flüchtige wünschte sich verzweifelt, dass der Pfleger aufhörte, sie zu verfolgen. Doch er holte auf und bald waren es nur ein paar wenige Schritte, die sie trennten. Der Pfleger versuchte, sie am Arm zu packen. Er verfehlte sie um Haaresbreite, griff ins Leere und kam ins Straucheln. Das verschaffte ihr etwas mehr Zeit. Plötzlich kam ihnen ein Arzt in seinem weißen Kittel entgegen. Er hielt ein silberglänzendes Tablett mit fein säuberlich angeordnetem Operationsbesteck in den Händen, das frisch poliert worden zu sein schien und für eine anstehende Operation gedacht war.
Sie nahm hastig und mit zitternden Fingern ein Skalpell vom Tablett und stieß den Doktor hart bei Seite, so dass dieser polternd zu Boden fiel. Er glotzte nur hilflos und sah, wie sich sein Besteck auf dem staubigen Boden verteilte, die Verfolgte mit großen Schritten davon eilte und der Pfleger weiterhin dicht hinter ihr her war.
Nach mehreren Metern bekam sie der Pfleger endlich am Arm zu packen. Jetzt gab es kein Entkommen mehr. Verzweiflung breitete sich in ihren Gedanken aus. Wild versuchte ihr Gehirn, einen Ausweg zu finden, aber es war schier aussichtslos. In wilder Verzweiflung umklammerte sie das Skalpell und rammte es mit einem geübten Stoß in den Unterarm ihres Verfolgers. Dieser ließ sie sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht los und sank auf die Knie. Die Waffe steckte tief in seinem Arm, aus dem das Blut augenblicklich dickflüssig und heiß hervorquoll und schon in kurzer Zeit den Hemdsärmel durchtränkt hatte. Der Krankenpfleger griff nach dem Skalpell und zog es mit einem Ruck heraus. Sofort schoss mehr Blut aus der Wunde, was ihn nicht mal ein müdes Lächeln kostete. Er stand auf, als fühle er keinen Schmerz, und sah seine Beute mit giftgrünen Augen an. Sie erkannte, den blanken Hass in seinem Blick und dieser galt alleine ihr. Die Verfolgte war wie versteinert. Nie hätte sie geglaubt, jemals einen Menschen derart zu verletzen. Das Skalpell hielt er weiterhin in seiner Hand, als er auf sie zuging. Unglaublich! Nicht einmal eine tiefe Fleischwunde hielt ihn von seiner Arbeit ab. Sie wich einige Schritte zurück, um den Abstand zwischen ihnen beizubehalten. Doch plötzlich spürte sie eine Wand an ihrem Rücken.
Der weiße Putz bröckelte ein wenig ab, als sie sich voller Angst gegen die Wand drückte. Unter keinen Umständen würde sie wieder in ihre Zelle zurückgehen. Verzweifelt schaute sie sich nach allen Seiten nach einem Fluchtweg um. Da bemerkte sie ein Fenster, das nicht wie die anderen vergittert war. Es war anzunehmen, dass man es bald ersetzt werden würde. Das war ihre einzige Chance, hier herauszukommen. Bei diesem Fluchtweg gab es nur ein winziges Problem, welches nicht unerheblich war. Der Pfleger, der sie die ganze Zeit schon verfolgt hatte, versperrte ihr den Weg dorthin. Aber ihr blieb keine andere Möglichkeit.
Alternativlos nahm sie all ihren Mut zusammen, drückte sich von der Wand ab und rannte mit voller Geschwindigkeit auf den Pfleger zu. Die Verfolgte hoffte, ihr Peiniger würde erschrecken und aus dem Weg springen. Doch dieser Plan schlug fehl. Ausdruckslos blieb der Pfleger, wo er war und so lief sie diesem unerwartet direkt in die Arme. Kaum hatte er sie im eisernen Griff gefangen, wehrte sie sich heftig und strampelte mit Armen und Beinen, doch er ließ nicht locker. Sie wusste selber nicht wie und dennoch gelang ihr das Wunder, sich zu befreien, nachdem sie sich genug gewunden hatte wie ein Fisch im Netz. Instinktiv wich sie seinen Fangversuchen aus, bis sie sich in der Nähe des Fensters bugsiert hatte. Mit ihrem gesamten Gewicht stemmte sie sich gegen das Glas. Es knackte, als sich um sie herum dünne Haarrisse abzeichneten. Sie warf sich nochmals dagegen. Das hielt das Glas nicht mehr aus. Es splitterte in tausende von Teilchen und sie fiel mit der Schulter voraus in den metertiefen Abgrund. Ihr gesamtes Leben lief wie ein Spielfilm vor ihrem geistigen Auge ab.
Plötzlich umfasste eine Hand ihren Fußknöchel. Der Pfleger hatte sie in letzter Sekunde gepackt. Warum ließ er sie nicht fallen? Der Plan, sich umzubringen, reifte schon eine ganze Weile in ihr. Sie hielt die Medikamentendosis, die täglich durch ihre Adern floss und sie paralysierte, schlicht und ergreifend nicht mehr aus. Wenn sie jetzt nicht fallen und sterben würde, dann musste sie sich später selbst in ihrer Zelle das Leben nehmen. Mit letzter Kraft trat sie mit dem andern freien Fuß nach dem Pfleger. Wie durch ein Wunder traf sie seinen Kiefer und das nicht zu knapp. Er schrie auf und ließ sie los. Sie fiel mehrere Meter tief, bis ein lautes Platschen auf der Wasseroberfläche ankündigte, dass die Gefallene unten angekommen war. Sofort vollzogen tosenden Wellen ihre Arbeit und verschlangen das neue Opfer.
Der Pfleger drehte den Kopf zur Seite und spuckte einen Zahn aus, den sie ihm mit ihrem harten Tritt ausgeschlagen hatte. Er beugte sich aus dem Fenster und schaute hinunter auf die tosende See. Er entdeckte sein Opfer trotz seiner Adleraugen nicht, aber früher oder später hatte sie keine andere Wahl als aufzutauchen. Er starrte lange in die tosende See, doch kein Lebenszeichen war ausmachen. Er fluchte leise: „Verdammt! Das wird dem Chef aber gar nicht gefallen.“
Kapitel 1
Die Sonne war kaum aufgegangen. Trotzdem lag schon eine erdrückende Hitze in der Luft. Mathew O`Conner wachte schweißgebadet auf. Es war wieder einer dieser Albträume, die er in letzter Zeit öfter hatte.
Es war immer derselbe Traum, in dem ein Mädchen mit extrem kurzen, rabenschwarzen Haaren vor ihm davon lief. In seinem Kopf schwirren dann Fragen woher sie kam und wer sie war. Doch die Antworten waren, steht’s unerreichbar. Immer wieder drehte sich die Unbekannte um und schaute ihn mit ihren großen graublauen Augen an. Doch bevor sie etwas antwortete auf seine Fragen, werden ihre Augen plötzlich trüb und ausdruckslos. Matthew kommt dann immer das Bild eines seelenlosen Zombies in den Sinn. Dann verliert die Schöne das Bewusstsein und sinkt zu Boden. Er bemüht sich nach Leibeskräften ihr zu helfen und versucht, zu ihr zu gelangen, aber so sehr er sich auch bemüht, er entfernt sich immer weiter von ihr, bis er zu guter Letzt allein in der Finsternis steht.
Genau in diesem Augenblick wacht Mathew auf, immer schweißgebadet und steht`s mit einem seltsamen Gefühl in der Magengegend. Schlaftrunken versuchte er, auf die Digitalanzeige seines Weckers zu sehen. Leider versperrte ihm die Whiskeyflasche die Sicht. Vom gestrigen Abend hatte er keinerlei Erinnerungen mehr. Obwohl er Polizist war, feierte Mathew fast jeden Abend wilde Orgien in der kleinen Kneipe, die nur eine Straße von seinem Appartement entfernt lag. Er nahm die Whiskeyflasche vom Tisch und drückte sie fest an sich. Dass er dabei die Hälfte in sein Bett schüttete, störte ihn nicht „Hach, du bist mein einziger Freund!“, flüsterte Mathew der Flasche zu und gab ihr einen kurzen zärtlichen Kuss. Damit hatte er endlich freie Sicht auf den Wecker. Dieser zeigte neun Uhr. Spätestens um zehn musste er sich im Präsidium blicken lassen, sonst würde seine Chefin ausrasten und ihn zwangsversetzen ins Archiv. Es blieb ihm somit nichts anderes übrig, als aufzustehen, sich anzuziehen und zu waschen und so schnell wie möglich ins Präsidium zu eilen.
Langsam kroch er aus dem Bett. Als er endlich stand, bemerkte er erst die Whiskeyflasche, die immer noch dicht an ihn gepresste in seiner Armbeuge schlief. Mathew drehte sich um und legte die Flasche zurück ins Bett. Er deckte sie sorgfältig zu und gab ihr einen Kuss, wie wenn sie eine lang ersehnte Geliebte wäre, welche den Weg zurück in sein Bett gefunden hätte. „Warte hier! Ich gehe mich waschen. Da kannst du leider nicht mitkommen.“ Dann schlenderte er ins Bad.
Auf dem Weg zur täglichen Waschung spürte er plötzlich etwas Nasskaltes unter seinem Fuß. Mathew sah hinunter und bemerkte, dass er in die restliche Pizza getreten war, die es zum gestrigen Abendessen gegeben hatte. Angewidert rümpfte er die Nase. „Oh man! Wie sieht es denn hier schon wieder aus?“ Sein Blick wanderte von der alten Pizza ausgehend im Zimmer umher. Es war grundsätzlich so versifft wie immer. Das Weiß der Wände wurde über die Jahre durch Zigarettenqualm zu einem Grau. Das vollkommen schief hängende Bild war einst eine Verschönerung, doch jetzt nicht mehr als ein Schandfleck, den eine dicke Staubschicht zierte. Es gab im ganzen Raum nur ein Fenster, was sich nicht öffnen ließ, weil das Scharnier schon seit geraumer Zeit verrostet war.
Das ganze Zimmer war überhaupt spartanisch eingerichtet. Die gesamte Inneneinrichtung beschränkte sich auf ein Doppelbett, einen kleinen Nachttisch mit Wecker und einen Kleiderschrank. Ein roter Teppich setzte im Zimmer einen farblichen Akzent. Pflanzen suchte man in Mathews Appartement vergeblich, denn er hatte keinen grünen Daumen. Er neigte dazu, die Pflanzen zu viel zu gießen oder sie vertrocknen zu lassen. Während Mathew so seinen Blick schweifen ließ, kam ihm die Idee zu einer Renovierung oder wenigstens zu einem Frühjahrsputz. Heute hatte er dazu aber keine Zeit, denn die Arbeit rief. Er betrat das kleine Badezimmer. Die Wände, der Boden, ja sogar die Decke waren weiß gefliest und strahlten eine kalte Atmosphäre aus. Jedes Mal lief Mathew ein Schauer über den Rücken, wenn er das Bad betrat. Er stellte sich ans Waschbecken und betrachtete sich im Spiegel. Seine roten Haare waren zerzaust und standen in alle Richtungen. Das Gewirr würde selbst dem stärksten Kamm den gar ausmachen, daher nahm er beide Hände und fuhr sich so lange durch die Haare, bis sie fast gleichmäßig lagen. „Man, siehst du heute wieder scheiße aus!“, sagte er zu seinem Spiegelbild. Damit war das morgendliche Ritual nahezu beendet.
Nach einer gründlichen Katzenwäsche fühlte er sich bereit, seinen Dienst als Polizist anzutreten. Auf Zehenspitzen bahnte er sich seinen Weg bis zum Kleiderschrank. Er passte höllisch auf, dass er nicht in irgendwelchen Müll trat, der auf dem ganzen Boden verteilt herum lag.
Niemals wich er von der Einheitskleidung des Streifenpolizisten ab. Blaues Hemd, schwarze Krawatte. Nur bei der Hosenwahl plädierte Mathew immer auf seine schwarze Lederhose, denn die blauen Stoffhosen der Polizei konnte er nicht ausstehen. Er zog sich an, betrachtete sich ausgiebig im Spiegel und verließ dann die Wohnung. Dabei fiel die Tür dermaßen laut ins Schloss, das die leeren Bierflaschen wackelten. Im Hausflur begegnete er der alten Dame, die das Appartement nebenan bewohnte.
Das Mütterchen lächelte ihn verständnisvoll an und sagte mit einer heißeren Stimme: „Mathew! Gestern Abend war es aber wieder spät! Ich habe es doch gegen 3 Uhr im Hausflur rumpeln gehört. Nur gut, dass Heinz nicht aufgewacht ist und sich erschreckt hat.“, „Verzeihen Sie den Lärm, Frau Bauer. Das nächste Mal werde ich leiser sein. Versprochen!“, „Sie sind ein guter Junge. Gott schütze Sie!“, erwiderte Frau Bauer, weiter lächelnd. Damit war für sie die Sache erledigt. Sie schlich wieder in ihr Appartement, um zu frühstücken. Jetzt war eile geboten, wollte Matthew rechtzeitig im Büro sein.
Um Punkt zehn Uhr betrat er die Empfangshalle des Hauptquartiers der Polizei in Allington City. Er nahm den Fahrstuhl und fuhr in den vierten Stock. Jetzt hieß es nur leise und unbemerkt am Büro der Chefin vorbeikommen, dann wäre alles im grünen Bereich. Die Tür des Fahrstuhls öffnete sich mit einem leisen Klingeln und Mathew schlich auf Zehenspitzen am Büro der Chefin vorbei.
Er hatte ihre Tür beinahe passiert, als diese plötzlich aufflog und Miss Taylor aus ihrem Büro trat. Mathew fuhr erschrocken zusammen. „Ah, Mr. O`Conner! Wir sind ja heute wieder einmal erstaunlich früh!“, fuhr sie ihn sarkastisch an. „Kommen Sie gleich mal in mein Büro! Wir haben einiges miteinander zu besprechen.“ Sie drehte sich um und stampfte zurück in ihre Räumlichkeiten. Mathew folgte ihr wortlos mit herabhängenden Schultern und gesenktem Kopf. Er war wieder erwischt worden und dieses Mal würde es riesigen Ärger geben. Er hatte kaum die Tür hinter sich geschlossen, da fing Miss Taylor schon an, ihn anzuschreien. „Ihr ständiges Zuspätkommen geht mir tierisch auf die Nerven. Denken Sie, hier tanzt alles nach ihrer Pfeife? Dazu kommt, dass Sie ihre Arbeit nur halbherzig erledigen. Ich warte seit drei Tagen auf Ihren Bericht vom letzten Tatort!“ Mathew versuchte etwas einzuwenden, Miss Taylor ließ ihn nicht zu Wort kommen.
„Ach, sparen Sie sich Ihre Ausreden! Ich habe keine Lust mehr. Sie fahren heute Streife, verstanden O`Conner?“ Es entstand eine kurze Pause, in der Matthew nur wortlos am anderen Ende des Schreibtisches saß und keine Miene verzog. „Hören Sie mir überhaupt zu?“ Mathew reagierte gar nicht auf ihr Geschrei. Er hatte sich voll und ganz in seine Gedankenwelt zurückgezogen.
In seiner Vorstellung stand Susan Taylor fast nackt vor ihm. Schon oft hatte er sich vorgestellt, sie in ihrem Büro zu nehmen. Doch dies blieb für immer ein Wunschtraum. Das wusste er genau. Als Mathew in die Realität zurückkehrte, stand Susan wieder bekleidet hinter dem großen Schreibtisch, der mit allerlei Akte belegt war und starrte ihn wütend an. Jeden Tag trug sie einen engen Minirock und eine Bluse, die über der Brust spannte. Grazil glitt sie auf ihren Chefsessel. Miss Taylor stützte sich mit den Ellenbogen auf dem Schreibtisch ab. Dabei gewährte die Bluse tiefe Einblicke. Heute trug sie zum Beispiel einen schwarzen BH mit Spitze. „Ich weiß nicht, wie ich weiter mit Ihnen verfahren soll. Wenn sich das nicht bald bessert, dann sehe ich mich gezwungen, sie zu entlassen.“ Mathew sah sie völlig entsetzt an. Sein Gehirn versuchte schnellstmöglich, zu verarbeiten, welche Konsequenzen eine Entlassung nach sich zöge. Das durfte nicht geschehen! „Ich verspreche, dass ich mich in Zukunft mehr anstrengen werde! Bitte feuern sie mich nicht!“ Susan schaute streng, doch ihr Blick wurde milder bei dieser Bitte. „Okay, aber das ist Ihre letzte Chance!“ Sie wendete sich von ihm ab und schaute aus dem Fenster. Das schien sie etwas zu beruhigen. „Verschwinden Sie jetzt. Morgen will ich Ihren Bericht auf meinem Schreibtisch liegen haben und das unaufgefordert!“ Dabei betonte sie das letzte Wort besonders streng. „Selbstverständlich!“, verabschiedete sich Mathew kurz und eilte dann mit schnellen Schritten aus dem Büro.
Draußen atmete er tief durch. Er konnte es sich unter keinen Umständen leisten entlassen zu werden. Beschämt schlich er zu seinem Schreibtisch, um den Bericht zu suchen, den Miss Taylor von ihm verlangt hatte. Voller Entsetzen stellte er fest, dass dieser daheim lag. Er hatte ihn sogar heute früh schon gesehen. Er lag unter der Whiskeyflasche. In der Eile hatte er ihn vergessen. Mathew setzte sich auf seinen alten Bürosessel und lehnte sich zurück. Der Tag hatte kaum angefangen und schon lief alles schief. Am liebsten wäre er jetzt aufgestanden und in seine Lieblingskneipe gegangen, um dort allen Frust mit literweise Alkohol wegzuspülen. Doch er liebte seinen Job zu sehr, als das er sich dies jetzt leisten könnte. Daher schloss er die Augen und versuchte, sich das Bier vorzustellen. Leider gelang ihm dieses Unterfangen nicht im Geringsten. Es war halb vier als er aus seinem „kurzen“ Nickerchen erwachte.
Verschlafen und laut gähnend stand er auf und streckte sich. Schlaftrunken schlurfte er den Gang entlang bis zum Fahrstuhl. Er wankte und es kostete ihn große Mühe, den kleinen Knopf zu treffen, der ihm den Fahrstuhl rufen würde. Es dauerte einige Minuten, bis sich die Türen zum Lift mit einem leisen Klingeln öffneten. Mathew gähnte. Dann stieg er ein und fuhr bis in das erste Untergeschoss. Dort war die Tiefgarage, wo die einzelnen Streifenwagen standen. Mathew wählte nach dem Zufallsprinzip einen Wagen aus und stieg ein. Es war egal, welches Auto er nahm, denn er hatte einen Universalschlüssel, der für alle Streifenwagen passte. Pünktlich zum Schichtbeginn der Streife fuhr er aus der Tiefgarage.
Mathew hasste es, Streife zu fahren. Das einzige, was seine Laune etwas hob, war der flammende Sonnenuntergang, den er über dem Meer bewunderte. Sein Blick wanderte von dem tiefen Rot des Sonnenuntergangs zu der Psychiatrie, die sich wie eine steinerne Festung aus dem Meer erhob.
Die kleine Insel war damals extra aufgeschüttet worden, um dort eine psychiatrische Einrichtung zu bauen. Damit in keinem Fall ein „Patient“ diese Heilstätten verließ, war das Gebäude doppelt mit Stacheldrahtzäunen umzäunt. Mathew erkannte sogar aus der Ferne, dass die einzelnen Fenster vergittert waren. Er wendete sich ab von diesem grauenhaften Ort. Er wollte und konnte sich nicht vorstellen, was hinter diesen dicken Steinmauern geschah. In der Zwischenzeit war die Sonne schon fast hinter dem Horizont verschwunden. Seine Gedanken kreisten einen Augenblick um die halbvolle Whiskeyflasche, die daheim auf ihn wartete, als ihm plötzlich etwas vor dem Wagen sprang. Sofort stieg er auf die Bremse. Die Reifen quietschten laut und das Auto blieb abrupt stehen. Voller Entsetzen stieg er aus dem Wagen, um zu sehen, ob das, was er angefahren hatte, noch lebte. Mathew traute seinen Augen nicht, als er vor dem Polizeiwagen eine junge Frau liegen sah, die nichts anderes anhatte als ein dünnes Flügelhemdchen. Sie schien nicht schwer verletzt zu sein, trotzdem krümmte sie sich am Boden. Um nicht noch mehr Schwierigkeiten zu bekommen, hob er sie behutsam auf und legte sie auf die Rückbank seines Streifenwagens. Dass er einen Menschen angefahren hatte, nur weil er den Sonnenuntergang betrachtet hatte, durfte Miss Taylor unter keinen Umständen erfahren. Daher blieb ihm nichts anderes übrig, um die Sache zu vertuschen, als sie mit nach Hause zu nehmen und sie dort gesund zu pflegen.
Kapitel 2
Als Mathew daheim angekommen war, legte er das bewusstlose Mädchen auf sein Bett. Er setzte sich neben sie auf die Bettkante und beobachtete sie einen Moment lang. Sie sah aus wie 20, dachte er bei sich. Sie maß kaum einen Meter fünfundsiebzig und hatte sich wie eine Kugel auf dem Bett zusammengerollt. Ihr gesamter Körper war mit blauen Flecken und Schnittwunden übersät. Mathew fielen ihre extrem kurzen rabenschwarzen Haare auf. Sie waren zu einzelnen Strähnen verklebt, die wild ihren Kopf umspielten. Mathew beugte sich über sie, um ihr Gesicht näher zu betrachten. Irgendwo hatte er sie schon einmal gesehen, da war er sich sicher. Aber wo? In diesem Moment öffnete sie ihre großen blaugrauen Augen und sah ihn an. Es traf ihn wie ein Blitz. Sie war das Mädchen aus seinen Träumen!
Als sie seine roten Haare sah, fing sie an laut und hysterisch zu schreien. Sie wich bis an das Kopfende des Bettes zurück, zog die Knie an und brach in Tränen aus. Kleine Rinnsale bildeten sich und liefen über ihre rosigen Wangen. Sie schien nicht zu begreifen, dass sie in Sicherheit war. Mathew versuchte sofort, beruhigend auf sie einzureden. Er hatte einmal in einem Buch über Psychologie gelesen, dass man immer mit einem panischen Patienten reden sollte, um ihnen ein wenig die Angst zu nehmen. „Hallo. Mein Name ist Mathew“, flüsterte er. „Du brauchst keine Angst zu haben! Du bist in Sicherheit. Ich habe dich bewusstlos an der Straße gefunden und daraufhin mitgenommen, damit dir nichts passiert. Jetzt, wo du wach bist, kann ich dich in ein Krankenhaus bringen, wenn du willst.“ „Nein! Bloß nicht!“, murmelte sie und kauerte sich dichter ans Kopfende des Bettes. „Alles in Ordnung. Es scheint, als brauchst du keinen Arzt. Wie heißt du denn?“, fragte er. „Miststück“, sagte sie jetzt mit heißerer Stimme. „Bitte?“, entgegnete Mathew irritiert. „Die Pfleger nannten mich immer so“, „Miststück?“, wiederholte Mathew etwas fassungslos. „Wen meinst du denn mit ‚Pfleger‘?“, „Die Männer, die mir mein Essen und meine Medikamente bringen.“ Jetzt wurde es Mathew klar. Es war es ihr gelungen, aus der psychiatrischen Klinik auf der kleinen Insel im Meer zu fliehen. Wo war er da nur wieder hineingeraten! Das Schicksal spielte ihm ständig solche miesen Streiche. Aber die Sache ließ sich nicht mehr revidieren. „Miststück ist, glaube ich, kein geeigneter Name für ein so umwerfendes Mädchen wie dich. Wir müssen dir einen neuen Namen geben. Wäre dir ‚Molly‘ recht? So hieß meine Katze früher.“ Er lächelte sie an. Sie erwiderte mit einem Kopfnicken. „Dann ist es beschlossen. Schlaf heute Nacht hier in meinem Bett. Ich übernachte im Wohnzimmer. Das Bad ist gleich dort drüben.“ Er deutete auf eine weißgestrichene Tür mit einem kleinen Glasfenster. „Gegenüber ist dann gleich das Wohnzimmer. Gute Nacht und träum was Schönes.“ Beim Verlassen des Schlafzimmers betätigte er den Lichtschalter. Jetzt spendete die kleine Nachttischlampe einen Hauch weiches warmes Licht.
Kaum im Wohnzimmer angekommen, warf sich Mathew auf die Couch und nahm sich die halbvolle Whiskeyflasche zur Brust. Er nahm einen kräftigen Schluck, um besser einzuschlafen. Nach wenigen Minuten war er auch schon in seiner Traumwelt versunken.
Mathew wurde von einem ungewohnten, lauten Geräusch wach. Er schreckte hoch und sah in Richtung Bad. Die Tür zum Badezimmer stand sperrangelweit auf und gab den Blick auf das komplette Innere frei. Molly stand nur mit einem Handtuch bekleidet vor dem Spiegel, zupfte sich an den Haaren und sang leise vor sich hin. Von ihrer gestrigen Angst war kaum mehr etwas zu spüren. Mathew war erleichtert, dass sie sich so schnell eingelebt hatte. Sie schien sich erholt zu haben. Er erhob sich von der Couch und schlurfte vorsichtig zu ihr hinüber. Zaghaft berührte er sie an der Schulter. Molly fuhr herum und schaute ihn entsetzt an. Vor lauter Schreck wäre ihr beinahe das Handtuch heruntergefallen. „Guten Morgen, Molly. Hast du gut geschlafen?“, begrüßte er sie mit einem Lächeln. Im selben Augenblick fing sie an, hysterisch zu schreien. Ihr Kopf wurde feuerrot. Sie rannte in Mathews Schlafzimmer. Die Tür fiel mit einem lauten Knall ins Schloss. Mathew lief ihr hinterher, um sie zu beruhigen, als er plötzlich das weiße Handtuch auf dem Boden liegen sah, das Molly vor wenigen Augenblicken umhatte. Er hob es vom Boden auf und marschierte bis vor die Schlafzimmertür. „Verzeih mir! Ich wollte dich nicht erschrecken. Hier ist dein Handtuch, das du verloren hast.“ Er öffnete die Tür einen Spalt weit und schob seine Hand mit dem Handtuch durch. Als nach wenigen Augenblicken immer noch keine Geräusche von drinnen zu hören waren, hielt Mathew die Spannung nicht mehr aus. Er öffnete die Tür ein Stück weiter und spähte angespannt ins Zimmer. Auf den ersten Blick war Molly nirgends zu sehen. Erst bei genauerem Hinsehen bemerkte Mathew, dass die Geflüchtete im Bett saß. Vor lauter Angst hatte sich die Bettdecke über den Kopf gezogen.
Leise betrat Mathew das Schlafzimmer. Er legte das Handtuch auf das Bett und setzte sich auf die Bettkante. Mit Daumen und Zeigefinger zog er die Decke von Mollys Kopf. Diese sah ihn mit Tränen in den Augen an. „Es muss dir nichts peinlich sein! Du besitzt keinen Körperteil an dir, was ich nicht schon einmal gesehen habe.“ Verlegen schaute Molly zur Seite. Ihre Wangen waren puterrot und ihr Atem kam stoßweise. Deshalb wechselte Mathew das Thema. „Ich bringe dich nicht in die Psychiatrie zurück. Versprochen! Dich hier allein zu lassen wäre unverantwortlich. Was sollen wir deiner Meinung nach machen?“ Fragend schaute er zu Molly hinüber. Diese hatte sich inzwischen wieder gefangen und beantwortete seine Frage mit einem Schulterzucken. „Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich mit auf die Arbeit zu nehmen. Das wird Miss Taylor gar nicht gefallen. Aber zu aller erst müssen wir etwas Ordentliches zum Anziehen für dich finden.“ Mathew stand auf und begutachtete seinen alten Kleiderschrank. Er riss die Schranktüren auf und schaute nach einem geeigneten Kleidungsstück. Nach kurzer Zeit flogen gebügelte Maßanzüge durch das Zimmer. Mathew fluchte, weil er nichts Passendes für Molly fand. Hätte er doch etwas von seinen Ex-Freundinnen aufgehoben! Mit einem Seufzer sank er wieder auf die Bettkante. Schlagartig fiel ihm Frau Bauer ein.
Sie war jetzt die Einzige, die ihn erretten könnte. Mathew sprang auf und rannte aus dem Schlafzimmer, durch den Flur bis an die Haustür. Von dort aus marschierte er langsam und gesittet weiter durchs Treppenhaus bis an Frau Bauers Tür. Er klingelte zweimal hektisch, weil er in Eile war. Frau Bauer öffnete die Tür und rieb sich verschlafen die Augen. Auf ihrem Arm lag ihr alter Kater Heinz und schnurrte. „Oh. Mathew, mein Junge. Was kann ich um diese frühe Stunde Gutes für dich tun?“ Erst jetzt fiel Mathew ein, dass er gar keine Erklärung dafür hatte, was er von ihr wollte. Spontan fing er an zu erklären: „Ja, also ... haben Sie zufällig noch ein paar alte Kleider aus ihrer Jugend?“ Mathew schätzte, dass sie damals die gleiche Größe getragen haben könnte wie Molly. „Das ist eine ungewöhnliche Frage. Aber ich schaue mal nach, weil du immer ein so guter Junge bist.“ Frau Bauer schwankte zurück in ihr Schlafzimmer, um nach passender Kleidung zu suchen. Trotz ihrer 82 Jahre war sie selbstständig und führte ihren Haushalt alleine. Immer, wenn Mathew sie sah, trug sie ihre rosaroten, mit kleinen Pailletten bestickten, Pantoffeln. Nach zehn Minuten kam Frau Bauer mit einer Plastiktüte in der Hand zurück. Der Kater war nicht mehr bei ihr. Heinz war unterwegs einer Maus hinterher gesprungen. „Hier mein Junge. Das ist alles, was ich auf die Schnelle finden konnte. Wozu brauchen Sie denn das alte Zeug? Sammeln Sie für Hilfsbedürftige?“ Das war seine Chance. Niemals wäre Mathew so eine fantastische Ausrede eingefallen. „Ja, genau! Ich habe großes Mitleid mit den Armen. Einmal im Jahr spende ich sogar für Greenpeace.“ „Ach Mathew! Sie sind so ein herzensguter Mensch. Gott schütze Sie.“ Mathew bedankte sich noch einmal höflich und beeilte sich dann zurück in sein Appartement zu kommen. Seine Schuldgefühle gegenüber dieser armen alten Frau verdrängte er mit dem Gedanken, dass es eine Notlüge war. Später würde Mathew ihr einfach mal wieder im Haushalt oder bei einer Reparatur helfen. Dann wäre die Sache beglichen.
Die Uhr zeigte halb 10, als Matthew wieder in die Wohnung kam. Jetzt war Eile geboten. Schon auf dem Weg ins Schlafzimmer kramte Mathew in der Plastiktüte. Mit geschicktem Griff zog er eine modische hellblaue Bluse mit Rüschen aus dem Beutel. Sie war aus feinem, weichem Stoff gefertigt, der im Tageslicht schimmerte. Das war das perfekte Oberteil für Molly. Als er im Schlafzimmer angekommen war, warf er die Bluse seiner Besucherin zu. Diese hatte sich keinen Zentimeter bewegt und die Decke bedeckte ihre Nasenspitze. Matthew kramte weiter nach einem passenden Unterteil und durchstöberte den Plastikbeutel. Nachdem er einen schwarzen Rollkragenpullover und ein weißes Unterhemd ausgesondert hatte, fand er endlich, wonach er suchte. Es war eine zerrissene Jeans aus den 70` er Jahren. An manchen Stellen waren zur Reparatur andere Stoffstücke aufgenäht worden. Wilde Fransen zierten die Kanten der Hosenbeine. Sie war das perfekte Gegenstück zur blauen Bluse. „Das wird jetzt erst mal für den Augenblick reichen! Später gehe ich mit dir in ein Kaufhaus. Dort kleiden wir dich richtig ein.“ Mathew verließ das Zimmer und wartete vor der Tür, bis Molly fertig angezogen aus dem Schlafzimmer trat. Danach eilten sie aus der Wohnung.
Pünktlich wie immer trat Mathew mit Molly an der Hand aus dem Fahrstuhl. Jetzt war oberstes Gebot auf gar keinen Fall Miss Taylor zu begegnen. Auf Zehenspitzen schlichen die beiden an ihrem Büro vorbei bis an Mathews Schreibtisch. Matthew holte gerade einen weiteren Stuhl, als Miss Taylor aus ihrem Büro stürmte. Sie hatte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen das Kommen der beiden bemerkt. Sie schaute sich um und entdeckte Molly, die auf Mathews Stuhl saß und mit der Computertastatur spielte. Zielstrebig marschierte sie auf Molly zu. „Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Wo ist O`Conner?“ Molly war vor Schreck wie versteinert. Sie brachte keinen Ton heraus, so verängstigt wie sie war. „Hallo? Ich rede mit Ihnen! Sind Sie taub!?“, schrie Susan Taylor Molly an. Doch ihr Geschrei schüchterte sie nur noch mehr ein. Die Angesprochene legte die Hände vor das Gesicht und schluchzte laut. Man konnte förmlich die Tränen hören, welche über ihre Wangen liefen. In diesem Moment trat Mathew mit dem Klappstuhl in der Hand auf den Flur. Er erschrak, als er Molly weinen hörte. Sofort ließ er den Stuhl fallen und rannte zu ihr hinüber. Er streichelte sanft über ihr Haar und tröstete sie. „Hab keine Angst! Ich bin bei dir.“ „O`Conner!? Wer ist diese junge Dame und was hat sie hier zu suchen?“ Mathew starrte zu ihr auf. Jetzt erst merkte er, dass Miss Taylor vor ihm stand und ihm einen vorwurfsvollen Blick zuwarf. „Ja, also … wissen Sie ...“, stotterte er zögerlich. „Das ist Molly ... meine ... Cousine dritten Grades mütterlicherseits.“ „Und was bitte tut sie hier?“ „Nun also ... Ich zeige ihr heute mal meinen Arbeitsplatz, denn ... sie will später auch Polizistin werden. Stimmt’s?“ Er schaute zu Molly hinüber, die seine Aussage kopfnickend bejahte. „Schön. Sie kann von mir aus hierbleiben, aber lassen Sie sie nicht mehr unbeaufsichtigt! Wo ist eigentlich mein Bericht?“, fuhr Miss Taylor Mathew an. „Öhm, ja … der ist ...“ In dieser Sekunde kniff Molly ihn in die Seite und reichte dem Erwischten einen Zettel, ohne dass die Chefin etwas merkte. „..... hier!“ Mathew überreichte den Bericht Miss Taylor. Diese wandt sich ab und marschierte, ohne ein Wort zu sagen, zurück in ihr Büro und schlug die Tür hinter sich zu.
Erleichtert atmete Mathew tief durch. Fragend schaute er Molly an. „Woher wusstest du …?“ Da fiel ihm seine Besucherin ins Wort, „Nenne es Intuition oder einfach Glück für dich.“ Ein breites Lächeln schlich sich auf Mathews Gesicht. Er umarmte sie stürmisch. „Vielen, lieben Dank! Du hast mir das Leben und meinen Job gerettet. Komm! Ich zeige dir, als angehender Polizistin, das restliche Gebäude.“ Er nahm Molly an der Hand und ging mit ihr in Richtung Fahrstuhl.
Erst am späten Nachmittag kamen sie nach Hause. Beide waren beladen mit Einkaufstüten. Gleich nach seinem Dienst war Mathew, wie er es versprochen hatte, mit Molly in ein großes Kaufhaus gegangen. Dort hatten sie allerlei Dinge gekauft. Das schönste Stück, was sie erwarben, war ein weißes Sommerkleid mit Spaghettiträgern und V-Ausschnitt. Die Beiden hatten ebenfalls eine Menge Tiefkühlkost für das heutige Abendessen mitgebracht. „Pizza ist meine Leibspeise!“, erklärte Mathew, als er die gefrorene Scheibe in den Ofen schob. „In zwanzig Minuten ist sie fertig. Wie wollen wir uns die Zeit bis dahin vertreiben?“ „Weiß nicht genau.“, erwiderte Molly. „Wie wäre es, wenn du mir dein bezauberndes neues weißes Kleid noch mal vorführst?“, schlug Mathew vor. Mollys Augen wurden groß und glänzen zu Tränen gerührt. Schon im Laden hatte es ihr auf Anhieb gefallen. Sie strahlte vor Freude, als Mathew ihr das Kleid kaufte. „Darf ich wirklich?“ „Na klar! Es ist doch dein Kleid.“ Molly rannte in das Schlafzimmer, um sich umzuziehen.
Derweil setzte sich Mathew auf die Couch im Wohnzimmer und schenkte sich ein Glas Whiskey ein. Er nahm gerade einen Schluck, als Molly ins Zimmer getänzelt kam. Das weiße Kleid umschmeichelte ihre Figur und bildete einen scharfen Kontrast zu ihren rabenschwarzen Haaren. Der untere Teil des Kleides betonte ihre ohnehin schon langen Beine. In diesem Outfit erinnerte sie Mathew an eine griechische Göttin. „Wundervoll! Du siehst bezaubernd aus.“ Molly lächelte verlegen, drehte sich um ihre eigene Achse und verbog sich dann zu einen Knicks. „Deckst du bitte den Tisch?“, sagte Mathew. Kaum hatte er das gesagt, eilte sie schon in die Küche, um dort Teller und Gläser zu holen. Während dessen nahm Mathew einen beherzten Schluck aus dem Whiskeyglas.
Nach dem Abendessen machten es sich die beiden auf der Couch gemütlich. „Was möchtest du trinken?“ „Wasser wäre nicht schlecht.“ Mathew erhob sich und holte aus der Küche ein Glas Wasser. Für ihn stand immer noch das Whiskeyglas auf dem Wohnzimmertisch bereit.
Er setzte sich wieder. Eine betretene Stille breitete sich aus, was Mathew beunruhigte. „Wir machen es so wie gestern Abend. Du nimmst mein Bett und ich schlafe hier auf der Couch.“ Molly nickte zustimmend. Obwohl Mathew von Natur aus sehr neugierig war, wollte er sie nicht in ein unangenehmes Gespräch über ihre Vergangenheit verwickeln. Ob Sie überhaupt etwas darüber wusste? „Na gut, dann kannst du jetzt als Erste das Bad benutzen. Ich bleibe hier noch ein wenig sitzen.“ Molly erhob sich und schlenderte ins Bad.
In dieser Nacht träumte Molly von ihrer Flucht aus der Anstalt: wie der Pfleger sie mit dem blutigen Skalpell verfolgte und von seinen hasserfüllten grünen Augen. Als der Pfleger sie in eine Ecke gedrängt hatte und mit dem Skalpell ausholte, wachte Molly auf. Sie war schweißnass und zitterte am ganzen Körper. Molly wusste, wenn sie jetzt wieder einschlief, würde der Albtraum weitergehen. In diesem Moment fiel ihr nur ein Mensch ein, bei dem sie Schutz und Geborgenheit fand. Molly stand auf und schlich auf Zehenspitzen ins Wohnzimmer. Die Tür knarrte leise, als Molly sie behutsam öffnete. Sie schlich bis zum Sofa hinüber, wo Mathew tief schlief. Er bemerkte nicht einmal, wie sich Molly zu ihm auf die Couch legte und sich an ihn kuschelte. Behutsam nahm sie seinen Arm und legte ihn um sich. Jetzt war ihr wohler zumute und sie schlief endlich wieder beruhigt.
Als Mathew am nächsten Morgen erwachte, sah er Molly in seinen Armen liegen. Sie schlief still und friedlich, nur mit der neuen Unterwäsche bekleidet, die sie zusammen am Vortag gekauft hatten. Schon bei der Anprobe im Kaufhaus war Mathew aufgefallen, wie außerordentlich reizend sie darin aussah. Spontan schlussfolgerte er, dass sie miteinander geschlafen hatten. Er hatte gestern wieder viel zu viel Whiskey getrunken, weshalb er sich an nichts erinnerte. Er besann sich, dass sie ins Bad gegangen war, doch dann kam nichts mehr. Wer wusste schon, was danach passiert war? Da er seinem Spürsinn vertraute, küsste er Molly, um sie zu wecken. „Guten Morgen, meine Schöne.“ Die Angesprochene öffnete langsam die Lider. In diesem Moment küsste er sie erneut. Sie riss die Augen weit auf. Verwirrt löste sie sich aus seiner Umarmung, sprang auf und rannte ins Bad. Man hörte nur die Tür lautstark ins Schloss fallen. Irritiert atmete Mathew tief durch. „Mist! Da habe ich mich wohl geirrt.“, dachte er. Es wäre aber auch zu schön gewesen.
Kapitel 3
In der Nacht kamen sie, um sie zu holen. Plötzlich und unerwartet brachen sie Mathews Wohnungstür auf. Es waren drei muskulöse Männer in weißem Polohemden und gleichfarbiger Hose, der Standartkleidung des Personals in Allingtons Psychiatrie. Ohne zu zögern, trennten sie sich im Flur. Einer betrat das Schlafzimmer, in dem Molly schlief. Die anderen zwei stürmten in das Wohnzimmer, um Mathew zu überwältigen. Sie wussten genau, dass er dort schlief, da sie die beiden schon länger beobachteten.
Alles passierte sehr schnell. Bevor Mathew überhaupt begriff, was um ihn geschah, hatten die Männer ihn gepackt und an einen Stuhl gefesselt. Als er Molly schreien hörte, sah er verzweifelt zur Tür. „Lasst sie los! Sie hat euch nichts getan!“, schrie Mathew die beiden Männer an. „Halt die Schnauze!“, bekam er als schroffe Antwort zurück. „Das Miststück ist abgehauen. Wir bringen sie nur wieder nach Hause.“, „Ihr Schweine!“, flüsterte Mathew leise. Prompt versetzte einer der Männer ihm einen Hieb gegen das Gesicht. „Das hab ich gehört!“ Erneut hörte Mathew die verzweifelten Schreie von Molly. Diesmal schienen sie aus dem Flur zu kommen. Da die Wohnzimmertür weit offen stand, sah Mathew mit an, wie der dritte Mann sie unsanft am Arm über den Flur schleifte. Als sich ihre Blicke trafen, schrie sie ihm verzweifelt zu: „Rette mich! Bitte Mathew!“ Aber der war gefesselt und so sehr er auch kämpfte, er konnte sich nicht befreien. Der dritte Pfleger schleifte sie aus dem Appartement. Ihre Schreie waren noch einen Moment zu hören, bis sich eine eisige Stille ausbreitete, welche Matthews Herz im Innersten traf. Die beiden anderen Männer blieben und als der erste die Faust hob, ausholte und die Schläge auf ihn niederprasselten, kniff Matthew die Augen zusammen. „Das wird dir eine Lehre sein, dich in unsere Geschäfte einzumischen“, lachte der Andere derweil. Nach einer Viertelstunde voller Schmerzen verlor Mathew das Bewusstsein.
Als er erwachte, war alles vorüber. Niemand außer ihm war in der Wohnung. Eine unheimliche und zugleich bedrückende Stille erfüllte den Raum. Es roch nach Schweiß und getrocknetem Blut. Warum hatte er sie nicht gerettet? Er hatte sich naiv dem Glauben hingegeben, niemand würde nach Molly suchen. Sein Instinkt hatte ihn im Stich gelassen. Warum hatte er sie überhaupt mitgenommen? Hätte er sie einfach liegen gelassen. Dann dachte er an ihr Lächeln. Immer wenn er ihr dieses sah, hüpfte sein Herz vor Freunde und sein graues Leben erstrahlte von Farben. Bei keiner anderen Frau hatte er bisher so ein Gefühl erlebt. Bevor er Molly traf, waren Frauen für ihn nur Objekte seiner Begierde. Nur da, um eine Nacht glücklich zu sein und morgens nicht alleine aufzuwachen. Am nächsten Tag trennten sich die Wege dann meistens schon wieder. Seine längste Beziehung hatte bisher gerade mal einen Monat gehalten. Aber mit Molly war alles anders. Er wollte sie einfach nur um sich haben und nie wieder loslassen. Ihre Beziehung war eher emotional, nicht unbedingt körperlich. Die letzten zwei Tage waren die besten seines Lebens gewesen. Solche und andere Gedanken kamen ihm, als er, noch immer an den Stuhl gefesselt, an die Wand starrte.
Nur durch Zufall entdeckte er die leere Whiskeyflasche auf dem Wohnzimmertisch. Das war seine Gelegenheit, sich zu befreien. Stück für Stück rückte er näher an den Tisch, in dem er mit dem Stuhl kleine Sprünge vollführte. Es war weniger als einen Meter Strecke zurückzulegen. Trotzdem dauerte es mindestens 20 Minuten, bis er endlich am Tisch angekommen war. Mathew griff nach der Flasche. Mit einem geübten Schlag zertrümmerte er sie, sodass der Flaschenhals mit scharfen Kanten in seiner Hand verblieb. Das war das perfekte Werkzeug, um sich zu befreien. Mathew schnitt damit die Handfesseln durch und sagte dann zu sich selbst: „Ich hab es doch immer gewusst. Dieser Whiskey rettet mir irgendwann das Leben!“
Die nächsten Tage erschienen ihm trostloser und ermüdender als sonst. Im Bett quälten ihn Albträume von jener Nacht, in der sie Molly holten. Mit jedem schweißgebadeten Aufwachen wurde Mathew bewusster, wie sehr sie ihm fehlte und was er wirklich für Molly empfand. Ihm war klar, dass sie nicht mehr als 24 Stunden zusammen verbracht hatten, dennoch kam es ihm vor, als wäre es eine Ewigkeit. Eine glückselige, die Sinne benebelnde Ewigkeit. Bei diesem Gedanken wurde ihm bewusst, dass er sie in jedem Fall retten musste. Er war nicht umsonst Polizist. Seine Ausbildung und die Kontakte im Revier waren jetzt doch zu etwas gut. Der Gedanke kam ihm das erste Mal in seinem Leben. Es gab nur ein Problem. Er hatte keine Ahnung, wie er das am besten anstellte. Es war ihm nicht möglich, in aller Selbstverständlichkeit in die Psychiatrie hineinspazieren und Molly rauszuholen. Gab es eine andere raffiniertere Lösung? Plötzlich fiel ihm der Hauptcomputer der Polizei ein. In diesem waren alle Leute gespeichert, die in und um Allington wohnten. Dort erhielt er Informationen über die Psychiatrie und ihren Leiter. Gedacht getan, der Plan stand.
An diesem Morgen eilte Mathew schon in aller frühe zur Arbeit. Er war sogar vor Miss Taylor im Büro. Mathew marschierte zielstrebig zu seinem Schreibtisch, wo der Computer stand. Dieser war die Lösung zu allen seinen Problemen.
Kaum hatte er den Rechner eingeschaltet, da spürte er plötzlich ein leichtes Atmen an seinem Hals. Etwas erschrocken schaute er zur Seite. Da stand Miss Taylor, die sich über ihn gebeugt hatte, um zu schauen, was er so früh an seinem Arbeitsplatz suchte. An diesem Tag war ihr Ausschnitt so tief wie nie zuvor. Mathew wandte seinen Blick hastig ab, um die sündigen Gedanken zu verbannen. „Sie arbeiten schon? Dass Sie sich aber nicht überanstrengen“, sagte sie mit einem Hauch von Sarkasmus in der Stimme. Mathew schwieg und starrte auf den Bildschirm. Mollys Rettung hatte jetzt oberste Priorität. Mathew schüttelte seinen Kopf, um die wirren Gedanken neu zu ordnen. „Nein, nein. Sorgen Sie sich nicht, Miss Taylor! Ich will nur nicht meinen Posten verlieren.“ Die Chefin war überrascht von dieser Antwort. Nie hätte sie geglaubt, dass Mathew O`Conner einmal so viel Ehrgeiz entwickeln würde und das nach einer ihrer Ansprachen. Zufrieden mit ihrer Leistung als Chefin überließ sie Mathew wieder sich selbst. „Na gut. Dann weiter machen, O`Conner!“, sagte sie, hob den Daumen in Mathews Richtung und lächelte. Er traute seinen Augen kaum. In all den Dienstjahren war dass, das erste Lob. Sie bildete sich wahrscheinlich ein, dass er das nur wegen ihrer Ansprache von neulich tat. Das war ihm jetzt auch egal. Er hatte andere Probleme, als sich mit Susan zu beschäftigen. Zu groß war der Drang, Molly zu retten. Er wendete sich dem Computer zu, der inzwischen hochgefahren war. Mathew gab sein siebenstelliges Passwort ein und schon öffnete sich das Personenregister. Es dauerte eine ganze Weile, bis er endlich den Ordner „Psychiatrie Allington City“ fand. Gleich am Anfang der Liste stand der Direktor, Adrien Grey. Er war der reichste Mann in der gesamten Stadt und seine Familie, die Vincentos waren mehr als einflussreich und regierten die gesamte Stadt. Wenn man ihn zum Freund hatte, brauchte man keine Feinde mehr. „Die Mafia“, knurrte Matthew, als es ihm eiskalt über den Rücken lief. Er wusste, dass Adrien schon mehrere Vorstrafen wegen illegalem Drogen- und Menschenhandel vorzuweisen hatte. Er war damals sogar bei einer der Anhörungen anwesend. Das Gericht sprach Adrien Grey jedoch aus Mangel an Beweisen frei. Nichtsdestotrotz hielt Mathew Mister Grey nach wie vor in allen Anklagepunkten für schuldig. Eine wahnsinnige Wut entbrannte in ihm, wenn er sich vorstellte, welche Perversionen er mit Molly auslebte. Es lief wie ein mieser Spielfilm vor seinem geistigen Auge ab. Erst dröhnten sie Molly mit Drogen zu. Dann wurde sie von Mister Grey und seinen Helfern wie ein Spielzeug benutzt. Bei diesem Gedanken lief Mathew ein weiterer kalter Schauer über den Rücken und er rieb sich die fröstelnden Oberarme. Kurzerhand wählte er die Nummer der Psychiatrie. Für einen perfekten Plan brauchte er wesentlich mehr Informationen. Eine jüngere Frauenstimme meldete sich aus dem Hörer. „Einen wunderschönen guten Tag. Psychiatrische Einrichtung Allington. Sie sprechen mit Frau Hörmann. Was kann ich für Sie tun?“ „Guten Tag. Ich hätte gerne den Direktor Adrien Grey gesprochen.“, „Bevor ich Sie durchstelle, wenn darf ich bei Herrn Grey melden?“„Ich bin .... Leiter eines großen Pharmaunternehmens. Mister Grey weiß schon Bescheid.“, „In Ordnung. Ich werde Sie verbinden. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.“ Nach diesem Satz erklang die kleine Nachtmusik von Mozart aus dem Hörer. Es dauerte einige Minuten, bis schließlich eine raue Männerstimme zu hören war. „Ja, bitte? Fassen Sie sich kurz. Ich habe noch mehr wichtige Aufgaben zu erledigen.“, „Guten Tag. Ich bin Leiter eines der größten Pharmaunternehmen des Landes und an etwas ganz Bestimmten interessiert. Wenn Sie verstehen, was ich meine“, sagte Mathew. Plötzlich klang die raue Stimme höchst erfreut. „Ah! Ein neuer Kunde! Kommen Sie doch gleich morgen gegen 14 Uhr hier vorbei. Dann zeige ich ihnen die Ware“, „Wie Sie meinen. Ich freue mich“, erwiderte Mathew und beendete damit das Gespräch. So leicht hatte er sich den Einstieg nicht vorgestellt. Morgen holte er sich, wie erhofft, die restlichen Informationen, die er für Mollys Rettungsaktion brauchte.
Kapitel 4
Es war halb zwei am Nachmittag, als Mathew aus dem Taxi am Hafen ausstieg. Allington City hatte nur einen kleinen Ankerplatz, da dieser nur den Zweck erfüllte, Leute zur Psychiatrie überzusetzen oder zurückzubringen. Dem entsprechend war die Anzahl der vor Anker liegenden Boote sehr spärlich. Mathew blechte zwanzig Dollar für ein kleines Ruderboot, mit dem er zur Insel übersetzte. Die See war an diesem Tag rau und stürmisch und dies gestaltete die Überfahrt durchaus mühsam. Hohe Wellen schlugen gegen das Boot, so dass es beinahe kenterte. Dazu wehte eine steife Brise. Auf den Lippen schmeckte Mathew Salzwasser und seine Augen brannten von der Meeresluft. Doch er wusste, für wen er sich diese Strapazen antat und so jubilierte sein Herz, das der Plan bis jetzt reibungslos klappte. Nach etwa fünfzehn Minuten Fahrt dockte das kleine Boot am Ufer an. Mathew bemühte sich nach Leibeskräften, um das Land auf trockenem Fuß zu erreichen. Mit letzter Kraft zog er das Boot ein Stück weiter an den Strand, damit es die See nicht forttrug. Jetzt galt es, nur noch den Eingang finden. Er schaute sich nach allen Seiten um und entdeckte einen hölzernen Steg direkt vor dem Haupteingang. Er seufzte, dann schritt er aufgeregt, aber entschlossen auf das große Eingangsportal zu. Dabei ließ er seinen Blick über das hohe, massive Gebäude wandern, welches vom Aussehen einer Festung glich. Schon von außen sah man, dass dieses Bauwerk viele Jahre hinter sich hatte. Die Fassade war so grau wie der Himmel an diesem Tag und bröckelte hier und da schon ein wenig. Das Dach war mit roten Ziegelsteinen gedeckt, die ihre besten Jahre schon hinter sich hatten. Das Rot war verwittert und gräulich. Ein riesiger schwarzer Schornstein ragte aus dem Dach und blies weiße Rauchschwaden in den Himmel. Insgesamt wirkte der ganze Gebäudekomplex eher trist, aber dennoch strahlte er eine bedrohliche Aura aus.
Mathew betrat die Eingangshalle durch zwei Schwingtüren am Eingang. Das Foyer war stilvoll eingerichtet und erinnerte an ein Luxushotel. Ein schwarz-weißes Schachbrettmuster aus Fliesen zierte den Boden. In der Mitte war eine Art Wappen angeordnet, welches Matthew nicht erkannte. Es waren zwei goldene Löwen auf royal blauem Hintergrund, die mit erhobenen Pranken gegeneinander kämpften. Der eine trug eine schwarze, der andere eine weiße Krone. „Speziell“, sinnierte Matthew und ließ seinen Blick weiter schweifen. Die Wände waren mit weißer Raufasertapete tapeziert. Mathew steuerte zu der Dame am Empfangsschalter, um sich zu erkundigen, wo er das Büro des Leiters fand. Die Frau hinter dem Schalter war anfang dreißig und hatte langes, lockiges Haar. Eine Tonne Wimperntusche hob ihre großen blauen Augen hervor. Sie trug zusätzlich jede Menge Rouge, um ihre Wangenknochen zu betonen. Ihre vollen Lippen glänzten in einem satten Rot. Sie erfüllte eindeutig jedes Klischee einer Krankenschwester. Leider war ihre Stimme nicht annähernd so zauberhaft wie ihr Aussehen. Es hörte sich an, als stritten hungrige Krähen um ein Stück Fleisch. „6. Stockwerk, Chefetage!“, sagte sie und wies auf den Fahrstuhl. Mathew bedankte sich höflich und verkniff sich gleichzeitig ein Lachen. Ihre Stimme war zu komisch. Manchmal täuschte das Aussehen wirklich über einige Schwächen hinweg. Zielstrebig marschierte er zum Fahrstuhl. Während er wartete, drehten sich seine Gedanken nur um ein Thema: die Rettung von Molly. Schon beim Hineinkommen hatte er sich gründlich nach Überwachungskameras und Sicherheitspersonal umgeschaut. Er bemerkte aber nur einen breitschultrigen Mann mit militärisch geschnittenen Haaren an der Eingangstür. Dieser trug eine schwarze Sonnenbrille und einen Maßanzug, wie er typisch für Security-Mitarbeiter war, oder für die Schläger der Mafia.
Ein lautes „Ping“ riss Mathew aus seinen Gedanken. Die Aufzugtüren öffneten sich und Mathew sah, dass der Fahrstuhl bereits brechend voll war. Trotzdem zwängte er sich dennoch. Eigentlich litt er ja an einer Art pseudo Klaustrophobie. Heute hieß es jedoch „Augen zu und durch“. Sein Ziel Molly zu retten verlieh ihm eine Menge Kraft. Ein weiteres „Ping“ erklang, die Lifttüren öffneten sich und gaben den Blick auf das erste Stockwerk frei. Hier waren die Personalabteilung und das Medikamentenlager untergebracht. Alle drängten sofort aus dem Fahrstuhl, mit dem Ziel, ihre Aufgaben zu erledigen. Wie in einem Ameisenhaufen liefen Krankenschwestern, Pfleger und Büroangestellte wild durcheinander. Ein verführerischer Duft von frischem, heißem Kaffee lag in der Luft. Mathew hatte sich eine Psychiatrie immer anders vorgestellt. Dieser Anblick erinnerte ihn vielmehr an eine Firma, in der alle Angestellten hin und her hasteten wie fleißige Bienen.
Als zum dritten Mal ein „Ping“ erklang und sich die Türen langsam schlossen, atmete Mathew tief durch. Er war inzwischen Mutterseelen alleine im Fahrstuhl, worüber er mehr als froh war. Plötzlich schob sich eine kräftige Hand mit langen Fingern zwischen die Türen. Zum Vorschein kam ein fein gekleideter, schlanker und trotzdem muskulöser Mann. Er war großzügige zehn Zentimeter größer als Mathew, der sich mit seinen einen Meter achtzig immer groß vorgekommen war. Der Mann hatte sein schwarzes Haar, welches im Licht des Fahrstuhls etwas meliert wirkte, mit einer ganzen Hand Haargel nach hinten gekämmt. Nur vorne fielen ihm beim Laufen ein paar Strähnen ins Gesicht. Die altrosafarbene Krawatte bildete einen scharfen Kontrast zu dem sonst eher schlichten dunklen Anzug. Dieser Mann strahlte eine Entschlossenheit aus, die Mathew bis jetzt nur von einem einzigen Menschen kannte: Susan Taylor. Jedes Morgen sah Mathew genau diese Entschlossenheit in ihren Augen.
Der Mann betrat den Fahrstuhl und betätigte den Knopf für die sechste Etage. Dann trat eine beklemmende Stille ein. Matthew fragte er frei heraus und dass, obwohl die Frage durchaus unhöflich war: „Werden Sie ebenfalls vom Chef erwartet?“ „Ja, ich arbeite sozusagen dort“, bekam er als Antwort zurück. „Und sie?“ „Ich wurde hierher eingeladen! Ich habe gleich ein Treffen mit Mister Grey“, verkündete Mathew mit vor Stolz geschwelter Brust. „Na, das trifft sich gut. Dann beginnt unser Treffen schon früher als geplant.“ Adrian streckte ihm die Hand zur Begrüßung hin. „Mein Name ist Adrian Grey. Ich leite die psychiatrische Klinik von Allington City.“ Für ein paar Sekunden war Mathew erstaunt. Niemals hätte er ihn auf der Straße wiedererkannt. Bei der damaligen Anhörung trug er das Haar schulterlang und war zusätzlich etwas legerer gekleidet. Wie die Zeit einen Menschen veränderte! Es war mal wieder allerhöchste Zeit die Bilder in den Polizeiakten zu erneuern. Solche Aufgaben hasste Mathew, deswegen schob er sie immer bis auf äußerste hinaus. Solange, bis Miss Taylor wieder einen ihrer berühmten Wutanfälle bekam und durch das ganze Polizeiquartier brüllte. Verlegen schüttelte Mathew Mister Greys Hand. „Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich konnte nicht ahnen, dass sie Adrien Grey sind.“, „Ist schon in Ordnung. Viele halten mich für einen alten Sack, der nur zu Hause in seiner Villa sitzt und mit Tonnen von Geld um sich wirft. Dabei bin ich erst Ende Zwanzig!“ „In Ordnung, dann lassen Sie uns gleich zur Sache kommen. Sie wissen, warum ich hier bin?“, erwiderte Mathew mit ernster Miene. „Selbstverständlich. Sie wollen sich meine ‚Ware‘ genauer ansehen. Stimmt’s?“, „Richtig!“, „Gut, die Zimmer der Patienten befinden sich im 4. Stock.“ Mister Grey drückte den Knopf für die 4. Etage. Da der Fahrstuhl jedoch erst in die 6. fuhr, hatten sie Zeit, um einige Einzelheiten zu besprechen. „An was haben Sie denn so gedacht? Eher einen Mann oder eine Frau?“, begann Mister Grey fragend. Dabei funkelten seine grünen Augen verstohlen auf. „Ich bin mir nicht sicher, was für unsere Zwecke geeignet ist. Könnten Sie mir von beiden Geschlechtern etwas zeigen?“, erwiderte Mathew. „Sehr gerne dürfen Sie sich alles genaustens ansehen. Bevor ich es vergesse, wir verkaufen auch an Privatpersonen. Nur falls Interesse besteht.“ Mathew schluckte heftig. Für einen Moment schoss ihn der Gedanke durch den Kopf, Molly einfach frei zu kaufen. Als erfahrener Polizist ließ er sich trotz dieser Gefühlsachterbahn nichts anmerken. Er erwiderte nur trocken: „Ich lasse mir ihr Angebot mal durch den Kopf gehen. Im Moment suche ich aber nur etwas für mein Unternehmen.“ Ein weiteres „Ping“ unterbrach ihr Gespräch. Sie waren im 6. Stockwerk angekommen. Die Türen öffneten sich, um sich gleich darauf wieder zu schließen. Die Fahrt nach unten wurde von einer erdrückenden Stille geprägt. Mathew wartete auf ein weiteres „Ping“, um das Schweigen zu brechen.
Dann war es endlich soweit. Noch ein „Ping“ - das Zeichen, dass sie angekommen waren.