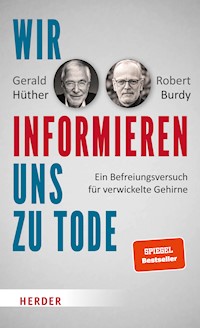Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Was Schiller einst dachte, bestätigt heute die Neurowissenschaft: Im Spiel entfalten Menschen ihre Potenziale, beim Spiel erfahren sie Lebendigkeit. Doch das Spiel ist bedroht – durch seine Kommerzialisierung ebenso wie durch suchterzeugende Online-Spiele. Der Hirnforscher Gerald Hüther und der Philosoph Christoph Quarch wollen sich damit nicht abfinden. Sie erläutern, warum unser Gehirn zur Hochform aufläuft, sobald wir es spielerisch nutzen, erinnern an die Wertschätzung des Spiels in früheren Kulturen und zeigen, welche Spiele dazu angetan sind, Freiräume für Lebensfreude zu öffnen – damit wir unsere spielerische Kreativität nicht verlieren!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Was Schiller einst dachte, bestätigt heute die Hirnforschung: Im Spiel entfalten Menschen ihre Potenziale, beim Spiel erfahren sie Lebendigkeit. Doch gegenwärtig ist das Spiel bedroht – durch seine Kommerzialisierung ebenso wie durch suchterzeugende Online- und Glücksspiele. Der Hirnforscher Gerald Hüther und der Philosoph Christoph Quarch wollen sich damit nicht abfinden. Sie rufen dazu auf, die Bedeutung des Spiels wiederzuentdecken. Sie erläutern, warum unser Gehirn zu Hochform aufläuft, sobald wir es spielerisch zu nutzen beginnen, und weshalb Computerspiele nicht geeignet sind, um die in uns angelegten Potenziale zu entfalten. Sie erinnern an die hohe Wertschätzung des Spiels in früheren Kulturen und zeigen, welche Spiele dazu angetan sind, Freiräume für authentische Begegnung und Lebensfreude zu öffnen – damit wir in einer vom instrumentellen Denken beherrschten Welt unsere spielerische Kreativität nicht verlieren.
Hanser E-Book
Gerald Hüther
Christoph Quarch
RETTET DAS SPIEL!
Weil Leben mehr als Funktionieren ist
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-44709-7
© Carl Hanser Verlag München 2016
Umschlag: Hauptmann & Kompanie, Zürich
Satz: Kösel Media GmbH, Krugzell
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
INHALT
Vorspiel
Was wird aus uns, wenn wir aufhören zu spielen?
Feuerwerk für graue Zellen
Die Neurobiologie des Spielens
Die befreiende und verbindende Kraft des Spielens
Die Spielfreude der Gene
Das universelle Prinzip des Lebens
Die spielerische Entfaltung von Kreativität
Das Gehirn als Organ für spielerische Kokreativität
Das Lächeln des Weisen
Zur Philosophie des Spielens
Die Spielweisen der alten Mythen
Die Spielweisen der antiken Philosophie
Die Spielweisen der Neuzeit
Angriff der Spielverderber
Wenn das Spielfeld zum Marktplatz wird
Die Herkunft des Homo oeconomicus
Die Verwechselung von Gewinn machen und gewinnen
Das schleichende Gift der Spielsucht
Wie Spiele missbraucht werden
Die Entzauberung des Zuschauers
Der Fluch der Monokulturen
Inseln der Lebendigkeit
Zur Phänomenologie des Spielens
Wo das Spiel ursprünglich ist
Wo wir heute spielen können
Leinen los und auf in die Freiheit!
Von der spielerischen Lebenskunst
Warum wir eine Kultur spielerischer Lebenskunst brauchen
Wie eine spielerische Lebenskunst unseren Alltag schöner werden lässt
Nachspiel auf Erden
Was wird aus uns, wenn wir beginnen, den Zauber des Spiels wiederzuentdecken?
Nachspiel im Himmel
Literatur
Anmerkungen
VORSPIEL
WAS WIRD AUS UNS, WENN WIR AUFHÖREN ZU SPIELEN?
Wir Menschen sind wunderbare Wesen. Wir verfügen über eine Fähigkeit, die uns unglaubliche Möglichkeiten eröffnet: Wir können zeitlebens Neues hinzulernen. Ausgestattet mit lernfähigen Gehirnen sind wir in der Lage, die Welt, in der wir leben, nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das haben wir getan. Und wie wir das getan haben!
Allmählich jedoch beginnen wir zu erkennen, dass nicht alles, was uns und unseren Vorfahren einmal wünschenswert erschien, uns und unseren Kindern auch wirklich ein gutes und glückliches Leben und Zusammenleben ermöglicht. Manches, was vor wenigen Jahren noch als erstrebenswert galt, bereitet uns zunehmend größere und schwerer zu lösende Probleme. Aber langsam dämmert uns, dass die Fähigkeit, die Welt nach Maßgabe der eigenen Wünsche und Ideen zu gestalten, nicht zwangsläufig von Vorteil ist.
Denn dieses wunderbare Gehirn hat als nicht durch genetische Programme konstruiertes Denkorgan auch einen entscheidenden Nachteil: Bei dem, was wir uns damit ausdenken, können wir uns irren. Was wir gestern noch für richtig und wichtig hielten, kann sich morgen schon als fataler Irrtum erweisen. Und allzu oft haben wir in Form von Leid und Elend anschließend einen hohen Preis für diese Irrtümer gezahlt: Angst, Ohnmacht, der Verlust von Lebensfreude. Wir sollten also vorsichtig sein bei der Umsetzung dessen, was uns auf den ersten Blick als wünschenswert oder bisweilen auch alternativlos erscheint.
Gewiss ist es kein Fehler, bei dem, was wir tun, danach zu fragen, wie es sich am einfachsten, schnellsten und kostengünstigsten machen lässt, wie sich unser Handeln effektiver organisieren und unser gesamtes Leben ökonomischer und bequemer gestalten lässt. Dass solche Fragestellungen aber nicht auf alle Lebensbereiche ausgeweitet werden können, bemerken wir meistens erst dann, wenn uns bei aller Effektivität, Funktionalität, Produktivität und Profitabilität etwas verloren gegangen ist: etwas, das wir dringend brauchen, um unser Leben nicht nur möglichst angenehm, sicher und nutzbringend zu gestalten, sondern auch und vor allem so, dass es uns erfüllt und wir Lebendigkeit, Leichtigkeit und Lebenslust verspüren, ja, dass es uns glücklich macht. Genau das aber ist in unserer gegenwärtigen, vom ökonomischen Denken beherrschten Welt eher die Ausnahme. Viele Menschen fühlen sich einsam, unglücklich und ausgebrannt. Psychische Krankheiten greifen um sich und eine diffuse Unrast macht sich breit. Könnte es also sein, dass wir uns mit unserer Vorstellung davon, worauf es im Leben ankommt, geirrt haben?
Solche Gedanken zu denken, ist schmerzhaft, aber anders können wir nicht herausfinden, was uns hilft und was uns schadet. Nur aus den Fehlern, die wir machen, und aus den Fehlentwicklungen, die wir in Gang setzen, können wir lernen, was besser oder richtiger gewesen wäre: was uns glücklicher, kreativer, gesünder, entwicklungsfähiger gemacht hätte – und machen könnte. Doch was genau könnte das sein?
Es könnte etwas sein, das wir in den letzten Jahrzehnten über all unseren Anstrengungen, das Leben gewinnbringender, erfolgreicher, effektiver, sicherer und bequemer zu machen, aus dem Blick verloren haben: die Lust am Spielen. Was das bedeutet und welche Konsequenzen es für uns hat – für jede Einzelne und jeden Einzelnen ebenso wie für unsere Gesellschaft im Ganzen: Davon handelt dieses Buch.
Wir haben es geschrieben, weil wir um den Fortbestand unserer Kultur besorgt sind; weil wir der fortschreitenden Funktionalisierung und Ökonomisierung unseres Lebens Einhalt gebieten wollen; weil wir die Freiheit und Schönheit des Lebens bewahren wollen. Wir haben es geschrieben, weil uns die Hoffnung bewegt, in einer gemeinsamen Anstrengung die schönste Pflanze der abendländischen Kultur zu neuer Blüte zu bringen. – Deshalb werben wir für unseren zivilisatorischen Imperativ: Rettet das Spiel!
Dass es tatsächlich möglich ist, dem Ernst des Lebens spielerisch zu begegnen, können Sie sich womöglich nur schwer vorstellen – gerade angesichts all der Krisen, die unsere Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts erschüttern. Aber davon wollen wir uns nicht entmutigen lassen. Deshalb bieten wir Ihnen jetzt die Gelegenheit zu erleben, wie schnell Sie Ihre Meinung ändern und lieb gewonnene Denkgewohnheiten ablegen können. Sie brauchen dafür noch nicht einmal dieses Buch von der ersten bis zur letzten Seite durchzulesen: Wir kommen direkt auf den Punkt. Genauer gesagt: auf fünf Punkte.
Erstens: Sie spielen öfter, als Sie denken. Schon wenn Sie denken, spielen Sie. Zumindest dann, wenn Sie in Gedanken alle vorstellbaren Möglichkeiten zur Lösung eines Problems, zum Erreichen eines Ziels oder zur Realisierung einer Absicht durchspielen: Bevor Sie handeln, überlegen Sie erst einmal, wahrscheinlich sogar sehr sorgfältig, wie Sie das, was Sie vorhaben, verwirklichen könnten. Sie tun erst einmal noch nichts (jedenfalls dann, wenn Sie einigermaßen bei Verstand sind). Erst einmal probieren Sie gedanklich aus, was alles denkbar und dann vielleicht auch umsetzbar ist.
Genau dasselbe taten Sie auch schon als kleines Kind, wenn Sie in Mutters Küche alle möglichen Kochutensilien herauskramten und sich fragten, was sich wohl damit alles machen lässt. Weil Ihre Vorstellungskraft damals noch nicht ganz so gut entwickelt war wie heute, werden Sie das Mögliche weniger gedacht, dafür aber praktisch ausprobiert haben. Wenn Kinder so etwas tun, sagen wir: Sie spielen.
Als denkender Erwachsener haben Sie genau genommen nur die Spielweise verändert: Gedankenspiele statt Kinderspiele. So oder so aber Spiele. Herzlich willkommen in der Welt, in der der Mensch nur dort ganz Mensch ist, wo er spielt. Denn was wären wir, wenn wir aufhörten zu spielen? Wir würden dann genauso reagieren wie ein Computer. Die können, weil sie nicht die Fähigkeit haben, in Gedanken zu spielen, auch immer nur das hervorbringen, wofür jemand sie programmiert hat. Ein Leben ganz ohne Gedankenspiele wäre ein Leben ohne Lebendigkeit.
Wir machen weiter.
Zweitens: Das spielerische Erproben dessen, was alles geht, ist nicht nur die entscheidende Voraussetzung dafür, dass Sie sich selbst als denkendes Wesen erleben können. Es ist auch das, was unseren äffischen Vorfahren den Weg zur Menschwerdung ermöglicht hat. Nichts von all dem, was im Verlauf dieses langen Prozesses erreicht worden ist, hätten Menschen erfinden, entdecken, bauen und nutzen können, wenn diese Fähigkeit in ihrem Gehirn nicht von Anfang an als Potenzial angelegt gewesen wäre. Zeugnisse dieses frühen Spielens finden wir noch heute in Höhlenzeichnungen. Auch die Mythen unserer Ahnen sind voller spielerischer Eleganz.
Nach allem, was wir wissen, spielen Menschen schon so lange, wie es Menschen gibt. Das kann auch gar nicht anders sein: Hätten sie nicht gespielt, wären sie nie in der Lage gewesen, den gesamten Erdball zu bevölkern und all das zu erfinden und zu entdecken, was uns als Menschen heute so selbstverständlich geworden ist. Ohne die immer neue spielerische Erkundung der in uns angelegten Potenziale hätten wir Menschen uns gar nicht weiterentwickeln können. Dass wir die Herausforderungen einer sich ständig verändernden Lebenswelt überhaupt zu meistern vermochten, uns an neue Gelegenheiten anpassen, neue Möglichkeiten erschließen konnten – und nicht irgendwann im Zuge der Evolution ausgestorben sind –, verdanken wir unserer Fähigkeit zu spielen.
Aber das ist noch nicht alles.
Drittens: Das Spielen haben wir Menschen gar nicht selbst erfunden. Auch Tiere spielen. Nicht alle, aber all jene, die mit einem lernfähigen, nicht durch genetische Programme fest verkabelten Gehirn zur Welt kommen. Krähenvögel zum Beispiel oder kleine Kätzchen und Hunde. Je lernfähiger ihr Gehirn ist, umso häufiger und umso intensiver spielen sie. Das Spiel ist also von Anfang an alles andere als eine nutzlose Beschäftigung zum Zeitvertreib: Es ermöglicht schon den Tieren und erst recht uns Menschen das Ausprobieren all dessen, was dem betreffenden Tier- oder Menschenkind möglich ist. Spielerisch finden sie heraus, was sie mit ihrem Körper, den Armen und Beinen, den Händen oder – im Fall der kleinen Kätzchen – mit dem Schwanz alles machen können.
Und später setzt sich dieser spielerische Erkundungsprozess des Möglichen in der Beziehung zu Eltern, Geschwistern und anderen Lebewesen fort. Bis jede und jeder herausgefunden hat, was alles geht und was nicht funktioniert. »Selbstorganisiertes, intrinsisch gesteuertes Lernen« nennen das die Lernpsychologen und haben inzwischen verstanden, dass diese Art des Lernens entscheidend dafür ist, wie gut sich ein Tier- oder Menschenkind später in der Welt zurechtfindet. Und was ist die Ursache für dieses Lernen? Das Spiel. Und wann kann ein Kind all das nicht mehr selbst lernen? Wenn es ständig unterrichtet und »frühgefördert« wird, sodass ihm keine Zeit zum Spielen mehr bleibt.
Immer noch nicht überzeugt? Okay, dann eben auch das noch, aber nur ganz kurz, denn es steht im Mittelpunkt unseres Buches.
Viertens: Ohne die Möglichkeit des spielerischen Ausprobierens gäbe es gar keine Kreativität. Einfach nur weiterdenken, was schon gedacht worden ist, können wir alle. Manche sogar besonders gut, wenn sie dazu gezwungen oder dafür belohnt werden. Aber dadurch, dass jemand das bereits Vorhandene ergänzt, umbaut oder verbessert, kommt nichts wirklich Neues in die Welt. Ein Fenster bleibt ein Fenster, auch wenn es nun eine Vakuum-Doppelverglasung und einen Plastikrahmen hat. Im Englischen heißt so etwas linear innovation, also die bloße Verbesserung des Bestehenden. Wirklich interessant sind die sogenannten breakthrough innovations, also tatsächlich neue, kreative Lösungen. Die Entdeckung der α-Helix-Struktur der DNA war so etwas – oder die Relativitätstheorie oder der Düsenantrieb oder der Verbrennungsmotor.
Fragt man danach, was es möglich gemacht hat, dass jemand eine völlig neue, bisher noch nicht gedachte oder auch nicht für möglich gehaltene Lösung finden konnte, dann stößt man immer wieder auf das gleiche Phänomen: Die entscheidende Idee kam nicht am Schreibtisch und auch nicht kurz vor der Deadline oder der angedrohten Kündigung, sondern morgens, noch im Halbschlaf, oder nachmittags bei einem Spaziergang oder abends unter der Dusche. Also immer dann, wenn kein Druck herrschte, wenn im Hirn mal das eine, mal das andere durchgespielt werden konnte, bis sich plötzlich etwas zu einem stimmigen Bild zusammenfügte. Der Durchbruch in das Neue entstand ganz von allein, hervorgegangen aus dem Spiel der Gedanken.
Einen fünften und letzten wichtigen Pflock für das Spiel möchten wir noch einschlagen: Ohne das Spiel gäbe es keine Schönheit. Maler spielen mit ihren Farben, Musiker spielen ihre Instrumente, Dichter spielen mit Worten, Tänzer mit Schritten und Bildhauer mit Ton und Marmor. Bei Lichte besehen sind alle Künste große Spielarrangements, mit denen wir spielerisch unsere Welt so einrichten, dass wir uns in ihr zu Hause fühlen, sie bejahen und gutheißen können, ja glücklich sind. Denn, wo uns solche Erfahrungen zuteilwerden, erfahren wir uns und die Welt nicht nur als sinnvoll, sondern erleben auch das Glück – das Glück, von dem Hermann Hesse einst sagte, es sei nichts anderes als ein »Mitsingen im Chor der Sphären, Mittanzen im Reigen der Welt, Mitlachen im ewigen Lachen Gottes«1: Mitspielen im Spiel des Lebens, um es auf den Punkt zu bringen. Denn seien wir ehrlich: Nutzen hin oder her – sind es nicht gerade Schönheit und Poesie, Anmut und Eleganz, die unsere Seele vibrieren lassen? Und erleben wir diese Qualitäten nicht gerade dann, wenn wir spielen? Steht dann nicht oft die Zeit still? Und fühlt sich das Leben nicht lebendiger an, wenn wir den großen Spielen unserer Künstler beiwohnen? Und besonders, wenn wir selbst im Spiel sind und spielend Schönheit schaffen, wenn wir die Grenzen der Wirklichkeit überwinden, indem wir sie in leuchtende Farben tauchen, Geschichten von anderen Welten erzählen oder eine Tonfolge finden, die uns selbst zum Klingen bringt? Nicht nur die Erfindung brauchbarer Gegenstände und technische Innovationen verdanken sich dem Spiel, sondern auch das ganze weite Feld der Kunst.
Johan Huizinga, ein niederländischer Kulturwissenschaftler, hat gezeigt, dass unsere ganze Kultur bei Lichte besehen nichts anderes ist als ein grandioses Spielergebnis – und dass sich die Kulturentwicklung der Menschheit als Folge immer komplexerer, schönerer Spiele begreifen lässt; dass sie jedoch gefährdet ist, wenn andere, dem Spiel zuweilen feindlich gesonnene Mächte wie die Wirtschaft und auch die Wissenschaft die Spielräume für Kunst und Kultur verdrängen oder kolonialisieren.2 Auch die großen Religionen haben sich wiederholt als Spielverderber erwiesen. Dabei war das Feld der Spiritualität ursprünglich vom Geist des Spiels durchdrungen, der erst später von jenem unerbittlichen Ernst religiöser Eiferer überlagert wurde, der uns auch heute wieder so große Sorgen bereitet. Ein griechischer Philosoph wie Platon hingegen konnte noch ganz im Geiste seiner von der olympischen Mythologie des alten Hellas inspirierten Spiritualität sagen, der Mensch könne sein Leben nicht besser zubringen denn als unablässige Folge schöner Spiele zu Ehren der Götter.
***
Götter hin oder her: Wer nun noch immer davon überzeugt ist, es wäre Unsinn, dem gewichtigen Ernst des Lebens mit dem heiteren Ernst des Spielens zu begegnen, den bitten wir um Nachsicht dafür, dass wir seine kostbare Zeit so lange in Anspruch genommen – um nicht zu sagen: aufs Spiel gesetzt – haben. Wer aber Lust hat mitzuspielen und sich unserer Entdeckungsreise in die große weite Welt der unbegrenzten Möglichkeiten anzuschließen, die sich dem Menschen dort eröffnet, wo er Zeit und Raum zum Spielen findet, sei zum Weiterlesen und Weiterdenken herzlich eingeladen.
Was Sie erwartet? Im ersten Kapitel dieses Buches kommt die Naturwissenschaft zu Wort. Wir werden Sie mitnehmen in die Tiefenstrukturen des Lebens und des Universums. Wir werden dort erstaunliche Entdeckungen machen und uns vor Augen führen, dass die Welt nicht falsch beschrieben ist, wenn man sie als ein großes Spielgeschehen deutet.
Das lehrten bereits die alten Philosophen, die wir im zweiten Kapitel des Buches konsultieren werden. Es ist erstaunlich, in welch hohem Maße alte Weisheit und neues Wissen passgenau zusammenfinden, wo es um das Spiel geht. Zumindest gilt das für die Denker, die sich intensiv dem Spiel gewidmet haben. Es lohnt sich, diese Magistri ludi – Spielmeister – ins Gespräch zu bringen: Sie zeigen uns, warum wir Menschen gut beraten sind, das Spiel zu retten, wenn es in Gefahr ist.
Der Blick zurück schärft den auf die Gegenwart. Für ihn stellen wir im dritten Teil unseres Buches fest: Nicht alles, was heutzutage als Spiel bezeichnet und vermarktet wird, ist auch tatsächlich ein Spiel. Wie alles, was wir Menschen erfinden, kann auch das Spiel missbraucht und für bestimmte Zwecke und zur Verfolgung bestimmter Absichten instrumentalisiert und verdorben werden. Nicht zufällig tadeln die Kinder beim Würfelspiel diejenigen als Spielverderber, die ihre eigenen Interessen und Ziele dem Spiel unterjubeln und meinen, die Regeln zu ihren Gunsten anpassen zu dürfen. Wenn es heute bei dem, was wir Spiel nennen, in manchen Fällen nicht mehr ums Gewinnen oder Verlieren, sondern um Gewinn und Verlust geht, wenn der Homo oeconomicus (der wirtschaftende Mensch) den Homo ludens (den spielenden Menschen) verdrängt, wenn also ökonomische Interessen unsere Spielwelten kolonialisieren, indem sie – wie bei großen Sportveranstaltungen oder auch in den zahllosen Kasinos an den Ausfallstraßen unserer Städte – das Spiel zum Konsumartikel umformatieren, dann handelt es sich nicht mehr um wirkliche Spiele, denn dann hat jemand das Spiel zu einem Geschäft gemacht und in bitteren Ernst verwandelt. Hier wird deutlich, wie sehr es an der Zeit ist, das Spiel zu retten. Ohne zu übertreiben, lässt sich sagen: Es geht dabei um unser Leben, um unsere Lebendigkeit und unsere Kultur. Es geht ums Ganze.
Und deshalb ist es wichtig, sehr genau zu prüfen, welche Spiele echte sind und uns Menschen guttun – und welche schon durch spielfremde Aspekte korrumpiert sind. Darum geht es im vierten Teil. Hier helfen freilich keine moralischen Kriterien, sondern nur ein klares Verständnis dessen, was das Spiel seinem Wesen nach ist. Wie aber erschließt sich das Wesen des Spiels? Indem wir die weite, bunte Welt der Spiele daraufhin befragen, welche immer wiederkehrenden Grundsignaturen des Spielens sich erkennen lassen. Mit ihnen gewinnen wir die Maßstäbe, anhand derer wir anschließend Empfehlungen aussprechen können, welche Spiele uns geeignet dazu erscheinen, Menschen bei der Entfaltung ihrer Potenziale zu unterstützen und erfüllte Lebendigkeit zu erfahren.
Bei der Rettung des Spiels geht es ums große Ganze, aber es sind die kleinen Gelegenheiten, bei denen sich zur Rettung ansetzen lässt – denn schließlich geht es immer auch um uns und unser eigenes Leben. Zuletzt gilt unser Blick deshalb der Frage, ob und wie es möglich ist, dem guten Geist des Spiels in unserem Alltag mehr Raum zu geben. Wir schlagen im fünften Kapitel darum eine Kultur spielerischer Lebenskunst vor, die sich in unterschiedlichen Bereichen für unser aller Leben als heilsam und lebendigkeitsfördernd erweisen wird: in Familie und Partnerschaft, in Schule und Spiritualität, in Politik und Wirtschaft. So bleibt die von uns geforderte Rettung des Spiels keine abstrakte Angelegenheit, sondern ein höchst konkretes und alltagstaugliches Programm – für jeden Einzelnen wie auch für unsere Gesellschaft im Ganzen. Die Forderung nach einer Rettung des Spiels ist, wie Sie sehen werden, ein politisches, ja, vielleicht sogar ein visionäres Projekt.
Wer spielt, konsumiert nicht. Wer spielt, benutzt nicht. Wer spielt, begegnet dem anderen als einem Gegenüber auf Augenhöhe. Deshalb ist das Spiel in einer von der instrumentellen Vernunft des Ökonomismus beherrschten Welt eine subversive Kraft. Spielen öffnet Räume unbedingter Sinnhaftigkeit, auch wenn kein Zweck dabei verfolgt und kein Nutzen avisiert wird. Spiele öffnen Räume für Kreativität, genauer: für Kokreativität, denn Möglichkeiten werden da am besten erprobt und Potenziale da am besten entfaltet, wo Menschen miteinander spielen. Gemeinsames Spielen ermöglicht Entwicklung und Innovation. Spielplätze sind Landeplätze, auf denen das Neue in die Welt kommen kann.
Wenn wir zu spielen aufhören, hören wir auf, das Leben in all seinen Möglichkeiten zu erkunden. Und damit verspielen wir die Potenziale, die in uns stecken. Wer dem Leben nicht spielerisch begegnet, den erstickt es mit seinem Ernst. Das Leben ist kein Spiel, aber wenn wir nicht mehr spielen können, dann können wir auch nicht mehr leben.
FEUERWERK FÜR GRAUE ZELLEN
DIE NEUROBIOLOGIE DES SPIELENS
»Der Mensch«, notierte Friedrich Schiller, »spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«3 Man spürt sogleich die Wucht, die diesen Worten innewohnt. Gewichtiges ist hier gesagt: über den Menschen und über das Spiel, da beider Wesen hier aufs Innigste verwoben werden. »Menschsein« – so will es scheinen – wird hier mit »Spielen« gleichgesetzt. Oder genauer: Eigentliches Menschsein, voll entfaltetes Menschsein, erblühtes Menschsein, lebendiges Menschsein ereignet sich im Spiel. Das heißt: Wenn wir verstehen wollen, was es heißt, ein Mensch zu sein – ja mehr noch: wenn uns daran gelegen ist, im eigentlichen Sinne Mensch zu sein –, dann sind wir offenbar gut beraten, uns zu fragen, was es mit dem Spiel auf sich hat. Dann müssen wir verstehen, was mit uns geschieht, wenn wir spielen.
Kann es sein, dass das Spiel eine Dimension unseres Lebens ist, an der wir immer dann teilhaben, wenn wir spielen? Und dass wir uns deshalb, wenn wir spielen, auf eine intensive, auf eine echte Weise lebendig fühlen? Dann wäre Spielen etwas völlig anderes als bloßer Zeitvertreib. Dann hieße Spielen: die eigene Lebendigkeit erfahren, Verbundenheit erleben, die eigenen Möglichkeiten erkunden und unser kreatives Potenzial entfalten. Dann würden wir immer dann, wenn wir spielen, diesen besonderen Raum betreten, in dem wir uns als aktive, lustvolle und kreative Entdecker und Gestalter unserer Möglichkeiten erfahren. Das muss es sein, was Friedrich Schiller und – wie wir später noch sehen werden – eine ganze Reihe großartiger Denker auch schon vor ihm erspürt und erkannt haben: dass der Mensch nur dann seinem Wesen gerecht wird, wenn es ihm zumindest vorübergehend gelingt, die Begrenzungen seines alltäglichen Lebens zu überwinden und ein Tor aus der Welt des Notwendigen und Zweckdienlichen in die Welt des Möglichen zu öffnen – im Spiel.
Was zu Schillers Zeiten und auf der Grundlage geisteswissenschaftlicher Ansätze noch nicht so genau fassbar und beschreibbar war, lässt sich inzwischen aber auch mithilfe naturwissenschaftlicher Erkenntnisse weiter untermauern und präzisieren. Vor allem die Befunde, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten dank moderner bildgebender Verfahren im Bereich der Neurowissenschaften zutage gefördert werden konnten, machen es heute möglich, recht detailliert zu beschreiben, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir es nicht mehr primär zur Organisation des Alltages, zum Erreichen irgendwelcher Ziele oder zur Verfolgung bestimmter Zwecke einsetzen. Wenn es uns also gelingt, den Raum zu betreten, in dem wir frei und unbekümmert denken und handeln, wahrnehmen und erkennen und dabei Neues entdecken und das Spektrum unserer Möglichkeiten erkunden können.
Was die Hirnforscher dann, beispielsweise mittels funktioneller Kernspintomografie, im Gehirn eines in dieser Weise spielenden Menschen messen können, ist eine Verringerung des Sauerstoffverbrauchs aufgrund einer verminderten Aktivität der Nervenzellverbände im Bereich der Amygdala. Das ist diejenige Hirnregion, die immer dann besonders aktiv wird, wenn wir Angst haben.
Im Spiel verlieren wir also unsere Angst. Gleichzeitig kommt es zu einer verstärkten Aktivierung all jener neuronalen Netzwerke, die gebraucht werden, um die jeweiligen Herausforderungen des betreffenden Spiels zu meistern. Je komplexer das Spiel ist, desto mehr solcher regionalen Netzwerke werden gleichzeitig aktiviert. Genau das ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir durch neuartige Verknüpfungen der in diesen regionalen Netzwerken verankerten Wissensinhalte neue kreative Einfälle und Ideen entwickeln können. Schließlich lässt sich bei jedem gelungenen Zug, bei jeder gut bewältigten Aufgabe auch noch beobachten, dass bestimmte Neuronenverbände im Mittelhirn, die als »Belohnungszentren« bezeichnet werden, verstärkt zu feuern beginnen. Das damit einhergehende Gefühl erleben wir als Freude, als Lust, manchmal sogar als Begeisterung. Spielen stärkt also unsere Lebensfreude.
Allein diese drei wichtigen Erkenntnisse der Neurobiologie bringen uns einer Antwort auf die Frage, welche Bedeutung das Spiel für uns hat und was mit uns geschieht, wenn wir spielen, deutlich näher. Immer dann, wenn wir zu spielen beginnen, öffnet sich für uns eine Welt, in der all das verschwindet, was uns im alltäglichen Zusammenleben daran hindert, die in uns angelegten Potenziale zu entdecken und zu entfalten. Wenn wir wirklich spielen, erleben wir auch keinen Druck und keinen Zwang mehr, und wenn es nichts mehr gibt, was uns bedrängt, verschwindet auch die Angst. Deshalb fühlen wir uns immer dann, wenn wir spielen, lustvoll und frei.
Die befreiende und verbindende Kraft des Spielens
Nur dann, wenn wir nicht mehr auf die vielfältigen Bedrängnisse und Notwendigkeiten reagieren müssen, die das Leben außerhalb des Spiels ständig für uns bereithält, sind wir in der Lage, wirklich frei zu denken und zu handeln. Dann erst können wir unbekümmert und ohne Angst erkunden und erproben, was alles möglich ist. Kinder spielen noch genau so und finden dabei selbst heraus, was alles geht, aber auch, was nicht funktioniert. Sie hören sofort auf zu spielen, wenn sie unter Druck geraten (beispielsweise wenn sie spüren, dass sie beobachtet werden) oder wenn es ihnen nicht gut geht (weil sie krank sind oder ein Problem sie belastet). Und – es gibt kaum einen besseren Indikator dafür – wenn sie sich verunsichert fühlen und Angst haben.
Sobald sie mit anderen zusammen zu spielen beginnen, erkennen Kinder recht schnell, dass es mehr Freude macht, wenn das, was spielerisch alles möglich ist, durch bestimmte Regeln begrenzt wird. Und spätestens als Erwachsene haben wir dann alle meist recht gut gelernt, diese Spielregeln einzuhalten. Wir halten uns dann an das, was innerhalb der Spielzeit und auf dem »Spielplatz« als Regelwerk von uns als Voraussetzung dafür erkannt worden ist, damit das Spiel ein Spiel bleibt. Es muss jedem Einzelnen die Möglichkeit bieten, sich innerhalb der Spielregeln frei zu fühlen, seine kreativen Potenziale zu entfalten, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vervollkommnen, sein Wissen und Können zu erweitern, sich also spielerisch weiterzuentwickeln.
Das geht zur Not auch allein, aber deutlich mehr Freude erleben wir, wenn wir mit anderen zusammen spielen. Auch hier brauchen wir bestimmte Regeln, auf die wir uns einigen, damit das Zusammenspiel gelingen kann. Und wenn es gelingt, fühlen wir uns mit unseren Mitspielern in einer Spielgemeinschaft verbunden.
Diese beiden Erfahrungen – Freiheit und Autonomie einerseits und Verbundenheit und Gemeinschaft andererseits – sind neben der Angstfreiheit die entscheidenden Gründe dafür, weshalb wir Menschen so gerne spielen. Am Anfang unseres Lebens, zum Teil sogar schon im Mutterleib, haben wir alle die grundlegende Erfahrung gemacht, dass Wachstum, eigene Weiterentwicklung und später auch Autonomie und Freiheit in engster Verbundenheit mit anderen, zumindest einer Mutter oder einem Vater, möglich sind. Diese frühe Erfahrung ist tief in unserem Gehirn verankert, und zeitlebens suchen wir alle nach einer Art des Zusammenlebens mit anderen Personen, die es uns erlaubt, uns gleichzeitig so frei und so verbunden wie möglich zu fühlen. In Freiheit und Verbundenheit leben zu können, ist deshalb ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Es lässt sich nicht immer – und bei manchen Personen auch nur sehr selten – stillen. Sehr leicht kann es dazu kommen, dass sich statt Verbundenheit klebrige, jede Autonomie unterdrückende Abhängigkeitsbeziehungen herausbilden. Und wenn dann das Bedürfnis nach Freiheit unstillbar wird, versuchen auch schon Kinder, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, ihre Autonomie zurückzugewinnen.
Aber im Spiel, im Zusammenspiel mit anderen (und unter Einhaltung der Spielregeln) können wir genau das wiedererleben, was draußen, in der Welt der Notwendigkeit und Zwecke, so selten zu finden ist: dass es geht! Dass es möglich ist, sich mit anderen – und sei es auch nur für die Dauer des gemeinsamen Spiels – gleichzeitig verbunden und frei zu fühlen.
Deshalb hat das gemeinsame Spiel solch eine enorme Anziehungskraft. Deshalb erscheint es so, als wäre es ein uns Menschen angeborenes Bedürfnis. Und deshalb lässt es sich auch nicht unterdrücken – vorübergehend vielleicht, aber niemals dauerhaft. Damit Menschen aufhören zu spielen, müssten sie ihr Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit ebenso verloren haben wie ihr Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie.
Bisweilen, etwa im Verlauf besonders leidvoller Phasen der Menschheitsgeschichte, werden die Gelegenheiten zum spielerischen Ausprobieren dessen, was alles möglich ist, sehr eingeschränkt. Und manchmal wird unser Hang zum Spielen auch von geschäftstüchtigen und gewinnorientierten Personen missbraucht. Aber dauerhaft unterdrücken lässt sich das Spielbedürfnis von uns Menschen offenbar nicht. Es kommt immer wieder hoch und bricht sich Bahn. Sogar in den Vernichtungslagern des NS-Regimes, von Auschwitz bis Buchenwald, gab es Todgeweihte, die bis zuletzt nicht aufgehört haben, ihr Leben erträglicher zu machen, indem sie spielten. Beispielsweise in Form von Theateraufführungen für ihre Mithäftlinge.
Dieses dem Menschen eigene Spielbedürfnis scheint also tief in unseren Gehirnen verankert zu sein. Diese Vermutung ist naheliegend und auch zutreffend. Aber bevor wir uns nun gleich allzu schnell mit motivationssteuernden Netzwerken und Belohnungssystemen im Gehirn beschäftigen, mit »Glückshormonen« und mit dem, was sonst noch alles dort oben aktiviert wird, wenn Menschen spielen, lohnt es sich vielleicht, das Ganze etwas spielerischer anzugehen. Denn manchmal offenbart sich das Entscheidende gar nicht dort, wo man besonders zielstrebig danach sucht.
Die Spielfreude der Gene
Sich einer Frage spielerisch zu nähern, heißt also in diesem Zusammenhang, nicht gleich die scheinbar naheliegendste Möglichkeit zu ergreifen, um ein beobachtetes Phänomen zu erklären. Allzu leicht landet man so nämlich in einer Zwickmühle. Denn selbst die allerbeste und ins letzte Detail gehende Erklärung der im Gehirn eines spielenden Menschen ablaufenden Vorgänge beschreibt ja letztlich nur, was dort alles passiert, wenn er spielt. Weshalb Menschen aber spielen wollen und es dann auch tun, lässt sich mit dem Hinweis auf die beim Spielen im Gehirn ablaufenden Prozesse jedoch nicht erklären. Um diese Frage zu beantworten, müssten wir uns fragen, weshalb unser Gehirn so gebaut ist, dass diese Phänomene dort in dieser Weise auftreten, wenn wir spielen. Als Antwort auf diese Frage wird von den Spielforschern meist behauptet: Weil die Spiellust in das Gehirn von uns Menschen genetisch so einprogrammiert ist. Und wenn wir dann genauso wie kleine Kinder mit spielerischer Leichtigkeit einfach weiterfragen, warum diese Programme denn so entstanden sind, wird uns von den entsprechenden Experten erklärt, dass dafür Mutationen und Rekombinationen auf der Ebene der DNA, also des Erbgutes unserer tierischen Vorfahren, verantwortlich seien.
Wer nun ein wenig pfiffig ist, kann diese Experten weiter in die Enge treiben, indem er darauf verweist, dass er zu Hause einen Hund hat, der nichts lieber macht, als mit ihm zu spielen. Diese genetische Konstellation, die zur Entwicklung eines Gehirns führt, welches seinen Besitzern das Spielen ermöglicht und gar zu einem Bedürfnis werden lässt, muss also auch schon bei Tieren entstanden sein. Spätestens an diesem Punkt geben die meisten Experten auf und brechen dieses Frage-und-Antwort-Spiel mehr oder weniger abrupt ab. So wie genervte Eltern, denen dann nichts Gescheiteres mehr einfällt, als ihren durch genauso spielerisches Fragen die Welt erkundenden Kindern zu entgegnen: »Warum, warum ist die Banane krumm?«
Meist waren diese Kinder aber mit ihren Fragen an die Erwachsenen – ebenso wie wir jetzt mit unseren Fragen an die Experten – kurz davor, die entscheidende Antwort aus ihnen herauszulocken. Denn unsere letzte und dann auch all diesen vernebelten Erklärungen auf den Grund gehende Frage lautet: Warum aber gibt es diese Mutationen und Rekombinationen im Erbgut? Und die Antwort der Experten kann nur heißen: Weil dort ständig spielerisch herumprobiert, Neues eingesetzt, Altes herausgeschnitten und das Ganze bei der sexuellen Fortpflanzung zwischen mütterlichem und väterlichem Genom auch noch ständig neu gemischt wird. Weil das Herumspielen und das Ausprobieren neuer Einfälle – also der spielerische Umbau unseres Erbgutes in Form bestimmter DNA-Sequenzen – eine Grundeigenschaft aller genetischen Anlagen ist. Und zwar von Anfang an. Das Spiel ist also gar nicht erst von lernfähigen Gehirnen erfunden worden. Im Gegenteil, die Herausbildung lernfähiger und zum Herumspielen und Ausprobieren aller möglichen Ideen geeigneter Gehirne ist die Folge dieser schon bei den ersten Lebewesen angelegten »Spielfreudigkeit« ihrer Erbanlagen.
Wenn wir also herausfinden wollen, weshalb wir so gerne spielen, so müssten wir uns fragen, weshalb diese Spielfreude bereits in den Erbanlagen aller Lebewesen angelegt ist. Ohne dieses ständige Einfügen und Herausnehmen von neuen DNA-Bausteinen, ohne die Tendenz zur spielerischen Verdopplung bereits entstandener DNA-Sequenzen, ohne die fortwährende spielerische Durchmischung von Genkonstellationen wäre die Entwicklung all der vielfältigen Lebensformen auf unserem Planeten gar nicht möglich gewesen. Dann gäbe es weder Einzeller noch Vielzeller, geschweige denn uns selbst. Das Spiel ist also nicht einfach nur ein Merkmal des Lebendigen, es hat die Entstehung von Leben und vor allem von lebendiger Vielfalt auf unserem Planeten erst ermöglicht. Wie sonst als durch spielerisches Zusammenfügen und Ausprobieren hätten sich die ersten zur Selbstreplikation befähigten, komplexen Molekülverbände in der »Ursuppe«, also in irgendwelchen geschützten Nischen unseres damals noch sehr lebensfeindlichen Planeten, herausbilden können?
Und nachdem wir mit unseren spielerisch, aber hartnäckig auf Klärung ausgerichteten Fragereien so weit gekommen sind, können wir auch noch den letzten Spielzug versuchen. Wir können nämlich nicht nur fragen, wie so etwas Komplexes wie das Leben entstanden ist, sondern auch der vielleicht sogar noch spannenderen Frage nachgehen, wie und unter welchen Voraussetzungen überhaupt eine Herausbildung hochkomplexer – allerdings im Vergleich zu Lebewesen noch relativ einfacher – Strukturen, also beispielsweise der eines Schneekristalls, möglich ist.
Das universelle Prinzip des Lebens
Jetzt wird es erst wirklich interessant, denn mit dieser Frage verlassen wir die Biologie des Spiels und wagen uns vor in die Physik und dort in den Bereich der noch recht jungen Komplexitätswissenschaft. Und dort, sollte man meinen, hat das spielerische Zusammenfügen und Ausprobieren nun wahrlich nichts zu suchen. Aber gemach! Es mag sein, dass wir uns auch hier mit unserer Angewohnheit, beim Denken an der Oberfläche der Phänomene haften zu bleiben, wieder einmal irren.
Was ist es denn und was für Voraussetzungen sind notwendig, damit sich beispielsweise Wassermoleküle so zusammenlagern können, dass daraus so ein einzigartiges und komplexes Gebilde wie eine Schneeflocke entsteht?
Wenn dem Wasser zu schnell Energie entzogen wird – indem man es herunterkühlt –, wird es zu einem Eisklotz. Und wenn ihm zu viel Energie zugeführt wird, taut es, kocht es und verdampft es.
Aber wann wird aus Wasser ein Schneekristall? Wenn es weder zu kalt noch zu warm ist. Wenn die Energie, die auf die Wassermoleküle wirkt, weder zu groß noch zu gering ist, sondern genau so, dass sie endlich genug Spielraum haben, um miteinander in Beziehung zu treten. Nur dann können sie das hervorbringen, was in ihnen steckt und was sofort wieder in den Hintergrund rückt und vergeht, wenn es dafür zu schnell zu kalt oder zu warm wird.
Spielraum für die Entfaltung dessen, was also sogar in unbelebten Molekülen steckt, gibt es offenbar nur dann, wenn die Energiezufuhr weder zu klein noch zu groß ist. Mit dieser interessanten Erkenntnis lässt sich jetzt nicht nur die Entstehung von Schneeflocken, sondern auch die Herausbildung anderer Kristallstrukturen erklären. Aber nicht nur die, sondern auch alle anderen komplexen Phänomene scheinen diesem grundsätzlichen Prinzip zu folgen. Die zauberhaften Wolkengebilde am Himmel, der fragile Golfstrom, die bizarren Strukturen eines Flussdeltas oder die atemberaubenden, von Wanderdünen erzeugten Landschaften unserer Sandwüsten – sie alle verdanken ihre Herausbildung dem spielerischen Suchen und Finden stabiler Beziehungen ihrer Komponenten zueinander unter Bedingungen, wo weder zu viel noch zu wenig Energie von außen in Form von Wind- und Wasserströmungen einwirkt.