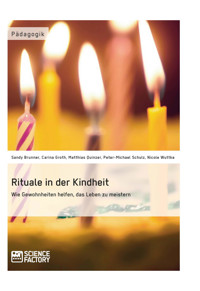
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Gute-Nacht-Geschichte, das gemeinsame Abendessen oder auch das Begrüßungslied im Kindergarten: All das sind Rituale und Traditionen, die wir seit vielen Generationen weitergeben und pflegen. Manche helfen gegen Angst, andere beim Einschlafen, wieder andere, den Tagesablauf zu strukturieren. Dieses Buch beschreibt die Bedeutung von Ritualen in der Kindheit. Dabei geht es sowohl auf Alltagsrituale in der Familie ein, als auch auf das Ritual als pädagogisches Hilfsmittel in der Schule. Aus dem Inhalt: Die Bedeutung von Ritualen in der Kindheit Warum sind Rituale für Kinder in der Familie sinnvoll und wichtig? Rituale für Kinder: Ein pädagogisch wertvolles Hilfsmittel Rituale und Zeremonien als soziokulturelles Gut
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © 2014 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlags GmbH
Coverbild: pixabay.com
Rituale in der Kindheit
Warum Rituale in der Kindheit wichtig sind
Von Carina Groth, 2009
Einleitung
Was machen Rituale aus und wozu dienen sie? Was genau ist ein Ritual? Diese Fragen werde ich im ersten Teil meiner Arbeit klären. Zunächst werde ich den Begriff Ritual klären und gehe dabei auf die Ansichten von Arnold van Gennep und Lorelies Singerhoff näher ein.
Im nächsten Teil geht es um die Rituale in der Kindheit. Hier gibt es viele rituelle Handlungen und Abläufe, die zu bestimmten Ereignissen stattfnden (z.B. Namensgebung, Einschulung, die „Gutenachtgeschichte“). Aber was bedeuten Rituale für Kinder? Viele Abläufe nehmen in der Kindheit rituellen Charakter an, sei es durch die Erwachsenen vorgegeben oder durch die Kinder, die sich selbst oft ihre eigenen kleinen Rituale schaffen. Warum das so ist und warum Rituale so wichtig für Kinder sind, werde ich im Folgenden beschreiben. Dabei gehe ich auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche ein, die im Kindergarten auch durch Rituale gefördert werden. Mit Hilfe von rituellen Handlungssequenzen können nämlich unterschiedliche Fähigkeiten bei Kindern sensibilisiert und ausgebaut werden. Hierzu fnden sich dann im weiteren Verlauf meiner Arbeit zwei Praxisbeispiele aus dem Alltag in Kindertageseinrichtungen. Zunächst wird der „Morgenkreis“ als Beispiel angeführt, den man in den meisten Einrichtungen für Kinder fndet. Da ich während meiner Ausbildung zur Erzieherin und auch später wieder in einem Montessori-Kinderhaus gearbeitet habe, stelle ich die Stille-Übung vor, die ich für ein gutes Beispiel einer rituellen Handlungssequenz sehe.
Klärung des Begriffs „Ritual“
In einer Gesellschaft wechselt jedes Individuum im Laufe seines Lebens von einer Altersstufe zur nächsten. Dabei ist der Übergang von einer Gruppe zur anderen durch spezielle Handlungen, die bei tribalen Kulturen in Zeremonien eingebettet sind, gekennzeichnet. Übergänge von einer Gruppe zur anderen oder von einer sozialen Situation zur anderen sind notwendig im Leben bzw. von Natur aus vorgegeben und gehören dazu, wie beispielsweise die Geburt, soziale Pubertät, Elternschaft, Aufstieg in eine höhere Klasse, Tätigkeitsspezialisierung. Solche Ereignisse haben immer eine Anfangs- und eine Endphase, zu denen Zeremonien mit einem identischen Ziel gehören. Das Individuum wird aus einer genau definierten Situation in eine andere, auch genau definierte Situation hinübergeführt. Durch das Gelangen von einer Etappe zur nächsten und das Überschreiten von Grenzen, verändert sich das Individuum. Diese Abläufe im Leben richten sich nach und gleichen den Abläufen in der Natur, wovon weder das Individuum, noch die Gesellschaft unabhängig sind. So wirken sich auch die rhythmischen Veränderungen des Universums auf das Leben eines jeden Individu- ums und der Gesellschaft an sich aus. Beispiele hierfür sind der Übergang von einer Jahreszeit zur anderen oder von einem Jahr zum anderen. (vgl. van Gennep 1981, S. 13 – 16)
Arnold van Gennep beschreibt eine besondere Kategorie der Übergangsriten („rites des passages“). Diese unterteilen sich in Trennungsriten („rites de separation“), Schwellen- bzw. Umwandlungsriten („rites de marge“) und Angliederungsriten („rites d’agregation“).
Übergangsriten erfolgen also, theoretisch zumindest, in drei Schritten: Trennungsriten kennzeichnen die Ablösungsphase, Schwellen- bzw. Umwandlungsriten die Zwischenphase (die Schwellen- bzw. Umwandlungsphase) und Angliederungsriten die Integrationsphase. Diese drei Phasen sind jedoch nicht in allen Kulturen oder in allen Zeremonialkomplexen gleich stark ausgebildet. (van Gennep 1981, S. 21)
Bei Bestattungen finden sich dementsprechend vorwiegend Trennungsriten, bei Hochzeitszeremonien Angliederungsriten und bei einer Schwangerschaft oder Verlobung beispielsweise kommen vor allem Umwandlungsriten vor. Diese dreigliedrige Struktur der Übergangriten kann sich in manchen Fällen noch weiter differenzieren. Arnold van Gennep beschreibt hier beispielsweise die Zeit des Verlobtseins, die einen Übergang von der Adoleszens zum Verheiratetsein darstellt. Dabei finden sowohl beim Übergang von der Adoleszens zum Verlobtseins, als auch beim Übergang vom Verlobtsein zum Verheiratetsein verschiedene Trennungs-, Umwandlungs- und Angliederungsriten statt. (vgl. van Gennep 1981, S.21)
Lorelies Singerhoff beschreibt Übergänge von einer Lebensphase in eine andere als Scheidepunkte. Die Entwicklung eines Individuums ist danach in verschiedene Richtungen möglich. Solche Scheidepunkte sind von rituellen Handlungen begleitet, um zu versinnbildlichen, was geschieht, d.h. das etwas abgeschlossen wird und etwas Neues beginnt.
Für Übergänge muss ein Individuum jedoch offen sein und sich darauf einlassen, da die Auswirkungen misslungener Übergänge krank machen können (z.B. Depressionen). In unserer Gesellschaft, die danach strebt, alles kontrollieren und lenken zu können, haben wir auf viele Übergangssituationen keinen Einfluss. So fällt es vielen Menschen schwer, sich darauf einzulassen und sich an die neue Begebenheit zu gewöhnen. Rituale sind bei vielen Übergangssituationen sehr wichtig. (vgl. Singerhoff 2006, S. 59)
„Rituale erleichtern diese Erfahrung und stützen den Menschen in seiner Entwicklung.“ (Singerhoff 2006, S. 59)
Rituale in der Kindheit
Auch und besonders im Kleinkindalter findet man eine ganze Reihe von Riten, welche das Kind von einer Lebensphase zur nächsten begleiten.
Der wichtigste Übergang ist erst einmal der Übergang aus dem „Nichts“ ins Leben, also von der Zeugung bis zur Geburt. Weitere Übergänge, die auch von Ritualen begleitet werden, sind die Phasen vom Säugling zum Kleinkind, vom Kleinkind zum Kindergartenkind, vom Kindergartenkind zum Schulkind usw. Diese Übergänge werden von rituellen Handlungen begleitet und helfen dem jeweiligen Individuum sich in dem neuen Lebensabschnitt zurechtzufinden. Beispiele hierfür sind der Eintritt in den Kindergarten und später in die Schule, wobei die Einschulung meist in einem größeren Rahmen geschieht. (vgl. Singerhoff 2006, S. 59)
Arnold van Gennep führt zu diesen Übergängen weitere Beispiele an:
Das Schema der Kindheitsriten umfaßt […] folgende Riten: Zertrennung der Nabelschnur; Besprühen und Baden des Kindes; Abfallen der vertrockneten Nabelschnur; Namengebung; erster Haarschnitt; erste Mahlzeit im Familienkreis; erstes Zahnen; erstes Laufen; erstes Verlassen des Hauses; Beschneidung; erstes Anlegen geschlechtsspezifischer Kleidung usw. (van Gennep 1981, S. 67)
Weiter geht Gennep auf den Ritus der Namensgebung ein, die als Angliederungsritus gesehen werden kann. Dabei wird das Kind auf der einen Seite individualisiert und auf der anderen gleichzeitig in eine soziale Gemeinschaft aufgenommen. Bei der Taufe, die früher als Trennungsritus bzw. als Reinigungs- und Befreiungsritus gesehen wurde, sollte der Getaufte von der früheren profanen oder unreinen Welt gelöst werden. Hierbei weist van Gennep jedoch darauf hin, dass man bei der Interpretation dieses Rituals vorsichtig sein sollte. Denn, wenn die Taufe mit geweihtem Wasser statt gewöhnlichem Wasser vollzogen wird, kann es auch die Funktion eines Angliederungsritus haben. Somit würde der Getaufte auch etwas hinzugewinnen und nicht nur etwas verlieren. (vgl. van Gennep 1981, S. 69)
Rituale in der Kindheit sind kulturell unterschiedlich. In der christlichen Tradition durften gefährdete Kinder schon im Mutterleib getauft werden, wenn nicht sicher war, ob das Kind lebend geboren wird oder die Geburt eventuell nicht übersteht. Auch werden viele Kinder noch im Taufkleid getauft, das von Generation zu Generation wei- tergegeben wird. Weitere religiös geprägte Rituale in der Kindheit sind Kommunion, Firmung und Konfirmation.
Rituale im Kindergartenalltag
Warum sind Rituale wichtig für Kinder?
Damit ein Kind sich leichter in der Welt zurechtfinden kann, laufen viele Dinge bzw. Handlungen in einer bestimmten Art und Weise ab. Dadurch kommt es zu Abläufen, die rituellen Charakter haben. Ein Beispiel sind die täglichen Mahlzeiten, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort eingenommen werden. Diese Regelmäßigkeiten geben dem Kind Sicherheit und auch eine Hilfestellung, sich in der Welt zurechtzufinden. Sie vermitteln Kindern Geborgenheit, Liebe und Zuneigung.
Beobachtet man Kinder, kann man bemerken, dass sie viele Dinge, die sie täglich tun, ganz von alleine in einem immer wiederkehrenden Ablauf tun. Sie entwickeln selbst eine Regelmäßigkeit in bestimmten Situationen und lernen somit ihre Umgebung und die Dinge, von denen sie täglich umgeben sind, besser kennen. (vgl. Biermann 2002, S. 11 – 12)
Dadurch, dass Dinge und Handlungen eine Regelmäßigkeit aufweisen, kann man sie leichter aufnehmen, sie leichter verstehen, sie leichter nachvollziehen, sie leichter in sein Leben mit aufnehmen, man kann sich leichter orientieren, man bekommt Mut mitzumachen, es selbst zu tun, denn das, was von einem erwartet wird, ist bekannt. (Biermann 2002, S. 12)
Damit erleichtern solche Regelmäßigkeiten und immer wiederkehrenden Abläufe unseren Alltag.
Auch in Kindergärten und sonstigen Tageseinrichtungen für Kinder findet man verschiedene Tätigkeiten, die einen immer wiederkehrenden Ablauf haben. Sie sollen auch dort den Kindern helfen, sich in der Einrichtung und der Gruppe zurechtzufinden. So sollen Ängste und Unsicherheiten überwunden werden und neue Verbindungen z. b. in Form von sozialen Kontakten entstehen. Rituelle Handlungen haben somit vor allem auch eine große Bedeutung für das soziale Verhalten der Kinder.
Diese Rituale im Kindergarten sind positiv bewertet, sie sollen Spaß machen. Das bedeutet, sie gliedern sich vielmehr spielerisch in den Tagesablauf der Kinder ein. Rituale können den Kindern „Halt, Geborgenheit, Freude und Sicherheit geben, sie in der Entwicklung ihrer Sozialkompetenz unterstützen, dazu beitragen, ihnen neue Werte zu vermitteln, […] sie dazu anleiten […] ihre Sinne zu gebrauchen, ihre Phantasie anzusprechen […].“ ( Biermann 2002, S. 13 – 14)
Rituale sind in den verschiedenen Tageseinrichtungen teilweise unterschiedlich in ihrem Ablauf, da sie immer an die jeweilige Gruppe oder die gesamte Einrichtung und deren Ziele und Bedürfnisse angepasst sind.
Wichtig sind Rituale aber in allen Kindertageseinrichtungen. Durch das bewusste Inszenieren von Zeit und Raum, werden Erlebnisse geschaffen, die das Bewusstsein der Kinder erweitern. So bieten Rituale eine Möglichkeit, Kinder im sprachlichen, kognitiven, emotionalen, motorischen und sozialen Bereich zu fördern. Als Ausgleich zu dem aktiven und anstrengenden Geschehen in der Kindergartengruppe während des freien Spielens, können Rituale, zeitlich und räumlich gelöst vom Gruppengeschehen, für Entspannung sorgen.
Rituale sind in Kindertageseinrichtungen feststehende Handlungssequenzen, die in verlässlicher Art und Weise ablaufen. So können die Kinder sich darauf freuen und das Ritual hat eine emotionale Wirkung. Werden diese mit immer gleichen Sprachmustern bewältigt, wirkt sich dies auch auf die sprachliche Entwicklung der Kinder aus. Rituelle Handlungen stellen Strukturierungshilfen bei der Selbstorganisation des Tagesablaufes dar und wirken damit kognitiv. Sie laufen automatisiert ab, gelten als Ordnung und Orientierung für alle Gruppenmitglieder und wirken sich so auf die soziale Entwicklung der Kinder aus. Die motorische Entwicklung wird gefördert, wenn diese rituellen Handlungssequenzen mit immer gleichen oder ähnlichen motorischen Abläufen bewältigt werden. (vgl. Jackel 1999, S. 17)
Praxisbeispiel: Morgenkreis
Einen Stuhl- oder Sitzkreis, in dem alle Mitglieder einer Gruppe oder Klasse zusammen kommen, fndet sich in den meisten Tageseinrichtungen für Kinder, sei es im Kindergarten, Hort oder Schule, wieder. In den meisten Einrichtungen fndet dieser zu Beginn des Tages statt (Morgenkreis) und stimmt auf den kommenden Vormittag ein.
Zu Beginn eines solchen Morgenkreises steht oft ein Begrüßungslied, das jeden Tag wiederkehrt und somit einen verlässlichen Bestandteil des morgendlichen Ablaufs darstellt. (vgl. Jackel 1999, S. 73) Das Zusammenfinden der Gruppe mit dem gemeinsamen Singen des Liedes hebt sich vom vorherigen Ablauf in der Gruppe ab und kann so als Trennungsritus gesehen werden. Nach solch einem Begrüßungslied wird den einzelnen Kindern meist die Möglichkeit gegeben, etwas zu erzählen oder zu zeigen. Zum Beispiel kann ein „Erzählstein“ dazu genutzt werde. Dieser wird reihum weitergegeben und wer ihn in der Hand hält, darf sich mitteilen. Die Kinder werden jedoch nicht dazu gezwungen, sich mitteilen zu müssen. Wer nichts beitragen möchte, kann den Stein z.B. auch einfach dem nächsten Kind weitergeben. Somit wird jedes Kind respektiert, hat aber trotzdem die gleiche Chance, wie alle anderen, am Gruppengeschehen teilzunehmen und muss sich nicht ausgeschlossen fühlen. Bei einer Gruppe, zu der gerade neue Mitglieder gestoßen sind, wird oft ein Kennenlernspiel eingebaut, um die Namen der neuen Mitglieder und die Gruppe an sich spielerisch kennen zu lernen. „Steht zum besonderen Anlaß eines Kindergeburtstages ein Geburtstagsritual an, kann es durchaus hier im Morgenkreis seinen Platz fnden; […] die Geburtstagskerze, das Geburtstagslied, ein von ihm gewünschtes Spiel und/oder sein Lieblingslied […]“ finden zum Geburtstag eines Kindes im Kreis der Gruppe statt. (Jackel 1999, S. 75) Alles Dinge, die im mittleren Teil des Morgenkreises stattfnden, sind auch Teil der Zwischenphase bzw. Schwellen- oder Umwandlungsphase.
Der letzte Teil eines Morgenkreises beinhaltet ein Planungsritual, welches die ErzieherInnen nutzen, um die weiteren Angebote oder Vorhaben des Tages anzukündigen und / oder zu besprechen. (vgl. Jackel 1999, S. 76) Dieser Teil kann als Angliederungsritus oder Integrationsphase gesehen werden, da er in den nächsten Teil des Vormittags einleitet. Anschließend können die Kinder entspannt ins Freispiel gehen oder an geleiteten Angeboten teilnehmen. (vgl. Jackel 1999, S. 76)
Praxisbeispiel: Stille-Übung
Eine der Hauptübungen in der Montessori-Pädagogik sind die Lektionen des Schweigens oder der Stille. Maria Montessori sieht dies als eine selbsttätige kindliche Einübung ins Menschsein. (vgl. Steenberg 1997, S. 190)
Die Stille ist für sie eine Gegebenheit, die entweder die Einsamkeit oder aber die Zustimmung einer Anzahl von Menschen fordert. Dabei wird das Bewusstsein geschult, gemeinsam zu handeln, um ein Ergebnis zu erreichen. Denn wenn einer nicht damit einverstanden ist, bricht die Stille. Soziales Handeln wird hierbei gefordert und gefördert. Ein wichtiger Aspekt bei einer Stille-Übung ist auch die Vorbereitung der Umgebung, der sich in drei Teile gliedert. Die Absicht dabei ist, dass die Stille nicht von einem Erzieher / einer Erzieherin herbeigeführt wird, sondern von den Kindern selbst. Als erstes wird bei der Vorbereitung alles „leer“ gemacht, womit das Fortlegen aller Materialien vom Platz gemeint ist und eine Ordnung geschaffen wird. (vgl. Steenberg 1997, S.191) Dieses „Leermachen“ kann mit einem Trennungsritus verglichen werden, da hier bewusst eine völlig andere Situation als das freie Spiel der Kinder geschaffen wird. Der zweite Punkt beinhaltet, die eigene Person in Ordnung zu bringen, d.h. eine bequeme Stellung (z.B. Sitzposition) einzunehmen, so dass man sich ganz wohl fühlt und in dieser Position ruhig verweilen kann, ohne sich bewegen zu müssen. Dies schließt den dritten Aspekt mit ein, Bewegungsantriebe zu hemmen bzw. Bewegungen zu kontrollieren, wie z.B. geräuschlose Atembewegungen, bewegungslose Arme und Beine. Um Kindern das Schweigen bzw. still sein zu lehren, beschränkt sich die Erzieherin darauf, dies zu demonstrieren, also es selbst vor zu machen ohne mit Worten zu beschreiben, was die Kinder tun sollen. Die Kinder ahmen diese Haltung nach und nach und nach werden äußere Geräusche immer mehr wahrgenommen, ohne jedoch die innere Stille zu stören. Die Übung kann intensiviert werden, indem der Raum abgedunkelt wird oder die Augen geschlossen werden. So wird die Intensität der Wahrnehmung gesteigert. Die Bedeutung dieser Lektion der Stille oder des Schweigens liegt darin, Kindern Stille erfahrbar zu machen und diese genießen zu können. (vgl. Steenberg 1997, S. 191 ff.) „Der Genuß der Stille besteht im Genuß der Früchte der Konzentration des Geistes – Ausgeglichenheit, Ruhe, Freude und Heiterkeit. Das Gemüt bildet sich heraus. Die Fähigkeit geistiger Wert-Schätzungen als Basis geistiger Bindungsprozesse entwickelt sich.“ (Steenberg 1997, S. 195)
Nach Montessori führt die Fähigkeit, die Stille zu genießen, über die Verfeinerung von Gehörwahrnehmungen hin zur Öffnung des Geistes. Über die Verfeinerung der Bewegung (Koordination, Gleichgewicht, Kontrolle, Gehorsam, Anmut, Geschicklichkeit) führt sie hin zu spontan auftretender höherer Disziplin, der Freiheit im Sinne der Selbstkontrolle. Insgesamt haben Stille-Übungen eine sensibilisierende Wirkung und fördern die Entwicklung des sozialen, moralischen und religiösen Sinnes. (vgl. Steenberg 1997, S. 195 ff.)
Fazit
In Kindertageseinrichtungen haben viele Handlungen rituellen Charakter, die nicht ausschließlich zur Strukturierung des Tagesablaufs dienen. Sie geben Kindern alswie auch Erziehern Sicherheit. Kinder gewinnen dadurch einen leichteren Überblick über den Tagesablauf und können das Geschehen im Laufe eines Tages auch zeitlich bes- ser einordnen. Beispielsweise orientieren sie sich daran, dass nach dem Morgenkreis gespielt und gefrühstückt werden kann. Ein bestimmtes Signal (z.B. das Läuten einer Glocke) deutet das gemeinsame Aufräumen an und lässt absehen, dass die Kinder bald von ihren Eltern abgeholt werden oder es Mittagessen gibt.
Aus meiner Erfahrung werden rituelle Handlungen im Kindergarten teilweise nur als Regelungen angesehen, woran die Kinder sich strikt halten sollen. Hier werden solche Handlungen manchmal einfach unbewusst übernommen, ohne über den Sinn nachzudenken. Da Rituale aber auch dem Erwerb neuer Fähig- und Fertigkeiten der Kinder dienen, sollte sich bewusst gemacht werden, was als Gewohnheit gesehen werden kann und was ein Ritual ist. Bei einer rituellen Handlung sollten die Teilnehmer dabei in vollem Bewusstsein handeln, was bei der Gewohnheit nicht der Fall ist. Auch sollten die Rituale nicht unbedingt einem starren Ablauf folgen, sondern sich an die Bedürfnisse der Kindergruppe richten. Aus meiner Erfahrung helfen rituelle Handlungssequenzen, wie z.B. der Morgenkreis und auch Stille-Übungen den Kindern, sich im Alltag zurechtzufnden. Sie bilden einen verlässlichen Punkt im Laufe eines Kindergartenvormittages. Sie erweitern das Bewusstsein der Kinder und fördern alle Bereiche ihrer Entwicklung.
Kinder verlassen sich auf diese regelmäßig wiederkehrenden Abläufe, sind enttäuscht, unsicher oder unruhig, wenn diese Handlungen, nicht wie gewohnt ihren Platz im Tagesablauf fnden. Dafür steht auch beispielhaft das abschließende Zitat:
Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen“, sagte der Fuchs. „Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um drei Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um vier Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen; ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll … Es muss feste Bräuche geben. (Antoine de Saint-Exupery)




























