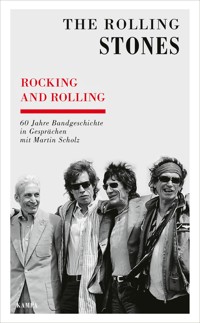
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Am 12. Juli 1962 gaben die Stones in London ihr erstes Konzert. 1988 hat Martin Scholz Keith Richards zum ersten Mal interviewt. Seither haben die Stones dem Journalisten und Autor elf Mal Rede und Antwort gestanden, mal gemeinsam, mal allein, in München, London, Paris, Brüssel oder Hamburg. Etliche Bandmitglieder kommen hier zu Wort: Neben Richards natürlich auch Mick Jagger und Ron Wood aber auch Bill Wyman, immerhin 31 Jahre Bassist bei den Stones, und der jüngst verstorbene Charlie Watts, der ganze 59 Jahre Bandmitglied war. Es geht, natürlich, um Sex, Drugs and Rock'n'Roll, aber auch um Political Correctness, Skandale und Gefängnisstrafen, Flugangst, Durchhaltevermögen und das Älterwerden, Gott, den Teufel und die Liebe, das Leben vor und das nach dem Tod, die Hassliebe zwischen Jagger und Richards und vieles mehr. Die Interviews mit der Band werden ergänzt um Gespräche mit prominenten Wegbegleitern und Bewunderern, darunter Tina Turner, Sheryl Crow, Wolfgang Niedecken, Salman Rushdie - und Bono, der einiges über seine langjährige Freundschaft (und Rivalität) mit dem Stones-Frontmann, geteilten Größenwahn - und, ja, auch die Falten in Jaggers Gesicht zu erzählen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Martin Scholz
The Rolling Stones, Rocking and rolling
60 Jahre Bandgeschichte mit Martin Scholz
Kampa
May the good Lord shine a light on you, warm like the evening sun.
»Shine a Light«, Rolling Stones, 1972
Für Brigitte, Liam, Nelson und Zoë
Martin ScholzDIESONNE, DERMONDUNDDIEROLLINGSTONES
This could be the last time,
maybe the last time,
I don’t know,
oh no,
oh no.
»The Last Time«, 1965
Throwback 1982: Die Rolling Stones werden zwanzig. Sie sind auf Deutschland-Tournee – und ich bin nicht dabei. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, eines ihrer Konzerte in Köln zu sehen. »But what can a poor boy do?« Die Tickets sind einfach zu teuer. Ich bin achtzehn, gehe in die zwölfte Jahrgangsstufe des Städtischen Gymnasiums in Gütersloh, einer nicht ganz so kleinen Kleinstadt in Ostwestfalen. Köln liegt nur zweieinhalb Stunden mit dem Auto entfernt, aber am 4. und 5. Juli, wenn die Stones dort spielen, ist es für mich unerreichbar. Ich habe eine Menge Stones-Alben in meinem Zimmer: Let It Bleed, Black and Blue, Some Girls, die Greatest-Hits-Doppel-LPRolled Gold, Emotional Rescue. Aber live gesehen habe ich die Band noch nie. Wie auch? Zuletzt haben sie 1976 in Deutschland gespielt, da war ich zwölf. Meine große, meine sehr große Befürchtung ist jetzt, dass ich die Rolling Stones nie mehr live sehen werde. Die Band ist schließlich unfassbare zwanzig Jahre alt – im jugendfixierten Musikgeschäft eine halbe Ewigkeit.
Mick Jagger, Keith Richards und ihre Kollegen sind zu dem Zeitpunkt erst um die vierzig und gelten dennoch als Rockopas. Ihre Tour bricht weltweit Zuschauerrekorde, aber die Medien sind dennoch überzeugt, es sei ihre letzte. Das Orakel vom Ende der Stones ist schon damals nicht besonders originell, wird es doch seit Jahren gebetsmühlenartig wiederholt, woran die Band selbst allerdings nicht ganz unschuldig ist. 1975 sagte Mick Jagger, damals zweiunddreißig, er wäre lieber tot, als mit fünfundvierzig noch »Satisfaction« zu singen. 1982 ist er zwar erst achtunddreißig, aber ich bin alarmiert, denn all das klingt auch für mich verdammt nach Abschluss.
An einem Morgen im Juli ’82 stehe ich mit ein paar Freunden auf dem Schulhof. Noch heute sehe ich deutlich vor mir, wie drei unserer Lehrer sehr beschwingt auf uns zugehen. Gerd Appelmann, Englisch, Rudolf Bülter, Geschichte, und Siegfried Bethlehem, Englisch und Geschichte. Sie sind alle Mitte dreißig und erst vor Kurzem an die Schule gekommen. Sie tragen Jeans, T-Shirts und Karohemden, haben längere Haare (Siegfried Bethlehem trägt seine fast schulterlang) und sehen nicht großartig anders aus als wir Schüler. Als »Überbleibsel der APO« werden wir sie später liebevoll-ironisch in der Abizeitung würdigen. Stones-Fans sind die drei auch. Klar, dass sie vor wenigen Tagen bei dem Konzert in Köln dabei waren. Und genau davon erzählen sie uns jetzt. In allen Details. Überragend sei es gewesen, schwärmen sie unisono und dämpfen die Euphorie sogleich, vielleicht, um dann doch ein bisschen kritische Distanz ihren Schülern gegenüber zu wahren: Natürlich habe man Mick Jagger und Keith Richards nur als Strichmännchen auf der riesigen Bühne sehen können. Dafür sei es ordentlich laut gewesen. Wir hängen an ihren Lippen, wollen mehr wissen. Mit welchem Song haben sie angefangen? – »Under My Thumb«. Was haben sie als Zugabe gespielt? – »Satisfaction«. Dann ist die Pause vorbei, wir müssen zurück in den Unterricht.
Dass es mich damals so außerordentlich fuchste, es nicht zum Stones-Konzert nach Köln geschafft zu haben, lag nicht etwa an einer übertriebenen Liebe zu Retroklängen. Als Teenager hörte ich reihenweise andere aktuelle Rock-, Pop- und Jazzrockmusik, ziemlich querbeet: Weather Report, AC/DC, The Police, The Clash, Dire Straits, und ja, ab und zu auch ein bisschen Neue Deutsche Welle. Im Vergleich dazu sind die Stones larger than life, mehr noch, sie sind eine Art Urquelle. Die einzige, die noch sprudelt. 1982 sind die Beatles schon seit zwölf Jahren Geschichte. Nachdem John Lennon 1980 erschossen wurde, war klar, dass es die Fab Four als Liveband nicht mehr geben wird. Von den beiden großen Bands, die in den Sechzigern um den Thron kämpften, sind also nur noch die Rolling Stones übrig geblieben. Sie sind die Letzten ihrer Art, Ikonen einer kreativen Explosion, die viele der nachwachsenden Musikergenerationen auf die eine oder andere Weise angefeuert hat. Deshalb wollte ich sie so gerne sehen. Einmal zumindest: »Catch you dreams before they slip away.«
Über die Hintergründe ihrer Songs wusste ich damals ehrlich gesagt noch nicht viel. Ich kannte ein paar Geschichten darüber, wie diese weißen englischen Mittelschichtjungs schwarzen amerikanischen Blues erst nachgespielt und dann erweitert haben, bis am Ende der wilde Sound von Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll dabei herauskam. Der Urknall. Ein paar Artikel hatte ich gelesen – von Drogenexzessen, Verhaftungen, Saalschlachten bei ihren frühen Konzerten war die Rede und davon, dass sie von manchen für den Niedergang der Moral verantwortlich gemacht wurden. Nicht zu vergessen die Klassikeranekdote, wonach sie im Kollektiv in aller Öffentlichkeit an einer Tankstelle urinierten und festgenommen wurden. Sie waren gefährlich und glamourös und, ja, auch komisch. Vor allem aber war ich fasziniert von ihrer elektrisierenden Musik. Von früheren Songs wie »Midnight Rambler«, »Get Off of My Cloud« oder »Jumpin’ Jack Flash« ging diese urtümliche, bedrohliche Kraft aus. Aber auch die aktuelleren Alben wie Emotional Rescueund Tattoo You, die ich unmittelbar nach ihrem Erscheinen gekauft hatte, hielten mit Krachern wie »Start Me Up« oder verstörend schönen Bluesklagegesängen wie »Down in the Hole« genügend Höhepunkte bereit. So viele, dass ich mir wünschte, sie würden noch lange weiterspielen.
Es ist erstaunlich, dass die Stones auf Leute wie mich, die noch gar nicht geboren waren, als sie 1962 ihr erstes Konzert gaben, diese Faszination ausübten. Niemand hat dieses Kuriosum besser erklärt als Keith Richards, als er 1995 auf die ihm eigene lässig-unbescheidene Art verkündete: »Jeder, der unter fünfundfünfzig ist, weiß, dass es den Mond, die Sonne und die Rolling Stones gibt.«
Dass ich die Stones 1982 nicht sehen konnte, war schlimm. Richtig schlimm. Nun wäre es aber auch übertrieben, zu behaupten, dass ich in der ostwestfälischen Provinz bis dahin ganz und gar abgehängt war. Miles Davis und Woodstock-Legende Alvin Lee hatten in Gütersloh gespielt, Spencer Davis sogar in der Aula meiner Schule. Und Alexis Korner, Schlüsselfigur der britischen Bluesrockszene, war ziemlich oft in unserer Gegend aufgetreten, in Minden, Höxter und Beverungen. Korner war übrigens gewissermaßen der Ziehvater der Rolling Stones – und verantwortlich für ihren ersten Auftritt. Am 12. Juli 1962 sollte er mit seiner Band Blues Incorporated im Londoner Marquee Club spielen. Weil er aber kurzfristig am selben Tag bei einer Liveübertragung in den Studios der BBC auftreten sollte, fragte er seine Zöglinge Brian Jones, Mick Jagger und Keith Richards, ob sie für ihn einspringen könnten. Damals nannten die drei sich noch »Rollin’ Stones«, ohne »g«. Dazu hatte sie der gleichnamige Song von Muddy Waters, eines ihrer großen Idole, inspiriert. Erst machten sie aus dem »Stone« die »Stones«, später fügte ihr Manager Andrew Loog Oldham das »g« hinzu. Seitdem heißt es vor nahezu jedem Auftritt: »Ladies and gentlemen – the Rolling Stones.«
Jagger und die beiden Gitarristen Richards und Jones wurden im Marquee von Mick Avory am Schlagzeug, Dick Taylor am Bass und Ian Stewart am Piano unterstützt. Avory verließ die Band kurz darauf, um mit Ray und Dave Davies die Kinks zu gründen, er wurde durch Charlie Watts ersetzt. Taylor wechselte zu den Pretty Things, und Bill Wyman übernahm den Bass. Stewart schließlich wurde von Manager Oldham gefeuert, weil der meinte, der Keyboarder passe wegen seines kolossalen Kinns nicht zum Image der Band – und überhaupt seien sechs Musiker einer zu viel. Die Stones hielten Stewart auf ihre Weise die Treue: Er blieb bis zu seinem Tod 1985 als Faktotum in ihrem inneren Zirkel, war Roadie, Fahrer und immer wieder Sessionmusiker.
Für Keith Richards war der Auftritt im Marquee, glaubt man seiner Autobiographie Life, der Beginn eines rauschhaften Erlebens auf der Bühne, von dem er bis heute nicht genug bekommen kann: »Da kommt dieser Moment, wo du merkst, dass du tatsächlich ein bisschen von der Erde abhebst und dass dir niemand was anhaben kann. Du bist einfach high, weil du da mit einer Handvoll Typen zusammen bist, die genau dasselbe wollen wie du. Und wenn das funktioniert, Baby, dann wachsen dir Flügel. Das ist wie Fliegen ohne Pilotenschein.«
Beflügelt hat die Musik der Stones auch mich. Das kam mir in einem Moment zugute, in dem ich gar nicht damit gerechnet hätte. Im Frühjahr 1983 habe ich mein Abi gemacht. Bis dahin hatte ich es sehr geschätzt, von jungen, engagierten Lehrern unterrichtet zu werden, von denen ich wusste, dass sie wie ich Rolling-Stones-Fans waren. Bei meiner mündlichen Abiprüfung in Geschichte sitzen dann gleich zwei von ihnen vor mir, Rudolf Bülter und Siegfried Bethlehem. Thema: Kriegsschuldfrage des Ersten Weltkriegs im Zusammenhang mit der Kontroverse um den Historiker Fritz Fischer. »Hot stuff«, um es mit einem Jagger-Song zu paraphrasieren. Für mein Empfinden treiben die beiden mich an diesem Tag ein bisschen zu energisch vor sich her. Im Journalistenjargon würde ich sagen: Sie haben mich gegrillt. Erst später kam mir der Gedanke, dass sie das vielleicht genauso machen mussten, um gar nicht erst den Eindruck entstehen zu lassen, dass sie es lockerer mit mir angehen würden, nur weil wir hin und wieder über die Stones gesprochen hatten. Zum Glück bin ich sehr gut vorbereitet (was leider nicht bei allen Prüfungen der Fall war). Die Antworten kann ich runterrattern wie die Zeilen von »Gimme Shelter«. Am Ende bin ich ausgelaugt. In das für meine Begriffe viel zu lange Schweigen hinein frage ich: »Und? Habe ich bestanden?« Die beiden lächeln und nicken. »Springen Sie ein bisschen auf der Schulwiese herum, machen Sie einen Handstand oder so was, und spielen Sie später ganz laut die Stones.« Hab ich dann auch gemacht – die Stones gehört, sehr laut. Nur auf den Handstand habe ich verzichtet.
Sechs Jahre später lebe ich in Frankfurt am Main, arbeite dort als Journalist. In München führe ich mein erstes Interview mit Keith Richards. In den folgenden Jahren werden weitere Gespräche folgen – mit ihm, Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts und Ron Wood. 1988 kommt es zu einem Zerwürfnis zwischen Richards und Jagger, weil der Gitarrist wütend ist auf die Soloprojekte des Sängers. 1989 findet die Gruppe wieder zusammen, geht auf große Welttournee. Am 23. Mai 1990 sehe ich sie zum ersten Mal auf der Bühne, im Niedersachenstadion in Hannover. Danach zweimal im Frankfurter Waldstadion und schließlich auch an jenem Sehnsuchtsort, der mir mit achtzehn unerreichbar erschien: dem Müngersdorfer Stadion in Köln. Die Rolling Stones haben recht behalten: »You can’t always get what you want, but if you try some time, you get what you need.«
Throwback 2002: Die Rolling Stones werden vierzig, und ich stehe wieder in der Aula meines alten Gymnasiums in Gütersloh. Siegfried Bethlehem ist inzwischen Schulleiter. Ich bin achtunddreißig, leite das Magazin der Frankfurter Rundschau. Über die Jahre haben wir losen Kontakt gehalten, hin und wieder trafen wir uns bei Spaziergängen, machten ein bisschen Small Talk, fragten den anderen, was er vom letzten Stones-Album hielt. Als er mich fragte, ob ich als Alumnus des Gymnasiums Lust hätte, eine kleine Rede bei der Entlassungsfeier des Abiturjahrgangs 2002 zu halten, habe ich gerne zugesagt. Und da stehe ich nun auf der Bühne meiner alten Aula, Siegfried Bethlehem sitzt an der Seite, er trägt Anzug. Seine Haare reichen nicht mehr bis zu den Schultern, aber sie sind immer noch lang. Ich muss an eine selbstironische Zeile von Mick Jagger denken: »Now we’re respected in society.« Ich erzähle von meinen Abizeiten, als es nur drei Fernsehsender gab, keine Handys, kein Internet, keine Laptops, noch nicht mal CDs – von MP3-Dateien ganz zu schweigen. Lachen im Auditorium. Jetzt komme ich mir selbst wie Methusalem vor. Am Ende spreche ich auch über die Stones. Ob die überhaupt noch jemand kenne? Wieder Lachen, jemand ruft »Yeah«, vermutlich ein Lehrer. Anschließend stehe ich einen Moment mit Bethlehem und Rudolf Bülter zusammen. Ich sage ihnen, dass ich sie immer noch darum beneide, die Stones 1982 in Köln gesehen zu haben. Wir lachen. Dann sind sie es, die mir Fragen stellen. Wie das sei, mit Mick Jagger und Keith Richards zu reden? Die Antwort fällt etwas länger aus.
In dieser Zeit geht mir erstmals durch den Kopf, dass die anhaltende Wirkung der Stones schon längst nicht mehr mit ihren Erfolgen, Mythen und Rekorden zu erklären ist, mit all den Legenden, die ständig variiert werden. Vielleicht sind wir deshalb so fasziniert von ihnen, weil wir ihnen nun schon seit Jahrzehnten beim Älterwerden zuschauen. Während die Kritiker mit immer neuen Metaphern die Faltenlandschaft in den Gesichtern von Richards und Jagger beschreiben, scheinen die Stones unsere Vorstellung von Zeit zu transzendieren. So sehr, dass inzwischen niemand mehr ernsthaft vorherzusagen vermag, wann genau es mit dieser Band zu Ende gehen könne. Sie werden einfach älter, lauter und in ihren Konzerten immer besser. Es gibt zwei Stones-Songs, die diese Diskrepanz auf wunderbare Weise spiegeln: »Time Is on My Side« von 1964 und »Time Waits for No One« von 1974. (Stimmt schon, der erste ist eine Coverversion einer Jerry-Ragovoy-Komposition. Die hat sich Jagger aber durch seine eigentümliche Dehnung von »time« zu »tai-a-iai-ime« ganz und gar zu eigen gemacht.) Im ersten Lied haben die Stones die Zeit auf ihrer Seite, sie meint es gut mit ihnen – es wirkt wie ein Versprechen auf die Ewigkeit. Und je länger sie da waren, umso mehr hat sich der Song metaphorisch aufgeladen: »Time is on their side« wurde zu einem Wunsch, dass sie doch bitte noch lange weitermachen. Die Rolling Stones sind, wie es Peter Kemper mal in der FAZ beschrieben hat, zu Symbolen menschlicher Ausdauer geworden, die wir wegen ihrer Beständigkeit und ihres Durchhaltevermögens lieben. In dem anderen Song ist die Zeit jedoch unerbittlich: »Time waits for no one, no favors has he, time waits for no one, and it won’t wait for me.« Die Stones haben es irgendwie geschafft, beiden Songs gerecht zu werden.
Unstrittig ist auch, dass die Stones 2002 ihren kreativen Zenit schon längst überschritten haben. Für die einen Kritiker ist Let It Bleed, 1969 erschienen, ihr letztes visionäres Album. Gnädigere Stimmen halten das drei Jahre später herausgekommene Exile on Main St für ihr bestes Album, und manche Kritiker sagen das auch noch über Tattoo You von 1981 – eine Seite gespickt mit Rock-’n’-Blues-Krachern, die andere ausschließlich für Balladen reserviert, allesamt zum Niederknien schön.
Alles, was seitdem erschien, war nicht viel mehr als die »Wiederkehr des Immergleichen«, wie Alan Posener in der Welt schrieb, dann aber doch besänftigend hinzufügte, dass »das Immergleiche ja immer auch gut war«. Ein anderer Stones-Kenner unter den Kritikern, Karl Bruckmaier von der Süddeutschen Zeitung, konnte im Album Bigger Bang von 2005 nur noch »Lautstärke gewordenes Mittelmaß, mittelgute Oldies und formelhafte Selbstzitate« erkennen. Aber auch er gab zu: »Nein, man würde sich gewiss nicht ärgern, die neuen Songs zufällig mal im Radio zu hören.« Vernichtender und zugleich prophetischer fiel schon 1989 das Urteil des US-amerikanischen Musikkritiker-Papstes Greil Marcus aus. Die Stones würden neue LPs nur noch zur Profitmaximierung aufnehmen, zürnte er und legte nach: Die Stones würden der Welt nur noch ein ums andere Mal zeigen wollen, dass sie keine Angst vorm Älterwerden haben. »Es sieht ganz so aus, als würden wir diese Band nie mehr los.« Damit hat er – bislang – recht behalten.
Fast Forward 2022: Die Rolling Stones werden sechzig. Ob sie nochmals auf Tournee gehen, womöglich ein weiteres Album aufnehmen, darüber wurde in den letzten Wochen immer wieder spekuliert. Und doch ist diesmal vieles anders, seit Charlie Watts am 24. August 2021 im Alter von achtzig Jahren starb. Ihr Schlagzeuger, der fast von Anfang an dabei war. Bereits 2004 war er an Kehlkopfkrebs erkrankt, galt nach einer Strahlentherapie jedoch als geheilt und ging ab 2005 wieder mit auf Tournee. Schon in den Wochen vor seinem Tod war klar gewesen, dass die Rolling Stones ihre wegen der Coronapandemie auf den Herbst 2021 verschobene »No Filter«-Stadiontournee in den USA spielen würden. Steve Jordan sollte Watts ersetzen. Vorübergehend, wie es hieß. Watts selbst hatte zu dem Zeitpunkt verlauten lassen, er hoffe nach seiner Genesung bald wieder auf den Schlagzeugstuhl zurückkehren zu können. Doch es kam anders.
Als ich Anfang 2022 mit Siegfried Bethlehem telefoniere, sagt er mir, er sei traurig und überrascht gewesen, als er vom Tod Charlie Watts’ erfahren habe. Bethlehem ist schon seit Längerem Rentner, aber immer noch aktiv im Bildungsbereich, er arbeitet an Geschichtslehrbüchern und unterstützt in Gütersloh Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Vor Kurzem, erzählt er mir, habe er die Dauerausstellung im Bonner Haus der Geschichte besucht. Die Stones wurden darin auch erwähnt: in einem Bereich über die 68er-Bewegung und die Studentenproteste. An einer Wand waren Konzertplakate ausgestellt vom Woodstock-Festival, von Frank Zappa und von den Rolling Stones – sie wurden am 29. März 1967 in der Bremer Stadthalle angekündigt als die »härteste Band der Welt«. An einer anderen wurde ein Video gezeigt mit Momenten, in denen Musik Geschichte spiegelt und mitgeschrieben hat. Die Szene, in der Jimi Hendrix beim Woodstock-Festival die amerikanische Nationalhymne verzerrte, was als lautstarker Protest gegen den Vietnamkrieg gedeutet wurde, hat Bethlehem besonders beeindruckt. Genauso wie die Aufnahmen, in denen Demonstrationen gegen den Krieg mit »Street Fighting Man« von den Stones begleitet wurden. »Ev’rywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy«: der donnernde Sound der Zeitgeschichte. Musik als Teil des Protests, als Teil einer Auseinandersetzung – »das fand ich immer spannend«, sagt Bethlehem.
Schließlich fragt er mich, welche von meinen Begegnungen mit den Rolling Stones die einprägsamste gewesen sei. Ich muss kurz überlegen. Es waren nicht die Interviews, auch nicht die Konzerte. Nein, überwältigend war der Moment im Juni 2007, als ich ihnen in einem Brüsseler Vorort mit einer Handvoll anderer Journalisten beim Proben zusehen durfte.
Die Stones probten in einem Fernsehstudio für ihre bevorstehende Europa-Tournee. Fotos oder Filmaufnahmen waren nicht erlaubt, aber ich durfte einen Notizblock mitnehmen. Was soll ich sagen … Es ist ein seltsames Gefühl, nur drei Meter von Mick Jagger entfernt zu stehen, ihm aus nächster Nähe dabei zuzusehen, wie er durch den Raum gockelt und die Hüften kreisen lässt. Die Rolling Stones beginnen mit dem Klassiker »Rocks Off«, müssen sich nicht erst warm spielen, sie legen los wie eine Herde wild gewordener Büffel. Und ja, ich sehe die vielen Falten, die Jaggers Gesicht inzwischen durchziehen. Es ist das Gesicht eines alten Mannes, ein Gesicht, das nicht zu dieser immer noch vollen Mähne, diesem jungenhaften Körper zu passen scheint. Einmal lupft er sein tailliertes, lilafarbenes Hemd und zeigt seinen Waschbrettbauch, als wollte er sagen: »Schaut her! Kein Gramm Fett.« Gesten, die man von seinen Stadionauftritten kennt, wo man ihn als nur streichholzgroßes Männchen auf der Bühne und parallel dazu gigantisch vergrößert auf einer Videoleinwand sieht. Wie soll man sich verhalten, wenn so jemand direkt vor einem sein komplettes Massenbeschwörungsprogramm inszeniert? Tanzen? Mitsingen? Etwas hilflos kritzele ich irgendwas in meinen Notizblock, was reichlich blöd aussehen mag, während Jagger mit seinen Armen nicht weit vor meinem Gesicht herumfuchtelt und dabei »women think I’m tasty, but they’re always trying to waste me« aus »Tumbling Dice« singt. Er scheint durch mich hindurchzusehen. Ich zucke zusammen, als er plötzlich die Arme hochreißt, an einer Stelle, bei der er sonst offenbar sein Publikum animiert, es ihm nachzutun. Einstudierte Ekstase. Während ich da so stehe, hoffe ich, dass Keith Richards nicht auf die Idee kommt, seine Telecaster-Gitarre als Prügel gegen mich einzusetzen, weil ich zu weit in sein Territorium vorgedrungen bin. Einen Fan hat er auf diese Weise mal von der Bühne gedroschen. »Er hatte dort nichts zu suchen, das ist mein Raum«, hat Richards die Attacke später gerechtfertigt.
Weiter hinten, im Auge des Sturms, sitzt Charlie Watts an seinem kleinen Gretsch-Schlagzeugset. Er ist der Ruhepol und zugleich das Energiezentrum der Band. Ein Minimalist, der die Trommeln nach Art der Jazzdrummer aus dem Handgelenk und nicht mit den Armen schlägt – cool, calm and collected. Ganz anders als seine früh verstorbenen Kollegen wie Keith Moon von The Who oder John Bonham von Led Zeppelin, die ihre Drumsticks eher wie Schlagknüppel einsetzten. Moon hat seine Trommeln sogar oft zerstört, Teile davon ins Publikum geworfen – nur um dem Frontmann und dem Leadgitarristen, die die ganze Aufmerksamkeit auf sich zogen, etwas entgegenzusetzen. Charlie Watts hätte so etwas nie gemacht. Das macht er auch an diesem Nachmittag in Brüssel nicht. Er verzieht keine Miene, presst nur die Lippen wie immer leicht aufeinander, während er die anderen mit seinen Beats antreibt, ohne dabei selbst ins Schwitzen zu kommen.
Jagger hat die unbändige Kraft, die von dem stillen Schlagzeuger ausgeht, mal besungen. »The band’s on stage and it’s one of those nights, the drummer thinks that he is dynamite«, faucht er in dem 1974 veröffentlichten Song »If You Can’t Rock Me«. Ob Watts das tatsächlich von sich selbst gedacht hat, weiß ich nicht. Aber an diesem Nachmittag, in dieser schmucklosen kleinen Halle in Brüssel, kann man den Motor dieser Band in seinem ursprünglichen Aggregatzustand beobachten. Wie er da inmitten der Equipmentkoffer sitzt und beständig, aber unauffällig trommelt, ohne dass eine bombastische Show von seiner lässigen Kraft ablenkt, von Charlie Watts, dem Taktgeber, dem Herzschlag der Rolling Stones.
Vierzehn Jahre ist das schon wieder her. Charlie Watts hat seitdem noch auf sehr vielen Stones-Konzerten den Takt vorgegeben. »Drink in your summer, gather your corn … and time waits for no one«, singt Jagger in »Time Waits for No One«. Eingeleitet wird der Song durch das Schlagzeug – durch die Bassdrum und das Geräusch des Sticks, der auf den Rand der Snaredrum schlägt, dezent, leise, Watts gibt den Takt vor, und einer nach dem anderen steigen seine Kollegen in das Lied ein. Folgen ihm.
Die Zeit kennt keine Gnade. Aber sie ist immer noch auf ihrer Seite. Trotz allem.
Mitte März 2022 zeigt sich Mick Jagger in einem Video auf seinem Instagram-Account entspannt in einen Korbsessel zurückgelehnt. Er ist inzwischen achtundsiebzig, trägt legere Kleidung, eine Katze schmiegt sich an sein Bein, durch die bodentiefen Fenster sieht man Palmen und das Meer. Aber Jagger hat offenbar keinen Sinn für seine Umgebung. Auf einem Tablet wischt er mehrmals von links nach rechts, murmelt: »That’s good … pretty good … could be better … that’s sexy.« Plötzlich zieht er anerkennend die Augenbrauen hoch, sagt »I think this is the best one«, als die Kamera über seine Schulter schwenkt und auch wir endlich einen Blick auf das Objekt der Begierde erhaschen können: das Logo der Rolling Stones, die herausgestreckte Zunge. Zum Jubiläum hat ihr der britische Designer Mark Norton ein Update verpasst, die Zunge schillert, erstrahlt in einem Kaleidoskop von Farben. Sie ist ein Versprechen auf vierzehn neue Open-Air-Konzerte in Europa, zwei davon sogar in Deutschland, zwei weitere in Wien und Bern. Maybe the last time? Wer weiß das schon.
Wenn die Rolling Stones nach Deutschland kommen, werden wir dabei sein, da sind mein Ex-Lehrer und ich uns einig. Siegfried Bethlehem lacht, als wir darüber sprechen. Dann fällt ihm noch etwas ein. Er erzählt mir, wie er von einer Regionalzeitung mal auf ungewöhnliche Weise gewürdigt wurde. Für eine Serie wurden Fotos amtierender und ehemaliger Amtsträger der Region Bildern von Weltstars und Ikonen gegenübergestellt, denen sie ähnlich sehen.
»Wissen Sie, wer das bei mir war?«, fragt er mich.
»Keine Ahnung.«
»Mick Jagger!«
»Das passt«, sage ich lachend.
IMGESPRÄCHMITDENROLLINGSTONES
Keith Richards»MUSIKSOLLTEWIEEINFLUGZEUGSEIN.«
Oktober1988, München
Ein paar Stunden bevor es mit den Interviews losgehen soll, befällt einige Mitarbeiter der Plattenfirma leichte Panik – die Lieferung der Kartons mit Rebel-Yell-Whiskey, eigens für diesen Tag aus den USA importiert, sei auf dem Weg vom Münchener Flughafen immer noch nicht im Hotel am Englischen Garten angekommen. Und das sei nun mal die Lieblingsmarke vom Rolling-Stones-Gitarristen Keith Richards. Ohne Rebel Yell würde er womöglich nur übellaunig Interviews geben. Oder im schlimmsten Fall gar nicht mit der Presse sprechen. Tatsächlich eilt Richards der Ruf voraus, auch schon mal mit Aschenbechern nach Journalisten zu werfen, wenn die ihn mit allzu blöden Fragen nerven.
Als ich am späten Nachmittag in seine Suite gebracht werde, steht eine Flasche Rebel Yell auf dem Couchtisch. Sie ist bereits geöffnet. Dahinter sitzt Keith Richards, in seiner linken Hand eine Zigarette, in der rechten ein Glas Whiskey mit Eiswürfeln. Er hebt es zur Begrüßung: »Hey Buddy.« Die Eiswürfel klackern gegen das Glas. Alles gut. Richards sieht auch in natura so aus wie auf den ikonischen Schwarz-Weiß-Fotos, die Gottfried Helnwein mal von ihm gemacht hat: klobiger Totenkopfring an der rechten Hand, Frisur wie ein Krähennest, die Augen mit dünnem Kajalstift umrandet und das Gesicht von vielen markanten Falten durchzogen. Am Anfang machen wir ein bisschen Small Talk über München, wo er mit den Rolling Stones zwei Alben aufgenommen hat, It’s only Rock ’n’ Roll (1974) und Black and Blue (1976). Aber diesmal ist er nicht nach Bayern gekommen, um über die Stones zu reden. Eigentlich. Richards hat ein Soloalbum aufgenommen, sein erstes überhaupt. Talk Is Cheap heißt es, bietet elf Rock-, Blues- und Reggaesongs, bei denen er selbst als Frontmann und Sänger agiert. Eine neue Rolle. Mick Jagger, der Leadsänger seiner »anderen« Band, hat in den vergangenen Jahren bereits zwei Soloalben veröffentlicht. In Boulevardblättern und Musikmagazinen haben sich Jagger und Richards deswegen gegenseitig beschimpft. Der Gitarrist warf Jagger vor, die Zukunft der größten Rockband aller Zeiten mit seinen Alleingängen aufs Spiel zu setzen. Dass Richards nun selbst ein Soloalbum veröffentlicht, wird schon im Vorfeld als Kampfansage gedeutet und mit der Frage verknüpft, ob die Rolling Stones nun wirklich am Ende seien. Vor allem der neue Song »You Don’t Move Me« wirkt wie eine Abrechnung mit Jagger.
Richards schenkt sich während des Interviews mehrfach Whiskey nach. Das Klirren der Eiswürfel begleitet unser Gespräch ebenso wie das gelegentliche Klicken seines Feuerzeugs, wenn er sich eine neue Zigarette ansteckt. Es wird ein längeres Gespräch. Der Aschenbecher füllt sich – und wird zum Glück nicht als Wurfgeschoss zweckentfremdet.
Sie haben oft gesagt, dass Sie, solange es die Rolling Stones gibt, kein Soloalbum aufnehmen würden. Jetzt haben Sie doch eins veröffentlicht. Heißt das im Umkehrschluss, dass es die Stones nicht mehr gibt?
Es war so: Die Rolling Stones haben sich nach dem letzten Album Dirty Work entschlossen, in absehbarer Zeit nicht zu arbeiten. Ich wollte aber im Anschluss auf Tournee gehen, so wie wir es eigentlich immer gemacht haben – das letzte Mal nach Some Girls. Das gehört für mich zu unserem Job dazu. Als das nach Dirty Work nicht passierte, kam es mir so vor, als hätten wir unseren Job nur zur Hälfte erfüllt. Und wenn ich nichts zu tun habe, werde ich verrückt (lacht). Ich wollte arbeiten. Also habe ich mich entschlossen, eine Solo-LP aufzunehmen. Es hat allerdings etwas gedauert, bis ich die richtigen Musiker beisammenhatte, die mit meinen Ideen richtig umgehen konnten. Ende 1986, Anfang 1987 war es dann so weit. Und weil ich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht absehen konnte, dass die Rolling Stones in den nächsten Monaten zusammen spielen würden, habe ich meine Meinung eben geändert. Ich spüre diese Notwendigkeit, diesen Drang, zu arbeiten.
War es nach fünfundzwanzig Jahren mit den Rolling Stones eine große Umstellung für Sie, mit neuen Musikern Songs zu komponieren und aufzunehmen?
Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Es klappte alles viel besser, als ich anfangs befürchtet hatte. Außerdem habe ich in den vergangenen zwei Jahren an mir ein gewisses Talent entdeckt, die richtigen Leute für den richtigen Job zusammenzubringen – beispielsweise für Aufnahmen mit Aretha Franklin oder Chuck Berry. Gib mir vier oder fünf Tage, dann klingt selbst ein bunt gemischter Musikerhaufen wie eine richtige Band, die schon seit Jahren zusammen spielt.
Ein bisschen Rolling-Stones-Input gab es für Ihr Soloalbum aber auch: Der frühere Gitarrist Mick Taylor spielt als Gast bei Ihrem neuen Song »I Could Have Stood You Up« mit. War das die erste Wiederbegegnung mit ihm, seit er die Stones 1974 verlassen hat?
Nein, wir haben davor schon ein paar Mal auf der Bühne zusammen gespielt. Er trat mal in einem Club in New York auf, und weil ich zu der Zeit gerade in der Gegend war, stieß ich als Gast dazu. Ich bin da sehr easy. Wenn mich jemand fragt: »Hey, hast du Lust, bei meinem Konzert mitzuspielen?«, dann mache ich das. Weil ich es einfach liebe. Mick Taylor lebt in der Nähe von mir in New York, quasi um die Ecke. Als er davon hörte, dass ich Sessions mit Johnnie Johnson, Chuck Berrys früherem Pianisten, für meinen Solosong plante, fragte er mich: »Du, könnte ich vielleicht mal vorbeikommen? Also, nur um zuzuhören?« Ich sagte nur: »Mann, du kannst mitspielen.« (Lacht.) »Aber bring deine eigene Gitarre mit.« So ist das passiert, es war nicht geplant.
Ihr Soloalbum ist gerade erschienen, wie geht es nun weiter? Werden Sie jetzt auch allein auf Tournee gehen?
Ja. Es scheint fast so, als wäre dieses Album nur ein Vorwand gewesen, um genau das wieder machen zu können – auf Tournee zu gehen. Sehen Sie, mir fehlt das Leben on the road. Und als ich diese Band zusammenstellte und wir zum ersten Mal zusammen probten, sagte ich schon nach einer halben Stunde: »Mann, das klingt großartig, Leute! Lasst uns gleich morgen irgendwo auftreten. Die Leute sollten das hören.« Dann meldeten sich die klügeren Stimmen aus meinem Umfeld, schlugen vor: »Warum nehmt ihr nicht erst mal ein Album auf und geht dann auf Tournee?« Genauso hab ich es gemacht. Wir planen in kleineren Hallen aufzutreten, ohne Rauchbomben und Lasershow. Ich würde gern in Theatern spielen, weil dort die Akustik besser ist. Ich mag Theater aber auch, weil die meisten eine Bar im Innenraum haben. Da kannst du dir während des Konzerts einen Drink holen, dabei trotzdem auf die Bühne gucken, und dann mit dem Drink wieder auf deinen Platz zurück.
In letzter Zeit war ständig von Zerwürfnissen zwischen Mick Jagger und Ihnen die Rede. Was genau ist denn bei den Aufnahmen von Dirty Work passiert, dass die anderen Stones nicht mehr auf Tournee gehen wollten?
Mick dachte nach Dirty Work, die Stones seien von gestern. Er hat sich mit Michael Jackson, Prince oder George Michael verglichen. Ich fand es idiotisch, wenn man mit fünfundvierzig so tut, als sei man noch fünfundzwanzig. In der Hinsicht waren Mick und ich sehr verschieden. Wir hatten uns aber nicht getrennt, es gab nur Zoff. Wahrscheinlich werden wir schon im kommenden Jahr eine neue Stones-LP aufnehmen und danach auf Tournee gehen. Ich meine, ich kann Ihnen das nicht garantieren. Aber im Moment sieht’s wieder ganz gut aus. Wer weiß, vielleicht hat mein Soloalbum Mick und die anderen ja angespornt, sie auch ein bisschen alarmiert, dass sie künftig besser auf mich achten sollten. Damit nicht ich es bin, der eines Tages das Handtuch wirft und mit einer neuen Band irgendwo am Horizont verschwindet (lacht).
Sie haben Ihr Soloalbum aber nicht aufgenommen, um Ihre Kollegen zu ärgern, oder?
Nein (lacht). An so was hab ich nicht gedacht. Aber es ist doch ein netter Nebeneffekt.
Was halten Sie von Mick Jaggers Solo-LPs She’s the Boss und Primitive Cool?
Das kann ich kurz machen: gar nichts. Sie klingen steril und langweilig. Ich habe mit ihm auch darüber gesprochen und ihn gefragt, ob er es wirklich nötig fand, wegen so was fünfundzwanzig gemeinsame Jahre mit den Rolling Stones aufs Spiel zu setzen. Wir hätten diese Songs auch spielen, uns mit den Ideen dazu beschäftigen können – und die Stones weiterhin zusammengehalten.
Jagger hat kürzlich einige Solokonzerte in Japan gegeben, er ist derzeit in Australien auf Tournee. Haben Sie ihn dort live gesehen?
Nein, aber ich habe Filmmitschnitte davon gesehen. Er spielt fast ausschließlich Stones-Songs und nur drei oder vier Lieder von seinen Soloplatten. Er spielt also meine Songs. Das macht mich ziemlich wütend. Er singt »Tumbling Dice« und lässt dazu drei Chicks um sich herumtanzen, während im Hintergrund eine Band spielt, die nur eine schlechte Stones-Imitation ist. So was ist wirklich nicht nötig. Ich finde das einfach nur dämlich.
Dieses Spannungsfeld aus Rivalität und Freundschaft zwischen Songwritern gab und gibt es ja in vielen großen Bands. Das war so bei John Lennon und Paul McCartney oder auch bei Robert Plant und Jimmy Page von Led Zeppelin. In der Musik bringt es oft außergewöhnliche Songs hervor, während es auf privater Ebene ständig kracht. Was macht das mit Ihnen?
Für die Musik brauchst du eine gewisse Spannung, das stimmt. Für mich gehört es aber auch zu einer Freundschaft, Mick sagen zu können, was mir nicht passt. Die anderen um ihn herum sagen immer: »Oh Mick, du bist der Größte, du bist wunderbar.« Sie geben ihm seine Streicheleinheiten. Aber niemand traut sich, ihm mal die Wahrheit zu sagen. Das ist gefährlich. Und als richtiger Freund sage ich ihm oft Dinge, die ihm nahegehen und ihn auch mal verletzen. Das ist für mich wahre Freundschaft.
Wie haben Jagger und Sie Ihre Differenzen überwunden?
Wir haben uns lange nicht gesehen, uns erst vor drei Wochen wieder getroffen. Nachdem klar war, dass die Stones wieder zusammenkommen würden, setzten Mick und ich uns eines Tages hin, er fragte mich: »Warum hast du mich im Daily Mirror einen Scheißkerl genannt?« Und ich antwortete: »Weil du mich in der New York Post als Arschloch beschimpft hast.« Wir konnten drüber lachen. Das hat uns stärker gemacht, weil wir diesen Streit überwinden konnten. Es ist, als hätten wir uns einen Knochen gebrochen. Das ist uns schon öfter passiert, nur bricht er nie an derselben Stelle. Nachdem wir fünfundzwanzig Jahre die Rolling Stones waren, hat uns dieser ganze Wirbel und die Auszeit von der Band vielleicht auch ganz gutgetan. Jeder hat etwas frische Luft geatmet und ein bisschen was dazugelernt.
Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum den Stones nach fünfundzwanzig Jahren die Luft ausgegangen ist? Ist man nach all der Zeit doch zu saturiert, zu erfolgsverwöhnt?
Es ist offensichtlich, dass es zuletzt schwierig war. Und es ist Fakt, dass es diesen Bruch gab. Aber wenn man selbst ein Teil davon ist, fällt es manchmal schwer, einen distanzierten Blick darauf zu bekommen und zu erkennen, was da eigentlich gerade passiert. Inzwischen ist mir aber klar geworden, dass so was nach fünfundzwanzig Jahren unvermeidlich ist. Das ist wie in einer Familie, da gibt es auch Kämpfe. Und älter zu werden ist manchmal gar nicht so einfach – diesen nächsten Schritt zu machen. Besonders dann, wenn der nächste Abschnitt noch sehr vage erscheint und du den Eindruck hast, dass du dich auf unbekanntes Terrain vorwagen musst. Ich selbst finde diese Vorstellung aufregend, die anderen haben davor vielleicht Angst (lacht).
Angst vor dem Unbekannten hatten Sie bei Ihrer Soloband ja offensichtlich nicht. Wie kamen Sie eigentlich auf diesen kuriosen Bandnamen X-Pensive Winos?
Der Name ist bei einer der ersten Sessions mit den neuen Musikern entstanden. Wir haben eine Pause gemacht, ich suchte nach dem Gitarristen Waddy Wachtel und nach Steve Jordan, dem Schlagzeuger und Co-Produzenten des Albums. Ich konnte sie aber nirgends finden, bis ich sie dann hinter dem Schlagzeug entdeckte. Da hockten sie und tranken eine Flasche Wein. Ich sagte zu ihnen: »Was haben wir denn hier, einen Haufen von Saufköpfen?« Und da zeigten sie mir das Etikett der Flasche. Sie tranken einen sehr teuren Wein und konterten: »Wir sind nicht einfach nur Saufköpfe, wir sind teure Saufköpfe.« (Lacht.) Das war die Geburtsstunde des Namens X-Pensive Winos. Ich habe ihn erst nur als Codenamen für die Beschriftung der Aufnahmebänder benutzt. So hatten wir das früher auch mit den Rolling Stones gemacht. Wir schrieben nie den richtigen Bandnamen auf die Schachteln mit den Aufnahmebändern. Wenn die im Studio herumlagen, hätte ja irgendjemand auf dumme Gedanken kommen und sie stehlen können. Also schrieben wir irgendwelche Phantasienamen drauf, um andere Leute gar nicht erst in Versuchung zu bringen. Niemand wusste, wer zum Teufel sich hinter diesen Namen verbarg.
Sie erwähnten eingangs Aretha Franklin. 1985 haben Sie mit der Souldiva eine neue Fassung des Stones-Hits »Jumpin’ Jack Flash« für den Soundtrack des gleichnamigen Kinofilms produziert. Sie selbst spielten auch Gitarre. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Das fiel auch in die Zeit, als die Stones nicht auf Tour waren. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Dem Schlagzeuger Steve Jordan, mit dem ich seit Langem befreundet bin, ging es zu der Zeit ähnlich. Er lebt wie ich in New York. Er hatte kurz zuvor die Paul Shaffer Band verlassen, mit der er lange gespielt hatte, und auch noch seinen Job in der Band von David Lettermans Late Night Show geschmissen, weil er davon die Nase voll hatte. Als ich also zurück nach New York kam, saß da der Schlagzeuger, der mir nach Charlie Watts am liebsten auf der Welt ist, und hatte, genauso wie ich, nichts zu tun. Wir waren beide in gewisser Weise gestrandet. Dann bekam ich einen Anruf von Aretha Franklin. Sie sagte mir, dass sie »Jumpin’ Jack Flash« neu aufnehmen wolle, fragte mich, ob ich den Song mit ihr produzieren würde. Ich sprach erst mal mit meinem Freund Steve Jordan. »Na gut«, sagte ich ihm, »ich kenne den Song, und ich mag Aretha. Hättest du nicht auch Lust mitzumachen?« Er nickte, und das war’s dann. Aretha hasst es allerdings zu fliegen. Sie machte sich daher Sorgen, wo die Aufnahmen stattfinden konnten, ohne dass sie dafür in ein Flugzeug hätte steigen müssen. Ich beruhigte sie: »Du bleibst schön daheim in Detroit, wir kommen zu dir.« Meine einzige Bedingung war, dass sie Piano spielen sollte – das hatte sie nämlich seit Jahren nicht mehr gemacht.
Warum war Ihnen das so wichtig?
Ich habe dazu eine Theorie: Noch bevor sie Sängerin wurde, als Kind schon, hat sie mit ihrem Vater Reverend Franklin in der Kirche Klavier gespielt. Sie begann also als Pianistin. Mir kam es schon immer so vor, als würden ihr Tempo und ihr Timing beim Singen harmonischer und besser klingen, wenn sie sich am Piano begleitete. Sie war ganz überrascht, als ich sie darum bat. So was hätte ihr noch nie jemand





























