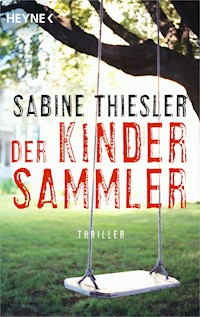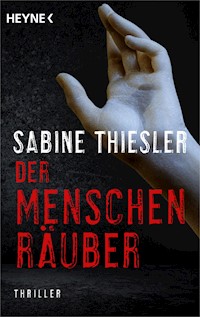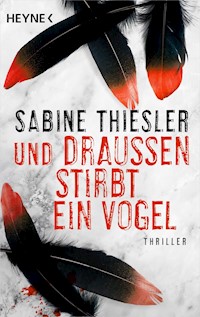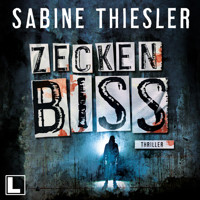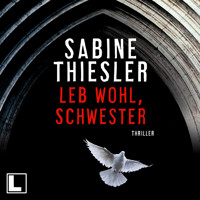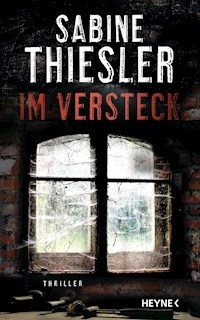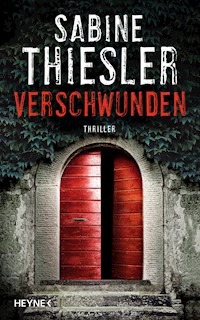10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der begnadete Schauspieler Jan Jespik verliebt sich Hals über Kopf in eine erotische, leidenschaftliche Frau. Mona ist gerade erst aus dem Knast gekommen und erzählt ihm ihre unerträgliche Geschichte. Von ihrem italienischen Ex-Mann hat sie schon Jahre nichts mehr gehört, offenbar ist er mit ihren Kindern in Italien untergetaucht. Während Jan jeden Abend auf der Bühne steht und große Erfolge feiert, startet Mona die Suche nach ihrer Familie in Florenz. Jan, der von Monas Schicksal schwer erschüttert ist, folgt ihr schließlich in die Toskana, um seine Geliebte zu rächen. Er weiß, dass dies seine schwerste Rolle sein wird und in der Katastrophe enden könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Premiere an einer kleinen Provinzbühne: Der exzentrische Schauspieler Jan Jespik brilliert als Hamlet, wächst über sich hinaus, die Zuschauer toben, er ist der unumstrittene Star des Abends. Bei der Premierenfeier lernt er Mona kennen, eine geheimnisvolle, erotische Frau, die ihn total fasziniert. Zwischen den beiden funkt es sofort, und sie erkennen sich auch als Grenzgänger, als Außenseiter in der Gesellschaft. Mona macht kein Geheimnis daraus, dass sie gerade erst aus dem Knast entlassen wurde. In langen Nächten erzählt sie Jan, was ihr italienischer Ex-Mann Vincenzo ihr angetan hat und was sie zu einer Verzweiflungstat trieb. Nun will sie Vincenzo, von dem sie zehn Jahre nichts gehört hat, wiederfinden, denn anscheinend ist er mit ihren beiden Kindern in Italien untergetaucht. Jan möchte ihr unbedingt helfen. Aber dann wird er für ein Stück engagiert, das ihm noch wichtiger ist als der Hamlet und in dem er sich selbst wiederfindet: der Lenz von Büchner. Erst danach könnte er Mona folgen und sie rächen. Jans Mutter Doro hilft Mona bei ihren Recherchen in Italien, und schließlich werden die beiden fündig: Die Bühne ist bereitet für Jans größten und verhängnisvollen Auftritt.
Die Autorin
Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Germanistik und Theaterwissenschaften. Sie arbeitete einige Jahre als Schauspielerin im Fernsehen und auf der Bühne. Außerdem schrieb sie erfolgreich Theaterstücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen. Bereits mit ihrem Debütroman »Der Kindersammler« stand sie wochenlang auf den Bestsellerlisten, ebenso mit allen weiteren Romanen. Zuletzt bei Heyne erschienen: »Leb wohl, Schwester.«.
www.sabine-thiesler.de
SABINE THIESLER
ROMEOS TOD
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 by Sabine Thiesler
© 2024 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung/Artwork: Eisele Grafik.Design, München,
unter Verwendung von Alamy Stock Photo
(Rawf8, McPhoto/Gann) und Bigstock (Intel.Nl)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30849-0V003
www.sabine-thiesler.de
www.heyne.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ZWEITER TEIL
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
DRITTER TEIL
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Kein großer Verstand hat jemals ohne einen Hauch von Wahnsinn existiert.
Aristoteles
ERSTER TEIL
HAMLET
1
BERLIN, FEBRUAR
Die Freiheit war grau und kalt. Bedeckter Himmel, minus drei Grad, ein scharfer Wind aus Nordost.
Sie hatte kein Ziel, kein Zuhause, niemanden, der auf sie wartete. Trug nichts als eine Jeans, einen Pullover, eine dünne Blousonjacke und Turnschuhe. Völlig richtig für Ende Mai, aber nicht für Mitte Februar.
In ihrer Sporttasche waren einige T-Shirts, Unterhosen, Socken, eine Zahnbürste mit schiefen Borsten, ein völlig zerliebtes Kuscheltier, das einmal eine Katze gewesen war und jetzt aussah wie ein durchgekauter Bär, ein kleines Büchlein mit längst veralteten Adressen und Telefonnummern und ihre Brieftasche.
Sie besaß noch einen Schlüsselbund zu ihrer Wohnung, die es nicht mehr gab. So wie es ihre Familie nicht mehr gab. Und ihre Schwiegereltern und die Pizzeria auch nicht.
Als Erstes musste sie sich ein Handy besorgen.
Und dann ernsthaft darüber nachdenken, wo sie den restlichen Tag, die kommende Nacht und überhaupt ihr Leben verbringen wollte.
Gar nicht so einfach, wenn man alles verloren hatte.
Sie kickte einen Stein von der Straße, warf den Kopf in den Nacken und schrie laut »Scheiße« in den Himmel.
Aber niemand hörte sie, und es hätte wahrscheinlich auch keinen interessiert.
Sie war jetzt seit fünf Minuten frei und schon halb erfroren.
Was hielt sie noch in dieser Stadt?
Würde sie hier ihren Mann wiederfinden? Sicher nicht.
Es gab nur eine einzige Chance.
Italien.
Also: Hauptbahnhof.
2
GERNERSBURG
Er hatte Schüttelfrost. Schweißausbrüche. Fieberschübe. Seit morgens um fünf. Als die Katze ihm irritiert um die Beine strich, weil er schon das vierte Mal zur Toilette ging, gab er ihr einen Tritt. Einen wirklich heftigen, weil er so wütend war.
Sie knallte gleich neben dem Fenster gegen die Schreibtischkante und ging zu Boden. Rührte sich nicht mehr. Er war nicht sonderlich besorgt, ging davon aus, dass Katzen ohnehin alles abkonnten. Die waren so schnell nicht totzukriegen.
Erst als er wieder von der Toilette zurückkam, sah er sie immer noch am Boden liegen. Er ging erneut ins Bad, holte ein Glas Wasser und schüttete es ihr über den Kopf.
Ganz langsam kam sie wieder zu sich. Na also. Sie outrierte. So etwas konnte er nicht ausstehen. Er hatte mal eine Opernsängerin gebumst, die outrierte immer. Jeder kleinste Kopfschmerz wurde zur Migräne, und wenn sie leicht umknickte, wurde sofort ein Beinbruch draus. Die Frau war eine Katastrophe. Während er es einmal mit ihr trieb, aß sie einen Apfel und fragte nach einer Weile: »Macht’s Spaß?« Er wurde irre, sprang aus dem Bett, raffte seine Sachen zusammen und wollte fliehen, aber sie war schneller, schloss die Tür ab und warf den Schlüssel aus dem Fenster. Auf dem Balkon rief er laut um Hilfe.
Letztendlich war er sie nur losgeworden, weil er das Theater wechselte.
Aber seine Katze bekam auch allmählich Starallüren.
Vor einiger Zeit, er konnte sich gar nicht mehr genau erinnern, wann, da war er in Mainz engagiert gewesen. Staatstheater. Du lieber Himmel! Selbst die Garderoben hatte er nicht mehr vor Augen, so selten war er dort gewesen. Er gehörte zur dritten oder vierten oder fünften Garde, durfte ab und zu einen Eimer Wasser über die Bühne tragen oder einspringen, wenn sich ein anderer Wimmelwurz den Hals gebrochen hatte. In der Kantine ließ er anschreiben, trank sich um den Verstand und lag ansonsten in seiner miesen Wohnung auf der Couch und knipste sich durch die Programme.
Er wohnte in einem fürchterlichen Mietshaus im vierten Stock. Fantasielosigkeit pur. Kaltes Treppenhaus, kalte Flure, kalte, quadratische Räume, da konnte selbst eine Innenarchitektin mit einem Faible für schweren Kitsch keine Atmosphäre hineinzaubern. Und bei ihm kam noch erschwerend hinzu, dass er direkt unter dem Dach wohnte. Schräge Wände in allen Zimmern, nur Dachfenster mit Blick in den Himmel, aber nicht auf die Straße.
Und eines Tages saß vor seinem Dachfenster eine Katze und schrie. So lange, bis er das Fenster öffnete, weil er die Situation so eigentümlich fand.
Sie sprang sofort ins Zimmer und aufs Bett und lebte seitdem bei ihm. Zog mit ihm von Appartement zu Appartement. Er hatte ihr keinen Namen gegeben, um sich nicht zu sehr an sie zu gewöhnen, aber das machte keinen Unterschied. Irgendwie war sie immer da, und mittlerweile mochte er sie. Mochte sie sogar sehr. Sie freute sich, wenn er kam. Schnurrte, wenn er sie fütterte, und schmiegte sich nachts an ihn.
Er legte sich wieder ins Bett, konnte aber nicht mehr schlafen. Natürlich nicht.
Ihm wurde heiß. Der Schweiß brach ihm erneut aus, sein Puls klopfte wild in den Schläfen. Er deckte sich ab, starrte ins Dunkel. Textfetzen fielen ihm ein, aber er wusste nicht weiter.
Es war ein Desaster.
Er begann zu zittern und zog sich die Decke wieder bis über die Ohren.
Er war krank, sterbenskrank. Vielleicht sollte er die Feuerwehr rufen, bevor es zu spät war. Auf gar keinen Fall konnte er die Premiere spielen. Das war vollkommen unmöglich. Aussichtslos.
Wie konnte er nur dermaßen am Ende sein? Wochenlange Arbeit für nichts. Die Kollegen würden ihn hassen, wenn er jetzt, im letzten Moment, alles platzen ließ. Wahrscheinlich würde ihn auch der Intendant vor die Tür setzen, weil er nicht begriff, wie schlecht es ihm ging.
Der Intendant hatte sowieso noch nie irgendetwas begriffen.
Er fühlte sich schwach. Ihm war übel, einfach nur zum Kotzen, aber er konnte sich nicht übergeben, hatte es schon versucht. Es war so elend, vor der Kloschüssel zu liegen und sterben zu wollen. Sterben – schlafen – nichts weiter! Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet …
Er wusste nicht weiter. Verdammt, er wusste wahrhaftig nicht weiter. Er würde versagen, all das würde in einer Katastrophe enden.
Noch dreizehn Stunden. Dann ging der Vorhang hoch.
Er stand auf und schleppte sich in die Küche. Ließ Wasser in den Kocher laufen, schaltete ihn an, zog einen Teebeutel aus dem kleinen Karton. Fenchel und Salbei. Zur Entspannung.
Dann wartete er. Seine Hände kribbelten. Bis hinauf zum Ellenbogen. Vielleicht die Vorboten eines Schlaganfalls. Wenn er jetzt zusammenbrach, würden sie ihn erst finden, wenn er nicht ins Theater kam. Wenn er um achtzehn Uhr dreißig nicht in der Maske war. Wenn die Maskenbildnerin hysterisch wurde und Wolf, der Inspizient, nicht wusste, was er tun sollte.
Wolf wusste nie, was er tun sollte. In seiner Not machte er pausenlos Durchsagen. Verkündete Wichtiges und Unwichtiges und bestellte alle Personen, die ihm einfielen, zum Inspizientenpult, damit sie gemeinsam beratschlagen konnten.
Wolf war ein Idiot.
Es waren alles Idioten. Er war dazu verdammt, in einem Haufen von Idioten zu arbeiten.
Das Wasser kochte, das Kribbeln wurde stärker. Er konnte das sprudelnde Wasser kaum eingießen, so sehr zitterten seine Hände, und er verschüttete die Hälfte.
Dann stellte er die Eieruhr auf zehn Minuten – so lange musste der Tee ziehen – und setzte sich in den Sessel vor dem Fernseher.
Zwölf Stunden, fünfzig Minuten, dann ging der Lappen hoch. Gnadenlos.
Das schaffte er nicht. Keine Chance.
Er schlief ein.
Um zehn vor neun wachte er auf, weil seine Füße eiskalt waren. Kälter als der Tee, der immer noch in der Küche stand.
Noch elf Stunden, zehn Minuten.
Oh Gott!
Er griff zum Telefon und rief Ingo, den Regieassistenten, an. Noch der Vernünftigste der ganzen Truppe. Er organisierte, tat, was er konnte, und behielt die Nerven. Er war ganz sicher schon wach. Wahrscheinlich checkte er im Theater gerade die Requisiten. Wenn es Leute wie Ingo nicht gäbe, würde der ganze verfluchte, marode Haufen zusammenbrechen und das offenbaren, was er war: nichts. Ein Haufen Scheiße. Wie eine Wolke Seifenblasen, die schon beim geringsten Lufthauch zerplatzten. Und dort verschwendete er sein Talent.
Gab es etwas Größeres als den Hamlet?
Nein.
»Ingo«, sagte er mit leidender Stimme, »ich hoffe, ich störe dich nicht. Entschuldige, dass ich so früh schon anrufe.«
»Aber gar kein Problem, Jan. Was ist los? Kann ich irgendetwas für dich tun?«
»Ja. Sag die Premiere ab. Hamlet liegt im Sterben. Es geht nicht. Ich werde nicht spielen. Es geht mir hundsmiserabel, das hohe Fieber schüttelt mich, meine Gedanken werden irre, ich weiß nicht mehr ein noch aus, weiß nicht mehr, wer ich bin oder sein soll, sterben, schlafen, träumen werden eins, ich stöhnt’ und schwitzte unter Lebensmüh! Denn wer ertrüg der Zeiten Spott und Geißel … Ingo, ich bin krank, sterbenskrank, ich schaffe es nicht, wer mich zwingt aufzutreten, dem komme ich mit meinem Selbstmord zuvor. Ich bitte dich, rede mit dem Intendanten, sag die Premiere ab, ich habe versagt. Drum lebet wohl!«
Er legte auf und schlug die Hände vors Gesicht. Noch nie zuvor hatte er sich so elend gefühlt. Wochenlang hatte er diesem Tag entgegengefiebert! Der Hamlet! Die Rolle seines Lebens! Es war ihm endlich vergönnt, sie zu spielen.
Und dann dies.
Vielleicht sollte er Schluss machen mit seinem Leben, mit dieser endlosen Quälerei. Schon zigmal war er auf der Bühne gestorben und hatte es gefühlt, das Ende. Diese Gier nach Leben, dieses Entsetzen vor dem endgültigen Aus, diese Enttäuschung über alles, was einem versagt, was ungelebt geblieben war.
Was für ein großer Moment!
Ein Genuss auf der Bühne. Horror in der Realität.
Und jetzt war er so weit. Er atmete tief durch und schloss die Augen.
Hamlet stirbt.
3
BERLIN, HAUPTBAHNHOF
ICE 2547, Berlin–München, Abfahrt 7:43, voraussichtlich 55 Minuten später.
Gefühlte minus zehn Grad, der eisige Nordwind machte sie fuchsteufelswild. Mona war eine attraktive Frau Anfang vierzig. Sie hatte ausgeprägte Wangenknochen, dunkle, fast schwarze Augen, braunes, im Sonnenlicht rötlich schimmerndes, ungebändigtes halblanges Haar und schmale, energische Lippen, die faszinierende, halbmondförmige Grübchen um ihren Mund zauberten, wenn sie lächelte.
Sie war schlank und durchtrainiert, an ihrem Körper gab es kein Gramm Fett zu viel. Man konnte sich vorstellen, dass diese Frau zupacken, sich selbst verteidigen und sogar noch auf einen fahrenden Zug aufspringen konnte.
Zum Glück saß außer ihr niemand im Abteil, das hätte ihr gerade noch gefehlt. Vielleicht irgendein alter Sack, der ständig vor sich hin rotzte und nieste und hustete und sein Taschentuch nach jedem Auswurf genau und lange inspizierte. Oder eine Frau mit drei lärmenden, nervigen Kindern … oder eine fette Schlampe, die nach Schweiß stank, einen Döner fraß und ohne Ende lautstark telefonierte.
Da hatte sie jetzt absolut keinen Bock drauf und würde sauer werden. Verdammt sauer.
Als sie am Hauptbahnhof angekommen war, war sie ins erstbeste Schickimicki-Geschäft gegangen – es gab dort anscheinend nur Schickimicki-Geschäfte –, hatte sich einen Wollpullover und eine dicke Steppjacke gekauft und beides sofort angezogen. Und in einem Telefonshop erstand sie ein Handy und ließ es sofort freischalten. In den letzten zehn Jahren hatte sie sich etwas Geld erspart. So um die fünfzehntausend. Das würde sie ein bisschen über die Runden bringen.
Dennoch hatte es ihr gereicht, fast vierzig Minuten in dieser Saukälte auf dem Bahnsteig stehen und auf den Zug warten zu müssen. Trotz der neuen Sachen war sie total durchgefroren. In diesem hochmodernen Drecksbahnhof gab es ja noch nicht mal ein kleines Wärmezimmerchen, in das man sich verkriechen konnte, um nicht zu erfrieren, wenn diese Scheißzüge Stunden Verspätung hatten.
Aber dann war ja zum Glück ein ICE gekommen.
Und alle waren eingestiegen. Wie die Lemminge. Ganz egal. Nur rein ins Warme. Selbst wenn er jetzt einfach losrollen und nach Novosibirsk fahren sollte. Der Deutschen Bahn war alles zuzutrauen.
Mona hatte gerade die Augen geschlossen und war kurz davor einzuschlafen, als eine kleine, sehr zierlich wirkende ältere Frau die Abteiltür aufschob. Sie hatte ihre Strickmütze tief ins Gesicht gezogen, trug einen dunklen, weiten Mantel und hohe Stiefel.
Oh nee, dachte Mona und schätzte sie auf Mitte, Ende sechzig. Kann sich die Tusse nicht woanders hinsetzen? Wie nervig war das denn jetzt?
»Guten Tag«, sagte die Frau, zog ihre Mütze vom Kopf, hängte ihren Mantel auf und setzte sich.
Sie hatte kurzes, sehr dünnes weißes Haar, durch das man die Kopfhaut schimmern sah. Mit den Händen fuhr sie schnell hindurch und verwuschelte es. Eine Geste, die sie sich wahrscheinlich angewöhnt hatte, seit ihr die Haare ausgefallen waren.
»Hallo«, meinte Mona.
Die Frau lächelte kurz, aber reagierte nicht weiter, kramte in ihrer Tasche, zog ein Taschenbuch heraus und begann zu lesen.
Mona konnte den Titel des Buches nicht erkennen, aber er interessierte sie auch nicht wirklich. Das Blöde war, sie selbst hatte nichts: kein Buch, keine Zeitschrift, keine Zeitung, gar nichts. Und dieser düstere, kalte Bahnhof, so seelenlos wie nur irgendwas, war nun wahrhaftig kein Augenschmaus.
Sie schloss wieder die Augen. Egal. Auch wenn sie noch zwei Tage und Nächte in diesem Zug sitzen müsste. Sie hatte wirklich Schlimmeres erlebt.
4
Dorothea Jespik war eine gescheite, bescheidene Frau, die ihr Licht gern unter den Scheffel stellte. Sie hatte ihr Leben lang als Gymnasiallehrerin für Latein und Geschichte gearbeitet, hatte es vermieden, mit den Kollegen hin und wieder einen über den Durst zu trinken, und sich stattdessen, als ihr Sohn bereits ausgezogen war und sie wieder allein lebte, lieber unter einer dicken Decke mit einem Buch verkrochen, das Handy ausgeschaltet und das Telefonklingeln ignoriert.
Einladungen lehnte sie ab, wenn sie sich danach anhörten, dass man sich aufbrezeln musste, sie hasste es, sich zu schminken, und besaß nur drei etwas elegantere Outfits, wenn sie mal ins Konzert oder ins Theater ging.
Dorothea war im wahrsten Sinne des Wortes eine graue Maus, sie liebte dieses Image und genoss es, von Freund und Feind, von Kollegen, Eltern oder Schülern unterschätzt zu werden. Dies war immer von Vorteil gewesen, aber jetzt – seit sie pensioniert war – kam es nicht mehr darauf an. Sie musste sich nicht mehr profilieren, war nur noch eine graue Maus unter den unzähligen anderen grauen Rentnermäusen.
Ihre Kolleginnen waren früher jedes Jahr in Abendkleidern und High Heels mit ihren Männern zum ADAC-Ball gegangen, sie hatte sich unterdessen eine Wärmflasche gemacht und auf die Couch gelegt.
Jetzt lagen die Rentner alle mit einer Wärmflasche auf der Couch, erwarteten nichts mehr vom Leben und fürchteten sich vor dem Tod.
Vielleicht sollte sie auf ihre alten Tage doch noch ihr Leben ändern und irgendetwas Neues in Angriff nehmen.
Und darum war sie heute auf dem Weg nach Gernersburg, hatte Schminkzeug, ein elegantes Outfit und hohe, aber dennoch bequeme Stiefeletten dabei – und jetzt dachte dieser verfluchte Zug gar nicht daran loszufahren.
Dorothea knallte ihr Buch zu, pfefferte es auf den Sitz neben sich, sah aus dem Fenster und murmelte vor sich hin: »Jetzt steht da: Abfahrt in voraussichtlich sechzig Minuten. Wer weiß, ob der Zug überhaupt noch fährt.«
Mona war sofort hellwach. »Verflucht! Diese Schweine! Aber was können wir machen?«
Dorothea lächelte. »Wo wollen Sie hin?«
»Nach Italien. Und Sie?«
»Nach Gernersburg, das ist kurz vor München.«
Mona nickte und sah aus, als ob ihr das jetzt nicht viel sagte.
»Haben Sie es eilig?«, fragte Dorothea. »Ich meine, müssen Sie dringend irgendwann irgendwo sein?«
»Nee. Und Sie?«
»Na ja, ich muss spätestens um sechs Uhr abends in Gernersburg sein.«
»Kein Drama. Is’ ja noch Zeit.«
Dorothea lächelte in sich hinein. Was für ein schönes Wortspiel. Doch ein Drama. Genau. Darum ging es.
Mona deutete auf Dorotheas Tasche, in der eine Zeitung steckte. »Sorry, kann ich mir die mal kurz ausborgen? Ich dreh hier durch vor Langeweile.«
»Aber sicher.«
Dorothea gab ihr die Zeitung. »Hier. Ich bin übrigens Dorothea.«
»Und ich bin Mona.« Sie grinste. »Danke.«
Mona begann zu lesen, auch Dorothea vertiefte sich wieder in ihr Buch, und eine Weile sagte keine der beiden ein Wort.
Was in der Zeitung stand, interessierte Mona nicht die Bohne. Seit zehn Jahren hatte sie keine mehr in der Hand gehabt. Aber dass sie so öde sein würde, hätte sie nicht gedacht. Langweilig, spießig, oh mein Gott, da hatte sie offensichtlich nichts verpasst.
Sie hatte immer nur ferngesehen. Das war okay gewesen. Aber hier diese Zeitung: die Hölle.
Sie faltete sie zusammen und reichte sie zurück. »Danke. Sehr freundlich.«
Dorothea nickte und legte sie neben sich.
»Ich geh jetzt mal raus, eine rauchen, und dann hol ich mir ein Brötchen. Soll ich dir was mitbringen?«
Dorothea riss die Augen auf und setzte sich aufrecht hin. »Oh ja. Das ist eine gute Idee. Für mich bitte auch ein Brötchen.«
»Wurst oder Käse?«
»Käse.«
»Okay.«
Dorothea kramte nach ihrer Geldbörse.
»Lass mal. Das machen wir später.«
Mona verließ das Abteil. Ihre Tasche mit den wenigen Habseligkeiten ließ sie zurück.
Als sie eine Viertelstunde später wiederkam, war Dorothea eingeschlafen und schreckte hoch, als Mona mit Schwung die Abteiltür aufschob und wieder zukrachen ließ.
»Sorry«, sagte sie, »aber ich wusste nicht, dass du schläfst.«
»Schon gut.« Dorothea sah so zerknautscht aus, als hätte sie zwanzig Stunden in einem engen Zelt einer Arktisexpedition verbracht.
Mona gab ihr das Brötchen und eine Flasche Wasser. »Is’ nicht die Welt, toll sahen die alle nicht aus, aber immerhin.«
»Danke.« Dorothea lächelte. »Sehr, sehr nett. Was hast du bezahlt?«
»Is’ jetzt wurscht. Guten Appetit.«
Beide bissen in ihre Brötchen und sahen sich an.
Und grinsten.
Mona nahm einen tiefen Schluck aus ihrer Wasserflasche.
»Hast du irgendwas erfahren, wie es hier weitergeht?«, fragte Dorothea.
»Nee. An der Anzeige steht jetzt: Die Abfahrt verzögert sich auf unbestimmte Zeit.«
»Hast du mal gefragt, was das soll?«
»Nee. Die Gefahr war zu groß, dass ich dem Typen, der mir ’ne blöde Antwort gibt, eine reinhaue. Aber so viel hab ich gesehen: Es fährt auch kein anderer Zug nach München.«
Dorothea gefror das Lächeln im Gesicht. »Verflucht! Und was machen wir jetzt?«
Mona zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung.«
Dorothea seufzte. »Wir haben nur drei Möglichkeiten in diesem Bundesbahndesaster. Möglichkeit eins: Wir gehen beide nach Hause und vergessen unsere Reise und alles, was wir vorgehabt haben.«
»Ich hab kein Zuhause«, murmelte Mona.
»Möglichkeit zwei: Wir warten. Irgendwann muss sich der Zug ja in Bewegung setzen. Allerdings könnte es dann für mich zu spät werden. Und Möglichkeit drei: Wir beiden Grazien versuchen jetzt noch, einen Mietwagen zu bekommen, denn diese Idee hatten sicher auch schon andere. Und dann fahren wir gemeinsam Richtung Süden … Was meinst du?«
Mona starrte die kleine graue Frau, die plötzlich verdammt energisch wirkte, mit großen Augen an. »Wie spät ist es jetzt?«
»Kurz vor zehn.«
»Ach komm, lass uns abhauen. Va bene?«
Dorothea stutzte. »Va bene? Bist du Italienerin?«
»Nee, aber ich war mal mit einem italienischen Verbrecher verheiratet.«
»Wie heißt du eigentlich mit Nachnamen?«, fragte Mona, als sie aus dem Zug kletterten.
»Dorothea Jespik«, sagte sie und blickte Mona kurz an. »Und du?«
»Mona Russo.«
»Der Name des Verbrechers?«
»So ist es.«
Die beiden lächelten sich zu. Und liefen den Bahnsteig entlang.
Dorothea fand die Autovermietungsfirmen sofort, klärte alles, füllte Formulare aus, schob ihre Kreditkarte rüber, zeigte ihren Führerschein und unterschrieb.
Mona stand staunend daneben. Und als sie wenige Minuten später in einem dunklen Golf saßen und Dorothea den Motor anließ, fühlte sie sich wie in einem Film.
Als würde ein großes Abenteuer beginnen.
5
Es begann zu schneien, und der Schnee blieb nass und klebrig auf der Autobahn liegen. Dorothea wusste, dass die Schneepampe jetzt bald gefrieren und alles in eine Schlitterpartie verwandeln würde.
Eigentlich liebte sie es, Auto zu fahren, aber Situationen wie diese machten ihr Angst, zumal sie in einem fremden und nicht in ihrem eigenen Auto saß.
»Verflucht«, sagte sie. »Was für ein Wetter! Das fehlt uns gerade noch!«
»Fahr langsam«, sagte Mona. »Mir ist es vollkommen egal, wann ich irgendwo bin. Ich habe ein vages Ziel vor Augen, aber keinen Termin. Bloß keinen Stress.«
»Alles klar«, sagte Dorothea, »ich pass auf.«
Der Schneefall wurde stärker. Obwohl der Scheibenwischer auf Hochtouren lief, konnte man kaum noch etwas erkennen. Die ganze Welt war in weißen Flocken verwirbelt.
»Ich bin kurz vorm Durchdrehen«, sagte Dorothea.
»Ganz ruhig. Keine Panik.«
Dorothea nickte. »Willst du fahren?«
»Kann ich machen, klar, aber ehrlich gestanden hab ich jetzt seit über zehn Jahren in keinem Auto mehr gesessen. Und dann bei dem Wetter …«
»Kein Problem. Dann fahr ich weiter. Aber was war denn los in den letzten zehn Jahren?«
»Ich war in einer anderen Welt.«
Dorothea sah sie an und grinste. »Auf einer einsamen Insel?«
Mona grinste auch. »So ungefähr. Nur nicht so romantisch. Erzähl ich dir irgendwann mal später.«
»Und warum willst du jetzt nach Italien?«
»Ich suche meinen Mann. Und meine Kinder.«
Dorothea sah Mona an. »Oh, das klingt heftig.«
»Ja.«
»Was willst du tun? Was ist dein Plan?«
»Noch hab ich keinen. Wenn du jetzt hier auf dieser verfickten zugeschneiten Autobahn anhalten könntest, würde ich aussteigen und eine rauchen. Ansonsten würde ich mich volllaufen lassen und dann irgendwo mit meiner Suche beginnen. Es gibt drei Situationen, in denen einem im Leben meist etwas Brauchbares einfällt: beim Rauchen, im Vollrausch oder unter der Dusche. Das funktioniert. Und darauf hoffe ich. Aber eine gute Idee und einen wirklichen Plan habe ich auch nicht.«
Dorothea kämpfte sich weiter durch das schlechte Wetter.
Mona schwieg bestimmt eine Viertelstunde. Dann fragte sie: »Was willst du überhaupt in diesem komischen Gernersburg?«
»Mein Sohn hat dort heute Abend Premiere. Er spielt den Hamlet. Er weiß nicht, dass ich komme, ich wollte ihn überraschen.«
»Oh! Wie geil ist das denn! Wann beginnt die Vorstellung?«
»Um zwanzig Uhr.«
»Das kriegen wir schon hin.«
»Hoffentlich. Wenn das Wetter nicht schlechter wird.«
Aber das Wetter wurde schlechter. Der Schnee fiel jetzt noch dichter und blieb auf der Autobahn liegen. Die Autos fuhren Spuren und begannen zu rutschen und zu schlittern. An einer Steigung blieben mehrere Lastwagen mit eingeschalteter Warnblinkanlage liegen.
Dorothea fluchte und versuchte, an den Lastern vorbeizuziehen. Direkt vor ihr verreckte ein Polo. Und dann ging auch für Dorothea nichts mehr.
Sie schlug gegen das Steuerrad. »Verdammt, jetzt kommen wir hier nicht mehr weg. Vielleicht hängen wir hier noch Stunden rum!«
Mona sagte nichts, aber sie dachte daran, dass es in diesem Mietwagen keine Decke, kein Wasser, nichts gab.
Einen Moment überlegte sie und sagte dann: »Pass auf! Noch ist niemand hinter uns. Meinst du, du schaffst es, ein Stück zurückzusetzen und dann noch mal anzufahren? Wenn ja, dann zieh, wenn nichts kommt, links an diesem Scheißpolo vorbei, und dann kannst du vielleicht mit ein bisschen Schwung an dieser ganzen Schlange vorbeifahren.«
Dorothea wirkte überkonzentriert. »Okay. Ich versuch’s.«
Sie legte den Rückwärtsgang ein und setzte vorsichtig zurück. Dann fuhr sie im ersten Gang an. Nicht zu sanft, aber auch nicht zu forsch. Beim dritten Versuch griffen die Reifen endlich im Schnee, und es gelang ihr, auszuscheren und an dem liegen gebliebenen Wagen vorbeizufahren. Es war verdammt schwierig, aber es ging.
Und schließlich hatte sie wieder freie Fahrt.
Der Schneefall hielt an, aber Dorothea fuhr langsam und konzentriert. Und niemand war mehr vor ihr, niemand hielt sie auf.
»Super!«, rief Mona. »Cool! Du hast es geschafft! Dorothea, du bist die Größte!«
Dorothea grinste. »Ich glaube, wir zwei sind ein gutes Team!«
Das war das schönste Kompliment, das Mona in den letzten zehn Jahren bekommen hatte.
Kurz danach stießen sie auf die ersten Streufahrzeuge, der Schnee verwandelte sich in Schneematsch, allmählich entspannte sich Dorothea.
»Wenn man sich das mal recht überlegt«, sagte sie nach einer Weile, »wir treffen uns im Zug, du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht, und jetzt sitzen wir zusammen im Auto und fahren in Richtung Süden, irgendwohin. Unvorstellbar eigentlich.«
»Das ist das, was ich am Leben so geil finde«, meinte Mona grinsend, »diese komischen überraschenden Schlenker.«
»Ich würde gerne mehr von dir wissen.«
»Klar, aber frag mich jetzt bitte nicht, was in den letzten fünfzehn Jahren passiert ist und warum ich meine Kinder suche und meinen Mann. Da hab ich keinen Bock drauf. Da will ich gar nicht dran denken.«
»Okay. Hast du eine Lieblingsfarbe?«
»Ja. Blau und Grau. Am besten beides zusammen.«
Doro lächelte. »Betrifft das auch deine Kleidung?«
»Nee. Da bevorzuge ich ein positives, freundlich-fröhliches Schwarz. Diese hässliche Winterjacke hab ich mir nur in Türkis gekauft, weil es nichts anderes gab. Nur noch gelb. Und das ist noch schlimmer.«
»Dein Lieblingsgericht?«
»Nudelpfanne mit Gamberi, viel Knoblauch, Petersilie und Porree. Oder Nudelsalat. Oder Nudeln mit Thunfisch, Tomaten und schwarzen Oliven. Ganz egal, Hauptsache, mit Nudeln.«
»Das geht mir genauso. Deine Lieblingsmusik?«
»Countrymusic. Johnny Cash, Dolly Parton, in der Richtung. Und du?«
»Eher Klassik. Deine Lieblingsjahreszeit?«
»Sonne und über fünfunddreißig Grad. Deine?«
»Ist auch für mich das Schönste! Dein Lieblingstier?«
»Schwäne.«
Doro sah Mona überrascht an. »Schwäne? Ich dachte, jetzt kommt irgendwas wie Elefanten, Hunde, Löwen, Schildkröten oder Erdmännchen. Aber Schwäne?«
»Tja, das ist eine komische Geschichte. Als Kind war ich in den Ferien oft bei meiner Oma, das war toll. Sie ist leider schon gestorben, als ich acht war. Sie wohnte auf dem Land, und ganz in der Nähe gab es einen kleinen See, viel Schilf drumrum und eine winzige Badestelle. Ich konnte nicht schwimmen, aber ich durfte trotzdem dorthin. Meine Oma ist einfach davon ausgegangen, dass ich nicht ins Wasser gehe und ersaufe. Punkt. Fertig. Und wenn einem jemand vertraut, passiert auch nichts.
Und auf diesem See, da lebten zwei Schwäne. Ich sah sie jeden Tag. Sie gehörten irgendwie dazu. Und eines Tages kreiste ein Schwan unaufhörlich über dem See und schrie ohne Ende. Es war fürchterlich. Und dann sah ich, dass der andere Schwan tot auf dem Wasser trieb.
Von nun an saß der einsame übrig gebliebene Schwan Tag für Tag neben dem toten, kreiste immer wieder allein über dem Wasser und schrie. Es war nicht zu ertragen. Und ich konnte ihm nicht helfen. Nach drei Wochen war auch der zweite Schwan tot und lag neben seiner oder seinem Liebsten. Gestorben an gebrochenem Herzen. Weißt du, ich bin diese Geschichte nie wieder ganz losgeworden. Hab diesen todtraurigen Schwan immer noch vor Augen, als wäre es erst gestern passiert. Das war einfach die ganz große Liebe. Und seitdem sind Schwäne meine Lieblingstiere.«
Dorothea sah stumm geradeaus und nickte. »Hast du so etwas schon mal selbst erlebt?«, fragte sie. »So eine große Liebe? Für die du sterben würdest?«
»Nee. Du?«
»Ich auch nicht.«
Eine Weile schwiegen beide. Jede hing ihren Gedanken nach.
Dann sagte Dorothea: »Komm doch einfach mit nach Gernersburg! In meinem Hotel ist bestimmt noch ein Zimmer frei. Und dann gehen wir beide zusammen zur Premiere, und du lernst meinen Sohn kennen.«
Mona sah Dorothea an, lächelte und nickte.
»Das ist eine Superidee!«
6
GERNERSBURG
Das Telefon klingelte. Ingo war am Apparat.
»Jan«, sagte er, »hör zu, ich habe telefoniert, aber Herrmann ist nicht zu erreichen. Lass uns noch eine Weile warten. Der Intendant ist nun mal der Einzige, der eine Entscheidung treffen kann. Sowie ich ihn erreicht hab, gebe ich dir Bescheid, okay?«
»Nein! Ich bin krank! Doch sei es drum. – Ingo, ich bin hin; du lebst: erkläre mich und meine Sache den Unbefriedigten.«
Ingo seufzte und atmete hörbar ins Telefon. »Alles klar«, sagte er. »Ich kümmer mich drum. Mach dir keine Sorgen. Es gibt schlimmere Dramen auf dieser Welt als eine Premiere, die ins Wasser fällt. Herrmann wird es verstehen, wenn du krank bist. Und die Kollegen und die Zuschauer haben sicher auch Verständnis dafür. Dann holen wir das Ganze nach. Kein Problem. So was haben wir ja nicht zum ersten Mal. Es ist nicht schön, es ist schlimm, ärgerlich, schade, was weiß ich, aber wir kriegen das hin. Pfleg dich, schone dich, damit du bald wieder auf die Füße kommst. Denn du warst sooooo gut, ja, soooo sensationell, so einen Hamlet wie dich hat die Welt noch nicht gesehen. Das sage jetzt nicht nur ich, das habe ich auch von den Kollegen gehört, die vor dir niederknien könnten und dich lieben, weil sie mit dir spielen dürfen, das hat mir auch Herrmann gesagt. Und du weißt, als Intendant hat er schon den einen oder anderen Hamlet kommen und gehen sehen. Und er hat gemeint, das ist der größte und beste Hamlet, den wir je hatten. Jan hat es begriffen. Er fühlt es. Er lebt es. Er ist ein Genie! Noch in fünfzig Jahren wird man sich an ihn als Hamlet erinnern. Er wird unsere Bühne weit über Deutschland hinaus berühmt machen. Dass wir an unserem Haus so einen Schauspieler haben, ist ein Geschenk des Himmels!«
Es war still in der Leitung. Mucksmäuschenstill.
Nach einer kurzen Pause redete Ingo weiter. »Aber ich verstehe dich, Jan. Wenn du krank bist und dich nicht fühlst, dann verkaufst du dich unter Wert. Ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Herrmann zu erreichen, und dann blasen wir alles ab. Mach dir keine Sorgen und werd gesund! Wir können ja heute Abend mal telefonieren, wie es dir geht! Ciao!«
»Ciao«, hauchte Jan Jespik schwach, und in diesem Moment brach ihm erst recht der Schweiß aus.
Eine halbe Stunde saß er still in der Küche.
Dann suchte er seine Katze, die sich unter dem Schreibtisch verkrochen hatte, zog sie am Nackenfell hervor und zu sich auf den Schoß und kraulte sie eine Viertelstunde, bis sie anfing zu schnurren.
Er stand auf, fütterte sie und riss das Fenster auf. Wenn sie fraß, kam sie nicht auf die Idee hinauszuspringen. Seine Wohnung lag im ersten Stock einer Neubausiedlung. Hinter den mit Tannen umsäumten Mülltonnen lag der Kinderspielplatz, den er hasste. Vom Hell- bis zum Dunkelwerden tönten Geschrei und Gekreische zu ihm herüber, und er konnte nichts dagegen tun. Er hasste die Kinder, er hasste die Mütter, die ihre Gören dort abluden und kreischen ließen, er hasste diese ganze Wohnanlage. Aber er hatte in Gernersburg so schnell nichts Besseres gefunden, als er sein Engagement bekommen hatte. Das beste und höchstdotierte, das er jemals gehabt hatte. Da war die miese Wohnung das kleinere Übel. Und sie war ja auch nur auf Zeit. Nicht für ewig.
Er schloss das Fenster wieder.
Zwei Stunden später rief er Ingo an. »Ich spiele«, sagte er. »Es geht mir sehr viel besser. Ein Freund hat mir ein Medikament vorbeigebracht, und das hat echt geholfen.«
»So schnell?«
»Ja, so schnell.«
»Du musst mir mal sagen, was das ist. Das ist ja irre!«
»Mach ich. Klar.«
»Aber das freut mich total. Dann muss ich die Premiere nicht absagen lassen?«
»Nein. Musst du nicht. Ich spiele.«
»Jan, ich freue mich so ungemein, das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist großartig, Jan! Danke! Das wird ein ganz, ganz toller Abend!«
»Sicher. Bis später.«
Jan legte auf und küsste seine Katze auf die Nase.
7
Das »Hotel zum Ochsen« in Gernersburg hatte auch für Mona noch ein Zimmer frei. Etwas schlichter und kleiner als das von Doro und direkt neben dem Fahrstuhl, aber Mona fand es großartig.
»Alles in Ordnung«, meinte Mona entspannt. Sie warf einen Blick ins Bad. »Alles sauber, alles super, alles bestens.« Sie schloss die Badezimmertür wieder und warf sich aufs Bett. »Und die Matratze ist auch okay. Nicht zu weich und nicht zu hart. Was will man mehr?«
Dorothea setzte sich in einen kleinen Sessel und schlug erschöpft die Hände vors Gesicht. »Was war das denn heute für ein grauenvoller Tag! Erst dieser Zug, der nicht fährt, dann das Schneechaos auf der Autobahn … Ich fasse es nicht!«
»Da muss die Premiere ja ein Hammer werden«, sagte Mona.
Dorothea sah sie an und schwieg eine Weile. Dann grinste sie. »Du hast recht! Du hast vollkommen recht! Mit so einem Auftakt kann nur noch alles gut werden! Und wir sind dabei!«
Mona strahlte. »Geile Sache. Ich freu mich!«
Dorothea überlegte, dass diese Frau, die sie da im Zug aufgegabelt hatte, schon eine komische Figur war. Liebenswert, stark, unerschrocken, ein bisschen ordinär und ziemlich weltfremd. Sie war ihr ein Rätsel, aber irgendwie interessierte sie diese Person, die allein von einem einfachen Bett hellauf begeistert war.
Dorothea sah auf die Uhr. »Noch zwei Stunden, dann müssen wir los. Ich geh jetzt rüber in mein Zimmer, denn ich würde mich ganz gern noch ein bisschen hinlegen. Ist das okay für dich?«
»Na klar«, sagte Mona. »Alles bestens. Und vielen Dank fürs Fahren.« Sie sprang auf, ging zu Doro, umarmte sie und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Buonanotte, cara.«
Doro lächelte und ging zur Tür.
»Ach, Doro!«, hielt Mona sie auf.
»Ja?«
»Ich wollte nur sagen, ich hab jetzt nichts dabei für die Premiere. Also irgendwelche besonderen Klamotten oder so. Oder Schminke, Schmuck oder was weiß ich. Ist das schlimm?«
»Nein, das macht gar nichts. Wir werden einfach die Vorstellung genießen. Ganz egal, was wir anhaben!«
»Super. Dann fress ich jetzt noch ein paar Erdnüsse aus der Minibar, und alles ist gut!«
Dorothea grinste und zog die Tür leise hinter sich ins Schloss.
8
Er hatte lange gebadet, hatte das ganze Stück Revue passieren lassen und seine Passagen laut gesprochen, hatte sein Herz schlagen hören und beobachtet, ob es unter der Wasseroberfläche Schaumblasen warf, wenn es in seiner Brust hüpfte.
Aus der Wanne kam er erst, als er mit Entsetzen sah, dass seine Fingerkuppen weiß und schrumpelig waren und seine Füße so weich und labberig wie die einer Leiche. Er dachte an die kraftlosen Lenden alter Männer, über die er im zweiten Aufzug, zweite Szene, sprach, und trocknete sich schnell ab.
Nur mit einem Bademantel bekleidet, briet er sich in der Küche vier Spiegeleier und aß sie mit Chili bestäubt auf zwei Vollkornbroten. Fühlte sich auf einmal kräftig und unverwundbar.
Dies heute war sein Abend. Seine Nacht.
Am Nachmittag trank er einen halben Liter herben Weißwein und aß dazu zwei Tafeln Schokolade. Dann nahm er sein Textbuch, machte einen zweistündigen Spaziergang durch den Park und betrat pünktlich um halb sieben das Theater.
Conny war Maskenbildnerin in der Ausbildung und stand schon bereit, als er in die Maske kam. Die Chefmaskenbildnerin Adele war noch nirgends zu sehen.
»Guten Abend, Herr Jespik«, sagte Conny. »Geht es Ihnen gut?«
Jan nickte, hatte keine Lust zu antworten. Die Kleine war süß, las ihm jeden Wunsch von den Lippen ab, und wenn er die Augenbrauen zusammenzog, fiel sie fast um vor Schreck. Wahrscheinlich verehrte sie ihn und war in ihn verliebt. Irgendwann würde er sie ficken, aber heute Abend legte er keinen Wert auf Kommunikation jeglicher Art. Heute war Hamlet. Nichts weiter.
Der Rest war Schweigen.
Er setzte sich auf den Stuhl, lehnte sich zurück und schloss die Augen.
Wie schon bei den Bühnenproben zuvor begann Conny mit einer Nacken- und Kopfmassage. Wunderbar. Wenn sie jetzt noch den Mund hielt, war es genial.
Aber leider platzte in diesem Moment Adele herein und flötete ein viel zu lautes »’n Abend!«
Jan reagierte nicht. Er fand, ihr Auftritt war Grund genug, sich auf sie zu stürzen und sie zu würgen.
»Na, Herr Jespik? Wie isses? Nervös? Müssen Sie nich’. Alles gut. Wir machen das schon. Wird schon. Keine Sorge.«
Jans Hände verkrampften sich, aber er zwang sich zur Ruhe. »Was sagen Sie da?«
»Ich sagte nur, dass ich glaube, dass es ein wundervoller Abend wird.« Während sie sprach, legte sie Puder, Make-up, Schwämmchen, Lidschatten und Kleenex bereit. »Sie haben alle viel gearbeitet, Cessnik ist ein fabelhafter Regisseur, es kann gar nichts schiefgehen.«
»Cessnik ist ein Idiot«, zischte Jan gefährlich leise zwischen den Zähnen. »Er hat überhaupt nicht begriffen, welches wahnsinnige Stück er da inszeniert. Eines der wahnsinnigsten, das die Welt je gesehen hat. Und jetzt halten Sie besser den Mund.«
Jans letzten Satz überhörte Adele leider.
»Also, was ich so von den Proben mitbekommen habe, war wirklich nicht schlecht. Und Sie machen Ihre Sache richtig gut, Herr Jespik! Ihr Monolog, Sein oder Nichtsein, alle Achtung. Nee, da sei’n Sie mal ganz ruhig, wir sind ja hier nicht in Hamburg oder Berlin, die Leute haben längst nicht diese Ansprüche, da können Sie ganz zuversichtlich sein. Ich bin sicher, es wird ein voller Erfolg.«
Jan sprang auf, krebsrot im Gesicht. »Halten Sie Ihre verdammte Schnauze! Was heißt hier: Wir machen das schon? Eine Scheiße ist das! Wenn es hier einer macht, dann bin ich das, okay? Nicht der Herr Cessnik und niemand sonst. Haben Sie das kapiert? Mischen Sie sich nicht in Dinge ein, die Sie nichts angehen und von denen Sie nichts verstehen. Natürlich bin ich nervös! Und ich habe allen Grund dazu. Wenn in diesem ganzen verschissenen Theater einer einen Grund hat, nervös zu sein, dann bin ich das. Und nicht Sie und keiner sonst. Egal, ob in Wien, Berlin, Hamburg, London oder New York, heute Abend stehen die Welt und mein Leben auf dem Spiel. Aber das ist zu hoch für Sie.« Er rang die Hände. »Was für eine Unverfrorenheit, mir zu sagen: keine Sorge! Was für eine Hybris! Sie, die nichts weiter zu tun hat, als die Haare aus der Bürste zu pulen, wagt es, mir zu sagen: keine Sorge?« Er wischte alles, was an Schminke und Utensilien auf dem Tisch lag, auf die Erde. Conny drückte sich vor Angst gegen die Wand, und Adele presste wütend ihre Fäuste in die Hüften.
»Gehen Sie mir aus den Augen!«, brüllte er weiter. »Sie haben ja nicht im Entferntesten begriffen, was Theater ist! Was es aus Menschen macht und was es für Schauspieler bedeutet, die ihr Leben auf der Bühne geben. Verstehen Sie das, Sie vertrocknete ignorante Zicke? Wahrscheinlich nicht. Also suchen Sie sich besser einen Job im Supermarkt und halten Sie in Gottes Namen Ihren Mund und stören Sie mich nicht!«
Er raufte sich die Haare und fiel zurück auf seinen Stuhl. Sein Gesicht glühte. Conny war so verstört, dass sie sich gar nicht mehr in seine Nähe wagte, Adele verdrehte die Augen, schüttelte den Kopf und ging aus dem Raum. Conny würde diesem Idioten schon irgendetwas aufs Gesicht klatschen.
Sie hatte ja schon eine Menge durchgeknallte Schauspieler erlebt, aber dieser Jan Jespik war mit Abstand der schlimmste.
Adele liebte ihren Beruf. Fand, dass es der schönste der Welt war. Aber manchmal dachte sie, sie sollte wechseln. Lieber mit verschüchterten Models zu tun haben als mit eitlen Schauspielern, die immer kurz vor dem Nervenzusammenbruch standen. Und dieser Jan Jespik kam direkt aus der Hölle.
Sie hatte gelogen. Hatte sich noch keine einzige Probe angeguckt, und wenn sie ehrlich war, hatte sie auch keine Lust, eine Vorstellung mit diesem Hysteriker zu sehen.
Aber an diesem Theater blieben Schauspieler ohnehin nie lange. Dazu war die Klitsche zu klein und zu unbedeutend. Spätestens nach ein oder zwei Jahren waren sie wieder verschwunden. Und dann war auch der Jan-Jespik-Spuk vorbei, und sie konnte wieder durchatmen. Hier fühlten sich alle immer wie der Mittelpunkt der Welt, aber kaum verließen sie das Theater, hörte man nie wieder etwas von ihnen. Und auch nach Jan Jespik würde in wenigen Jahren kein Hahn mehr krähen. Weder hier noch sonst wo. Dies hier heute Abend war eine beschissene kleine Premiere. Nichts Besonderes. Keine Oscarverleihung. Und wenn es ein Flop werden sollte, würde sich die Welt auch weiterdrehen und nach zwei Tagen niemand mehr darüber reden.
Was für ein eingebildeter Vogel.
Sie ging, um sich einen Kaffee zu holen.
Eine Stunde später waren Jan und die anderen Schauspieler in Kostüm und Maske. Auf den Garderobentischen standen Sektflaschen und kleine Premierengeschenke. Jan hatte für die Kollegen nichts mitgebracht. Er hatte einfach nicht daran gedacht, vor einer Premiere hatte er andere Dinge im Kopf als alberne Premierengeschenke: kleine Stofftiere als Glücksbringer, kitschige Karten, Fotos, Sprüche mit Herzchen, billige Anhänger, lauter Schund, den er verabscheute. Wenn alles klarging, das Stück ein Erfolg wurde und keiner unangenehm aus der Reihe tanzte, würde er die ganze Bande zum Essen einladen. Das war besser als ein Stofftier oder eine Rose auf dem Garderobentisch.
Wem man jetzt im Flur, hinter der Bühne oder in der ersten Gasse begegnete, dem spuckte man über die Schulter. »Toi, toi, toi.« Mein Gott. Es gab kleine oder winzige Rollen, Wurzen beziehungsweise Wimmelwurzen, denen musste man wirklich nicht unbedingt toi, toi, toi wünschen, von denen hing der Erfolg des Stückes nun wahrlich nicht ab. Fortinbras zum Beispiel spazierte wie ein Gockel durchs Theater und fühlte sich wie der Herr Staatsschauspieler persönlich. Dabei war, wenn er auftrat, schon alles vorbei. Da konnte er stottern, sich in die Hose scheißen oder einen Herzinfarkt bekommen, er konnte das Stück nicht mehr kaputt machen. Es war alles schon gesagt und gespielt. Aber trotzdem fühlte er sich wie Gottvater persönlich.
Jan war auf dem Weg zur Toilette, als er Helmut, der den Fortinbras spielte, den Gang entlangstolzieren sah. Er wollte dem eitlen Geck einfach nicht toi, toi, toi wünschen. Sollte er sich doch zur Hölle scheren. Er war nicht wichtig.
Heute Abend ging es nur um einen: um Hamlet.
Und Hamlet war er: Jan Jespik.
9
Dorothea hatte schon vor Tagen einen Platz in der dritten Reihe reserviert, aber jetzt hatte sie noch von unterwegs im Theater angerufen und gefragt, ob es möglich wäre, statt einen auch zwei Plätze in der dritten Reihe zu bekommen.
Das ging leider nicht, aber in der fünften Reihe fanden sich noch zwei Plätze nebeneinander. Die Premiere war nicht ausverkauft.
Dorothea schlug das Herz vor Aufregung bis zum Hals. All die Zuschauer, die jetzt ihre Plätze suchten, in den engen Reihen übereinanderkletterten, miteinander flüsterten, ihre Handtaschen zwischen die Beine klemmten, in den Programmheften blätterten und immer wieder den Namen »Jan Jespik« lasen und sich sein Bild ansahen, das bestimmt schon fünf Jahre alt war; all die, die jetzt darauf warteten, dass endlich Ruhe einkehrte und der Vorhang aufging; all die hatten Geld bezahlt und ihre warme, gemütliche Couch zu Hause verlassen, um ihn zu sehen: ihren Sohn, Jan Jespik, der heute Abend den Hamlet gab. Die wahrscheinlich spektakulärste Rolle der Weltliteratur.
Und das hatte ihr Sohn geschafft.
Sie erinnerte sich daran, wie er im Kindergarten ein weißes Gänseblümchen gespielt hatte, das in ein rotes Gänseblümchen verliebt war. Es trotzte dem Regen, dem Sturm und dem Frost, es richtete sich tapfer wieder auf, als es ein Fuß niedertrat. Doch dann kamen Kinder und pflückten das rote Gänseblümchen, und der kleine Jan klappte zusammen und fiel um. Das weiße Gänseblümchen war vor Kummer gestorben.
Es gab drei Aufführungen. Dorothea sah sie alle und weinte jedes Mal.
Sie konnte es kaum glauben, was aus ihrem Jan geworden war, und Tränen der Rührung traten ihr in die Augen, bevor der Vorhang überhaupt hochging.
Dies war der Abend ihres Lebens.
Er hörte das Rascheln, das Wispern, das Tuscheln der Zuschauer. Die Geräusche, die das Herz höher schlagen ließen. Sprach mit niemandem mehr. Ging in der ersten Gasse auf und ab.
Dachte nur eins: Das Schwein hat meinen Vater erschlagen und sitzt jetzt auf dem Thron. Hat keinerlei Unrechtsbewusstsein. Macht großkotzige Ansagen. Fickt meine Mutter. Was für eine dumme Sau.
Dann nahm er den Vorhang vorsichtig einen Zentimeter zur Seite und blickte in den Zuschauerraum.
Und da sah er sie. Konnte es kaum glauben. Blickte immer wieder genauer hin. War sie es wirklich? Oder spielte seine Fantasie ihm jetzt einen Streich?
Er sah ganz genau hin. Konzentrierte sich. Versuchte, seinen Blick zu schärfen, indem er seine Augen öffnete und schloss. Nein, sie war es wirklich. Seine Mutter saß im Publikum!
Und sein Herz verkrampfte sich.
In der Gasse ging er auf und ab wie ein wild gewordenes Tier. Der Schweiß brach ihm aus vor Wut. Das Schwein hat meinen Vater erschlagen. Fickt meine Mutter. Er fühlte den Hass. Abgrundtiefen Hass. Konnte kaum noch an sich halten, wäre am liebsten auf die Bühne gestürmt, aber schaffte es, den ersten Aufzug bis zu seinem Auftritt zu überstehen. Und auf der Bühne kontrollierte er sich, wusste, dass die Zuschauer seine Wut und seinen Zorn spürten. Sahen, dass er kurz vor der Explosion stand.
Und dann hörte er auf zu denken. Spielte.
Hamlet erwachte zum Leben. War nicht mehr zu zügeln.
Jan vergaß die Welt um sich herum, ging nach der Szene ab und wusste nicht mehr, dass es die Gasse das Theaters war, fieberte seinem nächsten Auftritt entgegen, dachte nicht mehr an Zeit und Applaus oder gar an den Text. Er durchlitt Hamlets Qualen, schwitzte, hyperventilierte, liebte und hasste, als ginge es um seine Ehre, sein Königreich, sein Leben.
Im zweiten Aufzug glaubte er von sich selbst zu sprechen, als er sagte: »Ich habe seit Kurzem – ich weiß nicht, wodurch – all meine Munterkeit eingebüßt, es steht in der Tat so übel um meine Gemütslage, dass die Erde, dieser treffliche Bau, mir nur als ein kahles Vorgebirge scheint; die Luft, dieser herrliche Baldachin, kommt mir doch nicht anders vor als ein fauler, verpesteter Haufen von Dünsten … Ich habe keine Lust am Manne – und am Weibe auch nicht.«
Rosenkranz stand dumm grinsend da. Er war dazu von der Regie verdonnert, aber Hamlet tickte aus und schrie: »Weswegen lachet Ihr denn?«
Und als er auch Güldenstern grinsen sah, war es zu viel.
In der Probe hatte Jan immer den schweren Stuhl mit den gedrechselten Beinen aus dem Thronsaal gepackt, hochgehoben und mit beiden Händen von sich geschleudert. Es war jedes Mal ein besonderer Kraftakt gewesen, und er hatte es nicht jeden Tag geschafft.
Aber jetzt trugen ihn die Emotionen, die unbändige Wut, und er nahm den Stuhl, hob ihn mit Leichtigkeit hoch und schleuderte ihn mit Kraft gegen Güldensterns Brust.
Güldenstern ging zu Boden und blieb nach Atem ringend liegen.
»Weswegen lachet Ihr denn, als ich sagte, ich habe keine Lust am Manne und am Weibe auch nicht?«, schrie Hamlet.
Niemand antwortete.
Im Theater war es gespenstisch still.
Güldenstern röchelte.
Hamlet riss den rechten Arm hoch und rief: »Ich bin nur toll bei Nordnordwest. Wenn der Wind südlich ist, kann ich einen Kirchturm von einem Leuchtenpfahl unterscheiden.«
Damit ging er ab.
Der Vorhang fiel.
Die Pause wurde vorgezogen, und der Notarzt kam.
Jan saß in seiner Garderobe. Es war still. Niemand zeigte sich. Seine Garderobentür öffnete sich kein einziges Mal.
Es war ihm recht.
Nach einer Viertelstunde war Güldenstern so weit fit, dass er wieder spielen konnte.
Die Vorstellung ging weiter. Von den Zuschauern hatte kaum einer etwas von dem Desaster mitbekommen.
10
Mona hatte so gehofft, dass sie in der Pause vielleicht einen kleinen Prosecco trinken würden. Endlich mal wieder Alkohol nach so vielen Jahren … Aber Dorothea saß wie festgeschraubt auf ihrem Sitz und machte keine Anstalten, den Saal zu verlassen und zur Theke ins Foyer zu gehen.
Die Tränen liefen ihr über die Wangen.
Mona nahm ihre Hand.
»Es ist alles gut«, sagte sie. Mehr fiel ihr nicht ein. »Wollen wir etwas trinken gehen?«, fragte sie dennoch.
Dorothea schüttelte den Kopf, und Mona gab auf. Dann eben nicht. Schade.
»Ist er nicht großartig?«, hauchte Dorothea. »Ich kann nicht glauben, dass das mein Sohn ist!«
»Er ist wirklich großartig!«, sagte Mona leise. »Aber noch viel mehr als das. Er ist wahnsinnig!«
Und es kribbelte zwischen ihren Beinen, wenn sie ihn in Gedanken vor sich sah.
11
Gut anderthalb Stunden später starb Hamlet in der Tragödie mit den Worten: »Der Rest ist Schweigen.«
Dass sich nun noch Fortinbras mit wenigen Worten als zukünftiger König präsentieren musste, nahm Jan Jespik Shakespeare übel. Das zeugte nicht von dramaturgischem Feingefühl, der Schluss war versiebt. Denn nur Hamlets Tod war es wert, am Ende eines großen Dramas, einer großen Tragödie, zu stehen.
Shakespeare kleckerte noch Fortinbras und seine Königswünsche hinterher, das war erbärmlich.