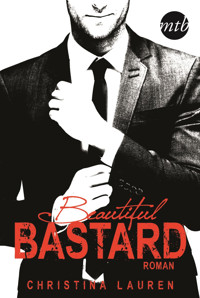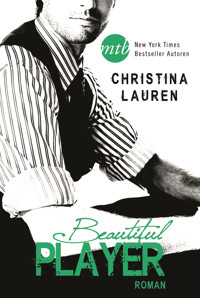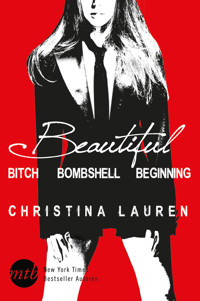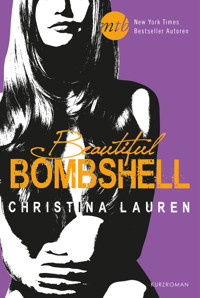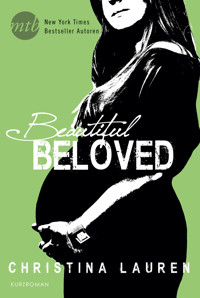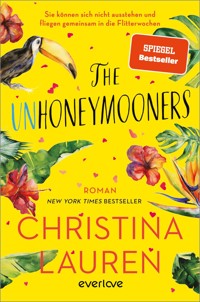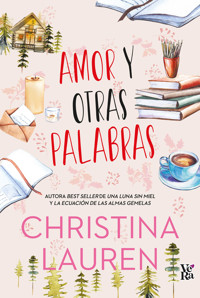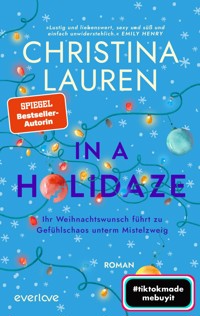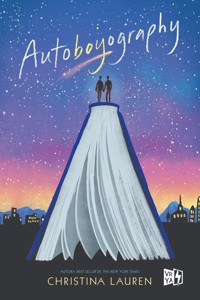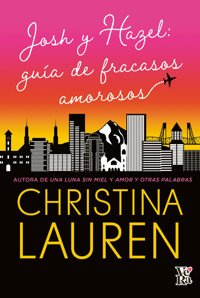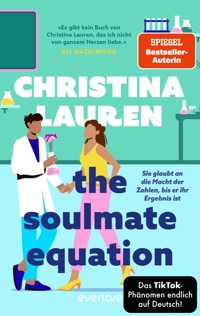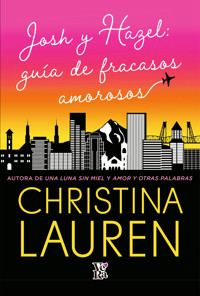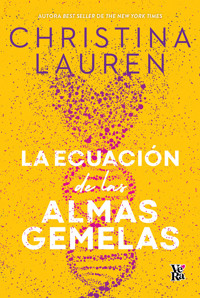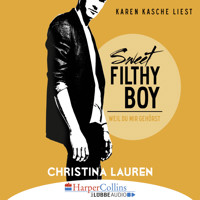9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weil Liebe unvorhersehbar ist ... Mit Mitte Zwanzig ist Holland nicht gerade auf dem Höhepunkt ihres Lebens. Sie verkauft T-Shirts im Broadway-Theater ihres Onkels und auf dem Weg zur Arbeit lauscht sie gern einem talentierten Straßenmusiker. Als dieser ihr eines Abends das Leben rettet, stellt sie ihn ihrem Onkel vor, der ihm prompt eine Stelle anbietet. Doch Calvins Studentenvisum ist abgelaufen, er ist illegal in den USA. Um seinen Traum einer Musikkarriere zu verwirklichen, schlägt Holland vor, ihn zu heiraten – sie hat ihn sowieso schon seit Monaten angehimmelt. Doch nachdem sie sich das Ja-Wort gegeben haben und Calvin bei ihr einzieht, wird klar: Die Anziehung zwischen ihnen ist mehr Sein als Schein … Dieses Buch erschien bereits 2019 unter dem Titel »Weil es Liebe ist« bei Forever.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Weil es Liebe ist
Die Autorin
Christina Lauren ist das Pseudonym der langjährigen Schreibpartnerinnen, besten Freundinnen, Seelenverwandten und Schwestern im Geiste Christina Hobbs und Lauren Billings. Sie sind die New-York-Times-, USA-Today- und internationale Bestseller-Autorinnen der Beautiful-Reihe, der Wild Seasons-Reihe, Dating you, hating you und Nichts als Liebe.
Das Buch
Weil Liebe unvorhersehbar ist...
Holland Bakker ist Mitte Zwanzig und jobbt eher erfolglos als T-Shirtverkäuferin. Ihr Highlight auf dem Weg zur Arbeit: der genauso attraktive wie talentierte Straßenmusiker Calvin, für den Holland täglich einen Umweg von „nur“ drei Blocks macht. Dass sie aber bald eine Wohnung und ihr Leben mit Calvin teilen würde, hatte sich Holland selbst in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Doch der Grund dafür ist eher unromantisch, zumindest am Anfang …
Christina Lauren
Weil es Liebe ist
Roman
Aus dem Amerikanischen von Sybille Uplegger
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinMärz 2019 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019German Translation copyright © 2019 by Ullstein Buchverlage GmbHOriginal English language edition copyright © 2017 by Christina Hobbs and Lauren BillingsAll rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition publishedby arrangement with the original publisher, Gallery Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.Titel der amerikanischen Originalausgabe: Roomies Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Übersetzung: Sybille UpleggerAutorenfoto: © Alyssa MichelleE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95818-350-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Danksagung
Leseprobe: Winston Brothers
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Eins
Eins
Der Familienlegende nach wurde ich im Fußraum eines Taxis geboren.
Ich bin das jüngste von insgesamt sechs Geschwistern. Angeblich sagte Mom: »Ich spüre da so ein leichtes Ziehen, aber lasst mich noch schnell das Mittagessen fertig machen«, und keine vierzig Minuten später hieß es: »Willkommen im Leben, Holland Lina Bakker.«
Das ist immer das Erste, woran ich denken muss, wenn ich in ein Taxi steige. Mir fällt auf, wie mühsam es ist, über das klebrige Polster zu rutschen; ich registriere die zahllosen Fingerabdrücke und mysteriösen Flecken auf den Fensterscheiben und der Plexiglastrennwand zwischen Vorder- und Rücksitz; und ich stelle fest, dass der Fußraum eines Taxis ein ziemlich schauriger Ort ist, um das Licht der Welt zu erblicken.
Schwungvoll ziehe ich die Tür hinter mir zu, damit der pfeifende Wind von Brooklyn draußen bleibt. »Zum U-Bahnhof Fiftieth Street in Manhattan, bitte.«
Der Fahrer sucht im Rückspiegel meinen Blick. Ich weiß genau, was er jetzt denkt: Sie fahren mit dem Taxi nach Manhattan zur U-Bahn? Gutes Fräulein, warum nehmen Sie nicht einfach die C-Linie für die komplette Strecke? Das würde Sie gerade mal drei Dollar kosten.
»Ecke Eighth Avenue und Forty-Ninth Street«, setze ich hinzu und ignoriere das aufsteigende Gefühl der Scham. Mein Verhalten ist lächerlich. Statt mit dem Taxi von Park Slope nach Hause zu fahren, lasse ich mich zu einem U-Bahnhof kutschieren, der etwa zwei Blocks von meiner Wohnung in Hell’s Kitchen entfernt liegt. Und nein, es liegt nicht daran, dass ich ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe und nicht möchte, dass der Taxifahrer meine Adresse erfährt.
Es hat einzig und allein damit zu tun, dass es dreiundzwanzig Uhr dreißig an einem Montagabend ist. Mit anderen Worten: Jack wird da sein.
Wenigstens meinen Berechnungen zufolge. Vor knapp einem halben Jahr hat er zum ersten Mal am Bahnhof Fiftieth Street gesessen und Gitarre gespielt. Seitdem habe ich ihn jeden Montagabend gesehen, außerdem mittwochs und donnerstags vormittags auf meinem Weg zur Arbeit sowie freitags während der Mittagspause. Dienstags ist er nie da, und am Wochenende habe ich ihn bisher auch noch nicht gesehen.
Die Montage sind meine Lieblingstage, weil er dann mit einer ganz besonderen Intensität spielt. Er beugt sich tief über seine Gitarre und wiegt sie in seinem Arm, als wolle er sie verführen. Es ist, als wäre die Musik das ganze Wochenende über in dem Instrument gefangen gewesen, und nun würde er sie endlich befreien. Das Einzige, was ihren Fluss unterbricht, ist das gelegentliche Klimpern des Kleingeldes, das Passanten in Jacks aufgeklappten Gitarrenkoffer werfen, oder das Donnern eines herannahenden Zuges.
Ich habe keine Ahnung, was er macht, wenn er gerade nicht am Bahnhof sitzt und spielt. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er nicht wirklich Jack heißt, aber irgendeinen Namen musste ich ihm geben. Erstens wollte ich ihn nicht dauerhaft »der Straßenmusiker« nennen, und zweitens lässt der Umstand, dass er einen Namen hat, meine Schwärmerei ein bisschen weniger bizarr erscheinen.
Oder so ähnlich.
Der Taxifahrer redet nicht; er hört nicht mal eine Radio-Talkshow oder eine dieser anderen Sendungen, an deren Geplärre man sich als New Yorker schnell gewöhnt. Ich reiße mich kurz von meinem Instagram-Feed voller Buchrezensionen und Make-up-Tutorials los und betrachte den ekligen Schneematsch draußen auf den Straßen. Mein Cocktail-Schwips scheint sich nicht so schnell zu verflüchtigen, wie ich gehofft habe. Als wir einige Zeit später am Straßenrand halten und ich bezahle, bin ich immer noch ganz kribbelig, so als hätte ich Sprudelwasser im Blut.
Bisher habe ich Jack noch nie in betrunkenem Zustand besucht. Das könnte eine hervorragende oder auch eine ganz blöde Idee sein. Wir werden es gleich erfahren.
Am Fuß der Treppe angelangt, sehe ich ihn, wie er gerade seine Gitarre stimmt. Ich bleibe in einiger Entfernung stehen und mustere ihn. Er hält den Kopf gesenkt, und im Licht der Straßenlaternen, das die Treppe hinunter bis in den Bahnhof fällt, wirken seine dunkelblonden Haare beinahe silbern.
Er ist, wie in unserer Generation so üblich, ziemlich nachlässig angezogen, wirkt aber ansonsten gepflegt, deshalb stelle ich mir vor, dass er irgendwo eine hübsche Wohnung sowie einen geregelten, gut bezahlten Job hat und aus reinem Spaß an der Freude hier sitzt. Er hat genau die Art Haare, die ich unwiderstehlich finde: an den Seiten kurz, oben auf dem Kopf wild und ungezähmt. Sie sehen so wunderbar weich aus und glänzen im Lichtschein, und man möchte einfach nur ganz fest in diese Haare hineingreifen und die Hände darin vergraben. Welche Augenfarbe er hat, weiß ich nicht, weil er beim Spielen nie hochschaut, aber in meiner Fantasie sind sie braun oder tiefgrün, in jedem Fall so dunkel, dass man darin versinken kann.
Ich habe ihn nie kommen oder gehen sehen, weil ich immer nur an ihm vorbeilaufe, einen Dollarschein in seinen Gitarrenkasten lege und dann weitergehe, um ihn – wie viele andere Wartende auch – von meinem Platz am Bahnsteig aus unauffällig zu beobachten. Seine Finger fliegen über den Hals der Gitarre. Seine linke Hand entlockt dem Instrument die Töne, als wäre Gitarrespielen für ihn so selbstverständlich wie Atmen.
So selbstverständlich wie Atmen. Für mich als angehende Schriftstellerin ist das ein furchtbares Klischee, aber es ist die einzige Beschreibung, die passt. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, dessen Finger sich so bewegen – ganz von selbst, ohne dass er auch nur einen Gedanken daran verschwenden muss. Fast ist es so, als würde er seiner Gitarre eine menschliche Stimme verleihen.
Er hebt den Kopf, gerade als ich einen Geldschein in seinen Gitarrenkoffer fallen lasse, blickt mich durch zusammengekniffene Augen an und sagt leise: »Danke schön.«
Das hat er noch nie gemacht – aufgeschaut, wenn jemand Geld in seinen Koffer wirft –, deshalb bin ich völlig überrumpelt, als unsere Blicke sich treffen.
Grün. Seine Augen sind grün. Und er schaut nicht sofort wieder weg. Er hält meinen Blick fest. Ich bin wie hypnotisiert.
Statt also mit »Ja« oder »Gern geschehen« zu antworten oder auch gar nichts zu sagen, wie es jeder anständige New Yorker tun würde, überkommt es mich. »Ichliebedeinemusiksowahnsinnig!«, stoße ich atemlos hervor, sodass es wie ein einziges Wort klingt.
Dafür ernte ich ein winziges Lächeln von ihm, das in meinem alkoholisierten Gehirn beinahe einen Kurzschluss auslöst. Er kaut einen Moment lang auf seiner Unterlippe, ehe er sagt: »Wirklich? Das ist echt nett von dir. Ich spiele auch wahnsinnig gern.«
Er hat einen starken irischen Akzent. Als ich ihn höre, beginnt es in meinen Fingern zu kribbeln.
»Wie heißt du?«
Drei unerträgliche Sekunden vergehen, bevor er mit einem leicht verblüfften Grinsen antwortet: »Calvin. Und du?«
Das hier ist eine Unterhaltung. Heilige Scheiße, ich unterhalte mich mit dem Fremden, in den ich seit Monaten verknallt bin.
»Holland«, antworte ich. »Wie die Provinz in den Niederlanden. Die meisten Leute denken ja, Holland und die Niederlande seien dasselbe, aber das stimmt nicht.«
Uff.
Heute Abend habe ich zwei Erkenntnisse über Gin gewonnen: Er schmeckt nach Kiefernzapfen, und er ist das reinste Teufelszeug.
Calvin lächelt zu mir auf und sagt verschmitzt: »Holland. Eine Provinz und eine Gelehrte«, ehe er halblaut etwas hinzufügt, das ich nicht verstehe. Ich kann nicht sagen, ob seine Augen so belustigt funkeln, weil ich er mich in meiner Trotteligkeit amüsant findet, oder weil hinter mir jemand steht, der gerade irgendwas Verrücktes macht. Da ich seit einem gefühlten Jahrtausend nicht mehr mit einem Mann ausgegangen bin, weiß ich nicht, wie ich das Gespräch am Laufen halten soll. Also suche ich mein Heil in der Flucht. Ich sprinte regelrecht die zehn Meter bis zum Bahnsteig. Kaum zum Stehen gekommen, beginne ich mit der wohlkalkulierten Geschäftigkeit einer Frau, die daran gewöhnt ist, so zu tun, als gäbe es etwas immens Wichtiges, das sie sofort und auf der Stelle finden muss, in meiner Handtasche zu wühlen.
Etwa dreißig Sekunden zu spät begreife ich, was er eben geflüstert hat: Zauberhaft.
Garantiert hat er damit bloß meinen Namen gemeint. Und das sage ich nicht aus falscher Bescheidenheit. Meine beste Freundin Lulu und ich sind zu der Einschätzung gekommen, dass wir in Manhattan attraktivitätsmäßig etwa im Mittelfeld liegen – was ziemlich gut ist, sobald wir die Stadtgrenzen verlassen. Aber Jack – ich meine, Calvin – ist jemand, der alle Blicke auf sich zieht, von Frauen wie von Männern, von reichen Pseudo-Hippies aus der Madison Avenue, die sich in der U-Bahn mal unters gemeine Volk mischen wollen, genauso wie von krawalligen Studenten aus Bay Ridge. Ich übertreibe nicht. Er hätte die freie Auswahl – wenn er sich denn jemals dazu bequemen würde, den Kopf zu heben und uns eines Blickes zu würdigen.
Wie um meine Theorie zu untermauern, offenbart ein rascher Blick in meinen Taschenspiegel, dass die Wimperntusche unter meinen Augen clownesk verlaufen ist und der Rest meines Gesichts geradezu gespenstisch bleich aussieht. Ich hebe die Hand und versuche die braunen Strähnen meiner verknoteten Haare, die sonst das Volumen eines platten Fahrradreifens haben, aber ausgerechnet heute mit ganzer Gewalt meinem Zopf entkommen wollen und mir in völliger Nichtbeachtung jeglicher Schwerkraftgesetze vom Kopf abstehen.
Zauberhaft bin ich in diesem Moment ganz sicher nicht.
Calvins Musik setzt wieder ein und erfüllt den stillen Bahnhof. Sie klingt so tief und sehnsuchtsvoll, dass ich mich noch betrunkener fühle als ohnehin schon. Wieso bin ich heute Nacht hergekommen? Wieso habe ich ihn angesprochen? Jetzt muss mein armer Kopf all diese Informationen verarbeiten – zum Beispiel, dass sein wahrer Name nicht Jack lautet und dass seine Augen auf einmal eine reale Farbe haben. Das Wissen, dass er Ire ist, macht mich dermaßen wuschig, dass ich ihm am liebsten auf den Schoß klettern möchte.
Mann. Verknalltsein ist echt das Schlimmste. Aber im Nachhinein ist es besser, mit Sicherheitsabstand verknallt zu sein, als das hier. Ich hätte mich darauf beschränken sollen, mir weiterhin Fantasiegeschichten über ihn auszudenken und ihn verstohlen anzuschmachten wie ein ganz normaler Stalker. Jetzt habe ich ihn angesprochen, und wenn er so aufmerksam ist, wie seine Augen vermuten lassen, dann wird er wahrscheinlich das nächste Mal aufschauen, wenn ich ihm Geld gebe. Und dann muss ich entweder kluge Dinge sagen oder das Weite suchen. Und durchschnittliches Attraktivitätsniveau hin oder her: Sobald ich Männern gegenüber den Mund aufmache, geht es bergab. Lulu nennt mich manchmal Trolland, weil ich dann so schrecklich unattraktiv wirke. Wie man sieht, hat sie nicht ganz unrecht.
Ich schwitze in meinem rosafarbenen Wollmantel, mein Make-up löst sich in Wohlgefallen auf, und ich verspüre das dringende Bedürfnis, mir die Strumpfhose bis unter die Achseln hochzuziehen, weil sie unter meinem Rock eine unaufhaltsame Reise gen Süden angetreten hat und es sich langsam so anfühlt, als trüge ich figurbetonte Haremshosen.
Warum mache ich es nicht einfach? Bis auf Calvin und den Mann, der auf einer Bank in der Nähe schläft, ist niemand da, und Calvin hat sich wieder ganz in seine Musik vertieft.
Doch im nächsten Moment erhebt sich, einem Zombie gleich, der Schlafende von seiner Bank und macht einen torkelnden Schritt in meine Richtung. Verlassene U-Bahnhöfe sind unheimlich, ein ideales Revier für Grabscher, Freaks und Exhibitionisten. Es ist nicht sehr spät – noch nicht einmal Mitternacht –, aber ich bin ganz allein. Offenbar habe ich gerade eine Bahn verpasst.
Ich gehe ein Stück den Bahnsteig entlang nach links und zücke mein Smartphone, um einen beschäftigten Eindruck zu machen. Tja, ich hätte wissen müssen, dass sich Betrunkene und hartnäckige Männer nicht von einem iPhone abschrecken lassen, und wenn noch so emsig darauf herumgetippt wird. Der Zombie kommt näher.
Ich weiß nicht, ob es an dem kleinen Stich der Angst liegt, den ich in der Brust spüre, oder ob gerade ein Windstoß durch den Bahnhof fegt, aber auf einmal habe ich den ekelerregend salzigen Geruch von Rotz in der Nase. Dazu gesellt sich das faulig-saure Aroma verschütteter Limo, die seit Monaten am Boden eines Abfalleimers vor sich hin sifft.
Der Typ hebt eine Hand und zeigt auf mich. »Du hast mein Handy.«
Ich wende mich ab und gehe in einem großen Bogen um ihn herum zurück in Richtung Treppe und Calvin. Mein Daumen schwebt über Roberts Telefonnummer.
Der Typ kommt mir nach. »Du da. Bleib stehen. Du hast mein Handy!«
»Lassen Sie mich in Ruhe«, sage ich so ruhig wie möglich und ohne aufzusehen. Dann tippe ich auf Roberts Nummer und hebe das Handy ans Ohr. Es tutet hohl im Abstand von jeweils fünf meiner pochenden Herzschläge.
Calvins Musik schwillt an, klingt nun beinahe aggressiv. Sieht er denn nicht, dass mich ein fremder Mann bedrängt? In diesem Moment kommt mir der völlig abstruse Gedanke, dass es bewundernswert ist, wie er komplett in seiner Musik aufgeht, wenn er spielt.
Der Mann hält weiterhin auf mich zu. Untermalt vom Soundtrack aus Calvins Gitarrenklängen, jagt er mich schlurfend und schwankend quer über den Bahnsteig. Wegen meiner heruntergerutschten Strumpfhose bewege ich mich weder besonders schnell noch besonders elegant. Der Mann hingegen gewinnt immer mehr an Geschwindigkeit, und seine Bewegungen scheinen mit jedem Schritt flüssiger zu werden.
Aus dem Telefon höre ich Roberts blecherne Stimme: »Hey, Butterblume.«
»Scheiße, Robert, ich bin hier gerade am –«
Der Mann greift nach mir, kriegt den Ärmel meines Mantels zu fassen und reißt mir das Handy vom Ohr.
»Robert!«
»Holls?«, ruft Robert durch die Leitung. »Schätzchen, wo bist du?«
Ich strauchle und versuche verzweifelt, mich irgendwo festzuhalten, denn ich habe das sehr, sehr beunruhigende Gefühl, jeden Moment das Gleichgewicht zu verlieren. Die Angst jagt einen kalten Schauer, der mich mit einem Schlag nüchtern werden lässt, über meine Haut: Dieser Kerl will mir nicht dabei helfen, aufrecht stehen zu bleiben – er schubst mich.
In der Ferne höre ich eine tiefe Stimme »Hey!« rufen.
Mein Handy schlittert über den Betonboden. »Holland?«
Es geht alles wahnsinnig schnell – aber wahrscheinlich ist das immer so. Wenn es langsam gehen würde, hätte ich ja die Möglichkeit, etwas zu tun – irgendetwas. Aber nein: In einer Sekunde stehe ich noch auf der genoppten gelben Warnlinie, in der nächsten stürze ich schon auf die Gleise.
Zwei
Ich habe noch nie in einem Krankenwagen gelegen, und im Beisein zweier von Berufs wegen stocknüchterner Menschen mit einem lauten Grunzen aus der Bewusstlosigkeit hochzuschrecken ist genauso demütigend, wie man es sich vorstellt. Eine Sanitäterin mit strenger Miene und Permanent-Falte auf der Stirn blickt auf mich herab. Monitore piepsen. Als ich meinen Kopf bewege, fühlt es sich an, als würde gerade der Countdown zum Selbstzerstörungsmodus angezählt werden. Mein Arm schmerzt. Nein, er schmerzt nicht, er tut höllisch weh. Ich stelle fest, dass er in einer Schlinge steckt. Als ich das ferne Rumpeln der U-Bahn höre, fällt mir wieder ein, dass mich jemand auf die Schienen gestoßen hat.
Jemand hat mich auf die Schienen der U-Bahn gestoßen!
Mein Herz macht eine Art Kung-Fu-Bewegung in meiner Brust, und sein panischer Rhythmus wird vom Piepsen diverser Apparate um mich herum aufgenommen. Ich rapple mich auf, kämpfe die monumentale Woge der Übelkeit nieder, die in mir hochzusteigen droht, und krächze: »Haben Sie den Kerl erwischt?«
»Immer mit der Ruhe.« Mit besorgter Miene drückt mich die Sanitäterin – auf ihrem Namensschild steht »Rossi« – sanft zurück auf die Trage. »Es ist alles in Ordnung.« Sie nickt ermutigend. »Es geht Ihnen gut.«
Dann überreicht sie mir eine Visitenkarte.
Landesweite Hotline für Suizid-Prävention
1–800–273–8 255
Ich drehe die Karte um. Wer weiß, vielleicht steht ja auf der Rückseite:
Rufen Sie an, wenn ein Besoffener Sie auf die Gleise geschubst hat.
Leider werde ich enttäuscht.
Ich sehe zu der Sanitäterin auf. Vor Empörung steigt mir die Hitze in die Wangen.
»Ich bin nicht gesprungen.«
Rossi nickt. »Schon gut, Ms Bakker.« Sie missversteht meinen verdatterten Gesichtsausdruck und fügt hinzu: »Wir kennen Ihren Namen, weil wir Ihre Handtasche auf dem Bahnsteig gefunden haben.«
»Er hat meine Handtasche nicht mitgenommen?«
Weil die Frau daraufhin ihre Lippen zu einem dünnen Strich zusammenpresst, sehe ich mich nach Unterstützung um. Ihr Kollege, ein kerniger Typ wie aus einem Sanitäter-des-Monats-Kalender, steht draußen vor den Türen des Krankenwagens und notiert gerade sorgfältig etwas. Sein Namensschild weist ihn als »Gonzales« aus. Ein Stück weiter weg parkt ein Streifenwagen am Straßenrand, und zwei Polizisten unterhalten sich angeregt neben der geöffneten Fahrertür. Ich kann mir nicht helfen: Irgendwie scheint mir das hier nicht die beste Art und Weise zu sein, mit einer potenziellen Suizidlage umzugehen. Ich habe beim Aufwachen quasi geschnaubt wie ein Nashorn, mein Rock ist komisch hoch bis zu meinen Hüften gerutscht, der Schritt meiner Strumpfhose hängt südlich des Äquators, und die Knöpfe meines Shirts sind offen, um Platz für die angeklebten Sensoren des Herzmonitors zu machen. Ein selbstmordgefährdetes Individuum könnte in einer solchen Situation einen Hauch von Erniedrigung empfinden.
»Ich bin nicht gesprungen«, wiederhole ich, während ich versuche, einigermaßen elegant meinen Rock wieder nach unten zu schieben.
Gonzales blickt von seinen Unterlagen auf und lehnt sich gegen die Tür des Krankenwagens. »Wir haben Sie auf den Gleisen gefunden, meine Liebe.«
Ich kneife die Augen zu und knurre, wütend über seine herablassende Art. Das ergibt doch alles hinten und vorne keinen Sinn. »Zwei Sanitäter gehen rein zufällig auf dem Bahnsteig spazieren, kurz nachdem ich auf die Schienen gefallen bin?«
Er schenkt mir ein winziges Lächeln. »Anonymer Notruf. Der Mann sagte, es läge jemand auf den Gleisen. In neun von zehn Fällen ist so was ein Selbstmordversuch.«
Anonymer Notruf.
CALVIN.
In dem Moment nehme ich eine Bewegung am Straßenrand jenseits des Krankenwagens wahr.
Es ist dunkel draußen, aber er ist es, kein Zweifel. Ach du Scheiße. Er steht gerade vom Bordstein auf und sieht in meine Richtung. Unsere Blicke kreuzen sich einen Sekundenbruchteil lang, ehe er erschrickt und sich hastig abwendet. Ohne noch einen weiteren Blick zurückzuwerfen, macht er sich davon und verschwindet die Eighth Avenue entlang.
»He!« Ich zeige in seine Richtung. »Warten Sie mal. Mit dem da müssen Sie reden.«
Gonzales und Rossi drehen sich langsam um. Rossi macht keine Anstalten aufzustehen. Ich fuchtele aufgeregt mit dem Finger. »Der Typ da hinten.«
»Hat er Sie gestoßen?«, fragt Gonzales.
»Nein, aber ich glaube, das ist der, der den Notruf gewählt hat.«
Rossi schüttelt den Kopf und verzieht, eher mitleidig als anteilnehmend, das Gesicht. »Der Mann kam erst dazu, als wir schon vor Ort waren. Er hat gesagt, er weiß von nichts.«
»Dann hat er gelogen.« Wieder versuche ich mich aufzusetzen. »Calvin!«
Er bleibt nicht stehen. Im Gegenteil, er beschleunigt seine Schritte und duckt sich hinter ein Taxi, ehe er im Laufschritt die Straße überquert.
»Er war doch dabei«, sage ich konfus. Gott, wie viel habe ich eigentlich getrunken? »Auf dem Bahnsteig waren ich, dieser Straßenmusiker – Calvin – und ein Betrunkener. Der Betrunkene wollte mir mein Telefon aus der Hand reißen, und dann hat er mich auf die Gleise geschubst.«
Gonzales legt den Kopf schief und deutet auf die beiden Polizisten. »Wenn das so ist, sollten Sie wohl Anzeige erstatten.«
Ich kann mir eine patzige Antwort nicht verkneifen. »Ach, finden Sie wirklich?«
Wieder der Anflug eines Lächelns – zweifellos weil eine heruntergerutschte Strumpfhose und eine klaffende Bluse mit rosa Punkten nicht gerade die ideale Ausgangslage für Sarkasmus sind.
»Holland, bei Ihnen besteht der Verdacht auf eine Fraktur des Unterarms.« Gonzales steigt zu uns in den Krankenwagen und richtet einen Gurt an meiner Schlinge. »Möglicherweise haben Sie auch eine Gehirnerschütterung. Das Wichtigste ist jetzt erst mal, dass wir sie ins Krankenhaus bringen. Das nächstgelegene ist Mount Sinai West. Gibt es jemanden, der Sie dort treffen könnte?«
»Ja.« Ich muss unbedingt meine beiden Onkel Robert und Jeff anrufen. Ich schaue zu Gonzales hoch und erinnere mich daran, wie ich in einem Augenblick noch mein Telefon in der Hand hatte und im nächsten auf die Schienen gestoßen wurde.
»Haben Sie zufällig mein Handy gefunden?«
Gonzales verzieht das Gesicht und schielt zu seiner Kollegin hinüber, die mir zum ersten Mal ein entschuldigendes Lächeln schenkt. »Ich hoffe, Sie wissen die Nummer auswendig.« Sie hält einen durchsichtigen Plastikbeutel hoch, der die kläglichen Überreste meines heiß geliebten Handys enthält.
Sobald mein Kopf untersucht und mein rechter Arm eingegipst sind (keine Gehirnerschütterung; Fraktur der Elle), erstatte ich vom Krankenbett aus Anzeige gegen unbekannt. Erst im Gespräch mit den zwei extrem Respekt einflößenden Polizisten wird mir bewusst, dass ich zu dem Mann, der mich auf dem Bahnsteig angegriffen hat, kein einziges Mal Blickkontakt aufgenommen habe. Ich kann also sein Gesicht kaum beschreiben – ganz im Gegensatz zu seinem Geruch.
Die beiden Uniformierten wechseln einen Blick, ehe mich der Größere von beiden fragt: »Der Kerl war Ihnen nahe genug, um Sie am Mantel zu packen, Sie zu beschimpfen und auf die Gleise zu stoßen, und Sie haben sein Gesicht nicht gesehen?«
Am liebsten würde ich zurückbrüllen: Offenbar waren Sie noch nie eine Frau, die vor einem Freak wegläuft! Stattdessen lasse ich sie einfach weiterreden. Die Tatsache, dass ich meinen Angreifer nicht beschreiben kann, schwächt die Glaubwürdigkeit meiner Behauptung, keine Selbstmörderin zu sein, erheblich, das lese ich in ihren Mienen. Angesichts der bereits durchlebten Peinlichkeiten beschließe ich, dass es nur noch seltsamer wirken würde, wenn ich ihnen offenbare, dass ich den Namen des Straßenmusikers kenne und dieser trotzdem nicht dageblieben ist, um mir zu helfen. Also lasse ich Calvin unerwähnt, und die beiden notieren sich meine vagen Angaben zum Tathergang mit einem Minimum an Diensteifer.
Nachdem sie weg sind, lasse ich mich in die Kissen sinken und starre an die kahle graue Zimmerdecke. Was für eine irre Nacht. Ich hebe meinen gesunden Arm und schaue durch zusammengekniffene Augen auf meine Uhr.
Falsch: Was für ein irrer Morgen.
Heilige Scheiße, es ist schon kurz vor drei. Wie lange hat das Ganze gedauert? Durch das dumpfe Pochen in meinem Schädel, gegen das auch die Schmerzmittel nicht ankommen, sehe ich immer wieder, wie Calvin vom Bordstein aufsteht und geht. Es bedeutet doch etwas, dass er gewartet hat, bis ich wieder zu mir kam, oder? Aber wenn er tatsächlich der anonyme Anrufer war – und davon gehe ich aus, denn wir wissen ja alle, dass der Zombie kein Telefon dabeihatte –, warum hat er der Polizei dann nicht gesagt, dass jemand mich geschubst hat? Wieso hat er geleugnet, Zeuge des Vorfalls gewesen zu sein?
Draußen im Gang höre ich das Knallen lederner Absätze auf Linoleum. Ich setze mich auf. Ich weiß, was gleich kommt.
Robert stürzt durch den Vorhang, gefolgt von Jeff, der sich dabei deutlich eleganter anstellt.
»Was. Zur. Hööööölle.« Robert dehnt das letzte Wort zu ungefähr siebzehn Silben, nimmt mein Gesicht in beide Hände und mustert mich aufmerksam. »Ist dir eigentlich bewusst, was für Sorgen ich mir gemacht habe?«
»Sorry.« Ich schneide eine Grimasse und spüre, wie mein Kinn anfängt zu beben. Zum ersten Mal in dieser Nacht. »Mein Handy wurde mir aus der Hand geschlagen.«
Als ich die Angst in den Gesichtern der beiden sehe, setzt auch bei mir der Schock ein, und ich beginne am ganzen Leib zu zittern. Gefühle steigen in mir hoch und brechen sich in Form einer salzigen Flutwelle Bahn.
Robert beugt sich zu mir herab und gibt mir einen Kuss auf die Wange. Auch Jeff tritt näher und legt mir sanft eine Hand aufs Knie.
Obwohl wir nicht blutsverwandt sind, kenne ich Onkel Robert schon mein ganzes Leben. Er und Jeff, der jüngere Bruder meiner Mutter, sind sich mehrere Jahre vor meiner Geburt begegnet.
Onkel Jeff ist der Zurückhaltendere der beiden. Man merkt eben, dass er aus dem Mittleren Westen kommt. Er ist besonnen und rational und arbeitet, wie Sie vielleicht schon erraten haben, im Finanzwesen. Robert dagegen ist von Kopf bis Fuß Bewegung und Musik. Er wurde in Ghana geboren und ist mit achtzehn in die USA gekommen, um am Curtis Institute of Music in Philadelphia zu studieren. Jeff hat mir erzählt, dass Robert nach dem Studium zehn verschiedene Stellenangebote hatte, sich aber für den Posten des Konzertmeisters der Des Moines Symphony entschied – der jüngste Konzertmeister, den das Orchester je gehabt hatte. Denn während er zum Vorstellungsgespräch in der Stadt gewesen war, hatte er Jeff kennengelernt, und die beiden hatten sich auf den ersten Blick unsterblich ineinander verliebt.
Als ich sechzehn war, zogen meine Onkel von Des Moines nach Manhattan um. Zu dem Zeitpunkt war Robert Chefdirigent der Des Moines Symphony, und diesen Posten aufzugeben und als musikalischer Leiter eines Off-Broadway-Theaters ganz neu anzufangen, bedeutete – auch finanziell – einen beruflichen Abstieg. Doch Roberts Herz schlägt nun mal für das Musiktheater, und noch wichtiger war für die beiden vielleicht die Überlegung, dass zwei Männer es als Ehepaar in New York um einiges leichter haben als in Iowa. In New York fühlten sich die beiden sofort heimisch, und vor zwei Jahren hat sich Robert schließlich hingesetzt und It Possessed Him komponiert – ein Musical, das schnell zur populärsten Produktion am Broadway aufstieg.
Weil ich nicht dauerhaft von ihnen getrennt sein wollte, zog ich irgendwann hinterher und schloss an der Columbia University meinen Master in Kreativem Schreiben ab. Seitdem hänge ich irgendwie in der Luft. Als angehende junge Autorin in New York kam ich mir vor wie ein mittelprächtiger Guppy in einem riesengroßen Schwarm voller schillernder Fische: Ohne den Hauch einer Idee für den nächsten großen amerikanischen Roman oder eine Begabung für Journalismus war ich auf dem Arbeitsmarkt praktisch nicht vermittelbar.
Irgendwann hat Robert, mein Retter in der Not, mir einen Job in seinem Theater besorgt. Meine offizielle Stellenbeschreibung lautet »Bühnenfotografin« – zugegeben eine etwas seltsame Arbeit für eine Fünfundzwanzigjährige mit null Erfahrung am Broadway. In Anbetracht der Tatsache, dass es bereits eine Million Fotos von der Produktion gibt, bin ich mir schmerzhaft bewusst, dass mein Job einzig und allein als Gefälligkeit für meinen Onkel geschaffen wurde. Ein- oder zweimal die Woche mache ich die Runde und knipse wahllos Bilder von Kulissen, Kostümen und dem Treiben hinter der Bühne, damit die Presseagentur genügend Bildmaterial für die sozialen Netzwerke hat. Vier Abende die Woche arbeite ich darüber hinaus am Einlass und verkaufe It Possessed Him-T-Shirts.
Leider kann ich mir nicht vorstellen, wie ich einarmig den Zuschauerandrang beim Ticketabreißen bewältigen oder meine riesige Kamera halten soll. Das löst weitere Schuldgefühle in mir aus.
Ich bin wirklich zu nichts zu gebrauchen.
Ich ziehe eins der Kissen unter meinem Kopf hervor und schreie ein paarmal hinein.
»Was ist denn los, Butterblume?« Robert nimmt mir das Kissen weg. »Brauchst du mehr Schmerzmittel?«
»Ich brauche ein Ziel im Leben.«
Er tut meine Klage mit einem Lachen ab, bückt sich und gibt mir noch einen Kuss auf die Stirn. Jeff greift in stiller Anteilnahme sanft nach meiner Hand. Jeff – der herzensgute, sensible Zahlenakrobat Jeff – hat im letzten Jahr seine Leidenschaft fürs Töpfern entdeckt. Er hat jetzt wenigstens die Keramik, die ihm seine tristen Arbeitstage an der Wall Street versüßt. Ich habe nur meine Liebe zu Büchern, die von anderen Leuten geschrieben wurden, und an ein paar Tagen in der Woche die Vorfreude auf meine Begegnungen mit Calvin am U-Bahnhof Fiftieth Street.
Wobei ich nach der Nummer heute Nacht nicht weiß, ob meine Gefühle für ihn vielleicht erloschen sind. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich wohl nicht mehr geneigt sein, vor Sehnsucht dahinzuschmelzen. Wahrscheinlich werde ich ihn eher fragen, wieso er untätig herumgesessen hat, während mich ein Kerl vor den Zug stößt. Jedenfalls vor einen hypothetischen Zug.
Vielleicht gehe ich auch, während mein Bruch verheilt, zurück nach Des Moines und nehme mir eine Auszeit, um darüber nachzudenken, was ich mit meinem Studienabschluss anfangen will. Bei den freien Künsten gilt in der Regel folgende Gleichung: ein nutzloses Studium plus noch ein nutzloses Studium gleich null Jobchancen.
Ich blicke zu meinen Onkeln auf. »Habt ihr Mom und Dad angerufen?«
Jeff nickt. »Sie wollten wissen, ob sie herkommen sollen.«
Trotz meiner düsteren Stimmung muss ich lachen. Bestimmt hat Jeff ihnen gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, noch bevor er über das Ausmaß meiner Verletzungen Bescheid wusste.
Meinen Eltern ist das Gewimmel von New York dermaßen verhasst, dass es für alle Beteiligten besser wäre, wenn sie in Iowa blieben, selbst wenn ich in zwei Hälften zerbrochen im Streckverband läge. Auf alle Fälle würde es mir eine Menge Stress ersparen.
Jeff setzt sich neben mich aufs Bett und schaut zu Robert hoch. Mir fällt auf, dass er sich mit der Zunge über die Lippen fährt. Das macht er immer, wenn er im Begriff ist, eine schwierige Frage zu stellen. Ich frage mich, ob ihm das bewusst ist. »Also, was ist denn nun genau passiert, Hollsy?«
»Du meinst, wie ich auf den Schienen der C-Linie gelandet bin?«
Robert sieht mich wissend an. »Genau. Da ich mir ziemlich sicher bin, dass der kleine Vortrag über den Umgang mit Selbstmordgefährdeten, den wir uns draußen im Wartebereich anhören mussten, überflüssig war, kannst du uns vielleicht erzählen, wie es zu dem Unfall gekommen ist.«
»So ein Typ ist auf mich losgegangen. Er wollte mir mein Handy wegnehmen, und als ich zu nah an die Bahnsteigkante gekommen bin, hat er mich aufs Gleis gestoßen.«
Robert fällt die Kinnlade herunter. »Das war es, was ich gehört habe, als du angerufen hast?«
Jeff steigt die Röte ins Gesicht. »Hast du eine –«
»Anzeige aufgegeben? Ja«, teile ich ihm mit. »Aber er hatte eine Kapuzenjacke an, und du weißt ja, dass es Verrückte nur ermutigt, wenn man Blickkontakt zu ihnen aufnimmt, also konnte ich der Polizei nicht viel mehr sagen, als dass es ein Weißer war, wahrscheinlich Mitte dreißig, bärtig und besoffen.«
Jeff lacht trocken. »Klingt wie ein ganz normaler Freitagabend in Brooklyn.«
Ich richte meinen Blick auf Robert. »Die Bahn war gerade abgefahren, deshalb gab es keine weiteren Augenzeugen.«
»Nicht mal Jack?« Beide Onkel wissen von meiner U-Bahn-Schwärmerei.
Ich schüttle den Kopf. »Er heißt Calvin.« In Antwort auf die Frage, die sich zweifellos gerade in ihren Köpfen formt, sage ich: »Ich hatte zwei Cocktails intus und habe ihn nach seinem Namen gefragt.«
Robert grinst. »Hast dir Mut angetrunken.«
»Eher Dummheit.«
Seine Augen werden schmal. »Und du willst mir sagen, dass dieser Calvin nichts gesehen hat?«
»Das hat er zumindest den Sanitätern gegenüber behauptet. Aber ich glaube, er war derjenige, der den Krankenwagen gerufen hat.«
Robert legt mir einen Arm um die Schultern und hilft mir dabei, mich aufzusetzen. »Also, du bist offiziell entlassen und darfst nach Hause.« Er küsst mich auf die Schläfe, und dann sagt er die sieben wundervollen Worte: »Du kommst heute Abend mit zu uns.«
Drei
Ich habe das große Glück, eine Wohnung für mich allein zu haben – was in Manhattan absoluten Seltenheitswert hat und einzig und allein der Großzügigkeit meiner Onkel geschuldet ist. Robert hat mir den Job verschafft, und Jeff, der jede Menge Kohle verdient, übernimmt einen Großteil der Miete. Doch sosehr ich mein trautes Heim auch liebe, heute bin ich froh, nicht dort sein zu müssen. Mit einem gebrochenen Arm in meine kleine, wenngleich hübsche und gemütliche Wohnung zurückzukehren, würde mir nur allzu schmerzhaft vor Augen führen, dass ich ein handyloser, privilegierter, nichtsnutziger, durch und durch jämmerlicher Haufen Mensch bin, der sich von einem Betrunkenen nicht nur belästigen, sondern auch noch auf die U-Bahn-Gleise schubsen lässt. Bei Jeff und Robert zu sein ist viel bequemer, außerdem habe ich hier wenigstens ansatzweise das Gefühl, gebraucht zu werden: Nachdem ich mich ausgeschlafen habe, bin ich der Brettspielpartner, den Jeff sonst immer schmerzlich vermisst, und schmettere mit Robert zusammen ausgelassene Lieder. Außerdem kann ich selbst einarmig besser kochen als die beiden zusammengenommen.
Jeff hat sich den Dienstag freigenommen, um höchstpersönlich dafür zu sorgen, dass es mir an nichts mangelt, und als wir irgendwann gegen Mittag alle wach sind, zaubere ich für uns Eier Benedict zum Frühstück. Obwohl mir dabei nur ein Arm zur Verfügung steht, ist mein Ergebnis natürlich wieder besser als alles, was Robert oder Jeff jemals zustande gebracht hätten. Robert hat sich irgendwann während der Neunziger in das Gericht verliebt, und sobald ich alt genug war, um mit Mixer und Bratpfanne umzugehen, teilte er mir mit, dass ich fortan immer Eier Benedict machen müsse, weil sie mit Sauce Hollandaise serviert würden. »Versteht ihr? Versteht ihr?«, fügt er unweigerlich hinzu, wenn er die Geschichte erzählt.
Jeff und ich stöhnen dann jedes Mal.
Wir verbringen einen entspannten Nachmittag damit, uns zu dritt auf das ausladende Sofa zu kuscheln und erst Brigadoon, dann Ein Amerikaner in Paris anzuschauen. Robert hat gesagt, ich solle mich heute krankmelden; er selbst muss erst um siebzehn Uhr im Theater sein. Ich weiß, dass ich Calvin heute Abend nicht sehen werde, also versuche ich ihn aus meinen Gedanken zu verbannen – erfolglos. Die Erinnerung an den Moment, als ich zum ersten Mal sein Gesicht sah und seine Stimme hörte, wird durch eine Mischung verschiedenster Emotionen getrübt. Zum einen ist da Enttäuschung: Er war meine kleine Oase … wieso musste ich von meiner Routine abweichen und alles kaputt machen, indem ich ihn anspreche?
Dann sind da Wut und Unverständnis. Warum hat er den Sanitätern nicht die Wahrheit gesagt? Warum ist er einfach abgehauen?
Und schließlich wäre da noch die erotische Anziehungskraft … Ich möchte nach wie vor sehr, sehr gerne mit ihm knutschen.
Mit wild klopfendem Herzen laufe ich am nächsten Morgen die Treppe zum U-Bahnhof hinunter. Meine Tasche fest an mich gepresst, schlängle ich mich zwischen den langsameren Pendlern hindurch. Unten angekommen, bleibe ich abrupt stehen. Wie immer überrascht es mich, Calvin schnellere, komplexere Stücke spielen zu hören. An den meisten Tagen hat er ein strikt klassisches Repertoire, nur mittwochs scheint er aus unerfindlichen Gründen Flamenco, Chamamé und Calypso zu bevorzugen.
Es ist acht Uhr fünfundvierzig, am Bahnsteig stehen die Menschen dicht gedrängt. Es riecht nach schmutzigem Stahl und verschütteter Cola, nach Kaffee und dem süßen Teilchen, das sich der Typ neben mir gerade gierig in den Mund schiebt. Ich hatte damit gerechnet, gewisse emotionale Turbulenzen zu empfinden, wenn ich an den Ort zurückkehre, wo ich um ein Haar den Tod gefunden hätte, doch außer dass ich unbedingt Antworten von Calvin will, ist da nichts. Ich bin schon so oft hier gewesen, dass die Alltäglichkeit stärker ist als das Trauma. Ich fühle nach wie vor nichts weiter als … oh, là, là, Straßenmusiker, und bäh, U-Bahn.
Ich nutze die letzten paar Sekunden, bevor Calvin in Sicht kommt, um all meinen Mut zusammenzuraffen. Normalerweise bin ich jemand, der die Konfrontation scheut, aber ich weiß genau, dass ich die Ereignisse von Montagnacht bis in alle Ewigkeit in meinem Kopf wälzen werde, wenn ich nicht irgendetwas zu ihm sage. Seine Füße tauchen als Erstes auf – schwarze Boots, hochgekrempelte Hosenbeine –, dann kommt der Gitarrenkoffer, dann die Beine – die Jeans hat einen Riss am Knie – und schließlich Hüfte, Oberkörper, Brust, Hals und Gesicht.
Als ich sehe, wie entrückt er selbst auf einem Bahnhof voller Menschen wirkt, schnürt es mir wie immer vor lauter Ergriffenheit die Kehle zu. Ich versuche die hochkommenden Gefühle zu verdrängen und beschwöre stattdessen die Erinnerung herauf, wie er mich schmählich im Stich gelassen hat, als ich im Krankenwagen gesessen und wie eine Bekloppte herumkrakeelt habe.
Als ich vor ihm stehen bleibe, sieht er auf. Unsere Blicke treffen sich, und es versetzt mir einen solchen Schock, dass mein Herz einen Salto schlägt und ich unwillkürlich das Gesicht verziehe. Mein gerechter Zorn ist verpufft. Calvins Blick fällt auf meinen Gipsarm und kehrt dann wieder zu den Saiten seiner Gitarre zurück. Ich sehe, wie er unter seinen Bartstoppeln rot wird.
Das macht mir Mut. Ich öffne den Mund, um etwas zu sagen. Im selben Moment fährt vier Meter entfernt kreischend der Zug der Linie E in den Bahnhof ein, und ich werde vom Strom der Pendler mitgerissen, der sich aus den sich öffnenden Türen ergießt. Atemlos spähe ich durch die Menge, nur um zu sehen, wie Calvin seine Gitarre einpackt und die Stufen hochrennt.
Getragen von der Masse, gehe ich widerstrebend weiter. Es ist doch bedeutsam, dass er hochgeschaut hat, oder? Normalerweise macht er das nämlich nicht. Das ist fast so, als hätte er auf mich gewartet.
Gleich darauf fährt die C-Linie in den Bahnhof ein. Alle treten einen Schritt näher an die Bahnsteigkante heran, und das Gedränge wird noch dichter. Jeder macht sich bereit, um einen Platz in der Bahn zu kämpfen.
Und so nimmt ein durch und durch überflüssiges Ritual seinen Lauf.
Robert wartet vor dem Levin-Gladstone-Theater auf mich. Vermutlich wäre es zutreffender, zu sagen, dass er auf den Kaffee wartet, den ich mittwochs bis sonntags immer mitbringe. Als ich ihm den Becher reiche, blitzt das Logo des Coffeeshops auf. Ich bin mir sicher, dass Robert es auch gesehen hat. Madman Espresso liegt ganze zehn Blocks vom Theater entfernt. Falls Robert weiß, dass ich jeden Morgen mit der Bahn zu einem Coffeeshop fahre, der nicht auf meinem Weg liegt, nur um Calvin sehen zu können, so spricht er mich mit keiner Silbe darauf an.
Das sollte er aber vermutlich. Ich brauche dringend jemanden, der mir den Kopf zurechtrückt.
Der Wind bläst Roberts roten Schal, den er zu seinem schwarzen Wollmantel trägt, nach hinten. Er flattert wie eine leuchtende Fahne vor dem grauen Stahlpanorama der Forty-Seventh Street. Ich lächle ihn an und gönne ihm diesen kleinen Moment der Ruhe.
Er hat im Moment sehr viel Stress. It Possessed Him hat im Laufe der letzten neun Monate unglaublich an Popularität gewonnen, bis in absehbare Zukunft sind sämtliche Vorstellungen ausverkauft. Leider hat der Hauptdarsteller Luis Genova nur einen Vertrag für zehn Monate unterschrieben, und diese zehn Monate sind in vier Wochen um. Danach wird Leinwandlegende Ramón Martín die Hauptrolle übernehmen. Er ist ein waschechter Hollywoodstar, was den Druck auf Robert noch erhöht, denn er muss dafür sorgen, dass sein Orchester Ramón in die Broadway-Stratosphäre katapultiert. Wenn er also erst mal ein Weilchen in Ruhe hier stehen und seinen Kaffee trinken möchte, bin ich die Letzte, die ihm das nicht gönnt.
Er trinkt einen Schluck und mustert mich. »Wie hast du gestern Nacht geschlafen?«
»Wie ein Stein – dank der Schmerzmittel und meiner emotionalen Erschöpfung.«
Robert nickt mit zusammengekniffenen Augen. »Und wie war dein Vormittag?«
Er will auf etwas ganz Bestimmtes hinaus. Ich kneife ebenfalls die Augen zusammen und betrachte ihn argwöhnisch. »Gut.«
»Nach allem, was Montagnacht passiert ist«, sagt er und hebt seinen Becher, »bist du heute trotzdem zum Bahnhof gegangen, weil du ihn sehen wolltest?«
Mist. Ich hätte wissen müssen, dass er mir auf die Schliche kommt. Vielleicht zwinge ich ihn jetzt doch zum Reingehen. Ich ziehe die schwere Tür des Seiteneingangs auf und klimpere mit den Wimpern. »Keine Ahnung, was du meinst.«
Robert folgt mir in die schattige Kühle des Theaters. Obwohl man Leute hinter den Kulissen und auf der Bühne arbeiten hört, ist es, verglichen mit der hektischen Geschäftigkeit während der Vorstellung, angenehm still. »Du bringst mir jeden Tag einen Kaffee von Madman Espresso mit.«
»Weil er lecker ist.«
»Sosehr ich mich auch über meine morgendliche Dosis Koffein freue – wir haben beide funktionstüchtige Kaffeemaschinen zu Hause. Du fährst jeden Morgen mit der U-Bahn zehn Blocks hin und zurück, um einen überteuerten Espresso zu besorgen. Glaubst du, ich weiß nicht, was da läuft?«
Stöhnend nehme ich Kurs auf die Treppe, die zu den Büros im ersten Stock führt. »Ich weiß, ich bin nicht mehr zurechnungsfähig.«
Robert hält mir mit ungläubiger Miene die Tür zum Treppenhaus auf. »Du magst ihn immer noch, obwohl er die Sanitäter in dem Glauben gelassen hat, dass du dich vor den Zug werfen wolltest?«
»Zu meiner Verteidigung sei gesagt, dass ich heute früh zu ihm gegangen bin, um ihn zur Rede zu stellen.«
»Und?«
Ich knurre in meinen Kaffeebecher. »Und ich habe nichts gesagt.«
»Ich verstehe, wie es ist, verliebt zu sein«, sagt er. »Aber findest du wirklich, dass du ihn fest in deinen Tagesablauf einplanen solltest?«
Während wir die Stufen hochsteigen, bohre ich ihm meinen unversehrten linken Ellbogen in die Seite. »Sagt der Kerl, der von Philly nach Des Moines gezogen ist, weil er scharf auf den Kellner war, der ihm sein Ribeye Steak serviert hat.«
»Touché.«
»Außerdem: Wenn es dir nicht passt, zeig mir jemand Besseren.« Ich hebe die Hände und sehe mich um. »Manhattan – vor allem die Musicalszene – ist die reinste Hölle für Singlefrauen. Calvin war eine harmlose kleine Ablenkung. Ich hatte nie vor, mich vor seinen Augen fast ermorden zu lassen, geschweige denn mit ihm zu sprechen.«
Wir treten aus dem Treppenhaus, und Robert folgt mir in sein Büro – ein winziger Raum in einem Gang mit noch drei weiteren winzigen Räumen, der permanent im Chaos versinkt. Überall liegen Notenblätter herum. Gemälde, Fotos und Post-it-Zettel bedecken jeden freien Quadratzentimeter Wandfläche. Roberts Computer ist, glaube ich, noch eine Generation älter als der alte Desktop-Rechner, den ich vor sechs Jahren auf dem College benutzt habe.
Er hackt auf die Tastatur ein, um den Bildschirm aus dem Ruhezustand zu wecken. »Na ja, mir ist aufgefallen, dass Evan von den Streichern dich immer ansieht.«
Im Geiste gehe ich kurz die Streicher durch. Der Einzige, der mir einfällt, ist der Erste Violinist Seth. Seth interessiert sich nicht für Frauen, und selbst wenn, würde Robert mir niemals erlauben, mit ihm auszugehen. Obwohl er als Solist für die Produktion unverzichtbar ist, hat Seth einen Hang zu Tobsuchtsanfällen und sorgt innerhalb des Ensembles immer wieder für Streit. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der Robert jemals zur Weißglut getrieben hat.
»Wer ist Evan?«
Er macht eine Kreisbewegung über seinen kurz geschnittenen Haaren und sagt: »Lange Haare. Bratschist.«
Ah, jetzt weiß ich, wen er meint. Evan ist sexy, er sieht ein bisschen aus wie Tarzan, aber … insgesamt ist mir da ein bisschen zu viel Wildwuchs.
»Okay, Bobert«, sage ich und halte die Hand hoch. »Aber die Fingernägel an seiner Bogenhand …«
»Wovon redest du?« Robert lacht.
»Wie kann es sein, dass dir das noch nicht aufgefallen ist? Manchmal sieht es so aus, als würde er die Saiten mit einem Haifischzahn zupfen.« Ich zucke mit den Achseln. »Er hat irgendwie was … Raubtierhaftes. Ich glaube, das könnte ich nicht ausblenden.«
»Raubtierhaftes? Du hast letzten Mittwoch dein Lammkotelett fast im Ganzen verschlungen. Das sah auch ziemlich raubtierhaft aus.«
Ungelogen. »Was soll ich dazu sagen? Ich mache eben ein vorzügliches Lammkotelett.«
Von der Tür her kommt das mürrische Grummeln meines Chefs Brian. »Wovon um alles in der Welt redet ihr?«
Grinsend antworte ich: »Lamm«. Im selben Moment sagt Onkel Robert: »Männerklauen.« Brians Gesicht verzieht sich zu einer noch größeren Grimasse.
Um die Vetternwirtschaft auf ein Minimum zu beschränken, ist offiziell nicht Onkel Robert mein Boss, sondern der Inspizient des Theaters, der ebenso geniale wie unausstehliche Brian. Ich bin fest davon überzeugt, dass er zu Hause irgendwelche merkwürdigen Sachen sammelt, zum Beispiel alle Ausgaben des National Geographic oder aufgespießte Schmetterlinge in verstaubten Schaukästen.
»Rührende Familienszene.« Brian macht kehrt, um davonzurauschen, und wirft dabei über die Schulter zurück: »Holland, Besprechung der Bühnencrew. Jetzt.«
Mit einem letzten, leicht manischen Grinsen in Roberts Richtung folge ich Brian nach unten.
Die Bühnencrew besteht aus insgesamt zwanzig Leuten. Brian kümmert sich um alle technischen Details der Vorstellung – Blocking, Einsätze, Requisiten, Kulisse – und sorgt dafür, dass alles wie geschmiert läuft. Das bedeutet, dass er sich den gegenwärtigen Hype um Possessed gerne als seinen eigenen Verdienst anrechnet, dabei sind die wahren Helden diejenigen, die auf seine gebellten Kommandos hin springen: die Leute, die Brian höchst charmant als seine Handlanger bezeichnet.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Brian hat einen verantwortungsvollen, harten Job, und er erledigt ihn hervorragend; die Aufführungen laufen wie eine gut geölte Maschine, das Bühnenbild ist atemberaubend und wurde in fast jeder überschwänglichen Rezension des Stücks eigens hervorgehoben. Es ist nur so, dass Brian trotz all seiner Kompetenz leider auch ein machthungriger Dämon mit einem extremen Hang zur Kleinlichkeit ist. Der Beweis: In diesem Moment geht eine Nachricht auf meinem Handy ein.
Ich sehe das du unpässlich bist. Da stelle ich mir die Frage wie du diese Woche deinen Pflichten nachkommen willst.
Brians Unfähigkeit, »das« von »dass« zu unterscheiden, löst in meinen Gehirnwindungen jedes Mal Juckreiz aus. Er schreibt mir eine Kurznachricht, obwohl er einen Meter entfernt sitzt, weil er einer direkten Auseinandersetzung aus dem Weg gehen will (direkte Auseinandersetzungen sind nicht sein Ding) – und vor allem, um der Bühnenarbeiterin, die gerade redet, zu signalisieren, dass ihn das, was sie zu sagen hat, nicht die Bohne interessiert.
Kann sein, dass er ein blöder Penner ist, aber leider hat er in diesem Fall recht: Wegen der Schlinge kann ich in der rechten Hand kaum das Handy halten, geschweige denn einen Fotoapparat.
Es dauert eine Weile, aber schließlich gelingt es mir, mit den Fingern der linken Hand eine Antwort zu tippen.
Gibt es abgesehen vom Einlass vielleicht noch andere Sachen, die ich in den nächsten zwei Wochen übernehmen könnte?
Es verursacht mir innerliche Schmerzen, eine dermaßen unterwürfige Nachricht abzuschicken. Obwohl mein winziges Gehalt aus dem Budget aller Abteilungen finanziert wird, ärgert sich Brian am meisten über mich, weil er als Einziger regelmäßig mit mir zu tun hat. Ich weiß selbst, dass mein Job ein Almosen ist – das kapiere ich auch ohne die gehässigen Bemerkungen, die er bei jeder Gelegenheit vom Stapel lässt.
Während die Bühnenarbeiterin uns über die Fortschritte der Malerarbeiten an den neuen Waldkulissen aufklärt, tippt Brian mit einem höhnischen Grinsen etwas in sein Handy.
Scheint so das dein Onkel mehr Hilfe braucht als ich.
Ich brauche eine Weile, um überhaupt zu begreifen, was er damit meint. Als endlich der Groschen fällt, ertönt zeitgleich und mit einem beinahe komödiantischen Sinn für Timing ein ohrenbetäubendes Scheppern der Becken aus dem Orchestergraben.
Alle erheben sich neugierig von ihren Sitzen und spähen in den Orchestergraben – nur um Zeuge zu werden, wie Seth sich einen Weg durch die Schlaginstrumente bahnt, an Robert vorbeischiebt und den Mittelgang hinaufstürmt.
Ich blicke auf Seths Stuhl; er hat seine Geige liegen lassen. Ich kann nicht aufhören, sie anzustarren. Von Robert habe ich gehört, dass sie mehr als vierzigtausend Dollar gekostet hat – und er hat sie einfach auf seinen Stuhl geknallt und ist abgerauscht. Von ihrem Platz daneben beugt Lisa Stern sich zur Seite und hebt das Instrument behutsam auf. Ich bin sicher, dass sie es ihm später zurückgeben wird. Zweifellos geht Seth auch davon aus. Was für ein Arsch.
Er hat oft Wutanfälle, aber aus irgendeinem Grund ist die Stille, die auf seinen Ausbruch folgt, diesmal besonders drückend. Der Magen sackt mir in die Kniekehlen.
Seth hat drei lange Duette mit Luis, und diese Duette sind das Herzstück des Musicals. Seths Violine ist dabei viel mehr als nur ein Teil des Orchesters; obwohl er nicht auf der Bühne steht, ist er eigentlich auch einer der Hauptdarsteller. Dementsprechend ist er auch auf unseren wichtigsten Merchandise-Artikeln abgebildet und wird des Öfteren in den Medien erwähnt. Ohne seine Solos keine Vorstellung.
Es muss etwas Schwerwiegendes vorgefallen sein, denn Roberts ruhige Stimme trägt durch den ganzen Theatersaal: »Nur, dass es keine Missverständnisse gibt, Seth. Du weißt, was es bedeutet, wenn du jetzt gehst. In einem Monat fängt Ramón Martín an, und du wirst nicht mit ihm zusammen auftreten.«
»Leck mich, Bob.« Seth fährt mit dem Arm in seine Jacke und ruft, ohne sich umzudrehen: »Ich bin hier fertig.«
Vier
Mein neues Handy vibriert, gerade als der Abspann der dritten Vampire-Diaries-Folge beginnt. Unter normalen Umständen würde ich mir an einem Wochentag keine süchtig machenden Teenie-Dramen reinziehen, aber als Robert sah, wie ich versuchte, mit einer Hand die Luis-Genova-T-Shirts zu falten, hat er mich gleich nach der Matinee nach Hause geschickt, wodurch sich mein schlechtes Gewissen natürlich nur noch verschlimmerte. Ich kann nicht zum Yoga gehen. Ich kann nicht schreiben. Wegen der Schmerzmittel darf ich keinen Alkohol trinken. Ich kann mich nicht mal aufs Lesen konzentrieren, ohne mir Sorgen darüber zu machen, was Robert tun soll, wenn Seth nicht mehr da ist.
Mein Handy vibriert erneut, und ich gehe zum Küchentresen, wo es zum Aufladen an der Steckdose hängt – neben dem Laptop, den ich seit Wochen nicht angerührt habe. Ich rechne fest damit, dass es mein Bruder Davis ist, der anruft, um sicherzugehen, dass ich mich nicht in den gefährlichen Großstadtdschungel namens Manhattan hinauswage, solange ich nur einen Arm zur Selbstverteidigung habe. Umso angenehmer bin ich überrascht, als ich stattdessen Lulus lächelndes Gesicht auf dem Display sehe.
»Na, du?« Ich öffne den Kühlschrank und lasse den Blick über den Inhalt schweifen.
»Wie geht es meiner kleinen Invalidin?« Dem Stimmengewirr und klappernden Besteck im Hintergrund nach ist Lulu gerade im Blue Hill, wo sie – wie so viele Schauspieler und Schauspielerinnen in Manhattan – als Kellnerin jobbt, während sie auf den großen Durchbruch wartet.
Ich klemme das Telefon zwischen Kinn und Schulter, nehme mit der gesunden Hand eine Auflaufform aus dem Kühlschrank und stelle sie auf den Tresen. »Ich bin zu Hause. Robert hat gemeint, ich sähe aus wie ein dreibeiniger Welpe auf einer Hundeschau, und mir befohlen, ein paar Tage freizunehmen.«
»Was für ein Scheusal«, sagt sie lachend.
»Bist du auf der Arbeit?«
»Ja, aber … warte mal kurz.« Es folgen einige Sekunden gedämpfter Stille, dann ist sie wieder da. Jetzt sind die Hintergrundgeräusche leiser.
»Ich hatte die Frühschicht, deswegen kann ich gleich gehen.«
»Du hast heute Abend frei?« Ich bleibe mit meinem Teller kalter Lasagne auf dem Weg zur Mikrowelle stehen. Meine Laune hellt sich ein wenig auf. »Komm doch rüber, dann koche ich uns was. Du müsstest mir nur eine deiner Hände leihen.«
»Ich weiß was Besseres. Ich habe da so einen Zwei-für-eins-Gutschein für ein Konzert irgendeiner albernen Coverband, und Gene kann nicht. Komm doch mit!«
Das sieht ihr ähnlich. Lulu hat auf Groupon wieder irgendwelche Tickets entdeckt und konnte nicht widerstehen, weil sie einfach so ein Wahnsinnsschnäppchen waren. Meistens lasse ich mich gerne von ihrer Spontaneität und Abenteuerlust anstecken. Aber heute Abend ist es kalt, und wenn ich ausgehen wollte, müsste ich ja meinen Schlafanzug aus- und richtige Klamotten anziehen.
»Heute nicht, Lu.« Ich stelle mein Essen in die Mikrowelle, während sie sich lautstark beschwert. Sie klingt so weinerlich, dass meine Entschlossenheit ins Wanken gerät. Und ich muss nicht mal etwas sagen – sie weiß schon Bescheid. »Komm schon, Holland! Die Band heißt Loose Springsteen! Wie cool ist das denn?«
Ich brumme abwehrend.
»Zwing mich nicht, ganz allein nach Jersey zu fahren.«
»Eine Coverband in Jersey?«, sage ich. »Das ist jetzt nicht gerade ein schlagendes Argument.«
»Du würdest also lieber zu Hause hocken und im Schlafanzug Reste essen als zusammen mit mir die Nacht deines Lebens zu feiern?«
Ich schnaube. »Könnte es sein, dass du ein bisschen zu dick aufträgst?«
Erneut fängt sie an zu wimmern, und ich knicke ein.
Lulu hat definitiv zu dick aufgetragen. Das Hole in the Hall ist eine … Bar? Das ist wirklich noch das Netteste, was man darüber sagen kann.
Die U-Bahn-Station, an der wir aussteigen, liegt genau gegenüber dem unscheinbaren Backsteingebäude. Lulu hüpft ausgelassen den Gehweg entlang. Die Gegend ist eine Mischung aus Geschäfts- und Wohnhäusern, allerdings scheint mindestens die Hälfte der Häuser leer zu stehen. Gegenüber der Bar ist ein leeres koreanisches Restaurant mit zugenagelten Fenstern und einem schiefen Schild über dem Eingang. Nebenan befindet sich ein umgebautes Wohnhaus mit dem Neonschriftzug House of Hookah, doch die Leuchtröhren sind dunkel und staubig und heben sich kaum vom grauen Blechdach ab. Es fällt nicht schwer, sich auszumalen, weshalb das Hole in the Hall seine Kundschaft mit Groupon-Gutscheinen ködern muss.
Lulu dreht sich um, tanzt rückwärts weiter und lockt mich über die regennasse Straße. »Sieht doch ganz vielversprechend aus«, meint sie munter, als wir uns vor der Tür in die Schlange der Wartenden einreihen.
Die gedämpften Klänge von ›Don’t Stop Believin‘‹ von Journey dringen durch die Backsteinwand, und jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, ergießt sich die Musik nach draußen, als wäre sie auf der Flucht. Ich muss gestehen, dass es guttut, sich in Schale zu werfen und seine Sorgen wenigstens für ein paar Stunden zu vergessen. Es war keine große Mühe, Leggings und ein schickes Top überzuwerfen, und Lulu mit ihren zwei gesunden Armen war so nett, mir beim Haareföhnen zu helfen. Zum ersten Mal seit mehreren Tagen sehe ich nicht aus wie ein Troll und fühle ich mich auch nicht so. Vielleicht wird der Abend ja doch noch ganz nett.
Als wir endlich an der Reihe sind, schwenkt Lulu ihren Zwei-für-eins-Coupon wie ein Abzeichen und schlängelt sich an den anderen Gästen vorbei durch die Tür.
Erwartungsgemäß ist das Innere der Bar ziemlich schmucklos. An den Wänden sind alte Videospielgeräte aufgebaut, und um die Theke herum stehen ein paar zerschrammte Tische in Gruppen zusammen. Die Deko ist ein fragwürdiger Mix aus Harley Davidson, ausgestopften Tieren und Wildwest-Look. Auf einer Seite befindet sich eine Stripperstange auf einer kleinen Plattform, auf der anderen ist die Bühne. Das Licht ist trübe und staubig, und in Verbindung mit der selbst gebauten Nebelmaschine führt das dazu, dass man die Bandmitglieder auf der Bühne nur als dunkle Schemen erkennen kann.
Lulu setzt sich an einen Tisch, winkt eine Kellnerin herbei, und wir bestellen Drinks, die uns mit besorgniserregender Geschwindigkeit serviert werden, so als wären sie schon vor Stunden eingeschenkt worden und hätten die ganze Zeit hinter der Bar gestanden.
Lulu betrachtet ihren Cocktail, der den reizenden Namen ›Adios Motherfucker‹ trägt. Mit einem kleinen Achselzucken, wie um zu sagen, Was soll’s?Man lebt nur einmal, probiert sie einen Schluck und schneidet eine Grimasse. »Schmeckt wie 7Up.«
Ich bin ganz fasziniert von dem blinkenden Neon-Eiswürfel in ihrem Glas.
»Ich habe Angst, dass dein Drink bei jemandem einen epileptischen Anfall auslösen könnte.«
Sie zieht erneut an ihrem Strohhalm, der sich mit leuchtend blauem Alkohol füllt. »Nee, eigentlich schmeckt es eher nach Mineralwasser.«
»Siehst du? Das ist der hausgebrannte Schnaps, der deine Geschmacksknospen killt.«
Sie ignoriert meine Bemerkung und sieht mich aus ihren braunen Augen an. »Ist der Gips sehr lästig? Ich hatte noch nie was gebrochen.« Sie feixt. »Na ja … jedenfalls nicht bei mir, wennduweißtwasichmeine.«
Ich lache und betrachte meinen lilafarbenen Gips, der aus der schwarzen Schlinge schaut. »Halb so schlimm. Mit der Kamera ist es ein bisschen schwierig, und ich kann nicht besonders gut T-Shirts falten, aber … ich könnte auch tot sein.«
Sie nickt und trinkt noch einen Schuck – ihr Glas ist schon beinahe halb leer.
»Ich meine«, fahre ich fort, »seien wir mal ehrlich: Um in der Pause Geld von den Zuschauern zu kassieren, reicht eine Hand völlig aus, insofern ist es wirklich keine große Sache.«
»Wie ich höre, bist du auch einhändig ziemlich gut.« Sie klopft einen Trommelwirbel auf die Tischplatte und macht ein Tuschgeräusch.
»Ich bin die Beste.« Ich zwinkere ihr zu. »Was ist mit dir – irgendwelche Castings gehabt?«
Lulu schüttelt mit einem kleinen Schmollmund den Kopf, dann bewegt sie im Takt der Musik die Schultern. Kann sein, dass sie kellnert, um über die Runden zu kommen, aber sie träumt davon, Schauspielerin zu werden, seit sie alt genug ist, um zu wissen, dass es den Beruf »Schauspielerin« gibt. Wir haben uns an der Columbia University kennengelernt, wo sie Theaterwissenschaften studierte. Sie hat mir schon mehrfach vorgeschlagen, dass sie doch meine Muse werden könnte, und ich würde dann ein Drehbuch nach dem anderen für sie schreiben. Das sollte euch einiges über unsere Beziehung verraten, die – auch wenn wir gerade in Jersey sind – normalerweise recht kurzweilig ist.
Sie hat schon in einigen Low-Budget-Werbespots mitgewirkt (in einer Werbung für eine Versicherung war sie ein zu Unfällen neigendes Huhn. Ich habe mehrere GIFs von ihrem Auftritt, die ich ihr gerne hin und wieder ganz spontan aufs Handy schicke), war in so ziemlich jeder Schauspielklasse, die in New York angeboten wird, und hat (als Gefälligkeit von Robert für mich) sogar mal eine kleine Rolle in einem von Roberts Musicals gespielt. Das ging allerdings nicht lange, denn wie Robert meinte: »Lulu spielt eine ganz hervorragende Lulu, aber mehr leider nicht.« Trotzdem: Solange sie atmet, wird sie daran glauben, dass ihr großer Durchbruch unmittelbar bevorsteht.
»Nein, diese Woche war nichts.« Sie schaut zur Bühne, während ich meine wässrige Cola light schlürfe. »Nach den Feiertagen kommen immer viele Gäste ins Restaurant, deswegen schieben wir alle Extraschichten.« Mit einer Kopfbewegung in Richtung der Musiker sagt sie: »Der Schritt von dem Kerl da springt einem total ins Auge, man kann gar nicht wegsehen. Aber ansonsten ist die Band keine Vollkatastrophe.«
Ich folge ihrem Blick dorthin, wo der Leadsänger soeben unter einen hellen Scheinwerfer getreten ist. Seine Acid-washed-Jeans sitzt so eng, dass ich seine komplette Auslage sehen kann. Noch ein paar Stunden in dieser Hose, und er kann seiner Zeugungsfähigkeit Adieu sagen. Als sich Def Leppards ›Pour Some Sugar on Me‹ dem Ende nähert, leitet die Band direkt in ein Cover von ›Rock Me‹ von Great White über (dieses Wissen habe ich der Hair-Metal-Sucht meines Bruders Thomas zu verdanken), und eine Gruppe mutiger – oder betrunkener – Frauen tritt an den Rand der Bühne und beginnt zu den bluesigen Anfangsakkorden zu tanzen.
Und warum auch nicht? Ich schunkle ebenfalls ein wenig auf meinem Stuhl, fasziniert von der Art, wie der Gitarrist jede einzelne Note aufreizend in die Länge zieht. Er hat den Kopf in höchster Konzentration gesenkt. Loose Springsteen ist vielleicht nur eine Coverband, und die meisten Bandmitglieder tragen mindestens einen baumelnden Ohrring und/oder ein Kleidungsstück mit Tierprint, aber Lulu hat recht: Sie sind gar nicht mal so übel. Mit ein bisschen Übung könnten sie sogar in einem größeren Club oder bei einem Achtziger-Revival Off-Off-Broadway auftreten.
Der Sänger zieht sich zurück. Nun betritt der Gitarrist den Kreis aus rauchigem Licht und setzt zu seinem obligatorischen Solo an. Die Frauen vor der Bühne reagieren sehr enthusiastisch … Und irgendetwas an der Art, wie er seine Gitarre hält, wie seine Finger den Hals entlanggleiten und wie ihm die Haare ins Gesicht fallen, kommt mir verdächtig bekannt vor.
Ach du …
Er hebt das Kinn, und obwohl seine Augen im Schatten liegen und er das Gesicht halb abgewandt hat, weiß ich sofort Bescheid.
»Das ist er«, sage ich und zeige auf ihn. Ich setze mich aufrechter hin und hole mein Handy heraus. Ich bin immer noch auf Schmerzmitteln, deshalb kann ich meinen Sinnen nicht ganz trauen. Ich zoome näher heran und knipse ein verschwommenes Foto.
»Wer?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: