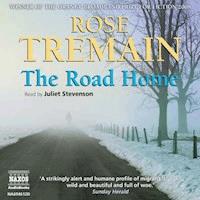9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geboren 1943 in London, ist Rose Tremain umgeben von zerstörten Familien und einer Stadt in Trümmern. Vordergründig ist ihre Familie zwar intakt, doch fehlt es an Zuneigung und Liebe. Ihre einzige Vertraute ist das Kindermädchen Vera, die für Rose wie eine Mutter ist. Ihre »richtige« Mutter Jane hingegen steckt ihre Töchter kurzerhand ins Internat, denn sie will die verlorene Zeit nachholen, hat der Krieg ihr doch die Jugendjahre genommen. Im Internat knüpft Rose prägende Freundschaften – vor allem aber findet sie das, was für ihr Leben bestimmend sein wird: den unbedingten Willen, zu schreiben.
Rose Tremains Kindheits- und Jugenderinnerungen bewegen durch die große Aufrichtigkeit der Autorin, bestechen durch ihren ungeschönten Blick – und das Bedürfnis danach, die eigene Mutter verstehen zu wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Titel
Rose Tremain
Rosie
Szenen aus einem verschwundenen Leben
Aus dem Englischen von Christel Dormagen
Insel Verlag
Widmung
In Erinnerung an Vera Sturt (»Nan«) und für meine geliebten Enkelkinder Archie und Martha Rose
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Paradies
Verstoßen
Mutter
Ein Engel
Das Englischzimmer
Teenagermusik
Miltons Gegensätze
»Titten gen Tal«
Nachwort
Bildteil
Fußnoten
Informationen zum Buch
Abbildungsnachweis
Textnachweis
Impressum
Hinweise zum eBook
Paradies
Daran kann ich mich erinnern: wie ich in meinem Kinderwagen liege und in einen weißen Himmel blicke. Am Himmel sind Striche gezogen, wie Notenlinien. Flatternde Schatten sinken herab und landen auf den Linien: Vögel auf Telegrafendrähten.
Meine Mutter hat immer behauptet: »Daran kannst du dich auf keinen Fall erinnern. Babys können gar nichts wahrnehmen, weil sie über keine Wörter verfügen. Dein Gehirn wird so leer gewesen sein wie der Himmel, den du angeblich gesehen hast.«
Ich erinnerte sie jedes Mal daran, dass der Himmel nicht leer war. Er war voller niederstürzender Notenvögel. Sie ließen sich auf den Drähten nieder. Und sie entgegnete dann: »Sei nicht albern. Das hast du erfunden. Deine erste echte Erinnerung – du wirst vielleicht drei oder vier gewesen sein – könnte am ehesten eine an Linkenholt gewesen sein.«
Also gut. Dann eben Linkenholt. Das habe ich klar und deutlich vor Augen. Das große Haus stand auf einem Hügel in Hampshire, wo stets ein starker Wind wehte. Eine Schönheit ist es nie gewesen. Die Farbe seiner korallenroten Ziegel war zu grell. Seine weiß gestrichenen Giebel waren zu massiv. Man fühlte sich an einen klobigen Dreimaster erinnert, der auf den Wellen einer wunderschönen grünen Landschaft ritt. Doch meine gesamte Kindheit hindurch sehnte ich mich danach – nach dem Moment, wenn ich durch die schwere Haustür trat und das vertraute Parfüm einatmete. Was war das für ein Parfüm? Eine Mischung aus Bienenwachsmöbelpolitur, Metallputzmittel, französischen Zigaretten und Hunden. Es war der Geruch von Heimat.
Es war nicht meine Heimat.
Gut Linkenholt gehörte meinen Großeltern Roland und Mabel Dudley. Meine ältere Schwester Jo und ich fuhren nur dreimal im Jahr dorthin – in den Weihnachtsferien, zu Ostern und im Sommer. Doch unsere Liebe zu dem Haus war unermesslich. Unser Alltag im dunklen Nachkriegslondon war smogbelastet, beengt und eingeschränkt auf den Schulweg, den Gang zu dem italienischen Laden an der Ecke, den verrußten Parks, der Rollschuhbahn und den Badeanstalten. Aber in Linkenholt waren wir frei. Rund um das Haus auf dem Hügel erstreckten sich 800 Hektar kalkhaltigen Ackerlands, das unserem Großvater gehörte und wo wir in Kordhosen, manchmal auch, wenig überzeugend, als Indianerhäuptlinge verkleidet, auf unseren Raleigh-Fahrrädern umherstromern durften. Diese Felder und Wälder gehörten in den 1950er Jahren mit zu den schönsten Englands. Es ist keine Übertreibung, wenn ich behaupte, dass unser Londoner Leben uns häufig wie eine Art Exil erschien, dem wir sehnlichst zu entkommen suchten, wie ein dunkler Traum, aus dem wir erst in Linkenholt erwachten.
Und dann waren wir endlich da: krochen im Morris Traveller unserer Mutter in einem niedrigen Gang den Linkenholt-Hügel hinauf, fuhren langsam durch das Dorf Linkenholt, vorbei an der Molkerei, am sehr kleinen Cricket-Gebäude, an der Kirche, in der ich getauft wurde, dann die gekieste Einfahrt entlang, an deren Rand drei gewaltige Ulmen wie unruhige Riesen standen.
Und nun der Empfang. Jill, die überfütterte Springer-Spanielhündin, die bellt. Die Haustür, die sich öffnet. Das langsame Erscheinen von Granny und Grandpop im Eingang. Kurzer Kontakt mit dem tabakgetränkten Geruch ihrer Kleidung und mit ihrer Haut – straff und glänzend auf Grandpops Schädel, weich und pudrig bei Granny mit ihren in teigige Falten gesunkenen Wangen –, und dann im Sturmschritt an ihnen vorbei, dorthin, wo wir so sehnsüchtig sein wollten, im Haus, spüren, wie es uns aufnimmt. Schließlich das herrliche Geräusch, wenn unsere Füße gegen die Messingstangen der breiten Stufen stießen.
Das Zimmer, das Jo und ich uns teilten, lag im rückwärtigen Teil, mit Blick auf einen Rosengarten und ein wildes Gehölz dahinter, in dem nachts der Wind seufzte. Zum Geräusch des Winds in den Schlaf hinüberzugleiten, in dem Bewusstsein, dass wir »zu Hause« waren und der kommende Morgen das Paradies, von dem wir immerzu träumten, vor uns ausbreiten würde, war ein einziger Glücksrausch.
Linkenholt liebte uns. So kam es mir jedenfalls vor, als ich »Rosie« war, ein sehr junges, ahnungsloses Mädchen. Der Ort schenkte uns seine Seele und seine Herrlichkeit, aber Granny und Grandpop selbst waren todunglückliche Menschen, denen fast nichts geblieben war, mit dem sie uns hätten beschenken können. Sie hatten ihren ältesten Sohn verloren, der ebenfalls Roland hieß und mit sechzehn an einem geplatzten Blinddarm gestorben war. Als das geschah, war er Internatsschüler in Harrow, weshalb sie ihn nicht einmal sterben sahen. Von den beiden übriggebliebenen Kindern – unserer Mutter Jane und unserem Onkel Michael – liebten sie nur Michael. Doch im letzten Monat des Kriegs, im November 1945, wurde Michael Dudley bei Fürstenau in Deutschland getötet. Er war achtundzwanzig. Roland und Mabel lebten weiter, aber sie wurden nie wieder froh.
Ihnen blieb das eine Kind, das mittlere, das Mädchen Jane, das ihnen offenbar nicht die geringste Freude bereitete. Ihre kostbaren Söhne waren tot. Das Wenige, was sie an Zuneigung noch besaßen, schenkten sie Michaels zwei Söhnen Jonathan und Robert, unseren Cousins. Vielleicht hofften sie heimlich, wenn sie Jo und mich in unserem Indianerschmuck über die Zufahrt davonradeln ließen, ein paar Cowboys hätten sich aus Wyoming, USA, nach Hampshire in England verirrt und würden uns erledigen – und damit auch ihren Versuch, Kinder zu lieben, die ihnen kaum etwas bedeuteten.
Das Seltsame war, dass uns das nichts auszumachen schien. Wir waren – jedenfalls meiner Erinnerung nach – nicht so bedürftig, dass wir den Großeltern unbedingt gefallen wollten oder darauf hofften, von ihnen geherzt und geknuddelt zu werden. Wir liebten Linkenholt, nicht sie. Sie waren reich, und sie hatten um sich herum eine wunderschöne Welt erschaffen, und diese Welt bedeutete uns alles.
Ein kleines Regiment von Dienstboten sorgte dafür, dass diese Welt funkelte. Sie wirbelten unablässig, um die parfümierte Pracht der großen Eingangshalle sowie die Lavendelpfade, die Obstbäume und die Lorbeergänge in dem riesigen Garten in Schuss zu halten. In der Küche bereitete Florence, die Köchin, gewaltige Braten und Nachspeisen zu. In der Milchkammer schlug der alte Mr Abbot gelbe Sahne und eine steife, salzige Butter, die köstlicher war als alle, die ich danach gegessen habe. In den Gewächshäusern offerierte uns Tom, der Chefgärtner, mit seinen sanften, erdverdreckten Händen erlesene reife Erdbeeren und Strauchtomaten, die wie exotische Früchte dufteten.
In London aßen wir gewöhnlich sehr viel Brot mit Marmelade, Frühstücksfleisch, Kraft-Käsescheibletten, Knäckebrot und Cracker, Würstchen im Schlafrock und Büchsenravioli – karges Nachkriegsessen, bei dem wir sehr dünn blieben. Hier in Linkenholt verspeisten wir gebratenes Raufußhuhn, gebackenen Schinken in Honigkruste, Rhabarbercreme, Sirupnapfkuchen, Apfelkuchen mit Sahne. Und wir konnten uns ganz und gar auf diese Wunder konzentrieren. Niemand erwartete, dass wir während der Mahlzeiten groß redeten. Ich glaube, man ging davon aus, dass Mädchen nichts zu sagen haben würden. Wir mussten nur gerade sitzen, uns den Mund hübsch mit weißen Leinenservietten abwischen und nach dem Essen Granny fragen, ob wir aufstehen durften. »Können wir nach unten gehen, Granny?«, sagten wir dann. Aber sie antwortete nie. Sie reagierte immer nur mit einem kurzen finsteren Nicken, das ihr gepudertes Doppelkinn erbeben ließ.
Doch ich glaube, das war uns egal. Ich erinnere mich, dass wir auf der Stelle aus dem Esszimmer, durch die Halle und, vorbei an einem verschlossenen Waffenzimmer, einen langen Flur entlang bis zur Hintertür rannten, wo unsere Fahrräder warteten. Ein, zwei Runden vielleicht um die unruhigen Ulmen, dann ging es fort über die Auffahrt, hinaus ins grenzenlose Grün, durch eine Lärchenlichtung und, die Räder schiebend, einen kalkigen Hügel hinauf in einen großen Wald aus Buchen, Kiefern, Eichen und Eschen, wo Fasane sich fett fraßen für die Jagdsaison. Und wenn wir in aufgekratzterer, verwegenerer Stimmung waren, radelten wir langsam vom Grundstückstor bis ganz nach oben auf den Linkenholt-Hügel, machten einen Moment Pause und schossen dann, so schnell wir konnten, in unglaublichem Tempo den Berg hinunter, vorbei an schemenhaften duftenden Hecken rechts und links und einem hüpfenden klaren Himmel am Augenrand.
Wenn wir unten schliddernd zum Stehen kamen, trafen wir vielleicht auf Mr Carter, den Wildhüter, mit seinem Rudel lebhafter Springer-Spaniels. Die Hunde – es waren fünf oder sechs – rannten uns dann entgegen, und Jo liebte diesen Ansturm. Sie kniete sich hin und tätschelte die Tiere, während ich weglief. Da sie als Jagdhunde abgerichtet waren, dachte ich, sie würden alles kurz und klein beißen, und stellte mir vor, dazu würden wahrscheinlich auch meine Arme und Beine und mein Gesicht gehören. Mr Carter ermunterte mich stets freundlich, die Hunde zu streicheln, aber ich verlor nie die Angst vor ihnen.
Mr Carter war kein Mann vieler Worte. Er lebte allein in einem der Gutshaus-Cottages, einem Haus mit einem seltsam aus dem Dach herauswachsenden Turm. Er war stets freundlich und geduldig im Umgang mit uns. Das galt überhaupt für alle Personen, die für die Dudleys arbeiteten. Sie müssen uns sicherlich lästig, sogar lächerlich gefunden haben – verwöhnte Kinder aus London, die auf teuren Rädern herumsausten und denen jeder Wunsch, den sie äußerten, erfüllt wurde. Aber weil sie die schrecklichen Tragödien miterlebt hatten, die die Dudley-Familie so stark getroffen hatten, begriffen sie vielleicht, wieso unsere Großeltern unfähig waren, liebevoller mit uns umzugehen, und das machten sie nun dadurch wett, dass sie uns mit all der ihnen zur Verfügung stehenden Freundlichkeit bedachten.
Den engsten Umgang hatten wir mit Douglas Abbot, dem einzigen Sohn von Mr Abbot, der sich um die Milchwirtschaft kümmerte. Douglas hatte zwei Rollen, als Butler und als Chauffeur. Er war groß und sehr dünn, hatte eine sanfte Stimme und ließ sich durch die Wutausbrüche unseres Großvaters nicht aus der Ruhe bringen. In einem speziellen Schrank im Esszimmer hatte er extra für uns Orangensaft und Ingwerlimonade stehen. Als wir einmal zusammen mit unseren Cousins Jonathan und Robert im Gehölz hinter dem Rosengarten ein Baumhaus gebaut hatten, kam Douglas mit vier Gläsern Saft auf einem Silbertablett die provisorische Leiter zu unserem Versteck hinaufgeklettert.
Wenn ich über dieses erstaunliche Bild nachdenke, begreife ich eines: Wer einen Teil seiner Kindheit in einem Paradies wie Linkenholt verbringt, den trennt ein Schleier von der Welt, wie sie in Wahrheit ist, die er doch zu lernen hat. Später hebt sich dieser Schleier.[1]
Zu Weihnachten gehörten in Linkenholt verheißungsvolle Vorbereitungen.
Jedes Jahr durften Jo und ich einen winzigen Weihnachtsbaum in dem Gehölz hinterm Haus ausgraben und ihn eingetopft in unser Schlafzimmer stellen. (Im Januar wurde er dann wieder im Wald eingepflanzt.) Wir schmückten ihn mit allerlei Gebasteltem: den Ähren von Flusshafer, dessen Samenköpfe wir in buntes Bonbonpapier hüllten; mit Glitzerpulver bestäubte Kiefernzapfen und Zweige; aus Schokoladensilberpapier ausgeschnittene Girlanden.
Wir dekorierten unser Zimmer mit selbstgemachten Papierketten und mit Seidenpapierglöckchen von Woolworth in der Londoner King’s Road. Wir arrangierten unser Spielzeug um den Baum: mein Schweinchen und dessen beide Stoffpuppenfreunde Mary und Polly, die ich selbst gemacht hatte, komplett mit aufwendiger Garderobe; Jos Hund Diggles und seinen Gefährten Little Bear. Wir stellten sie aufrecht hin, damit sie unsere Dekorationen bestaunen konnten. Mary und Polly trugen dazu ihre Cocktailkleider.
Unten in der Bibliothek wartete der andere, der richtige Weihnachtsbaum. Er war sehr groß und streckte seine breiten, duftenden Arme weit in den Raum hinein. Der Baumschmuck, den wir an ihm am schönsten fanden, waren seltsame pastellfarbene viktorianische Engel mit verängstigten Gesichtern und langen fließenden Gewändern aus Pferdehaar.
Nachdem die tiefe, pechschwarze Dunkelheit uns in einen langen Schlaf gewiegt hatte, lagen, wenn wir am Weihnachtsmorgen erwachten, schwere, volle, raschelnde Strümpfe am Fußende unserer Betten. Wir packten sie immer allein in unserem Zimmer aus, da wir angewiesen waren, die Erwachsenen ausschlafen zu lassen (vermutlich nach ihrem feuchten Gelage am Weihnachtsvorabend).
Bei den Strümpfen handelte es sich um die schweren Wollsocken von der Art, wie Roland Dudley sie beim Jagen trug. Und die kleinen Geschenke waren in Seidenpapier eingewickelt: Schokoladenzigaretten, winzige Möbel für unser Puppenhaus, Buntstifte, Matchboxautos, Dauerlutscher, Päckchen mit Abziehbildern und Mandarinen ganz unten im Strumpf … Irgendwann pflegte unsere Mutter zu erscheinen, um zu prüfen, ob wir für das Weihnachtsfrühstück auch sauber und ordentlich aussahen. Wahrscheinlich rauchte sie dabei ihre erste du-Maurier-Zigarette des Tages in einer langen schwarzen Spitze.
Sie war sehr pingelig mit unseren Haaren. Jos Haar war irrsinnig lockig – »hoffnungslos«, sagte unsere Mutter. Sie konnte sich nicht erklären, woher diese Locken stammten. (Einmal ärgerten wir sie und schlugen vor, Jo sei afrikanischer Abstammung.) Mein Haar war einfach sehr glatt und widerspenstig und musste zu Büscheln gebunden oder mit einer Schildpatthaarspange gebändigt werden, die immer wieder aufging. Mutter musterte uns dann von oben bis unten. Auf eine Weise, die ich nicht zu ergründen vermag, enttäuschten wir sie. Hatte sie sich Jungen gewünscht, von ihren Eltern gar quasi geerbt, dass sie nur Jungen fähig war zu lieben? Hatte sie womöglich in den vier Jahren zwischen Jos und meiner Geburt durch eine Fehlgeburt einen Jungen verloren? Ich werde es nie wissen. Ich erinnere mich nur daran, dass diese Enttäuschung von langer Dauer war.
Das Weihnachtsfrühstück ist eine meiner schönsten Linkenholt-Erinnerungen. Die Sonne fiel zwischen den Fensterkreuzen in das nach Süden gehende Esszimmer auf die Mahagonianrichte, wo Douglas Scheiben von einem Knochenschinken säbelte und uns auf feinen Porzellantellern vorlegte. In meinem Haus in Norfolk essen wir, wenn meine Tochter mit ihrer Familie über die Feiertage kommt, immer noch Schinken am Weihnachtsmorgen. Überhaupt haben wir etliche kleine, unvergessene Rituale aus Linkenholt übernommen und halten sie so lebendig. Zum Beispiel wickeln wir die kleinen Geschenke in den Strümpfen für die Enkelkinder auch heute noch in Seidenpapier ein.
Nach dem Schinkenfrühstück zogen wir immer unsere besten Mäntel an – die von Hayford aus der Sloane Street mit den kleinen Samtkragen – und wanderten zur Linkenholter Kirche, jenem Ort, wo ich getauft worden war und Jo, die während der Taufzeremonie eine Kerze halten sollte, in einem ihrer verträumten Momente wegdriftete und ihre widerspenstigen Locken in Brand steckte. Gewöhnlich las unser Großvater eine der Bibelstellen. Granny rührte sich nie von ihrer Kirchenbank. Mit unbeweglichem Gesicht saß sie da, ein seltsames schlaffes Samtbarett auf dem Kopf, und starrte auf die Gebinde aus Stechpalmen und Efeu. Mit Sicherheit dachte sie an ihre toten Söhne. In the bleak midwinter. O little town.[2]
Die St. Peterskirche in Linkenholt ist ein kleines Feldsteingebäude, das in der Mitte der einzigen Dorfstraße steht, etwas zurückgesetzt hinter uralten Eiben, mit einem germanischen »Hexenhut«-Turm und einem kaum besuchten Friedhof. Als unsere Großmutter starb, ließ Roland Dudley ein überdachtes Friedhofstor zu ihrem Gedenken errichten. Als er dann selbst starb, wurde eine zweite Marmortafel an dem Tor angebracht. Und nach dem Tod meiner Mutter erwirkten mein Stiefbruder, Sir Mark Thomson (in der Familie immer »Mawkie« genannt), und ich die Erlaubnis des Pfarrers und der Kirchenältesten, zwei weitere Tafeln für Jane und ihren zweiten Ehemann, Mawkies Vater, Sir Ivo Thomson, hinzuzufügen. Janes Asche wurde, wie von ihr festgelegt, auf Linkenholt Hill verstreut. Mit einem zusätzlichen Weihguss aus Gordon’s Gin als Trankopfer.
Von Zeit zu Zeit pilgern Mawkie und ich immer noch nach Linkenholt – zusammen mit meiner Tochter Eleanor und Richard Holmes, meinem geliebten Lebenspartner seit fünfundzwanzig Jahren. Gewöhnlich machen wir uns im Frühling auf, in den Hecken strotzt es dann von Schlüsselblumen, Veilchen und den kleinen weißen Blumen, die wir damals »Stern von Bethlehem« nannten. Danach wandern wir zum Haus hinauf und stehen vor verschlossenen Toren, und die gekieste Zufahrt ist jetzt eine asphaltierte Straße. Die Ulmen sind natürlich verschwunden, aber das wilde Gehölz gibt es noch, und bei Wind seufzt es auch jetzt. Ich finde diese Besuche schön. Ich finde es schön, wenn ich Rosie als Geist vor mir sehe, wie sie mit ihrem Kopfschmuck aus Federn auf ihrem Raleigh-Fahrrad um die Rasenflächen kurvt. Aber Jo ist nie wieder dort gewesen. Sie gehört zu den Menschen, die Teile ihrer Vergangenheit ins Vergessen schieben können. Nicht, dass sie sich nicht erinnern könnte; sie möchte sie nur einfach nicht wieder aufsuchen.
Ohne Jo wäre ich als Kind auf Linkenholt einsam gewesen. Die Erwachsenen beschränkten sich auf ein Wohnzimmerdasein. Dort rauchten und tranken sie, spielten Karten, lösten das Kreuzworträtsel der Times und warteten auf die Mahlzeiten. Nur Roland, der als Bauingenieur in Indien gearbeitet hatte und jetzt all seine Energie in die Modernisierung und Mechanisierung seiner riesigen Farm steckte, fand das ermüdend und machte sich über die Zufahrt mit seinem alten Jeep davon, den er, wie Mr Toad, mit besorgniserregender Leidenschaft fuhr, und suchte seine Schafe oder sein Vieh auf oder besprach mit Mr Carter, welches Waldstück wann bejagt werden musste. Die Hündin Jill – seine liebste Beifahrerin – stand stets aufrecht neben ihm.
Manchmal nahm er uns – diese komischen kleinen Mädchen, die er lachend Rosebud und Jo-bags nannte – nach dem Tee hinten in seinem Land Rover mit. Wir sollten die Geburt vom Lämmchen miterleben, die neue Bündelvorrichtung bewundern, die er für Stroh und Heu erfunden hatte, oder zusehen, wie Stoppeln abgebrannt wurden. Anfangs mochten wir diese Ausflüge. Doch als wir eines Tages mit ihm auf dem Mähdrescher saßen, kam Jill uns über das halb abgeerntete Weizenfeld entgegengerannt. Jill liebte ihren gutmütigen Herrn. Sie war nicht gerne von ihm getrennt. Sie wollte zu ihm und versuchte, über die rotierenden Messer des Mähdreschers zu klettern. Ich kann mich noch an Grandpops entsetztes Gesicht erinnern und daran, wie er »Jill! Jill! Meine Jill!« rief. Aber die Hündin kletterte weiter und wurde vor unseren Augen in Stücke gerissen. Danach bestiegen wir den Mähdrescher nie wieder.
Vor dem Weihnachtsfestessen zogen Jo und ich identische dunkelrote Kleider mit Spitzenkragen an. Wir durften nach unten in die Bibliothek gehen und uns Lamettafäden vom Baum nehmen und sie uns wie kleine Diademe in unsere hoffnungslosen Haare flechten.
Anschließend setzten wir uns hin und warteten darauf, dass die Dienstboten erschienen, um ihre Geschenke von Granny in Empfang zu nehmen – Douglas elegant im Frack, Florences Wangen scharlachrot von der Küchenhitze, die Hausmädchen stets in Taubenblau. Und was bekamen sie? Ihr großes Leid hatte die Dudleys nicht zu Geizkragen werden lassen, weshalb vielleicht ein schöner Batzen Geld überreicht wurde, aber vielleicht war Douglas auch im Rolls nach Andover oder Marlborough geschickt worden, um »geeignete« Präsente zu besorgen. Die Geschenke der Dienstboten wurden nie an Ort und Stelle ausgepackt. Man stand einfach herum, ein Glas Sherry in der Hand. Es herrschte stets eine Art verlegenen Schweigens, das keiner aufzuheben vermochte. Mit Sicherheit hätte Michael, berühmt für seine gute Laune, für seine Witze und sein Lachen, die richtigen Worte gefunden, aber der war schon lange tot.
Danach tranken die Erwachsenen Champagner, während Florence ihren gewaltigen Truthahn begoss und Douglas letzte Hand an die wunderschön gedeckte Tafel legte. Wir tranken Ingwerlimonade und packten unsere Geschenke aus. Es waren nur wenige, aber sie waren immer gut. An zwei ganz besondere kann ich mich noch erinnern – eine Registrierkasse aus Blech und einen blauen Roller, ziemlich ähnlich wie die, mit denen alle Kinder noch heute gern fahren, aber massiver und schwerer zu lenken. Doch was schenkten wir – höfliche Kinder, die wir waren – Roland und Mabel? Irgendetwas war sicherlich organisiert worden: eine »Jagd«-Krawatte für Grandpop, Yardley-Seife für Granny, Taschentücher oder Talkumpuder für die exzentrische Großtante Violet, die hin und wieder die düsteren Räume ihrer Wohnung in der Grosvenor Street verließ, um tapfer ein Hampshire-Weihnachtsfest durchzustehen? Ich weiß es nicht mehr.
Was ich noch weiß, ist, dass der Weihnachtstag in Linkenholt für uns Kinder in einem nahezu betäubenden Wirbel aus Aufregung und sich Überfressen verging. Nach dem Truthahnbraten und dem Plumpudding, nach noch mehr Ingwerlimonade, Minztäfelchen und kandierten Früchten stapften Jo und ich, vollkommen erschöpft vor lauter Seligkeit, langsam die Treppenstufen mit dem grünen Teppich und den Messingstangen hinauf. Unsere Lamettakrönchen waren längst irgendwo unter einem Berg von Einwickelpapier verschwunden. Wir zogen unsere Flanellschlafanzüge an, starrten in die Nacht hinaus und warteten auf das Geräusch des Winds. Wir fragten jedes Mal unsere Plüschtiere, ob sie auch einen schönen Tag verlebt hatten.
Am Tag nach Weihnachten, dem Boxing Day, wurde stets gejagt. Grandpop hatte das Linkenholt-Grundstück den Erfordernissen für die Jagd entsprechend neu gestalten lassen und herrliche Waldstücke und Gehölze gepflanzt, wo die großen Vögel, die Mr Carter so sorgfältig züchtete, Unterschlupf und Nahrung fanden. Auf unseren Spaziergängen hörten wir immer das Quak-Quak der Fasane. Häufig schraken sie auf, wenn wir auf unseren Fahrrädern den Linkenholt Hill hinuntersausten, und erhoben sich schwerfällig in die Luft. Und nun wurden die armen exotischen Tiere von einer Armee von Treibern aus Wald und Gehölz gescheucht und durch Flinten niedergemäht. Die Hunde schienen vor Vergnügen zu vibrieren, wenn sie losstürmten, um die toten Tiere zu apportieren.
Die Männer, die die Jagdgesellschaft bildeten, waren jedes Jahr dieselben – Nachbarn der Dudleys, alle mit eigenem Gutshof. Zusammengenommen muss diese ländliche Elite etwa ein Drittel von Hampshire besessen haben. Sie trugen schwere, nach Tabak riechende Jacken, karierte Hemden und Knickerbocker. Ihre Gesichter waren rau und gerötet vom Leben im Freien. Viele hatten borstige Haare in der Nase, deren Berührung man fürchtete, wenn die Männer sich herabbeugten, um einem einen onkelhaften Schmatz auf die Wange zu setzen.
Aber eigentlich waren sie ein liebenswürdiger alter Haufen. Der netteste von ihnen, Sir Eastman Bell, dem Fosbury Manor gehörte, hatte eine späte Liebe zu Narzissen entwickelt; an jedem Osterfest lud er uns zum Mittagessen ein, und wir besichtigten dann seine endlosen Blumenfelder. Er musste an die dreißig oder vierzig verschiedene Sorten angepflanzt haben. Sie erstreckten sich über Wiesen und Felder und bis in den Wald. Er pflanzte sie nicht für den Verkauf. Er pflanzte sie, weil er sie liebte.
Die Narzissen von Fosbury waren ein Anblick, den Jo und ich niemals vergessen haben. In Vielfalt und Schönheit überstrahlten sie mit Sicherheit jene goldene Blütenpracht, die Wordsworth erblickte: »Am See, dort wo die Bäume sind / flatterten, tanzten sie im Wind«.
Die Zeit vergeht langsam, wenn man Kind ist, und ich dachte immer, dass diese Blumenfelder den ganzen Sommer bis zum Fallen der ersten Blätter da sein würden. Erst später begriff ich, dass Sir Eastman Bell zwei Drittel des Jahres auf hängende braune Stängel oder bloßes Gras schaute. Doch er opferte diese Monate einer kahlen Landschaft für sein Frühlingsparadies.
Dick eingepackt in Wollmützen und Handschuhe, leisteten Jo und ich ihm manchmal Gesellschaft beim Anstehen auf einer der Treibjagden. Er erinnerte uns dann jedes Mal nachdrücklich daran, wie wichtig Stille sei, während wir auf das Geräusch der Treiber warteten, die sich vom Wald her näherten. Und das Besondere dieser Stille – Männer mit Gewehren, nebeneinander aufgereiht, brave, reglose Hunde, tief über dem Acker hängender Nebel und manchmal sogar leise fallender Schnee – habe ich nie vergessen.
Die Bilder haben fast etwas von Kriegsbildern, und doch war es eher ein bewunderndes Staunen, was mich als Kind erfüllte. Die Stille fühlte sich an, als enthielte sie mein gesamtes zukünftiges Leben. Mein Großvater und seine Freunde würden sehr bald das Ende ihrer Zeit auf Erden erreicht haben, doch was ich sah, war eine Landschaft, die sich in ihrer winterlichen Herrlichkeit um mich herum erstreckte und darauf wartete, dass ich meinen Platz in der Welt fand.
Draußen auf den Feldern von Linkenholt konnte es bitterkalt sein. Aber die Kälte gehörte mit zu dem Wunderbaren, war etwas, was man aushalten musste. Ich weiß noch, wie ich meine frierenden Zehen in den Gummistiefeln krümmte und mich an Jos warmem Arm festhielt. Und einmal erlaubte Sir Eastman uns einen Schluck Cherry Brandy aus einem silbernen Flachmann – ein Strom parfümierter Lava rollte in mein Inneres hinunter. Er tätschelte unsere wolligen Häupter. »Das müsst ihr nicht unbedingt eurer Mutter erzählen«, sagte er.
Dann flogen die ersten Fasanen auf, stießen ihren hupenden Schrei aus, die Gewehre wurden gen Himmel gerichtet, und die rostrot und grün gefärbten Körper stürzten herab, und die Luft roch nach Kordit.[3]
Ich habe mich häufig gefragt, ob auch Jo das Gefühl hatte, jenseits der Felder von Linkenholt erwarte sie eine wunderbare Zukunft.
Denn ich wuchs auf in der unverrückbaren Annahme, dass Jo genial war. Schon in einem sehr frühen Alter war sie eine wirklich brillante Künstlerin. In der Schule überschütteten die Kunstlehrer sie mit Lob. Unsere Tante June (die Schwester unseres Vaters), die selbst eine Art Malerin war, pries und förderte Jos Talent mit immer neuen Superlativen. Sogar unsere Mutter, die nichts davon hielt, uns zu loben und mit uns »anzugeben«, begriff, dass Jo begabt war und in der Kunst möglicherweise eine Zukunft hatte.
Als wir auf Linkenholt einmal bei Regen nicht nach draußen konnten, begannen wir ein kleines Buch zu verfassen. Es hieß Der Bär, der zur See fuhr. Ich weiß nichts mehr von der Geschichte, die ich schrieb, aber ich sehe immer noch Jos lebendige Bilder vor mir: wie der Bär mit seinem Rucksack aufbricht, wie er in einer Bucht ein Segelschiff entdeckt und wie er sich auf hoher See, allein mit der Nacht, dem Mond und den Sternen, nach Hause sehnt.
Einmal beteiligte Jo sich an einem überregionalen Zeitungswettbewerb. Sie fertigte eine Buntstiftzeichnung von mir auf Linkenholt an. Der Titel lautete Meine Schwester auf der Farm. Ich trage meine Kordlatzhose, einen Wollpulli und ein Halstuch mit einem Muster aus Windmühlen und Holländern in Holzpantinen. Dieses Bild gewann den ersten Preis (ich glaube, zwei Guinees) und wurde in der Times abgedruckt. Jo kann da nicht älter als neun oder zehn gewesen sein. Sogar Granny fand es großartig.
Im Sommer wurden unsere Cousins Jonathan und Robert nach Linkenholt geschickt, um die Sommerferien mit uns zu verbringen. Ihre Mutter Barbara, Michaels Witwe, hatte wieder geheiratet und zwei weitere Söhne, James und Charles, geboren. Roland und Mabel luden Barbara oder die anderen beiden Jungen nie nach Linkenholt ein. Ich glaube, dass sie ihre Schwiegertochter, deren Vater Bertie Stein ein jüdischer Geschäftsmann war, in ihrem unerschütterlichen Nachkriegsdünkel nie besonders gemocht haben. Wahrscheinlich hatten sie Barbara nie als gut genug für ihren geliebten Michael befunden. Und jetzt mieden sie jede Begegnung mit ihrem neuen Ehemann. Zu Beginn des Sommers entrissen sie Barbara die beiden Enkelsöhne und gaben sie in Janes Obhut.
Für Johnny und Rob waren diese Zeiten auf Linkenholt genauso wunderbar wie für Jo und mich (und sind es immer noch). Aber ich weiß, dass unsere Mutter sich beklagte, weil sie sich nun um vier Kinder kümmern musste statt um zwei. Viel später erklärte sie uns, sie habe gewusst, dass wir und die Cousins während jener Ferien »im Paradies« waren, doch sie sei »in der Hölle« gewesen. Es sei die Hölle gewesen, sich ungeliebt zu fühlen, mit Grandpop über Nichtigkeiten zu streiten und Mabels ewigen lähmenden Kummer zu ertragen.
Und die Anwesenheit der Jungen machte es ihr womöglich auch nicht einfacher. Sie waren lauter und größer als wir. Sie fanden es herrlich, auf Bäume zu klettern und mit ihren Fahrrädern noch schneller durch Pfützen zu fahren als wir. Ihre Kleidung wurde dreckiger. Und – was am wichtigsten war – sie hatten weniger Angst vor Janes schlechter Laune. Sie schliefen auf unserem Flur gegenüber dem Treppenabsatz in einem Zimmer, wo, wie Rob sich beschwerte, die Vögel sie die ganze Nacht über wach hielten. Häufig wurden Jo und ich dadurch aus unserem friedlichen Schlaf gerissen, dass Jane laut rief: »Würdet ihr Jungs endlich LEISE SEIN!«